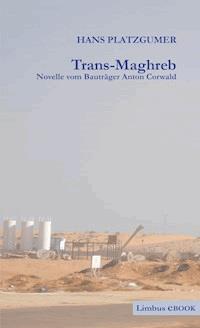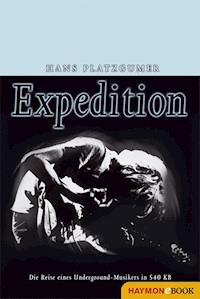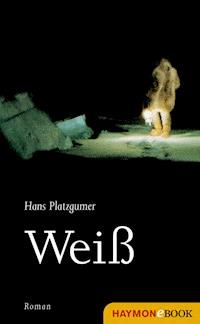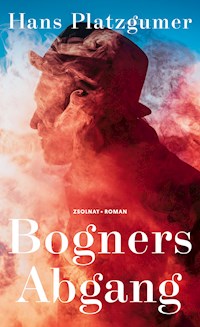
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Paul Zsolnay Verlag
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
„Hans Platzgumer ist ein Meister darin, Extremsituationen fühlbar zu machen“ (Profil). Der Autor von „Am Rand“ fragt in seinem neuen Roman: Ist am Ende nur schuld, wer sich schuldig fühlt?
Eine Kreuzung in Innsbruck. Ein Unfall mitten in der Nacht. Ein Fußgänger ist tot. Was ist passiert? Und wer ist schuld? Andreas Bogner, der die Schusswaffe seines Schwiegervaters eigentlich nur zeichnen wollte? Nicole Pammer, die an diesem Abend ausnahmsweise ein Glas zu viel getrunken hat? Ihre Mutter, die ohne Zögern alle Spuren verwischt? Oder gar der Kunstkritiker Kurt Niederer selbst, der schließlich immer schon sehr genau gewusst hat, wie man anderen das Leben zur Hölle macht? Geschickt webt Hans Platzgumer in seinem neuen Roman ein Netz aus Eitelkeiten und Unzulänglichkeiten. Ist am Ende nur schuld, wer sich schuldig fühlt?
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 158
Veröffentlichungsjahr: 2021
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Sammlungen
Ähnliche
Über das Buch
»Hans Platzgumer ist ein Meister darin, Extremsituationen fühlbar zu machen« (Profil). Der Autor von »Am Rand« fragt in seinem neuen Roman: Ist am Ende nur schuld, wer sich schuldig fühlt?Eine Kreuzung in Innsbruck. Ein Unfall mitten in der Nacht. Ein Fußgänger ist tot. Was ist passiert? Und wer ist schuld? Andreas Bogner, der die Schusswaffe seines Schwiegervaters eigentlich nur zeichnen wollte? Nicole Pammer, die an diesem Abend ausnahmsweise ein Glas zu viel getrunken hat? Ihre Mutter, die ohne Zögern alle Spuren verwischt? Oder gar der Kunstkritiker Kurt Niederer selbst, der schließlich immer schon sehr genau gewusst hat, wie man anderen das Leben zur Hölle macht? Geschickt webt Hans Platzgumer in seinem neuen Roman ein Netz aus Eitelkeiten und Unzulänglichkeiten. Ist am Ende nur schuld, wer sich schuldig fühlt?
Hans Platzgumer
Bogners Abgang
Roman
Paul Zsolnay Verlag
Nichts beeinflusst Stimmung und Motivation,
nichts Befindlichkeit und Lebensqualität,
nichts unser Selbstwertgefühl so sehr wie manche Kränkung.
Reinhard Haller, 2017
Mama, just killed a man
Put a gun against his head
Pulled my trigger, now he’s dead
Freddie Mercury, 1975
*
Aus Bogners Arbeitsnotizen
Mittwoch, 4. April 2018, 23:45
Von all den Waffen, mit denen ich mich in diesem Zyklus bislang auseinandersetzte, verlangt mir die Pistole am meisten ab. Ihren Charakter mit Tusche auf Papier einzufangen ist noch schwieriger als jenen von Pfeil und Bogen, woran ich mich zuvor versucht hatte. Helmut hat sie heute Vormittag gebracht, seither liegt die scharfe Waffe im Atelier. Dass sie geladen sein muss, hat Helmut schließlich verstanden. Ich will die Waffen in ihrer Brutalität porträtieren, ihre Persönlichkeit herausschälen, nicht Stillleben produzieren. Ich will den Sinn, nicht bloß die Form, mehr das Innere als das Äußere abbilden.
Einen Tag lang sitze ich nun schon vor der Walther PPK 7,65 mm an meinem Arbeitstisch, versuche, ihr Wesen zu begreifen. Ich weiß nicht, wie viele Skizzenblätter bereits im Müllkorb gelandet sind. Erst seit den Abendstunden werde ich zuversichtlicher. Die letzte Studie von heute wirkt verblüffend echt. Oder bilde ich mir das ein, weil ich erschöpft, überarbeitet bin? Auf dem Papier meine ich ein Objekt zu erkennen, das sich preisgibt. Es besitzt Ausstrahlung. Diese Waffe verführt den Betrachter. Eine Versuchung. Sie will benutzt werden. Sie ist schön und plump zugleich. So anziehend sie wirkt, so abstoßend ist sie. Eine Pistole ist niemals unschuldig. Auch wenn sie selbst nicht böse ist, sie zieht das Böse an.
Nehme ich die Waffe in die Hand, kippt sie nach hinten, in den Handballen hinein. Ich lege drei Finger um den Schaft. Ich halte den Daumen oben als Stütze und den Zeigefinger am Abzug. Der Schlagbolzen ist nicht zurückgezogen, aber der rote Punkt am Abzug zeigt: Die Waffe ist entsichert. Schon mit geringem Druck könnte ich einen tödlichen Schuss abfeuern.
Sieben Schüsse, sieben Patronen sind im Magazin, hat Helmut gesagt. Ich werde die Munition nicht aus dem Griff ziehen, werde die Pistole nicht ihrer Gefährlichkeit berauben. Ich will ihr genau so, wie sie ist, begegnen. Sie ist eiskalt, tot, ganz und gar unorganisch, unangenehm glatt, unangenehmes Metall. Ein haptisches Missvergnügen. Und doch will ich sie berühren. Besonders den Griff mit der gerippten Oberfläche. Seine Struktur gibt Halt. Auch einem nervösen Schützen mit schweißnassem Ballen würde die Waffe nicht aus der Hand rutschen. Ich wäre so einer. Unfähig. Ich wäre nicht dazu in der Lage, den Lauf dieser Waffe an eine Schläfe zu legen, weder die eigene noch eine fremde, und abzudrücken. Sogar aus nächster Nähe würde ich mein Ziel verfehlen.
*
Seit zwei Jahren
studierte Nicola Pammer Deutsch auf Lehramt an der Innsbrucker Universität. Sie war in Bregenz aufgewachsen. Innsbrucker wussten sie, sobald sie den Mund aufmachte und ihr Vorarlberger Dialekt durchklang, sofort als »Gsibergerin« einzuordnen. Von der ersten Minute an hatte sich Nicola fremd gefühlt in dieser Stadt.
»Es gibt doch tausende Vorarlberger Studenten in Innsbruck«, sagte ihre Mutter. »Gib dich halt mit denen ab, wenn dir die Tiroler zu ruppig sind.«
Nicola hatte sich in einer Wohngemeinschaft eingemietet und bewohnte gemeinsam mit zwei Deutschen, einem Oberösterreicher und einer »Oberländerin« eine schäbige, überteuerte Wohnung im ersten Stock eines Häuserblocks unweit der Uni. Nicolas Zimmer lag direkt an einer stark befahrenen Durchfahrtsstraße. Nachts stopfte sich Nicola Schaumgummistöpsel so tief wie möglich in die Ohren und zog den doppelten Vorhang zu, den sie angebracht hatte, weil es, sobald die Straßenlaternen leuchteten, im Zimmer heller war als tagsüber. Auch tagsüber trug Nicola Ohrenstöpsel, nicht nur um dem Lärm des Straßenverkehrs, sondern auch jenem ihrer Mitbewohner zu entkommen. Die beiden Deutschen waren beste Freundinnen, ständig hielten sie ihre Zimmertüren offen und unterhielten sich lautstark über den Flur hinweg. Der Oberösterreicher drehte, sobald er aufwachte, Hip-Hop-Musik an, und auch einschlafen konnte er nicht ohne Beats und Raps. Die Bässe wummerten durch die Wand.
»Und die Oberländerin?«, fragte Nicolas Mutter. »Mit der kannst du ja quatschen, wie dir der Schnabel gewachsen ist.«
Als Oberland bezeichnen Vorarlberger den südlichen, bergigen Teil ihres Bundeslandes.
»Die Bea ist schon ganz nett«, sagte Nicola. »Aber sie ist halt ganz anders drauf irgendwie.«
Dass Bea sich selbst als Partygirl bezeichnete und jeden Anlass zum Feiern nutzte, führte Nicola nicht näher aus.
Hätte es in Vorarlberg eine Universität gegeben, hätte Nicola dort studiert. Jede Lücke, die sich im Vorlesungsplan ergab, nutzte sie, um die zweihundert Kilometer nach Bregenz zu fahren, wo sie ein Zimmer im Dachgeschoß ihres Elternhauses bewohnte, nur wenige hundert Meter vom Ufer des Bodensees entfernt. Nicola setzte sich in den überfüllten Railjet oder ins Auto, den anthrazitfarbenen Ford Fiesta ihrer Mutter, den sie des Öfteren auslieh, um so schnell wie möglich heimzukommen. Auch am 5. April 2018 wäre sie, wie jeden Donnerstag, gleich nach der letzten Vorlesung abgereist. Doch es war Beas Geburtstag.
»Komm doch mit, Nicola. Wenigstens eine Pizza. Wir haben im Vapiano reserviert. Einmal anstoßen! Ich werde nicht alle Tage zweiundzwanzig!«
»Ich bin mit dem Auto da …«
»Ein Aperol Spritz! Das wird wohl erlaubt sein. Mit extra viel Mineralwasser!«
Aus einem Aperol Spritz wurden zwei, schließlich drei. Und an extra viel Mineralwasser dachte niemand. Als Nicola deutlich später als geplant endlich loskam und zum Auto ging, spürte sie den Alkohol. Sie trank selten. Ein wenig Weißwein hin und wieder, mehr nicht. Heute aber hätte sie mehr trinken können. Es hatte Spaß gemacht. Hätte sich Nicola nicht fest vorgenommen gehabt, nachts noch nach Hause zu fahren, wer weiß, wohin dieser Abend noch geführt hätte?
*
Protokoll Dr. Werner Gnessel
Therapeutische Sitzung Andreas Bogner, Montag, 15.1.2018
»Ihr Vater ist heute vor zwölf Jahren gestorben, sagen Sie, Herr Bogner. Haben Sie ein bestimmtes Gefühl, wenn Sie daran denken?«
»Nein.«
Lange Pause.
»Er rauchte ein bis zwei Packungen pro Tag. Über ein halbes Jahrhundert lang. Es war nicht verwunderlich, dass er Lungenkrebs bekam.«
Pause.
»Erinnern Sie bestimmte Bilder von ihm?«
»Hauptsächlich die letzten Tage, als ich ihn im Krankenhaus besuchte. Die körperliche Auflösung dieses Menschen faszinierte mich. Von Tag zu Tag wurde er weniger. Nichts als Haut und Knochen. Er lag im Bett, seine Nase stand wie ein Schnabel in die Höhe. Die Augen zogen sich zurück. Sie waren trüb und flackerten eigenartig. Die Hände, mit denen er ständig herumfuchtelte, weil es ihn irgendwo juckte, waren komplett hart. Ein Mensch ohne Fleisch. Und ohne Farbe. Ich weiß noch, ich hätte ihn gerne porträtiert. Abgezeichnet, wie er so dalag. Aber das konnte ich natürlich nicht tun.«
»Wieso nicht?«
»Es wäre mir pietätlos vorgekommen. Er hätte es nicht gemocht. Ich hätte mich an einem Wehrlosen vergangen. Ich habe ihn auch nicht fotografiert. Ich fotografiere praktisch nie. Ich zeichne lieber, wenn ich etwas sehe, das ich in Erinnerung behalten will.«
»Haben Sie Ihren Vater später aus Ihrer Erinnerung heraus gezeichnet, nachdem er gestorben war?«
»Nein. Vielleicht wollte ich ihn einfach nicht zeichnen. Als Schulkind hatte ich einmal eine Bleistiftzeichnung von ihm gemacht. Mama zeigte sie ihm, als er von der Arbeit kam. Das soll ich sein?, sagte er und lachte kurz. Wissen Sie, er hatte absolut kein Verständnis für Kunst. Das hielt er für Zeitverschwendung. Mein Lebensinhalt war für ihn Zeitverschwendung. Er war Autohändler. Ein erfolgreicher Unternehmer. Er hatte ständig irgendwelche Sachen zu tun, die Geld einbrachten. Das Autohaus Bogner in der Höttinger Au, nicht weit vom Flughafen. Das kennen Sie doch bestimmt, vom Sehen zumindest?«
»Ja, doch, ich glaube schon.«
»Eine der letzten Sachen, die mein Vater im Spital zu mir sagte, solange ich ihn noch verstehen konnte, war: ›Bald wird es nicht mehr Autohaus Bogner heißen, sondern Autohaus Neureuther.‹ Er machte mir zum Vorwurf, dass ich sein Lebenswerk nicht weiterführte. Ein Fremder musste seinen Betrieb übernehmen, weil ich mich weigerte. Das konnte er mir nie verzeihen. Ich denke, er hätte mich am liebsten enterbt. Aber das ließ die Mama nicht zu. Im Übrigen hat er sich getäuscht: Autohaus Bogner heißt es immer noch. Der Herr Neureuther, der neue Besitzer, hat den Namen beibehalten.«
»Sie sind der einzige Sohn?«
»Ein Einzelkind, ja. Ganz am Schluss übrigens, vielleicht eine Woche vor seinem Tod, wollte mir mein Vater noch etwas mitteilen. Er lag völlig entkräftet im Krankenhausbett und dämmerte vor sich hin. Ich dachte, er hätte gar nicht mitbekommen, dass ich bei ihm war. Auf einmal schlägt er die kleinen Augen auf und fixiert mich. Ich bekam fast Angst. Seine Augen funkelten. Ein paar Sekunden bloß. Dann wandte er sich ab und murmelte etwas vor sich hin. Es klang feindselig. Vielleicht bildete ich es mir ein, aber ich meinte zu verstehen, dass er mich nicht mehr sehen wolle. Er wollte nicht länger an diesen Versager erinnert werden.«
Pause.
»Wenn die Mama das jetzt hören würde! Wann immer ich ihr gegenüber anzusprechen wagte, dass mich der Vater nicht mochte, wie ich war, sagte sie: Red nicht so einen Blödsinn. Aber ich bin überzeugt davon, es stimmt. Der Vater hätte sich einen anderen Sohn gewünscht. Einen, der unter Autos kriechen und Kunden alle möglichen Sonderausstattungen hätte aufschwatzen können. Ich hingegen scheitere ja schon, wenn ich eine Schraube irgendwo hinein- oder herausdrehen muss. Irgendwann gab ich den Versuch auf, mit Mama darüber zu sprechen. Und auch meinen Vater habe ich ab diesem Tag nicht mehr besucht. Bis er gestorben war. Da hat mich dann die Mama um sechs in der Früh angerufen. Jetzt behalten wir nur die schönen Zeiten in Erinnerung, die wir mit ihm verbringen durften, sagte sie. Versprich mir das!«
»Wie war es, als Sie vom endgültigen Tod Ihres Vaters erfuhren?«
»Ich dachte an die Mama. Wie würde es jetzt weitergehen mit ihr? Aber sie war eine völlig selbstständige Frau. Innerhalb weniger Tage wurde klar: Um sie musste man sich keine Sorgen machen. Sie lebte noch einmal richtig auf. Keine zwei Monate, nachdem ihr Mann gestorben war, unternahm sie eine Reise nach Schottland. Danach buchte sie eine Kreuzfahrt mit der Hurtigruten entlang der norwegischen Küste. Später flog sie sogar nach China und schickte mir eine Postkarte von der Großen Mauer. Der Vater hatte ja nie verreisen wollen. Ihm war Tirol genug gewesen. Als Witwe holte die Mama alles nach. Vielleicht hat sie sich dabei übernommen? Vor fünf Jahren hatte sie dann den Schlaganfall. Sie lebte allein am Mitterweg. Man fand sie nicht rechtzeitig. Doch, wirklich: Schöner kann man den Tod wohl nicht erwischen. Abends ins Bett gehen und entschlafen. Das sagte ich mir immer vor, wie gut sie es erwischt hat. Zumindest ihre letzten sieben Jahre, in denen sie sich vor niemandem rechtfertigen musste. Sie machte, was sie wollte, und eines Nachts schlief sie ein, um nie wieder zu erwachen. Ich denke oft an Mama. Sie ist mir in gewisser Weise immer ein Rätsel geblieben. Auch als sie noch lebte, war sie nicht wirklich greifbar. Noch zu ihren Lebzeiten habe ich angefangen, ihr Briefe zu schreiben, Briefe, die ich nie abschickte. Ich schrieb ihr all das, über das ich nicht mit ihr sprechen konnte. Immer noch schreib ich ihr manchmal einen Brief, eine Art Tagebucheintrag, wenn Sie so wollen, stecke ihn in ein Kuvert, adressiere es an den Mitterweg, wo die Mama bis zu ihrem Tod wohnte, und lasse es in einer Schublade zwischen anderen Notizen und Aufzeichnungen verschwinden.«
»Das ist sehr gut, wenn Sie ein solches Ritual weiterführen.«
»Ich sehe es nicht als Ritual. Es ist keine Trauerarbeit. Ich schreibe nicht regelmäßig Briefe an die verstorbene Mutter, um meine Seele zu reinigen. Ich führe nur innere Dialoge mit ihr, wenn mir der Sinn danach ist. Monologe. Mama war wortkarg, wissen Sie. Von ihr kam kaum mehr zurück als von Ihnen, wenn ich hier mit Ihnen spreche. Die Mama war der pragmatischste, trockenste Mensch, den Sie sich vorstellen können. Über Gefühle redete sie nicht. Dafür regelte sie geradlinig und fast erschreckend direkt alles, was es zu erledigen galt. All die Formalitäten nach Vaters Tod, die Verwaltung seiner Hinterlassenschaft … Und auch auf ihr eigenes Ableben war sie bestens vorbereitet. Alles war testamentarisch geregelt. Das SOS-Kinderdorf und die Ärzte ohne Grenzen werden sich sicherlich über die Spenden gefreut haben. Und auch mir ist mehr als genug geblieben. Wenn Sie so wollen, bekam ich gutes Schmerzensgeld für diese Schicksalsschläge. Geldsorgen kenne ich nicht. Ich habe mir das Atelier in der Dreiheiligenstraße gekauft, weil ich meinte, dass mir in so einem sonnendurchfluteten Dachgeschoß mehr … gelingen würde. Doch ich will Ihnen etwas sagen: Für einen Künstler ist es gar nicht gut, wenn er sich nicht um sein Einkommen kümmern muss. Das habe ich im Lauf der Jahre gelernt. Fällt dieser rein logische Antrieb weg, Geld mit seiner Kunst zu erwirtschaften, muss sich ein Künstler nur aus inneren Bedürfnissen heraus motivieren. Nichts sonst spornt ihn an. Ich beneide meine Kollegen, die darauf angewiesen sind, etwas zu verkaufen. Welche Befriedigung sie wohl erlangen, wenn es ihnen gelingt! Wenn sie es schaffen, rein durch ihre Kunst zu überleben! Nichts sonst steht ihnen zur Verfügung. Sie haben ein dringliches, klar abgestecktes Ziel. Verfehlen sie es, müssen sie hungern. Das kann ich nicht von mir behaupten. Ich bin gewissermaßen Freizeitkünstler. Für mich geht es nicht um Leben oder Tod. Ich habe alles, was ich brauche, ohne auch nur ein einziges Bild anzufertigen.«
Pause.
»Und doch arbeiten Sie, wenn ich Sie richtig verstehe, wie besessen an Ihren Werken. Wenn es nicht ums Geld geht, worum geht es Ihnen dann?«
»Um die Sache an sich …«
Pause.
»Um die Kunst … und, ja, schon auch darum, dass jemand anerkennt, was ich mache. Ich meine, ich kann ja was. Ich gebe ja nicht nur vor, ein Künstler zu sein. Ich will jetzt nicht angeben, aber … ein jeder braucht doch etwas Anerkennung, nicht? Bestätigung für das, was er tut. Wer existiert schon rein für sich? Das kann vielleicht eine Weile gut gehen, aber nicht auf Dauer.«
*
Nicola Pammerkam
an jenem 5. April nachts nicht zu Hause in Bregenz an. Es war spät geworden im Vapiano. Einige von Beas Bekannten waren Nicola durchaus sympathisch gewesen. Selbst wenn Nicola ohne Komplikationen durchgefahren wäre, wäre sie nicht vor halb zwei Uhr morgens daheim gewesen. So aber, in diesem Zustand, war nicht daran zu denken, bis nach Hause zu fahren. Sie konnte nur so viel Strecke wie irgendwie möglich zwischen sich und Innsbruck bringen.
Kurz nach Mitternacht hielt Nicola das erste Mal an. Sie hatte nun den Arlberg erreicht. Um die Mautstelle und die Überwachungskameras des Straßentunnels zu vermeiden, entschied sie, den Umweg über den Arlbergpass zu nehmen. Die sich in Serpentinen den Berg hochschlängelnde Passstraße war leer zu dieser Uhrzeit. Nicola nahm einen kleinen, unbeleuchteten Parkplatz neben der Fahrbahn. Sie fuhr, so weit es ging, zum Waldrand hin und parkte das Auto im Schutz dreier großer Fichten. Sie drehte den Motor und das Licht ab. Dann begann sie, heftig zu zittern. Kurz verlor Nicola die Kontrolle über ihren Körper. Jetzt erst entglitt ihr alles. Oh Gott, dachte sie, oh Gott, was habe ich getan! Sie brach in Tränen aus. Sie vergrub den Kopf ins Lenkrad und wollte sich vor sich und vor der Welt verstecken.
Nach einer Weile fand sie wieder zu sich. Sie hatte es bis hierhin geschafft. Sie würde auch alles Weitere schaffen. Es gab jetzt kein Zurück mehr.
Ein Kleinlaster fuhr den Berg herab. Sein Licht war weit durch die Dunkelheit zu sehen. Nicola duckte sich unter das Armaturenbrett, bis er vorne an der Passstraße vorübergefahren war. Dann öffnete sie vorsichtig die Tür und stieg aus, vergewisserte sich, dass sich niemand in der Nähe befand.
Nicolas Mutter hatte immer einen Kanister mit Benzin und einen mit Wasser im Kofferraum. Man weiß ja nie, sagte sie. Nicola nahm das Wasser und einen Lumpen und schrubbte die vordere Stoßstange ab. Soweit sie es beurteilen konnte, war kein Schaden zu erkennen. Nichts war zerbrochen, nichts abgeschlagen. Dem Mann wird nichts passiert sein. Nichts Lebensgefährliches. Hastig verstaute Nicola den Kanister wieder im Auto und fuhr weiter. Doch sie war schwach und fahrig jetzt. Mit Mühe hielt sie den Wagen auf den engen Kurven der Bergstraße.
Keine weitere Stunde hielt Nicola durch, dann war ihre letzte Energie aufgebraucht. Kaum schaffte sie es noch, sich am Lenkrad festzuhalten. Die Passstraße war mittlerweile in eine Schnellstraße übergegangen. Rechter Hand im Tal erkannte Nicola den Parkplatz eines Freibads, in dem sie vor Jahren einmal gewesen war. Das Bad war im April nicht in Betrieb. Nicht bloß nachts, auch morgens würde dieser Parkplatz leer sein. Nicola nahm die Abfahrt und stellte das Auto an der Mauer des Freibads ab. Sie drehte den Motor und das Licht ab. Schob die Rückenlehne nach hinten. Atmete tief durch, wie sie es im Yoga-Kurs gelernt hatte. Nicola versuchte, die Augen geschlossen zu halten, bis der Morgen graute. Doch unaufhörlich flackerten dieselben Bilder vor ihrem inneren Auge auf. Immer wieder dieselbe Szene. Der Knall. Das kurz aufblitzende Gesicht dieses Fußgängers. An Schlaf war nicht zu denken.
Nicola blickte auf ihr Handy. Kein verpasster Anruf. Keine Nachricht. Nichts. Das war gut. Bea und die anderen würden in diesem Moment auf irgendeiner Tanzfläche herumhüpfen oder schon zu Hause sein und dort weiterfeiern.
Es gab keine Zeugen. Es war dunkel gewesen, es hatte geregnet.
Nicola stieg aus. Ziellos streifte sie im matten Licht vereinzelter Straßenlaternen umher. Vorne an der Schnellstraße fuhr gelegentlich ein Auto vorüber, ansonsten war alles still. Ein paar Stunden bloß musste Nicola verstreichen lassen. Ihre Mutter traf sich freitagvormittags nach dem Einkauf auf dem Markt stets mit alten Freundinnen zu einem Kaffeekränzchen in der Bregenzer Innenstadt. Um acht würde Mama außer Haus gehen. Dann könnte Nicola heim, ohne sich rechtfertigen, ohne irgendwelche Fragen beantworten zu müssen. Später könnte sie behaupten, sie wäre frühmorgens in Innsbruck losgefahren. Ihr würde schon etwas einfallen. Sie hätte den ganzen Vormittag Zeit, um sich frisch zu machen und alles in Ruhe zu überdenken. Wenn ihre Mutter mittags nach Hause kam, würde Nicola nichts mehr anzumerken sein.
*
Protokoll Dr. Werner Gnessel
Therapeutische Sitzung Andreas Bogner, Montag, 19.2.2018
»Wie geht es Ihnen heute, Herr Bogner?«