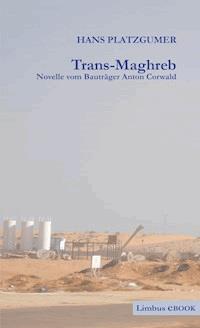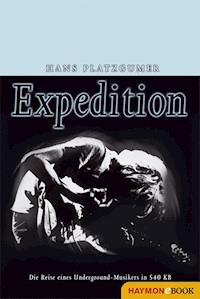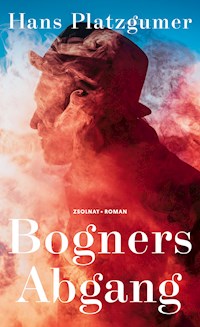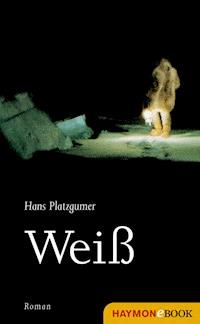Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Paul Zsolnay Verlag
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Kaum erwachsen flieht das Findelkind François vor seinen Pflegeeltern und landet in einem zwielichtigen Hotel an der Küste von Marseille, wo er von „Le Boche“, dem Deutschen, in obskure Geschäfte verwickelt wird. Er fühlt sich wohl in diesem Hotel, das nur selten Gäste beherbergt – bis dort ein Mann tot aufgefunden wird. François zieht in die Ungewissheit New Yorks, und bald – blind vor Liebe – nach Montreal in Kanada, wo ihn seine Gutgläubigkeit und der kalte Winter nahe an den Abgrund bringen. Aber kann man überhaupt leben, ohne zu wissen, wer man wirklich ist? Wie schon in „Am Rand“ geht es Hans Platzgumer um die wesentlichen, die existenziellen Dinge im Leben.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 321
Veröffentlichungsjahr: 2018
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Kaum erwachsen, flieht François vor seinen Pflegeeltern und landet in einem Hotel an der Küste, wo er von Le Boche, dem Deutschen, in obskure Geschäfte verwickelt wird. Er fühlt sich wohl im Richard, das nur selten Gäste beherbergt – bis dort ein Mann tot aufgefunden wird.
François zieht in die Ungewissheit New Yorks und bald – blind vor Liebe – nach Montreal, wo ihn seine Gutgläubigkeit und die Kälte des Winters nahe an den Abgrund bringen. Aber kann man überhaupt leben, ohne zu wissen, wer man wirklich ist? Wie schon in Am Rand geht es Hans Platzgumer um die wesentlichen, die existenziellen Dinge im Leben.
Zsolnay E-Book
HANS PLATZGUMER
DREI SEKUNDEN JETZT
Roman
Paul Zsolnay Verlag
Ich weiß nicht, wie alt ich bin, und habe immer das Gefühl, ich bin jung.
Woher ich komme, wer ich bin, wer meine Eltern waren … Ich weiß nichts.
(Holt aus der Tasche eine Gurke und isst)
Charlotta Iwanowna – Anton Tschechow »Der Kirschgarten«, 1903
Der Mensch muss sich sein eigenes Wesen schaffen.
Indem er sich in die Welt wirft, in ihr leidet, in ihr kämpft, definiert er sich allmählich.
Jean-Paul Sartre »Der Existentialismus ist ein Humanismus«, 1944
Teil Eins
DER MOND AUF DEN WELLEN
1
Einer wie ich erhält ständig eine neue Chance. Freispiel. Andere gehen verloren, Menschen wie ich tauchen unermüdlich auf aus dem Nichts. Im Alter von ungefähr dreizehn Monaten hat man mich gefunden, ich weiß nicht, wer, und dann hielten sie mich an der Hand, und es blieb bei dem Mich-Finden und Mich-an-der-Hand-Halten. Ich nenne mich François und weiß nicht, wer ich eigentlich bin, aber dass ich nicht verlorengehen soll, das habe ich verstanden. Stets findet sich jemand, der mich findet, sei es nun in Marseille-Bonneveine im Einkaufswagengitterbett oder später in der Innenstadt oder in den Ästen der Pinie. Immerzu nehmen sie mein Leben in die Hand, zu allen Unzeiten. Es ist ein ungeschriebenes Gesetz.
Wahrscheinlich war es von Beginn an so, dass ich mich verkroch und aus Verstecken herausgezogen wurde. Man gönnte mir das Verkrochensein wohl nie. Doch aushalten mit mir konnten sie es ebenso wenig, meine Eltern, wer immer sie waren. Mein erstes Dutzend Monate: vielleicht die besten meines Lebens, eher aber die schlechtesten, ich weiß es nicht. Verglichen mit dem ersten Jahr meiner Freundin Lucy werden sie ziemlich annehmlich gewesen sein.
Lucy wurde wie ich gefunden. Sie war jünger als ich, wenn wohl auch größer, denn groß war Lucy schon immer, groß und stark, eine Kämpfernatur. Ein knappes Jahr alt, schätzt man, sei sie gewesen, als sie nackt auf die Straße kroch. Wir beide schafften es in ähnlich kurzer Zeitspanne, die Eltern, die wir einmal hatten, über die Grenze der Belastbarkeit von uns wegzustoßen. Irgendwann ging nicht mehr, was vorher, allen Umständen zum Trotz, vielleicht für möglich gehalten worden war. Die Zukunft mit uns verengte sich zu einem dunklen Loch, auf das unsere Eltern zurasten. Den Aufprall wollten sie uns ersparen, indem sie uns wie Ballast abwarfen.
Einmal fragte ich Lucy, ob auch sie meinte, es wäre unsere eigene Schuld, dass man uns loswerden musste.
– Vielleicht haben wir die Großen einfach aus unserem Leben hinausgetrieben, hinausgeschrien?, sagte ich. Vielleicht war es unsere eigene Wahl?
Lucy antwortete nicht, aber sie warf mir einen Blick zu, der mir zu verstehen gab, dass ich sie nie wieder mit derlei Überlegungen konfrontieren sollte.
Die Frau, die mich in den Supermarkt hineingeschoben und dort abgestellt hatte, denke ich immer wieder, auch wenn es ein Gedanke ist, der mich nicht weiterbringt, diese Frau, die meine Mutter gewesen sein könnte, sie hatte die Hoffnung auf ein Weiterkommen mit mir aufgegeben, nicht aber die Hoffnung auf ein Weiterkommen für mich. Ich hasse sie nicht, ich liebe sie nicht, ich habe sie nur nicht mehr.
Oft stelle ich sie mir vor. Ich betrachte mich im Spiegel, meine magere Statur, als wäre ich ausgequetscht worden. Die bleiche, grobporige Haut, die Muttermale. Auch meine fransigen Feuerhaare habe ich vielleicht von einer Mutter. Die plattgedrückte Nase oder meine Augen, die die Farbe des Meeres an einem trüben Nachmittag zu spiegeln scheinen. Wenn ich mich und die Welt mit Gleichmut und Schwermut und Übermut betrachte; inwieweit habe ich das dieser unbekannten Frau zu verdanken?
An einen Vater zu denken, den es irgendwo da draußen geben muss, ist nicht möglich. Gedanken an ihn zu verschwenden, ist sinnlos, wie es für die Menschheit sinnlos ist, sich vorstellen zu wollen, woher sie kommt, wohin sie geht. Manches ist zu groß, um angedacht zu werden.
Bei anderen Fragen wiederum gibt es Anhaltspunkte.
Das Überwachungsvideo des Kaufhauses zeigte eine Frau mit Kopftuch und Sonnenbrille. Das wurde mir gesagt, spät erst, und als Nebensächlichkeit abgetan. Längst gab es das Videoband nicht mehr. Eine Frau, wie Millionen andere Frauen auch, billig, aber ausreichend getarnt, ein Kopftuch wie unzählige andere, eine Sonnenbrille, wie jede sie trägt, eine bröselige Schwarzweißaufnahme, nicht wert, sich länger damit zu befassen. Und doch: für mich ein Anhaltspunkt. Ein Beweis, dass es sie gibt. Ich habe eine Mutter. Sie hat mich nicht verstoßen, nein, in gewisser Weise fühle ich mich von ihr gerettet. Mit ihr ist es losgegangen, das beharrliche Retten von François.
2
Für Lucy, klar, ist es schwieriger. Sie kann sich nicht mit dem Gedanken trösten, von ihren Eltern gerettet worden zu sein. Sie wurde nicht wie ich in einem Einkaufswagen an den Ort gerollt, wo sie gefunden werden sollte. Auch wurde sie nicht wie andere in eine Babyklappe gesteckt oder in einem Körbchen an einem geschützten Ort abgestellt, zugedeckt womöglich, eingepackt, vorbereitet für ein Weiterleben. Nein, ihre Eltern, oder wer immer sich der Sache annahm, entledigten sich ihrer an einem äußerst unangenehmen Ort: dem Straßenrinnsal einer Ausfahrtsstraße von Dakar, wo sie abgeworfen wurde aus ihrem jungen Leben, hingeschmissen in den Schmutz, ausgestoßen in die Nacht, um von dieser für immer fortgespült zu werden. Wie andere Babys, die ihre Eltern rein durch ihre Existenz heillos überfordern, in Mülltonnen landen, wurde Lucy eines Nachts als Müll auf den Straßenrand gekippt. Nichts als eine Last war sie gewesen, ein Unglück, ein unerwünschtes Menschenwesen in einer unerwünschten Welt, eines mehr, eines zu viel. Es wurde entsorgt.
Nach einer Handvoll Monaten hätte dieser Straßenrand bereits das Ende ihrer Lebensstrecke bedeuten sollen. Doch wie Lucy nun mal ist: Sie gab sich mit dem mülligen Totenbettchen, das ihr zugewiesen worden war, nicht zufrieden. Eine Weile lag sie wohl dort, verletzt, verblüfft, verstört. Doch als sie merkte, dass ihr Schreien und Zappeln zu nichts anderem taugte, als Ratten und Geziefer fernzuhalten, ergriff sie die Initiative. Sie krabbelte fort aus der Müllhalde, gegen den Strom. Eine wie Lucy, die personifizierte Selbstbestimmung, sie wäre aus jedem Abfalleimer herausgeklettert, wie tief er auch sein mochte – ihre Eltern hatten das vielleicht geahnt.
Mittlerweile hatte die Dämmerung eingesetzt, und diese Auflösung der Nacht war Lucys Glück. Nun setzte sich im Halblicht ihr kohlrabenschwarzer Körper vom hellen, brüchigen Asphalt und den verblichenen Bodenmarkierungen der Straße deutlich ab, sodass er erkannt werden konnte. Lucy hievte sich aus dem Rinnstein hoch, zurück auf die Fahrbahn, splitternackt, verklebt vom Dreck, ein Klumpen Mensch, heiser vom stundenlangen Schreien, das für immer ihre Stimmbänder abgenutzt hatte.
Als ich Lucy gut anderthalb Jahrzehnte später, einen Kontinent weiter nördlich kennenlernte, fiel mir ihre Stimme als Erstes auf. Trotz ihrer Jugend klang Lucy bereits wie eine greise Blues-Sängerin, hoffnungslos verbraucht und unbezwingbar zugleich. Was für eine Stimme!, dachte ich, als ich sie da am Strand von Pointe Rouge im Südosten von Marseille mit einer Schulkollegin sitzen sah und mithörte, wie sie in einem fort schimpfte über andere Schulkolleginnen und Typen und Lehrer und überhaupt über alles. Auch über mich hätte sie geschimpft, aber mich kannte sie noch nicht.
Nur wenige Stunden später lagen wir beide weiter draußen am Stadtstrand, versteckt in der Dunkelheit zwischen diesen Wellenbrecherfelsen, die es schaffen, das Mittelmeer selbst während der Mistralstürme zu bändigen. Kalt und schmutzig war es im dunkelbraunen Sand. Die übereinandergetürmten Felsblöcke dienten Hobbyanglern, Kindern, Obdachlosen als Toilette und Müllkippe. Lucy und ich liebten uns in dieser grauromantischen Finsternis ein erstes Mal. Während wir es taten, schimpfte Lucy in einem fort, nun auch mit mir. Sie schimpfte mich aus, so mag sie es nicht, so tut es weh, nicht so fest, François, dann wieder: fester, François, halt an, mach weiter, kannst du nicht mehr, François? Die Steine waren ihr zu hart und der Sand scheuerte zwischen ihren Arschbacken. Die Nickelbrille, die sie trug – auch in all den folgenden Jahren habe ich Lucy nie ohne diese Brille gesehen –, verrutschte. Putain, fluchte sie. Die Ausläufer so mancher Wellen, die die Dünung zu unserem Liebesörtchen spülte, griffen nach Lucys Zehen, während ich ein wenig unbeholfen auf ihr herumturnte. Sie hörte nicht auf zu fluchen. Putain, maulte Lucy, so oft, dass ich schon annehmen musste, sie glaubte, nicht François, sondern Putain wäre mein Name.
Vielleicht war er das ja auch? Schließlich war ich bereits über ein Jahr lang auf der Welt gewesen, da hatte mich jemand neu benannt, war jemand auf die Idee gekommen, mich François zu nennen – jemand mit beschränkter Phantasie, wie ich anmerken will. »Das Französlein« – ich hätte mir etwas Besseres verdient. Doch jemand wollte gehört haben, wie die Frau mit Kopftuch und Brille mich so nannte, die mich in die Bücherabteilung des Supermarkts gekarrt und dort stehengelassen hatte. Dodo, François, hätte sie, zwischen den Bücherregalen angekommen, gesagt. Schlaf, mein Kind. Oder war es vielleicht: Warte hier auf mich, François? Oder: Ich komme gleich zurück, François? Manch ein Augenzeuge mutmaßte, diese Frau wäre wohl davon ausgegangen, dass ein Baby bei Menschen, die Bücher und Zeitungen kauften, besser aufgehoben wäre als bei denen, die durch die Autozubehörabteilung schlenderten.
Die Leute erzählen viel, warum auch nicht? Meine Ankunft zwischen den Büchern ist rätselhaft, wie meine Herkunft und Zukunft es nun mal sind. Ich bin ein weißes Blatt Papier, das jeder beschreiben kann, wie es ihm beliebt. Mein Lebenslauf besteht aus Gerüchten. In der Fiktion geborene Realität. Des Findlings aktive Mitarbeit an seiner Chronologie ist nicht vonnöten, seine Glieder sind an Fäden aufgehängt. Hin und her wird er geschoben. Hinein in den Supermarkt. François wird er genannt. Ebenso gut aber hätte man der Einkaufswagenmutter andere Wörter, andere Namen in den Mund legen können.
Ich selbst habe von all der Schieberei nichts mitbekommen. Sediert nuckelte ich an meinem Schnuller, der wie die meisten Schnuller französischer Kinder in Rotwein getränkt war. Ein Schlaftablettchen war mir obendrein verabreicht worden. So schlief ich zwischen mannshohen Regalen, Stellagen, Drehständern voller Bücher, Comics, Zeitschriften, Zeitungen des Hypermarchés. Klein und zart, wie ich für mein Alter war, konnte ich mich im Einkaufswagen ausstrecken. Ich schlief mein Räuschlein aus und erwachte irgendwann unter diesem mir zugeteilten Namen François. François Toulet, um genau zu sein, der ich bald wurde, denn so hießen die Adoptiveltern, denen man mich zuteilte.
Als François Toulet stellte ich mich auch Lucy in jener Nacht vor. Toulet klänge wie Poulet, sagte sie, Hühnchen, und ich konnte ihr nicht widersprechen. Ob sie mich rupfen sollte?, fragte sie und lachte, und wieder widersprach ich nicht. So landeten wir vorne bei den Wellenbrechern, und ein Putain nach dem anderen prasselte auf mich ein.
Eigentlich war ich froh, dass der Besitzer der benachbarten Strandbar vorbeikam und dem Rupfen ein Ende bereitete, als er uns fand. Dass man uns fand, versteht sich von allein. Wir beide waren Findelkinder, zusammen doppelt auffindbar, wir zogen die Blicke der Welt auf uns, zu zweit noch mehr als jeder für sich allein. Wann immer ich Lucy in der Folge traf, wusste ich: Lang würden wir nicht unter uns bleiben. In jenem Moment im schmutzigen Sand, beschäftigt damit, Lucys Flucherei zu entschärfen, war ich mir über all das aber nicht im Klaren. Plötzlich stand der spitzbärtige Prolet mit seiner sonnenverbrannten Lederhaut, in die sich alberne Tattoos verirrt hatten, über uns und grinste von einem Felsblock auf uns herab. Oh, là là, sagte er und zupfte an seinem Bärtchen. Er fühlte sich weit mehr als die paar Meter, die er uns überragte, über uns erhaben. Das hier wäre doch kein Ort für die Liebe, l’amour!, lachte er. Va te faire futre!, warf Lucy ihm mit ihrer rauen Stimme an den Kopf, so laut, dass ganz Pointe Rouge es hören musste, und im selben Moment schon warf sie mich fluchend ab, sodass ich das Gefühl hatte, ihr bellender Befehl, sich zu verziehen, wäre an mich gerichtet gewesen. Wütend streifte Lucy ihren Rock zurecht, rückte die Brille gerade und begann, mit nicht enden wollenden Tiraden den Mann zu verscheuchen. Das hier wären Frankreich und die neunziger Jahre, fauchte sie, und wer er denn dächte, wer er wäre, der erbärmliche Wächter einer Prüderie, an der dieser ganze aschfahle Kontinent noch ersticken möchte. Würde sie wollen, würde sie hier weiterficken, mit wem sie wollte und so lange sie wollte!
Der Mann brachte in der Folge kein Wort mehr über die Lippen, Lucy ließ ihm keinen Raum, verstummt blieb er, eingeschüchtert, reglos auf seinem Felsblock stehen, verblüfft ob Lucys heftiger Reaktion, bereit, jederzeit die Flucht zu ergreifen, sollte diese Furie handgreiflich werden. Ich schummelte mich ins Abseits und versuchte, mein noch halberigiertes Glied in meine Hose zu stopfen.
Was wir hier trieben, ginge ihn einen Scheißdreck an, wütete Lucy. Doch jetzt wäre es ihr vergangen. Mais bravo!, applaudierte sie. Ob er sich etwas darauf einbildete? Muttersöhnchen! Putain!
Ich knöpfte die Hose zu und war froh, nichts mitzureden zu haben. In gewisser Weise genoss ich es mehr, Lucy dabei zuzuhören, wie sie dem Kerl ihre Meinung sagte, als mit ihr Liebe zu machen. Sie hatte voll und ganz die Kontrolle übernommen. So war es immer schon in ihrem Leben gewesen und würde es wohl immer bleiben. Diese unbeugsame Tatkraft, die sie aus dem Rinnstein Dakars mit in ihr zweites Leben gezogen hatte, dieses Aufbäumen, Sich-gegen-das-Schicksal-Stemmen, genau das hätte ich mir von ihr abschauen sollen. Es hätte die Blaupause für eine selbstbestimmte Lebensführung sein können, das wurde mir in jenem Moment am Strand bewusst. Doch wieder und wieder scheiterte ich in den folgenden Jahren daran. Ich beobachtete Lucy, ich bewunderte sie, aber ich konnte nie werden wie sie.
Noch als der lederhäutige Mann sich wieder zurückzuziehen begann, gab Lucy ihm zu verstehen, was sie von seinesgleichen hielt. Kleinlaut brachte er sich vor ihren Flüchen in Deckung und verschwand im Dunkel, aus dem er gekommen war. Alles nur Erdenkliche war ihm entgegengeschleudert worden, das die Geringschätzung einer Person ausdrücken konnte, bis er ganz im Schwarz der Nacht zerfloss. Dann packte mich Lucy wuchtig an der Hand und zog mich weg vom Strand zur Straße hin, die im schummrigen Licht vereinzelt leuchtender Laternen versunken war. On y va, sagte Lucy heiser. Ihre Wut war nur mehr in ihren Schritten zu erkennen, nicht mehr in ihrer Sprache.
Ich ließ mich von Lucy zur Corniche, der Küstenstraße, ziehen, die eine Trennlinie zwischen der Stadt und dem jetzt nachtfarbenen Meer markierte, das unablässig in die Furchen und Ritzen Marseilles hineinfuhr. In die Richtung, in der der Mann, der uns gestört hatte, verschwunden war, hatten wir uns kein einziges Mal umgedreht, er existierte nicht mehr, und auch sonst war keine Menschenseele zu sehen. Zwei Uhr morgens wird es gewesen sein, ein Montag im September. Ruhiger als jetzt wurde die normalerweise lärmende und stinkende Stadt nie. Schweigend trotteten Lucy und ich nebeneinander her. Ihre Flipflops schlurften über den Asphalt.
Weit draußen spiegelte sich der Mond am Wasserhorizont. In einem fort zerbrach die Dünung sein glitzerndes Abbild in unzählige Scherben. Stetig versank das Glitzerlicht und tauchte von neuem wieder auf. Diese Beständigkeit vermochte mich zu beruhigen, auch in jenem Moment. Hätte ich eine Heimat benennen müssen, so wäre es nicht Marseille, sondern der unerreichbare Ort draußen auf dem Meer gewesen, an dem die Wasseroberfläche Tag und Nacht mit dem Himmel verschmolz, dieser in endlose Weite gezogene Strich, der Stadt und Bewohner immerzu in ihre Schranken wies. Das Meer gab uns zu verstehen, wie begrenzt unser Wirkungsfeld war. Sosehr wir hineindrängten in die Wasserwelt, die sich neben unserer Beton- und Asphaltwelt erstreckte, was immer wir versuchten, die Dünung würde uns überdauern. Ich fühlte mich geborgen bei diesem Gedanken. La mer und la mère, das Meer und die Mutter. Für mich war es dasselbe.
Als ich nun still neben Lucy – denn alles, was ich hätte sagen wollen, erschien mir deplatziert – die Küstenstraße entlangging, malte ich mir aus, wie die wieder- und wiederkehrenden Fluten uns beide in diese Stadt gebracht, uns beide hier abgegeben hatten und eines Tages wieder mit sich nehmen würden. Ich ahnte nicht, dass auch Lucy ein Findling war. Ich stellte mir einfach vor, wie sie wie ich von dort draußen, wo der Mond auf die Wellen fiel, in die Stadt gespült worden war. Menschen aus der ganzen Welt sind vom Meer in diesen Hafen getragen worden. Lucy eine von ihnen, egal, woher sie kam. Ich einer von ihnen.
In einem Einkaufswagen in Bonneveine war ich gelandet.
Als wir meinen angenommenen zehnten Geburtstag gefeiert hatten, hatten mir die Toulets davon berichtet.
– Setz dich, François, hatte mein Adoptivvater befohlen.
In allem, was er sagte, schwang der Befehlston mit.
– Wir müssen dir etwas mitteilen, jetzt, da du alt genug bist.
Von einem Moment auf den anderen zog er mir den Boden unter den Füßen weg.
Ich hatte den Adoptivvater immer zu siezen. Eine Frage des Respekts war das für ihn. Eine Frage des Anstands – wohl eher aber eine des Abstands voneinander.
Seine Frau, Éveline Toulet, hingegen gestattete mir, sie zu duzen, auch wenn dies in Gegenwart des Vaters zu merklichen Spannungen führte, da dieser einen saloppen Umgangston innerhalb der Familie nicht gutheißen konnte. Auch die Erwachsenen pflegten untereinander einen so formellen Konversationsstil, dass ich manchmal meinte, im falschen Jahrhundert gelandet zu sein. Mich wies der Adoptivvater oft wegen Kleinigkeiten zurecht, mit seiner Frau aber kommunizierte er stets auf höfliche, distanzierte Weise. Und trotzdem klang in jedem Satz durch, wie deutlich die Gattin unter ihm stand.
Schon rein körperlich war diese Rangordnung vorgezeichnet. Während ihr Mann ein stattlicher Herr mit distinguiertem Auftreten und strikten Manieren war, in jeder Beziehung darauf bedacht, Haltung zu bewahren, schlich die kleingewachsene Éveline Toulet meist geduckt neben oder hinter ihm her. Ihr früh ergrautes Haar hatte sie tagein, tagaus zu einem festen Zopf geflochten. Manchmal überlegte ich, ob sie zum Schlafengehen wenigstens ihr Haar öffnete. Nie durfte ich das elterliche Schlafzimmer betreten, ohne vorher anzuklopfen und auf Erlaubnis zu warten. Wann immer ich dies tat und Maman mir nach einer Weile die Tür öffnete, hatte sie ihre Haare zusammengebunden. Selbst im Nachthemd schien sie ordentlich gekleidet zu sein. Außerhalb des Schlafzimmers trug sie ohnehin stets gerade geschnittene, meist schwarze Kostüme mit langem Rock, sodass sie auf ihre Umwelt den Eindruck einer Ordensfrau machen musste. Brav und sittsam ihrem Mann zur Seite stehend, so gab sich Éveline Toulet in der Öffentlichkeit. Kein einziges Mal erlebte ich, dass sie aus dieser Rolle fiel.
Andererseits aber spürte ich, wie sie im Geheimen ihren Gedanken freien Lauf ließ und sich hinaus sinnierte aus der starren Welt, in der sie – wie ich – gefangen war. Je älter ich wurde, desto mehr hatte ich den Eindruck, sie benutzte mich als Chance, sich in eine andere Welt zu denken. Ich, der Fremdkörper in unserer Familienkonstellation, ich verkörperte für sie einen Hauch von Freiheit und Eigenständigkeit, die ihr selber verwehrt waren. Was mir an Verwurzelung fehlte, mochte sie als erstrebenswerten Grad einer Anonymität einordnen, die ihr in ihrem eng gefassten Alltag stets untersagt geblieben war. Es hatte den Anschein, als sehnte sie sich im Stillen nach dem Tag, an dem ich an ihrer Stelle dazu bereit sein würde, eigenmächtig den Schritt hinaus in ein neues, selbst definiertes Leben zu wagen, und vollbringen würde, wozu es ihr an Kraft und Mut und Möglichkeiten mangelte. Ihr Dasein, das sie anspruchslos unter dem Joch des Patriarchen fristete, diente meiner Vorbereitung auf diesen Befreiungsschritt, den ich für uns beide tun sollte, sie wünschte sich, dass ich ihn machte, selbst wenn ich sie dadurch allein in ihrem Käfig zurücklassen würde. Als hätte sie sich selbst bereits aufgegeben und lebte nur weiter durch mich. Eine solche Vorstellung erschreckte und befremdete mich, ich fühlte mich benutzt und in der mir aufgebürdeten Verantwortung überfordert, aber da es mir unmöglich war, mit Maman oder jemand anderem darüber zu sprechen, und all die Vermutungen und Gefühle nirgends anders als in meinem Kopf Gestalt annahmen, gab ich mein Bestes, sie als Einbildung abzutun.
Soweit es der schmale, durch den Ehemann abgesteckte Rahmen erlaubte, unterstützte Éveline Toulet jedenfalls mein unausgesprochenes Bedürfnis, mich aus ebenjenem Rahmen freizustrampeln. Hinter Monsieur Toulets Rücken deckte sie mich, wenn ich schlechte Noten nach Hause brachte, schlampig oder ungewaschen zu Tisch kam oder mich in sonst einer Weise unangemessen benahm. Ich erkannte durchaus eine Gehilfin in ihr, aber ich zollte ihr für ihren Beistand wenig Wertschätzung. Ich konnte die beiden Adoptivelternteile nicht getrennt betrachten. Was auch geschah, Maman würde die Gattin dieses Mannes bleiben. Ihr Platz war an seiner Seite. Wo mein Platz war, das wusste ich nicht. Doch dieses Haus Toulet betrachtete ich, je älter ich wurde, mehr und mehr als eine Zwischenstation auf meinem Weg ins Ungewisse. Noch hatte ich nicht allzu viele Chancen in meinem Leben bekommen, dennoch ging ich bereits verschwenderisch mit ihnen um.
Wie sich meine Adoptivmutter um mich sorgte, wurde mir zunehmend lästig. Anstatt es ihr zu danken, machte ich ihr zum ewigen Vorwurf, dass sie mich der Herrschaft Monsieur Toulets unterworfen hatte. Das Selbstmitleid eines verstoßenen Jungen, der Egoismus, der allen Kindern und Jugendlichen eigen ist, die Wirren, die mich durch all die Jahre begleiteten; je mehr ich heranwuchs, desto mehr bekam Éveline Toulet all dies zu spüren. Die Beziehung, die ich zu dieser Frau hatte, die ich Maman nannte, irritierte mich. Anstatt mich bei ihr geborgen zu fühlen, wusste ich immer weniger, ob ich denn eine Mutter hatte oder nicht.
Jahre später erst kam mir die Vermutung, dass Monsieur Toulet absichtlich diese Verwirrung hervorgerufen hatte, denn sie nützte seiner Vormachtstellung. Aus diesem und keinem anderen Grund verlautbarte er an jenem Tag, so früh in meinem Leben, so überdeutlich und ohne Vorwarnung, dass ich in Wahrheit ja gar nicht ihr Kind war.
– Jetzt, da du alt genug bist, François, sollst du es wissen.
Er wollte mich brechen, früh genug, wie man ein wildes Fohlen zur Zähmung bricht. Und er hielt seine Ehefrau so klein wie möglich, indem er sie mir als Mutterfigur entriss. Wohl fürchtete er den geheimen Bund zwischen ihr und mir. Ihm war nicht entgangen, wie Éveline mit mir litt, wann immer er mich schalt oder gar ohrfeigte. In seiner Anwesenheit wagte sie nicht, mich zu trösten, aber er wusste: Zu einem späteren Zeitpunkt würde sie mich in die Arme nehmen. Wenn auch unbeholfen. Wenn auch nur, um seine strengen Erziehungsmethoden zu entschuldigen.
Beharrlich, doch mit wenig Überzeugungskraft, versuchte Éveline Toulet sich als Vermittlerin zwischen dem Familienfürsten und dem adoptierten Sohn, eine undankbare Aufgabe. Ihr Mann wies sie zurecht, weil sie zu weich mit mir war, ich wiederum ließ sie spüren, dass sie auf seiner Seite stand. Mit den Jahren nach der Verlautbarung meiner Fremdheit innerhalb der Familie wuchsen die Gräben zwischen uns. Der Plan des Adoptivvaters ging auf. Er untergrub die Phalanx zwischen Ehefrau und Sohn. Seit ich wusste, dass meine echte Mutter mir irgendwo da draußen abhandengekommen war, galt meine Sehnsucht dieser unbekannten Frau und nicht jener, in deren Haus ich wohnte. Zunehmend wurde das Familienleben, wie ich es kannte, ein emotionales Chaos. Weder wagte ich, Éveline Toulet zu lieben, noch sie zu hassen. Bis ich längst ausgezogen war und Abstand zwischen mich und die Frau Maman gebracht hatte, verstand ich nicht, welche Gefühle ich ihr gegenüber entwickelt hatte. Lange meinte ich, ich durfte sie nicht lieben. Ich brauchte sie, ja, aber nicht einmal das konnte ich mir eingestehen.
Wenigstens über eine einzige Sache war ich mir im Klaren: dass ich schaffen musste, wozu diese Frau nicht in der Lage war. Eines Tages, so bald wie möglich, musste ich mich aus den Klauen des Adoptivvaters befreien.
Monsieur Toulet als Vater zu bezeichnen, war mir unbewusst, schon bevor er mir die Wahrheit über meine Herkunft berichtet hatte, schwergefallen. Ab jenem Moment aber, auch wenn ich ihn weiterhin so zu nennen hatte, verkam der Ausdruck mon père zur Floskel. V-a-t-e-r blieben mir fünf unbedeutend aneinandergereihte Buchstaben. Ich konnte mir die Bedeutung vorstellen, aber ein Gefühl zu diesem Wort fehlt mir bis heute. Wie fühlt es sich an, einen Vater zu haben?
Es wäre wohl besser gewesen, ich hätte die Wahrheit über meine Adoption nie erfahren. Doch es war müßig, daran herumzuknobeln. Ich konnte es nicht rückgängig machen. Nur irgendwie mich einrichten in diesem Leben, in das ich gerutscht war. Wie Éveline Toulet musste ich es halten: das Leben ertragen, wie es war, und gleichzeitig mich hinausträumen aus ihm. Alternativen erfinden. In meinem Kopf.
Meine echte Mutter, sagte ich mir, sie war irgendwo da draußen auf der nicht erkennbaren Linie zwischen Meer und Himmel. Sie war der große, nicht greifbare Horizont. Eines Tages würde ich zurückfinden, dorthin gehen, woher ich gekommen war. Vielleicht würde Mutter noch auf mich warten? Ich wollte mich als Kind des Meeres sehen, nicht als Stadtkind, obgleich ich nichts anderes als die Stadt und ihre Enge kannte und aufs Meer hinaus bloß wehmütig blickte.
Vielleicht lag es an diesem mondfunkelnden Meer, dass auch Lucy sich allmählich beruhigte. Sie hatte aufgehört zu fluchen und schritt wortlos, ich weiß nicht, in welche Gedanken versunken, neben mir her. Auch sie blickte über das Wasser Richtung Afrika und sog die salzige Luft ein, während wir stadteinwärts gingen. Vielleicht dachte sie daran, dass am anderen Ufer des Nachtmeers ihre Herkunft lag. Wahrscheinlich aber machte sich Lucy keine Gedanken darüber. Alles Zurückliegende war für sie abgeschnitten, Abschnitte eines Lebens, mit denen man sich nicht aufzuhalten hatte.
Eine Weile noch hatte sie mich an der Hand gehalten, an ihrer rauen, groben Prankenhand, mich länger als nötig nicht losgelassen, wohl einfach eine Weile vergessen, mich loszulassen, und obwohl sie mich mehr gefangen als in Liebe gehalten hatte, hatte ich den festen Halt genossen, den sie mir gab. Nun genoss ich das Schweigen, das Lucy und ich miteinander aushielten. Wir kannten uns erst seit dieser Nacht, und doch mussten wir uns nichts vormachen. Seelenverwandte waren wir, wir wussten es nicht, aber spürten es. Zwei Findelkinder, die sich gefunden hatten. Still und zügig entfernten wir uns aus Pointe Rouge. In großer Entfernung waren die dichtbebauten Hügel der Innenstadt zu erkennen, auf die wir uns zubewegten. Über all dem Häusergewirr thronte mächtig und schützend die Basilique Notre-Dame de la Garde, La Bonne Mère, die gute Mutter. Unser aller Mutter. Die ganze Stadt schien unter ihrer Obhut eingeschlafen. Auch die Corniche war ruhig jetzt, wie ausgestorben, getaucht in das orange Licht der Straßenlampen. Hin und wieder raste ein verbeultes Auto an uns vorbei, ratterte über den brüchigen Straßenbelag und all die Schlaglöcher hinweg, nur um Lucy und mich daran zu erinnern, dass wir uns weiterhin in der Menschenwelt befanden und unsere Suche nach einem Platz in ihr noch längst nicht ausgestanden war.
3
– Dich mag ich, sagte Lucy nach einer Weile. Ansonsten können mir die meisten Weißen gestohlen bleiben. Dich aber mag ich.
Es war eine trockene Feststellung.
– Ich mag dich auch, sagte ich.
Wir hatten den Prado hinter uns gelassen, eine Strandanlage, deren vertrocknete Picknickwiesen an Sonntagnachmittagen von Familien bevölkert, nachts jedoch Brachland und Rückzugsgebiet für gestrandete Kreaturen waren, die im Niemandsland zwischen Meer und Stadt Zuflucht suchten.
– Die meisten Schwarzen können mir auch gestohlen bleiben, sagte Lucy. Und die beurs (die Araber) sowieso.
– Was ist mit den Asiaten?, fragte ich, weniger aus Interesse, eher im Versuch, das Gesprächsthema auf einem neutralen Niveau zu halten.
Lucy lachte nur, antwortete nicht. Daran gewöhnte ich mich später, wie sie so manche Frage ohne ersichtlichen Grund unkommentiert ließ.
Wir spazierten weiter stadteinwärts, am abgezäunten Yachthafen vorbei. Ruhig gingen wir nebeneinander her und fühlten, wie richtig es war, nebeneinander zu gehen. Auch wenn wir konträrer nicht aussehen konnten, es war, als wären wir miteinander verwandt. Sie die große, starke, schwarze Schwester, unerschütterlich, fast brutal in jeder Bewegung, die sie machte, eine ebenso unverwüstlich wirkende Nickelbrille auf ihrer breiten Nase. Ich ihr kleiner, durchsichtiger Bruder, den sie beschützen würde. Eine Fürsorglichkeit – nicht steif und erzwungen wie die der Toulets – strahlte Lucy aus. Auch wenn ich mich nicht der Illusion hingab, ihr völlig zu trauen – das Vertrauen in meine Mitmenschen war mir wohl im Einkaufswagen für immer abhandengekommen –, fühlte ich instinktiv, dass Lucy für mich keine Bedrohung darstellte, nicht in diesem Augenblick zumindest. Es fühlte sich befreiend an, in ihrem Fall das Misstrauen abzulegen, das ich sonst gegenüber der Welt entwickelt hatte.
Später, in New York, legte ich es ein weiteres Mal ab. Mein größter Fehler.
Vom Meer wehte ein kühler Wind durch die wolkenlose Nacht. Hätte ich eine Jacke gehabt, hätte ich sie übergezogen. Lucy, die nur ihren Rock und ein dünnes Hemd trug, barfuß in Plastiksandalen, schien sich weder daran noch an dem Umstand, dass die Gläser ihrer Brille beschlagen waren, zu stören.
Die Corniche zog sich eine Anhöhe hinauf, dem Steilufer folgend in die Stadt hinein. Immer höher blickten wir über den Meereshorizont hinaus, immer tiefer warf sich unter unseren Füßen weiße Gischt an die Felsen. Auf den Hügeln landeinwärts schliefen in ihren verdunkelten Häusern und Villen, verborgen zwischen spärlichen Straßenlaternen, die Groß- und Kleinbürger, die sich südlich der Innenstadt angesiedelt hatten, in sicherem Abstand zum Mief der Straßenhändler, Marktschreier und Kleinganoven. Dutzende Marseilles gab es, streng voneinander getrennt. Über hundert Viertel zählte die Stadt, Dörfer, Stadtteile, Bereiche mit eigenen Gesetzen und unsichtbar gezogenen Grenzen, alle irgendwann eingemeindet, alle aber weiterhin für sich. Niemals drangen die Bewohner aus dem Süden in die nördlichen Banlieues vor, wo sich bewaffnete Banden bekriegten und Zigeuner in Zeltstädten hausten.
Ich war in einer besseren Gegend der Stadt untergekommen. Wo immer ich ursprünglich hineingeboren gewesen war, ohne eigenes Zutun hatte ich es geschafft, meiner Bestimmung zu entkommen. Ich hätte meinen leiblichen Eltern dankbar sein sollen, dass sie mich ausgesetzt hatten, und den Adoptiveltern, dass sie mir ein Leben in Sicherheit und Wohlstand anboten. Über allem hing der Dank, den ich schuldete. Ein Leben lang müsste François dankbar sein. Dankbarkeit aber ist ein theoretisches Konstrukt. Man bekommt es anerzogen. Oder eben nicht.
Ein verirrtes Taxi verlangsamte neben uns. Ob wir einsteigen wollten, rief uns der pakistanische Taxifahrer in gebrochenem Französisch zu. Lucy ging nicht darauf ein und scheuchte ihn weiter.
Wir waren fast eine Stunde an der Corniche unterwegs gewesen, da erreichten wir über ein Viadukt Endoume, den Stadtteil, in dem meine Adoptiveltern wohnten und wo ich den Großteil meiner Kindheit verbracht hatte. Noch wohnte ich bei ihnen. Ein Jahr noch, dann würde ich das Baccalauréat machen. Glücklicherweise fiel mir die Schule nicht schwer. Diese eine Sache wollte ich hinter mich bringen, dann würde ich ausziehen, einen Strich unter all das gute Leben ziehen, das die Toulets mir vorzeigten, offerierten, aufzwangen, und nie wieder zurückkehren zu ihnen.
Neben Lucy und mir führte eine steile Treppe, versteckt hinter einer Bushaltestelle, hinunter zur Fausse Monnaie, der Falschgeldbucht, wo ich hin und wieder baden ging und noch nie einen falschen oder echten Geldschein gefunden hatte. An diesen ausgestorbenen Küstenfleck hätten wir uns zurückziehen können und dort weitermachen, wo uns der Strandbarprolet in Pointe Rouge gestört hatte.
Wir verlangsamten und hielten kurz inne. Lucy bemerkte, wie ich darüber nachdachte.
– Sollen wir wieder?, fragte sie.
Ich drückte mich vor einer Antwort. Mir war kalt, ich war müde, überhaupt fühlte es sich eigenartig an, mit Lucy zu schlafen.
– Ha!
Wieder Lucys dreckiges Lachen. Es wirkte ansteckend.
– Auch ich hab jetzt keine Lust mehr, sagte sie und winkte ab. Machen wir es ein andermal wieder. Wann immer du magst. Auch ohne Pariser. Ich kann sowieso nicht schwanger werden.
Weit zog sich Lucys heisere Stimme durch die Stille der Nacht. Ich blickte zu den umliegenden Häusern, deren Fensterläden ausnahmslos geschlossen waren. Ich war versucht nachzufragen, warum sich Lucy so sicher sein konnte. Doch sie war bereits weitergegangen und hatte mich stehengelassen. Sie schien keine Lust mehr zu haben. Ich sah zu, dass ich sie einholte.
Wenig später, beim Petit Casino, dessen Eingang mit einem eisernen Rollo gesichert war – derartig verbogen, dass ich mich fragte, wie der Ladenbesitzer es überhaupt in Bewegung setzen konnte –, deutete ich zur gegenüberliegenden Straßenseite. Dort fiel in einer Senke ein kleines, verstecktes Wohnviertel ab, die Malmousque, eine nach und nach zugebaute Halbinsel, die wie ein steinerner Irrgarten ins Meer reichte. Die Sträßchen dort waren keine rues, sondern hießen je nach ihrer Passierbarkeit Impasse oder Traverse, großteils verliefen sie im Nichts. Früher war diese Landzunge ein verschlafenes Fischerdorf gewesen, bis nach und nach der Moloch Marseille es umzingelt hatte. Nach wie vor aber war die Malmousque, mit ihren winzigen, für den Autoverkehr nicht geeigneten Sackgassen, ein vom Stadtlärm entfernter Ort.
– Dort wohne ich. Noch. Meine Eltern wohnen dort, sagte ich.
– Wirklich?
– Ja, wirklich.
– Sehen die aus wie du?
– Nicht wirklich, nein.
– Meine auch nicht, sagte Lucy und lachte kurz.
Eine Weile blieben wir wortlos nebeneinander stehen. Ich musste die Durchfahrtsstraße überqueren, um ins Labyrinth der Malmousque-Gassen zu gelangen, Lucy musste geradeaus weiter. Sie hätte noch einen weiten Weg vor sich, meinte sie. Ein Küsschen links, ein Küsschen rechts, schon verabschiedete sie sich, fast nebensächlich, von mir. Ich wollte mir ihre Telefonnummer notieren, aber Lucy ging bereits weiter Richtung Norden.
Bei jedem anderen Menschen hätte ich Bedenken gehabt, ihn ziehen zu lassen in die nördlichen Vororte – denn da musste Lucy vermutlich hin, La Rose, Grands-Carmes, Saint-Mauront, staubige Gegenden zwischen abgezäunten Hafenbecken und übereinandergetürmten Stadtautobahnen, Sackgassen, abgeschnitten vom Rest der Welt. Niemand betrat freiwillig diese schmucklosen Straßen, in denen Tag und Nacht derselbe stumme Lärm herrschte. Um Lucy aber machte ich mir keine Sorgen. Allein, unbewaffnet, in Flipflops und trotz der Brille, die ihr einen fast besonnenen Eindruck vermittelte, traute ich ihr zu, nachts durch Viertel zu spazieren, durch die andere nicht einmal tagsüber mit dem Auto fuhren.
– Ist ja noch ein Stück bis Cinq-Avenues, hörte ich sie im Fortgehen sagen.
– Cinq-Avenues? Dort wohnst du?
Ein letztes Mal drehte sie sich zu mir um.
– Ja, Boulevard Blancarde. Hast du was dagegen?
Dann kehrte sie mir den Rücken zu und entfernte sich. Offensichtlich hatte sie sich für heute genug unterhalten.
Ich akzeptierte das. Was wäre mir auch sonst übriggeblieben? Doch es verwunderte mich zu hören, dass Lucy in solch einem gutbürgerlichen Stadtteil wohnte. Sie sah nicht aus wie eine aus Cinq-Avenues. Französische Familien waren dort zu Hause, Pensionisten, die Einkaufsroller hinter sich herzogen, Spießbürger wie mein Vater, die der Grande Nation und ihren kulturellen Errungenschaften huldigten. Wie ein kleines Stück Paris wirkte diese Gegend auf mich, weit entfernt vom Meer, weit entfernt vom Rest Marseilles, der sie umschlang. Ich bezweifelte, dass Lucy mir die Wahrheit gesagt hatte, wo sie wohnte, aber es störte mich nicht. Wir alle erzählten ja nur, was wir erzählen wollten, und glaubten, was wir bereit waren zu glauben. Ganz Marseille bastelte sich die Wirklichkeit zurecht, Tausende Wirklichkeiten nebeneinander, neue, alte, immer wieder andere. Die Stadt war voller Märchenerzähler. Die einen redeten es sich schöner, den anderen kam es schlimmer vor, als es tatsächlich war. Marseille war, was die Leute darin sehen wollten, Frankreich für die einen, Algerien für die anderen. Unwiderlegbar war nur das Meer, das in einem fort an die Küsten spülte. Endlos schön. Die Häuser und Straßen und Menschen hielten allem bloß stand, und konnten sie dies eines Tages nicht mehr tun, wurden sie durch neue ersetzt. Alles stand ständig vor dem Zusammenbruch und blickte schwermütig zurück auf vergangene, bessere Tage. Die Stadt war ein Geröllhaufen, der den Menschen, die ihn bevölkerten, Angst einjagte und sie gleichzeitig dazu nötigte, ihn zu lieben. Niemand war eingeladen worden, an diesem Hafen zu verweilen. Eher wirkte es, als hätten die Sirenen über das Meer die Einwohner hierhergelockt und dazu verdammt, auf ewig zu bleiben. Jeder fand sich damit ab und bald nicht mehr hinaus aus dem Gewirr. Wen kümmerte die Zukunft, ungreifbar, vage wie sie war? Alle waren wir mit der Gegenwart beschäftigt, mit unseren persönlichen Gegenwarten. Auch ich hatte ja begonnen, nicht über den Rand des Moments hinauszublicken und Ersatzwahrheiten einer allgemeingültigen Wahrheit vorzuziehen. Bald würde ich das Bac und die Toulets und dieses zweite Leben, in das ich hineingeschoben worden war, hinter mich gebracht haben. Danach würde ein nächstes durchgestanden werden, eine Episode nach der anderen. Eine Abfolge kleiner Geschichten war es, die täglich neu geschrieben wurden, Erzählungen, mal bessere, mal schlechtere. Lucy wohnte also in Cinq-Avenues. Soll sie!, dachte ich.
– Ciao!, rief ich ihr hinterher.
Kurz hob sie die Hand, aber sie drehte sich nicht mehr nach mir um.
4
Dass Lucy damals wirklich in Cinq-Avenues gewohnt hatte, erfuhr ich erst viele Monate später. Ein halbes Jahr war vergangen, da traf ich sie wieder, und dann erzählte sie von sich. Zufällig rannten wir auf dem Boulevard Garibaldi ineinander.
Ich hatte Lucy keineswegs vergessen, auch sie mich nicht. Oft hatte ich den Winter über an sie gedacht und mich geärgert, keine Telefonnummer von ihr zu haben. Manchmal war ich sogar zurück nach Pointe Rouge gegangen, um am Strand Ausschau nach ihr zu halten. Den Besitzer der Strandbar hatte ich wiedererkannt, Lucy aber nicht entdeckt. Einsam war ich die Corniche nach Hause spaziert, hatte auf den Mond am Wasserhorizont geblickt und mir Lucy vorgestellt. Ungeschützt war ich mir an den finsteren Flächen des Prado vorgekommen. Wie schwarze Löcher, in denen verschwinden würde, was ihnen zu nahe kam, hatten die Parkanlagen auf mich gewirkt. Ich hatte das Tempo meiner Schritte erhöht. Zum ersten Mal in meinem Leben hatte ich überlegt, ob ein Leben zu zweit mehr Sinn ergab. Ich hatte ja nie viele Freunde gehabt. Oft hatte ich mich gefragt, was das überhaupt sein würde, ein Freund, eine Freundin. Immer wieder war mir Lucy in den Sinn gekommen.
Auf dem Zebrastreifen an der Kreuzung zur Canebière, dem vielleicht belebtesten Fußgängerübergang der Stadt, liefen wir uns plötzlich in die Arme, mitten in der Hektik eines späten Nachmittags.
– François?!
– Lucy! Mon dieu!