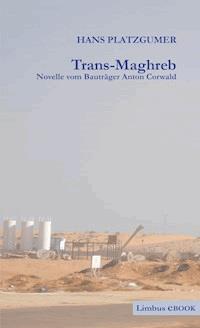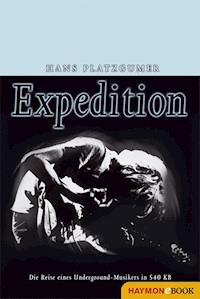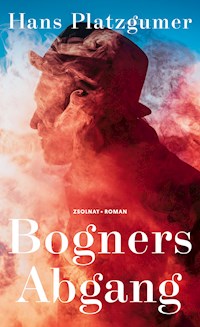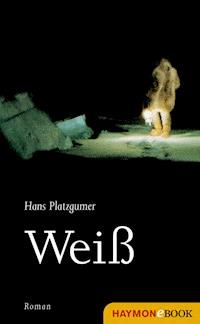Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Paul Zsolnay Verlag
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
100 Jahre nach dem Kantō-Erdbeben in Japan erzählt Hans Platzgumer von einem Machtvakuum, das politische Grabenkämpfe auslöst – aktueller denn je.
Ein Machtvakuum, das Ideologen zu nutzen wissen. Eine Naturkatastrophe, die ein Land aus den Angeln hebt. Hans Platzgumer erzählt anhand einer Epoche der japanischen Historie eine universelle Geschichte - fesselnd und fast unheimlich heutig.
Hauptmann Amakasu, strammer Diener der japanischen Geheimpolizei, blickt auf den Krieg seines Lebens zurück. Jahrzehntelang hat er im Schatten Kaiser Yoshihitos, der sich mehr für Gedichte und Pflanzen als für Politik und den Zustand seines Reichs interessierte, einen erbitterten Kampf gegen den Anarchisten und Aufrührer Sakae Ôsugi und seine Frau Itô ausgetragen. Bis das große Kantô-Erdbeben 1923 nicht nur Tokio zerstört, sondern auch politisch eine Stunde null einläutet.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 392
Veröffentlichungsjahr: 2023
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Sammlungen
Ähnliche
Über das Buch
100 Jahre nach dem Kantō-Erdbeben in Japan erzählt Hans Platzgumer von einem Machtvakuum, das politische Grabenkämpfe auslöst — aktueller denn je.Ein Machtvakuum, das Ideologen zu nutzen wissen. Eine Naturkatastrophe, die ein Land aus den Angeln hebt. Hans Platzgumer erzählt anhand einer Epoche der japanischen Historie eine universelle Geschichte — fesselnd und fast unheimlich heutig.Hauptmann Amakasu, strammer Diener der japanischen Geheimpolizei, blickt auf den Krieg seines Lebens zurück. Jahrzehntelang hat er im Schatten Kaiser Yoshihitos, der sich mehr für Gedichte und Pflanzen als für Politik und den Zustand seines Reichs interessierte, einen erbitterten Kampf gegen den Anarchisten und Aufrührer Sakae Ôsugi und seine Frau Itô ausgetragen. Bis das große Kantô-Erdbeben 1923 nicht nur Tokio zerstört, sondern auch politisch eine Stunde null einläutet.
Hans Platzgumer
大博打
Großes Spiel
Roman
Paul Zsolnay Verlag
Selbst Himmel und Erde können nichts Dauerndes schaffen, um wie viel weniger der Mensch.
Laotse, »Dao de jing«, ca 400 v. Chr.
一、
Der Chrysanthementhron
Nicht in Kaiserjahren wird heute gerechnet, sondern nach dem gregorianischen Kalender. Es ist fünf Uhr morgens. 20. August 1945. Die Sonne ist eben erst aufgegangen, irgendwo im Osten, man sieht sie nicht. Es ist ein bewölkter Tag, ziemlich warm, sechzehn Grad. Auch mitten in der Nacht ist es nicht viel kälter gewesen hier in Shinkyô.
»An mein Volk: Das Erdbeben hat uns erschüttert und verängstigt. Die Verluste sind groß. Der Wiederaufbau unserer Kultur und unseres Landes hängt nun an der Moral des gesamten Volkes. Unabhängig von gesellschaftlichem Rang oder Stellung müssen wir uns gegenseitig helfen. Ich werde mit eurer Hilfe und zu euren Gunsten über Japan herrschen. Ihr sollt euch aber bitte auch bemühen.«
Nein, der Kaiser übertrieb nicht, wenn er sagte, dass uns das Kantô-Beben erschüttert, verängstigt hat. Am 1. September 1923 bebte die Erde unter unseren Füßen. Das zwölfte Jahr Taishô, Samstag, Mittagszeit. Ohne Vorwarnung wird unsere strahlende Hauptstadt angegriffen. In den Küchen der Häuser und auf den Straßen und Plätzen bereiten die Menschen gerade das Mittagessen über offenen Feuerstellen zu. Der Boden unter ihnen klafft auf und reißt die Wände ein. Die unzähligen aus Holz errichteten Gebäude Tôkyôs entzünden sich. Minuten später fahren Böen in die Brandherde hinein und tragen die Glut überallhin. Die Stadt geht in Flammen auf. Feuerwalzen verschlingen ein Viertel nach dem anderen. Stadtteile, die von Erdrutschen und Flutwellen verschont bleiben, brennen nieder. Binnen weniger Stunden liegt die Welt, wie wir sie kannten, das Herz Nippons, in Trümmern. Beißender Rauch steht über den Weiten der Kantô-Ebene. Hunderttausend verkohlte Leichen säumen die Straßen, auf denen noch in den Morgenstunden dieses Tages die Bewohner Tôkyôs, Kawasakis und Yokohamas unbekümmert ihrer Wege gegangen sind.
22 Jahre später habe ich nun mein Todes-Haiku auf eine Papierserviette geschrieben.
Großes Spiel,
alles verloren
und ganz nackt.
»Japan ist zerstört«, sagte ich gestern in einer kurzen Ansprache zu den wenigen Mitarbeitern, die mit mir noch auf dem Gelände verblieben waren.
Vielleicht hörten sie mir gar nicht richtig zu oder gingen davon aus, dass ich, angesichts unserer hoffnungslosen Lage, den Verstand verloren hätte. Niemand widersprach, niemand stimmte zu. Nur betretenes Schweigen.
Beim Erdbeben hatten wir, die wir dafür verantwortlich waren, die Ordnung aufrechtzuerhalten, mit kaltem Kalkül reagiert. Als hätten wir die Katastrophe erwartet. Die Feuer loderten noch, und wir erkannten die Chance, die in der Zerstörung lag. Im Schatten des Zusammenbruchs hatten die Polizeieinheiten endlich freie Hand. Einem Armeeoffizier wie mir dienten die Rauchsäulen am Himmel als Deckmantel. Jahrelang hatten sich Aufrührer im ganzen Land — allen voran Sakae Ôsugi — zur Aufgabe gemacht, die Regierung zu stürzen. Nun war ihnen das Erdbeben dazwischengekommen. Ein Revolutionär nach dem anderen würde in einem namenlosen Kerker verschwinden, auch Ôsugi. Es lag an mir, Japan von ihm zu befreien. Dieser Auftrag duldete keinen Aufschub. Es war der Höhepunkt meiner Karriere. Ich war bereits zum Hauptoffizier der Armeepolizei aufgestiegen, auf meiner Polizeiuniform hatten sich Medaillen, Stecknadeln, Ehrungen, Auszeichnungen angesammelt. Nun würde ich mir endgültig die Anerkennung meiner Vorgesetzten sichern. »Militäroffizier Masahiko Amakasu«, würden sie sagen und das Haupt zu meinen Ehren senken, »Sie haben dem japanischen Volk einen unschätzbaren Dienst erwiesen.« Ich würde zum Stabsoffizier oder Generalmajor ernannt werden.
Der Moment war gekommen, Ôsugi endlich unschädlich zu machen. Auch Itô, seine Frau, konnte nicht verschont werden. Dass ich aber auch das Leben des sechsjährigen Munekazu Tachibana an sein Ende führen musste, das wurde mir zu spät bewusst. Über die Taishô-Jahre hinweg hatte sich alles hochgeschaukelt. Nun hatte ich handeln wollen, jetzt oder nie. Alles hatte auf diesen einen Moment hingezielt. Dort auf dem zertrümmerten Boden Tôkyôs entschied sich unser Schicksal, Ôsugis, Itôs, Munekazus, meines. Als Einziger habe ich überlebt. Bis heute. Doch aus den Scherben, in die Japan damals zerbrach, aus dem Ruß, der seinen Boden bedeckte, kam auch ich nie wieder hoch. Der Dreck klebt heute noch unter meinen Fingernägeln.
Gestern händigte ich die Samtsäckchen aus. Alle wussten, dass ich Edelsteine gesammelt hatte. Alle wussten diese Säckchen zu schätzen. Und jetzt, da dieser bewölkte, ziemlich warme Tag anbricht, werde ich ein solches Säckchen öffnen. Auch Mine habe ich eines in unserer Wohnung hinterlegt.
Um diese Uhrzeit ist es vollkommen ruhig auf dem Produktionsgelände. Ein dämmriges, mattes Licht dringt durchs Fenster. Kein Mensch befindet sich in meiner Nähe. Niemand stört, niemand hindert mich.
Begonnen hat alles mit dem Taishô-Kaiser. Seine Inthronisierung brachte die Dinge ins Wanken, lange bevor der Boden unter unseren Füßen aufklaffte.
»Eure Herrschaft währe tausend Generationen, achttausend Generationen, bis ein Steinchen zum Felsen wird, auf dem das Moos sprießt!«
Fast auf den Tag genau zehn Jahre vor dem großen Beben stehe ich neben meinen Kameraden auf dem sengenden Vorplatz des kaiserlichen Palasts. Ich singe inbrünstig und drücke, wie alle es tun, die Hand aufs Herz. Ich spüre, wie es schlägt, wie all unsere Herzen gemeinsam schlagen, im Takt. Ich halte die Augen geschlossen. Noch heute hallen die Echos der kaiserlichen Hofkapelle in meinem Kopf. Die Kraft dieser feierlichen Fanfaren der Gagaku. Die Hymne meines Landes. Ein Leben lang sollte sie Rhythmus, Melodie und Leitfaden für mich sein.
Es ist der Geburtstag des Kaisers. Yoshihito, wie der Eigenname des Taishô-Kaisers lautet, ist 34 Jahre jung und seit etwas mehr als einem Jahr im Amt.
»Bürgerinnen und Bürger, Soldaten der kaiserlichen Armee«, verlautet der Sprecher auf dem Podest. »Die kaiserliche Majestät wird heute seinem Volke in würdevoller Weise eine Botschaft zukommen lassen. Tragen Sie die heiligen Worte dieses feierlichen Tages für immer in Ihrem Herzen. Tragen Sie sie bis in die hintersten Winkel unseres unsterblichen Reichs hinaus!«
Sonntag, der 31. August 1913, kurz vor der größten Mittagshitze. Ich, Militärkadett Masahiko Amakasu, 22 Jahre alt, am Knie versehrt seit meinem Unfall, stehe so stramm wie möglich in meiner Uniform. Ich halte den Blick auf die Bühne und zugleich in die Zukunft gerichtet, auf die Dienstgrade der Armee, durch die ich mich trotz der Knieverletzung emporarbeiten würde. Seit Stunden exerziert die Kompanie auf dem überhitzten, staubigen Platz. Die Sonne brennt vom Himmel auf Tôkyô herab. Schweiß steht auf meiner Stirn. Mir schwindelt wie all den Kameraden auch. Kein Einziger aber würde es wagen, sich den Schweiß abzuwischen. Mit eiserner Miene stehen wir nebeneinander, die Schirmmützen ins Gesicht gezogen, unsere Lederstiefel zeichnen eine gerade Linie. Seit den frühen Morgenstunden sind wir vor der Bühne aufgereiht, die mit Chrysanthemen — den Blumen der kaiserlichen Familie — geschmückt, von samtenen Seilen umrandet und durch ein hölzernes Vordach abgeschattet ist. Im gleißenden Licht blicken wir, ohne zu blinzeln, zum Rednerpult. In Kürze wird der Kaiser erscheinen. Wir wissen, welch Ehre es ist, den Tennô, den Kaiser Japans, mit eigenen Augen zu sehen. Ganz geben wir uns diesem Augenblick hin.
Keiner wird die Stunde seiner Thronfolge stärker gefürchtet haben als Yoshihito selbst. Bis er im Alter von 32 Jahren Kaiser werden musste, hatte er in seinem Leben noch keine einzige nennenswerte Tat vollbracht. Drei Jahrzehnte lang hatte er mit gesundheitlichen Problemen zu kämpfen gehabt und nie in seiner Rolle als Kronprinz genügen können. Wie sollte er es schaffen, künftig als Kaiser die Ehre seiner Familie aufrechtzuerhalten, den Respekt des Regierungsstabs, die Sympathien des gesamten Landes zu gewinnen? Der Ausblick auf dieses bevorstehende Leben und Scheitern als Herrscher muss ihn in Panik versetzt haben. Niemand setzte Vertrauen in ihn, er selbst wohl am allerwenigsten.
Am liebsten hätte sich Yoshihito ins hinterste Zimmer des kaiserlichen Palasts zurückgezogen. Dort war er allein mit sich und seiner ausufernden Sammlung chinesischer und japanischer Gedichtbände. Er studierte sie Tag und Nacht. Wann immer Yoshihito Zeit und Muße fand, versuchte er auch selbst zu dichten. Das Verlangen, sich seine ungeerdeten Gedanken in Versform von der Seele zu schreiben, war stärker als alles andere. Wäre es nach Yoshihito gegangen, hätte sein Leben der Poesie gegolten. Doch dieses feine Baumeln seiner Seele musste ein Ende finden. Ein Kaiser hatte anderes zu erfüllen, als sich Versmaßen hinzugeben, die er mit schwelgenden Inhalten versah. Eine ausschließlich dem Thron und Volk dienende Zukunft baute sich vor Yoshihito auf.
Es ist mehr als bloß jugendliche Ungeduld, die mich überkommt, als der Kaiser zum angekündigten Zeitpunkt seines Auftritts um Punkt elf Uhr noch nicht auf dem Podium zu sehen ist. Pünktlichkeit ist eine der höchsten Tugenden. In der seit zweieinhalb Jahrtausenden andauernden heiligen Thronfolge hat sich kein japanischer Kaiser jemals verspätet. Der Taishô-Tennô ist der 123. Kaiser einer ununterbrochen herrschenden Dynastie. Von ihm wird dasselbe Verantwortungsbewusstsein erwartet wie von seinen Vorgängern. Aufgrund seiner angeborenen Göttlichkeit — er ist der erste männliche Abkömmling des Meiji-Kaisers — wurde Yoshihito für den Thron auserkoren. Nun steht die Bühne, die für ihn vorbereitet ist, seit einer Minute leer, und ich merke, wie sich auch in den Reihen um mich herum Verwunderung ausbreitet. Ich weiß: Kein Irdischer hat das Recht, den Tennô in Zweifel zu ziehen. Gottgleich ist der Kaiser. Was immer geschieht, wir dürfen uns kein Urteil über ihn anmaßen. Doch innerlich ringe ich mit mir.
Bislang ist es mir gelungen, den Gerüchten keinen Glauben zu schenken, die in einigen Regimentern bereits die Runde machen. Womöglich befinde sich der neue Kaiser weder in der körperlichen noch geistigen Verfassung, heißt es, um unser Land mit der Herrlichkeit weiterzuführen, die seine Vorgänger ausstrahlten. Von Unzulänglichkeit wird gemunkelt. Von Yoshihitos weichem Gemüt. Ich wollte nie ein Wort darüber hören. In diesem feierlichen Moment erneuere ich den Schwur, den alle geleistet haben, niemals die Loyalität zum Kaiser in Frage zu stellen. Jeder von uns Infanteristen, die wir in kerzengeraden Kolonnen in der flimmernden Luft vor dem Palast stehen, würde, ohne mit der Wimper zu zucken, sein Leben für ihn geben. Und trotzdem, während wir warten, den Kaiser erwarten, eine Minute länger als gedacht, zwei Minuten, drei, da erfasst mich eine düstere Ahnung. Unerträglich dehnt sich die Zeit. Beinahe vier Minuten nach elf ist es bereits, und noch immer ist der Kaiser nicht zu sehen!
Natürlich hatte Yoshihito in Gakushûin studiert. Alle Mitglieder der Kaiserfamilie wurden dorthin geschickt. Die Ausbildung hatte zum Ziel, diesen Jungen, den der große Meiji-Tennô Mutsuhito mit seiner Lieblingskonkubine gezeugt hatte, zu seinem würdigen Nachfolger zu formen. Sofort nach der Geburt war das Kind der Mutter entrissen und niemals wieder mit ihr in Kontakt gebracht worden. Yoshihito war der Sohn des Kaisers, nicht der der Liebesgespielin, weder Bastard noch gewöhnliches Kind, sondern dazu auserkoren, der zukünftige Kaiser zu sein. Der Titel Prinz Haru war ihm gegeben worden. Er hatte ein wahrer Herrscher zu werden, wie seine Vorfahren es gewesen waren. Der Hof setzte alles daran, wieder und wieder. Die Kaiserfamilie versuchte alles Menschenmögliche. Doch es genügte nicht. Yoshihito wuchs heran, aber in seine Rolle nicht hinein. Als hätte er es nicht ernst genommen, sein Leben, seinen Auftrag. Wie er auch als Erwachsener nichts ernst zu nehmen schien, an Rednerpulten Zeit verplemperte oder wie ein Tagträumer auf dem Thron lümmelte, so verhielt es sich mit ihm bereits als Kind.
Um 11 Uhr 5 werde ich endlich erlöst. Yoshihito erscheint in seiner kaiserlichen Uniform auf dem Podest. Wir Kadetten halten die Luft an und salutieren. Vergessen sind die Verunsicherung und all die Zweifel, die aufgekommen waren. Augenblicklich werden wir von militärischem Gehorsam erfasst. Wir bilden einen gemeinsamen Körper, eine kaiserliche Armee. Wir sind Bestandteile des seit jeher funktionierenden Apparats. Jeder Rekrut kennt seine Aufgabe. Jedes Glied in der Kette weiß, was zu tun ist. Jede Bewegung, jede Geste drückt die Bewunderung aus, die wir für das Vaterland empfinden. Ein Schauer fährt mir den Rücken hinab angesichts der vollendeten Synchronisation, mit der wir die Finger an die Schläfe führen, die Augen zusammenkneifen und in ein und derselben Sekunde die Hacken unserer Stiefel gegeneinanderschlagen. Es ist ein erhebendes Gefühl, Baustein dieser Herrlichkeit zu sein, Teil dieses Schauspiels, dieses Ausdrucks größtmöglicher Macht. Tief versteckt in mir aber habe ich zum ersten Mal eine Verwirrung erfahren. Ein Urvertrauen ist mit der Verspätung des Kaisers erschüttert worden. Der Schliff, die Präzision, die Vollkommenheit, die seit Anbeginn der Zeit Japan auszeichnen, sind ein Stück weit abhandengekommen. Mein Leben ist diesem Land und seinem Kaiser gewidmet. Doch mit dem jetzigen Auftauchen Yoshihitos auf dem Podest — es ist das erste und letzte Mal, dass ich ihn leibhaftig zu Gesicht bekomme — muss ich erkennen, dass die Bedenken, die ihm vorauseilten, eine Berechtigung zu haben scheinen.
Nicht würdevoll durchschreitet der Kaiser die festliche Bühne, er nähert sich dem Rednerpult eher mit wackeligen Beinen, als wäre er durch Krankheit oder Nervosität geschwächt. Gefolgsleute begleiten ihn, umringen ihn zu allen Seiten. Inmitten dieser Begleiter ist der gottgleiche Kaiser eine zarte Figur. Bei allem zeremoniellen Prunk, mit dem er umgeben und geschmückt ist; bei aller Hingabe, mit der er sich bewegt; den dutzenden Abzeichen und Medaillen zum Trotz, die seine Uniform verzieren und im Licht des Sommertages glänzen; fast unscheinbar wirkt Yoshihito. Als himmlische Erscheinung haben wir erwartet, ihn zu Gesicht zu bekommen, nun aber macht es den Eindruck, als würde er sich in seiner am königlichen Hof geschneiderten Festtagsuniform verstecken. Eine bis ins kleinste Detail prächtig ausgearbeitete Kleidung. Doch der mit sechs goldenen Bändern, einer mächtigen Brosche und einem weißen Federnstrauß geschmückte Hut wirkt zu groß für seinen Kopf. Auch die steife Jacke und die Hose, selbst die weißen Lederhandschuhe füllt der Kaiser nicht aus. Während die Augen seiner Streitkräfte auf ihn gerichtet sind und Yoshihito das Rednerpult ansteuert, zieht er sich wie ein Meer zur Ebbe in sich selbst zurück. Als würde die Last all der Dekoration, die seine Uniform übersät, ihn erdrücken. Der Behang aus Schnallen, Spangen, Broschen, Bruststernen, Emblemen, Verdienstzeichen, Quasten, Moiré-Bändern, Ärmelschleifen und geschwungenen Ordensketten. Die Schulterstücke und Gürtel. Die silbernen Tressen, Borten und vergoldeten Manschetten. Der blitzende Säbel, den er an der Hüfte trägt. Unsicher müht sich der Kaiser an das Pult heran, als wäre jeder Schritt eine Zumutung.
Irgendwann ist er am vorderen Bühnenrand angekommen. Jetzt wird der Kaiser die Stimme erheben und zu uns sprechen. Doch bevor Yoshihito das Papier entrollt, von dem er seine Ansprache abzulesen hat, verschnauft er. Wieder verstreichen Minuten. Yoshihito steht tatenlos am Rednerpult, geistesabwesend blickt er ins Leere. Die Papierrolle in seiner Hand scheint er völlig zu vergessen. Ich bin versucht, den Kameraden, der in meiner Reihe neben mir steht, heimlich anzustupsen, ob er diesen seltsam ereignislosen Auftritt des Kaisers ähnlich wie ich erlebt. Doch ich beherrsche mich und lasse mir nicht anmerken, wie erstaunt ich bin.
Yoshihitos Lehrer stellten Rückstände in allen Disziplinen fest. Je mehr Leistungen sie von dem jungen Thronfolger einforderten, desto mehr versperrte er sich. Krank lag er im Bett, fiebernd, wochenlang abgesondert von der Welt. War er zurück auf der Schulbank, verweigerte er, was an ihn herangetragen wurde — wenn auch nicht mit Absicht. Denn bei klarem Bewusstsein schien Yoshihito seit seiner Geburt nie gewesen zu sein, und eine Hirnhautentzündung im Kindesalter hatte ihn zusätzlich und dauerhaft geschwächt. Versuchte man ihm ohne Druck die nötige Ernsthaftigkeit nahezulegen, verpuffte dieses Unterfangen im Nichts. Zwang man ihn dazu, seinen Mann zu stehen, zerbrach er unter den Erwartungen. Wie man auch versuchte, ihr Herr zu werden, Yoshihitos Lernschwäche offenbarte sich in allen Bereichen. Es würde nicht lang dauern, da verzweifelte nicht bloß die Kaiserfamilie an dem unvermögenden Thronfolger, sondern auch seine Untergebenen, das Militär. Auch dem Volk und den politischen Feinden würde die mentale und körperliche Schwäche dieses Führers auf Dauer kaum zu verheimlichen sein.
In denselben Jahren wuchs in Shibata, nahe Fukushima, Sakae Ôsugi heran. Niemand in Tôkyô wusste von ihm. Niemand dachte daran, dass dieser Balg eines Tages ein landesweit bekannter Staatsfeind sein und danach streben würde, die Schwachstellen auszunutzen, die durch den unzulänglich besetzten Thron entstehen mussten. Dissidenten wie er würden sich formieren. Sie führten im Sinn, das Land von Grund auf umzukrempeln, und ein närrischer Kaiser, wie Yoshihito es sein würde, bereitete ihnen den Boden.
Noch aber waren sowohl Ôsugi wie auch Yoshihito jung, formbar, wie man hoffte. Noch saß Yoshihitos Vater auf dem Thron und regierte ein rechtschaffenes Land mit unumstößlichen Traditionen. Der fünf Jahre nach Yoshihito und sechs Jahre vor mir geborene Ôsugi war ein unbekanntes Gesicht im tief verschneiten Norden, fern der Hauptstadt, ohne Stellenwert, ein Punkt in der Ewigkeit. Und im kaiserlichen Palast vertraute man darauf, dass sich die Unzulänglichkeiten des jungen Thronfolgers geben würden, wenn Yoshihito im Erwachsenenalter endlich zu sich finden würde.
Doch was sich in der Jugend nicht formt, fügt sich auch später nicht zusammen. Im Grunde zeigt der Mensch bereits in frühen Jahren, wozu er fähig ist und wozu nicht. Zu dieser Überzeugung bin ich gekommen. Was Yoshihito von Anfang an war, ein weltentrückter Zärtling, er würde es bis an sein Lebensende bleiben. Auch ich selbst hielt fast ein Leben lang an früh gewonnenen Idealen fest. Trotz allem, was geschah. Nun sitze ich im Ledersessel in Shinkyô, und auf dem Schreibtisch vor mir liegt die beschriebene Papierserviette. Ähnlich Ôsugi. Bis zu allerletzt war die ihm eigene, destruktive Energie nicht zu bändigen. Wir hätten ihn in den Tod foltern können, nie hätte er die Überzeugungen verraten, die er sich in der Jugend angeeignet hatte.
So verhielt es sich auch mit seinem Stottern. Wie Ôsugi die krankhafte Lust am gesellschaftlichen Umbruch nie aufgeben konnte, so begleitete ihn das Stottern bis in den Tod. So weit zurück ich mich erinnere, schrieb er in seinen Memoiren, immer stotterte ich.
Ôsugi war — zu Recht — überzeugt davon, dass ihn wegen seiner politischen Gesinnung ein früher Tod ereilen würde. Deshalb begann er ab dem dreißigsten Lebensjahr, eine Autobiografie zu verfassen. Er konnte sich mündlich nur schlecht artikulieren, also schrieb er auf, was ihm wesentlich erschien. Unzählige Texte brachte er zu Papier, nie aber stellte er fertig, was er schrieb. Seine politischen und theoretischen Schriften blieben Stückwerk, auch die biografischen Aufzeichnungen vollendete er nicht. Das passte zu ihm. Ôsugi hatte keine Angst vor offenen Enden. Er sah die politische Arbeit als endlosen Prozess. Alles musste unaufhörlich nachjustiert und an die Gegebenheiten angepasst werden. Alles eine immerwährende Abfolge kleiner Schritte, die sich mitunter auch im Kreis drehen konnten und logischerweise über die eigene Existenz hinausgehen würden. Als er schließlich an sein Ende kam, hatte Ôsugi viel und doch nichts erreicht. Vielleicht lässt sich das über uns alle am Ende unseres Lebens sagen? Ôsugis Texte blieben skizzenhaft. Viele der Episoden, die er teils zusammenhanglos aus seinem Leben erzählte, waren mir jedoch nützlich, als ich seine Verfolgung aufnahm. Über sie bekam ich einen Eindruck von der Persönlichkeit dieses Mannes, der mir — ich gebe es zu — bei allem Ärger, den er mir bereitete, auch imponierte.
Mutter schlug mich mit der Bambusrute, wenn ich stotterte, aber das machte es nicht besser. Auch in der Schule wurde ich von den Lehrern jeden Tag für mein respektloses Stottern bestraft, als würde ich es absichtlich tun. Überhaupt wurde ich durchgehend diszipliniert für Dinge, die ich getan oder nicht getan hatte. Wenn Mutter mich nicht schlug, schrie sie mich an. Sie hatte eine furchtbar laute Stimme, und wenn sie mich züchtigte, steigerte sich ihr Stimmvolumen sogar.
»Schon wieder stotterst du!«, schrie sie auf mich ein.
Sie war stets von großer Ungeduld erfasst, und mein »D-d-d-d…« verstärkte ihren Jähzorn. Mit nackten Händen schlug sie mir auf beide Ohren, sodass ich eine Weile nichts mehr als einen penetranten Summton hörte.
»Du stotterst, du stotterst, du stotterst!«, brüllte sie über diesen hinweg. »Bring mir den Besenstiel!«
Mir blieb keine Wahl, als zu gehorchen und ihr das Werkzeug zu bringen, mit dem sie auf meinen Rücken, mein Hinterteil und auch meine ausgestreckten Arme einschlagen würde. Dass ich selbst ihr das Instrument reichte, mit dem sie mich quälte, erhöhte ihre Rage noch. Wie dumm von mir! Was für ein missratender Wurm ich war! Jedes Wort, das ich nicht richtig artikulierte, versuchte sie aus mir Kreatur hinauszuprügeln. Sie war die Frau eines Armeesoldaten. Sie kannte es nicht anders. Und ich war der Sohn eines Armeesoldaten. Die Schläge waren Teil meines Lebens. Ich würde sie ertragen, ohne auch nur eine Träne zu vergießen oder auch nur einmal um Erbarmen zu betteln.
Mein Vater wiederum schlug mich weder, weil ich stotterte, noch sonst aus einem Grund. Er war nur sonntags zu Hause, und an diesem Tag erwartete er eine ruhige, friedliche Familie und eine gute Schale Reis. Kein Streit, keine Schreie, keine Schläge waren erlaubt. Selbst meine Mutter musste ihre Stimme zügeln. Es fiel ihr schwer. Der Sonntag musste für sie der anstrengendste Tag der Woche gewesen sein. Sie zog sich zurück und gab sich ganz der Hausarbeit hin. War der Reis, den sie auftischte, etwas zu wenig gekocht, entschuldigte sie sich unaufhörlich.
»Ich weiß nicht, wie mir das passieren konnte«, jammerte sie.
»Nein, nein, er ist gut«, sagte Vater. »Er schmeckt vorzüglich, nicht wahr, Sakae?«
»Hai!«, antwortete ich und nickte und schaufelte meine Schale leer.
Montagfrüh, noch bevor der Morgen graute, würde Vater wieder in die Kaserne einrücken und Mutter erneut das Regiment in unserem Haus übernehmen.
Je älter und widerwilliger ich wurde, desto schärfer wurden Mutters Strafmaßnahmen. Eines Tages fesselten sie und die Dienstmagd mich an Händen und Füßen und stellten mich an die Wand. Dann schlugen beide Frauen mit Bambusruten und Händen schimpfend auf mich ein, weil ich mich zuvor, in Mutters Abwesenheit, der Magd gegenüber nicht respektvoll genug benommen hatte. Ich ließ es über mich ergehen. Kaum Schmerzen oder Wut verspürte ich, später ein wenig Genugtuung, als die beiden nach keiner Viertelstunde von mir abließen und jammerten, dass ihnen die Finger wehtaten.
Trotz alldem mochte ich meine Mutter. Durch sie lernte ich, Schmerzen und Qualen zu ertragen, was mir in meinem späteren Leben sehr nützlich wurde. Ich vermisste Mutter und ihre Eigenarten sogar, als ich zur Kadettenschule in Nagoya einrückte. Das Leben dort war härter als zu Hause und ebenso die Strafen, die ich für mein Stottern aufgebrummt bekam. Dort versuchte man es mir durch Zwangsarbeiten, Einzelhaft oder Essensrationierungen auszutreiben. Auch das war eine gute Vorbereitung auf meine Zukunft mit all den Inhaftierungen.
Hauptmann Kitagawa hatte es besonders auf mich abgesehen. Wann immer der Mond in seiner abnehmenden Phase — »kagen« — war, würde er mich im Klassenzimmer aufstehen lassen.
»Ôsugi!«, brüllte er, und ich wusste, welche Frage kommen würde: »In welcher Phase befindet sich der Mond gerade?«
Silben mit K und T sind am schwierigsten auszusprechen, das weiß jeder Stotterer. Besonders wenn einem »ka« ein »ge« folgte und vor versammelter Klasse Druck aufgebaut wurde, war es mir praktisch unmöglich, ein derartiges Wort über die Lippen zu bringen. Mir blieb nur eine mögliche Antwort:
»Der Mond befindet sich nicht in seiner zunehmenden Phase, Herr Hauptmann.«
»In welcher Phase befindet er sich dann?«
»Er befindet sich nicht in seiner zunehmenden Phase, Herr Hauptmann.«
»Wie nennen wir die Phase, in der er sich befindet, Ôsugi?«
»Es ist nicht seine zunehmende Phase, Herr Hauptmann.«
Es dauerte nicht lang, bis ihm die Geduld riss. Er schlug mit dem Stock mit voller Wucht auf meinen Rücken und brüllte: »Es reicht, Ôsugi! 24 Stunden Einzelhaft, dann kommen Sie vielleicht auf bessere Ideen. Melden Sie sich unverzüglich beim diensthabenden Offizier. Abtreten!«
Die gesamte Klasse salutierte, als er mit diesem Befehl wutentbrannt das Klassenzimmer verließ. Niemand wagte es, mich anzublicken. Mein Rücken brannte.
Hauptmann Kitagawa war deutlich kräftiger als meine Mutter. Er bereitete mich vorzüglich auf mein zukünftiges Leben vor.
Ôsugis zukünftiges Leben, das er zu großen Teilen in staatlichen Haftanstalten verbringen sollte. Knapp sechs Jahre saß er insgesamt hinter Gittern. Anstiftung zu öffentlichem Aufruhr. Verstöße gegen die Pressevorschriften oder das Versammlungsverbot. Gefährdung der öffentlichen Ordnung. Verletzung des Friedens-Erhaltungs-Gesetzes. Behinderung von Beamten. Wiederholte Rote-Flaggen-Vorkommnisse. Verbotene Zeitschriften, Flugblätter, unerlaubte Zeitungsartikel, aufwieglerische Reden. Es blieb uns nichts übrig, als ihn wieder und wieder ins Gefängnis zu stecken.
Vorerst aber stehe ich als junger Militärkadett an jenem hitzeschweren Sonntag im August 1913 auf dem Vorplatz des kaiserlichen Palasts und warte, bis der Kaiser auf dem Podest endlich mit der Rede beginnt, die er zu Ehren seines 34. Geburtstags zu halten gedenkt. Zögerlich findet er aus dem Loch in der Zeit, in dem er sich verloren hat, zurück in die Wirklichkeit. Die Papierrolle hält er nach wie vor wie einen Fremdkörper in der Hand.
Nach einer Weile schafft es Yoshihito, seine Sinne zu sammeln. Kurz taumelt er, hält sich am Rednerpult fest, vielleicht weil ihn ähnlich wie uns, die wir seit Stunden in der Hitze stehen, ein Schwindel überkommt. Dann gelangt er zurück in Raum und Zeit. Bedächtig entrollt Yoshihito das Papier. Räuspert sich. Jetzt wird unser Warten belohnt, hoffe ich. Endlich wird Yoshihito das Wort an uns, das Heer ihm treu ergebener Soldaten, richten.
Doch anstatt zu reden bläst der Kaiser nur sachte in das Kohlemikrofon vor ihm, als würde er einen Kuss über den Vorplatz schicken. Er ist erstaunt über das unerwartete Geräusch aus den Lautsprechern. Damit hätte er nicht gerechnet, wie dieser Klang über unsere Köpfe und unser gebanntes Schweigen hinweggetragen wird. Erst weit hinten verliert er sich. Mehrfach wiederholt Yoshihito das effektvolle Hauchen. Testet die unterschiedlichen Möglichkeiten der Klangerzeugung. Haucht kurz und lang, hoch und tief, laut und leise ins Mikrofon, kann nicht genug davon bekommen. Verzückt und mit absonderlichen Gesten kommuniziert der Kaiser mit uns oder der Luft in einer universellen Sprache — womöglich jener der Liebe zur Natur und all ihren Geschöpfen. Niemand unterbricht ihn, niemand hält ihn davon ab, alle möglichen Geräusche durch die Lautsprecheranlage zu schicken. Yoshihito lächelt beglückt. Auch wir sind nahe daran zu lächeln. Es bedarf großer Selbstbeherrschung, ernst zu bleiben. Vielleicht ist es ein Test? Ein Spiel, das sich der Kaiser mit uns erlaubt?
Selbst als gebildete Japaner sind wir es gewohnt, den Reden und Schriften eines Kaisers nicht detailgetreu folgen zu können, denn die kaiserliche Familie pflegt eine derart gehobene Sprache, dass nur wenige Gelehrte in der Lage sind, sie zu verstehen. Wenn ein Kaiser zu seinem Volk spricht, kann dieses Volk das Gesagte höchstens symbolhaft deuten. Nur wenige Wörter des kaiserlichen Repertoires sind für gewöhnliche Menschen verständlich. Die niederen Gesellschaftsschichten besitzen kein nur annähernd ausreichendes Vokabular und Sprachbewusstsein, um die Wort- und Satzgebilde zu durchleuchten, mit denen sich ein Kaiser ausdrückt. Für sie ist es, als würde der Kaiser Japans seine Reden in einer Fremdsprache halten. Das aber spielt keine Rolle, es geht um die Geste. Der Kaiser lässt sich dazu herab, zu gegebenen Anlässen zu seinem Volk zu sprechen. Ob dieses ihn verstehen kann oder nicht, ist nebensächlich. Der Taishô-Kaiser vor uns vereitelt nun zu Beginn seiner Rede selbst uns akademisch geschulten Militärkadetten jede Chance, seinen Wörtern nachzuspüren. Statt zu reden, erfreut er sich daran, wie sein Atem, den er mit Grimassen und in unterschiedlichen Positionen ans Mikrofon führt, aus den Lautsprechern schallt. Sein Gebärden trifft uns unvorbereitet. Jeder Anwesende ist befremdet. Nicht ein Einziger aber verzieht das Gesicht oder wagt, auf das Tun des Kaisers zu reagieren. Denn würde er dabei ertappt werden, wie er den Mund zu einem verstohlenen Lächeln verzieht oder durch verminderte Körperspannung Ungeduld andeutet, ohne Zweifel würde er noch am selben Tag aus der Armee entlassen werden.
Im Alter von zwanzig Jahren war Yoshihito mit der fünf Jahre jüngeren Sadako Kujô verheiratet worden. Dieses Mädchen stammte aus aristokratischen Verhältnissen, aber ihr Vater, ein Mann des Ziviladels, hatte es einer Landfamilie zur Pflege gegeben. Sadako hatte eine naturverbundene Kindheit genossen und war als »wildes Mädchen« aufgewachsen. Im Gegensatz zur noblen Blässe der Adeligen war sie braungebrannt und kerngesund, als sie, dank der Beziehungen ihres Vaters, der am Herrenhaus des Reichstags tätig war, in Gakushûin eingeschult wurde. Yoshihito besuchte dasselbe Haus. Während er die Schulzeit leidend hinter sich brachte, machte nebenan im Mädchentrakt Sadako von sich reden, nicht nur wegen ihrer auffallend guten körperlichen Verfassung und dunklen Hautfarbe, auch weil sie außerordentliche Freude am Lernen zeigte. Besonders die naturwissenschaftlichen Fächer machten ihr Spaß.
»Die kleine Sadako scheint alles umarmen zu wollen, was sie noch nicht kennt«, berichtete ihr Biologieprofessor den Beratern der kaiserlichen Familie, als sich diese nach möglichen Ehefrauen für den Kronprinzen erkundigten. »Ihr Interesse an der Natur ist unbändig. Freiwillig nimmt sie sogar Zusatzarbeiten wie das Katalogisieren lokaler Schmetterlingsarten auf sich.«
Der Professor zeigte den Beratern Zeichnungen von Insekten und Blüten, die Sadako in ihrer Freizeit anfertigte. Doch nicht bloß Sadakos Eifer und ihre Naturverbundenheit gaben den Ausschlag, sie als Gattin auszuwählen, vor allem waren es die Sanftmut und unerschöpfliche Geduld, die der Professor hervorhob. Er beschrieb, wie uneigennützig sich Sadako um Mitschülerinnen kümmerte, die Probleme in der Schule hatten. Sie zeigte Verständnis für die Schwächen anderer und wurde nicht müde, ihre Umgebung zu unterstützen.
»Ohne Zweifel wird sie sich mit gleicher Ausdauer und Liebe um ihren Gatten kümmern.«
Irgendwann hält Yoshihito inne. Er blickt auf uns herab, als würde er uns erst jetzt zur Kenntnis nehmen. Er erinnert sich der Papierrolle in seiner Hand, wendet sich ihr zu und beginnt mit gebrechlicher Stimme wiederzugeben, was er darauf entdeckt.
»Chin spricht zu euch«, sagt er. »Mein Volk, mein Heer, meine Untergebenen, getreuer Körper unseres in die Unendlichkeit strahlenden Landes.«
Ob Yoshihito vom Manuskript abliest oder frei rezitiert, ist nicht ersichtlich. Rein akustisch können wir ohnehin kaum ausmachen, was er spricht. Nicht nur flüstert er beinahe, auch gehen sein Kopf und sein gesamter Körper, sobald Yoshihito zu sprechen beginnt, in ein Schwanken über, wodurch manches, was er von sich gibt, zwar ins Mikrofon trifft, das meiste aber daneben landet. Ganze Passagen dringen nicht durch, nur unzusammenhängende Fetzen von Yoshihitos vielleicht eine Viertelstunde dauernder Rede verstehen wir.
»Das Land erblüht wie eine Knospe im Frühjahr«, meine ich den Kaiser sagen zu hören, »wenn die Seele seines ehrerbietenden Volkes sich als im Vollbesitze ihrer Kräfte und strotzend von heiterer Vitalität erweist.«
Auch wenn ich wenig Ahnung habe, wovon der Kaiser spricht und warum er sich mitten in der größten Sommerhitze frühjährlicher Metaphern bedient, so fühle ich mich dennoch angesprochen. Meinen Kameraden ergeht es ebenso.
»Der Geist als innerster Zusammenhalt des auserwählten Volkes, seine Tugenden und kulturellen Errungenschaften müssen immerzu gehuldigt und gefördert werden. Ein Staat kommt nicht umhin, sowohl die kleinsten Einheiten seiner Bürger als auch die zwingenden Formationen seiner Heere, die der Verbreitung der japanischen Rasse verpflichteten Familienverbände einerseits, welche unsere Kultur als Erbgut durch die Generationen tragen, die redlichen Dorfgemeinschaften und tüchtigen Verwaltungsabteilungen andererseits, all die großen und minderen Gruppierungen und Truppen der dem Wohle der Gemeinschaft Verpflichteten wie auch, selbstredend, die übergeordneten Instrumente seiner Machtstruktur auf einem väterlichen Schoße zu vereinen, will er seine vervollkommneten Kräfte zu jedweder Stunde des leuchtenden Tages oder der Schutz gebietenden Nacht in jedem Wimpernschlag und jeder Faser seines mannigfaltigen Gebildes und unverwerflichen Gemüts gebündelt wissen.«
Einige Wochen lang wurde Sadako beobachtet. Als sich all die Empfehlungen bestätigten, besprachen die Anwälte des kaiserlichen Hofs mit ihrem Vater die Formalitäten. Sadako war noch keine vierzehn Jahre alt, da wurde sie eines Tages nach dem Unterricht ins Direktionszimmer Gakushûins bestellt. Im Beisein ihres Vaters wurde ihr mitgeteilt, dass sie die Ehefrau des Kronprinzen werden solle. Sadako verstand es, ihre Überraschung zu verbergen. Nichts als ein unscheinbares Lächeln huschte über ihre Lippen. Ob sie sich bewusst sei, was dies bedeute?, wurde sie gefragt. Ob sie sich dieser Aufgabe gewachsen fühle?
»Durchaus. Selbstverständlich. Ich werde mein Bestes geben«, sagte Sadako, und ihre Augen leuchteten.
Wochenlang diskutierten wir nächtens im Schlafsaal der Kaserne die Rede des Kaisers und versuchten im Nachhinein, das bruchstückhaft Verstandene wie ein Legespiel zusammenzusetzen. »Tendenzen oberflächlicher, vergänglicher Pracht«, meinte einer verstanden zu habe. »Manneszucht«, der andere. Wieder ein anderer erinnerte: »Weisheit und Moral, unabhängig von gesellschaftlichem Rang.« Oder: »Die Wege gemeinschaftlicher Harmonie, welche es zu erhellen gilt.« Auch die Worte »Bescheidenheit« und »Mut« wurden mehrfach zitiert. Dass der Kaiser sich bemühen wollte, ein redlicher Vater für alle zu sein, meinte ich herausgehört zu haben und ebenso, dass der Kaiser es als seine Pflicht verstünde, zum Wohl aller Japaner das Zepter zu führen.
»Auch wir, jedes einzelne Glied im mächtigen Reich, dürften nicht aufhören, uns über die Grenzen der Belastbarkeit hinaus zu bemühen, hat er gesagt«, behauptete ein Kamerad.
Letztendlich konnte es jeder auslegen, wie er wollte, denn ab der Hälfte seiner Rede hatte Yoshihito den Kopf ganz dem Mikrofon abgewandt und nur mehr zur Seitenwand der Bühne nuschelnd weitergesprochen. Immer größere Lücken durchzogen seine Rede. Im Gebälk hatte er ein Schwalbennest entdeckt, das er nun genauer studierte als sein Lesemanuskript. Er fuhr zwar fort zu sprechen, aber was er sagte und ob es an uns oder an die Schwalben gerichtet war, war nicht länger auszumachen.
Unverhofft flatterte Minuten später ein junger Vogel aus dem Nest heraus und segelte durch den Dachstuhl. Das Tier ließ sich auf einem Balken nieder und setzte nach einer kurzen Pause seinen Flug fort. Mit vorsichtigen Schwüngen wagte es sich aus dem schützenden Schatten hinaus in die Weite des strahlenden Sommerhimmels. Diese junge Schwalbe versetzte Yoshihito in ein derartiges Entzücken, dass er immer mehr ins Stocken geriet und schließlich ganz verstummte. Seine Ansprache war beendet.
Es war Sadakos Aufgabe, den kränklichen Ehemann in allen Belangen zu unterstützen, ihn zu stärken, ihm Standfestigkeit, Selbstsicherheit und gesunde Söhne zu geben. Yoshihito sollte durch sie Bodenhaftung finden, aus den Lüften, durch die er bisweilen wie eine Himmelslaterne trieb, zurück auf den Boden der Realität gelangen. Sadako nahm ihre Rolle an. Mit Hingabe widmete sie sich ihrem Gatten, geduldig, aufopfernd, liebevoll, zärtlich. Sie nahm ihn in seinen Bedürfnissen ernst. Sie ließ ihn dichten, fantasieren, sprechen oder schweigen, so lange er wollte. Sie zeigte ihm Wertschätzung für alles, was er tat. Er durfte sich an ihren Brüsten ausweinen und sie beschnuppern, bestaunen, bewundern, berühren, wie es ihm beliebte.
Yoshihito verfiel Sadako und ihrer Natürlichkeit. In den Jahren seiner Thronanwärterschaft klammerte er sich richtiggehend an sie. Er hielt sich an Sadakos Hand fest, wie ein Kind die Hand seiner Mutter hält und sich weigert, sie jemals wieder loszulassen. Sein Leben lang würde Yoshihito keine andere Frau begehren und sich keinem Menschen je so öffnen wie ihr. Später als Kaiser entschied er sogar, was kein Tennô je vor ihm getan hatte, mit seiner Gattin ein monogames Leben zu führen — eine seiner vielen ungewöhnlichen Ideen.
Schweigend stand er noch eine Weile vor uns. Dann nickte der Kaiser. Ob er uns, den Schwalben, sich selbst oder seinen Gefolgsleuten zunickte, war nicht ersichtlich. Er drehte sich wortlos um und verließ den Schauplatz ähnlich fahrig, wie er aufgetreten war. Seine Entourage umringte ihn erneut und half ihm, von der Bühne zu steigen. Die kaiserliche Kapelle stimmte noch einmal die Nationalhymne an.
»Achttausend Generationen, bis ein Steinchen zum Felsen wird, auf dem das Moos sprießt«, sangen wir feierlich.
Danach wurde uns Befehl gegeben, den brütend heißen Vorplatz strammen Schrittes zu verlassen.
二、
Taishô Romantica
Endlich war der Tag gekommen, da meine Zeit abgesessen war. Über ein Jahr in der Ichigaya-Haftanstalt in Tôkyô und danach noch die endlosen Monate in Chiba, wohin ich überstellt worden war. Es hatte sich auf meine Psyche ausgewirkt, auch wenn ich alles unternommen hatte, um meine Zeit hinter Gittern so sinnvoll wie möglich zu gestalten. Ich trottete dem Wärter, der mir mittlerweile vertrauter war als meine eigene Familie, durch den langen Flur des Gefängnistrakts hinterher, als hätte ich es nicht eilig. Er brachte mich an das große Tor des Gefangenenhauses.
»Auf Wiedersehen!«, sagte er mit ironischem Unterton und schob das Eisentor für mich auf.
Ich nickte ihm zu und trat zögerlich auf die Straße hinaus in die Freiheit.
Ein paar Genossen erwarteten mich. Auf der Heimfahrt wollte ich ihnen sogleich von meinen Erlebnissen in Haft erzählen, aber ich schaffte es kaum, fünf ordentliche Wörter über die Lippen zu bringen. Zwei Jahre lang hatte ich fast nicht gesprochen. So wie es mir zunehmend schwergefallen war, Tag und Nacht auseinanderzuhalten, war es immer schwieriger geworden zu unterscheiden, ob mir die vielen Gedanken, die ich verfolgte, bloß still durch den Kopf gingen, oder ob ich Fetzen von ihnen laut wiedergab. Mein Stottern hatte sich durch all diese Verwirrung verschlimmert. Ich war mir dessen nicht bewusst gewesen, aber jetzt, da ich mich mit alten Freunden unterhalten wollte, bemerkte ich es. Mehr als Stottern war es nun, ich war in eine vollkommene Unfähigkeit zur Kommunikation gerutscht. Es dauerte einen Monat, bis ich durch beharrliche Übung und Konzentration der Sprachlosigkeit wieder einigermaßen Herr wurde. Einen Monat lang trug ich, zu Hause und unterwegs, Stift und Papier mit mir, um schriftlich mit meinen Mitmenschen zu kommunizieren. Stumm war ich geworden. Als ein Domori, ein Sprachbehinderter, hatte ich das Gefängnis betreten; hinter seinen Mauern war mir die Sprache ganz abhandengekommen.
Meine Freunde gewöhnten sich bald daran, dass ich während unserer holprigen Konversationen aufschrieb, was ich nicht über die Lippen brachte. Leute, die mich nicht kannten, gingen davon aus, dass ich auch taub sein musste. Sie schrieben auf, was sie mir sagen wollten. Zögerlich und ein wenig beschämt reichten sie mir die Zettel.
Unzählige Male habe ich Ôsugis biografische Schriften gelesen, wieder und wieder seinen Werdegang studiert. Wie konnte in einem intelligenten Menschen so viel Widerwille gegen seine Kultur entstehen?
Sakae Ôsugi, 1885 in Shikoku als erster Sohn eines hohen Militärs geboren. Zwei jüngere Brüder, drei Schwestern. In der Echigo-Provinz, wo der Schnee das Land begrub und die Zeit stillstand, verbrachte er seine Kindheit. Dorthin ins Nichts war sein Vater, ein berittener Militärleutnant und ein Stotterer wie Ôsugi selbst, versetzt geworden.
Hat die Schande des beim Militär gescheiterten Vaters den Trotz des Sohns hervorgebracht? Oder war die Tatsache, dass Ôsugi im Alter von siebzehn Jahren selber unehrenhaft aus der Kadettenschule entlassen wurde, der Grund, warum er bei den Anarchisten landete? Ich stellte mir diese Fragen wieder und wieder. Ich versuchte, Ôsugis Psyche zu erforschen. Vielleicht verstrickte ich mich zu tief mit ihm? Wenn ich die Augen schloss, sah ich Ôsugi vor mir, seinen Kopf mit diesen übergroßen Augen, den schönen Kopf, die schönen Augen, seinen langen, athletischen, begehrenswerten Körper, dem die Frauen, eine nach der anderen, verfielen. Ôsugi wusste seine Attraktivität einzusetzen, seit seiner Jugend schon und immer schamloser, je mehr er ein Mann wurde. Ich verglich mich mit ihm und merkte, wie ich, sein Richter, ihm eigentlich unterlegen war. Die Natur verteilt so ungerecht. Die einen bekommen Größe, Kraft und Charisma. Die anderen bleiben klein und unscheinbar, ein Los, mit dem sie sich bis an ihr Lebensende abzufinden haben. Ôsugi war so viel mehr Männlichkeit gegeben als mir. Er hätte alles einfach haben können, was ich mir hart erarbeiten musste. Wie konnte er sein Glück einfach so wegwerfen, hinein ins Brachland revolutionärer Hirngespinste?
Unter Sadakos Einfluss hatte es den Anschein, als würde sich Yoshihito entwickeln und lernen, das ihm bevorstehende Kaiserleben zu meistern. Er schien zu sich zu finden, schien eine (wenn auch sonderbare) Persönlichkeit zu entfalten, schien in die Verantwortung hineinzuwachsen, die an ihn übergeben werden musste. Yoshihito flanierte in jener vielleicht unbeschwertesten Zeit seines Lebens durch den kaiserlichen Park und reckte sein Gesicht der Sonne entgegen, anstatt sich hinter zugezogenen Schiebewänden im Schreibzimmer zu verkriechen. Sein Vater führte die Regierungsgeschäfte. Auf Yoshihito lastete kein Druck, und die tägliche Überwältigung seiner Sinne — die Düfte, Winde, Geräusche und Bewegungen, all die Sensationen der Natur, denen er sich immerzu ausgesetzt sah — hatte er nicht alleine durchzustehen. Er konnte sich Sadakos Unterstützung und ihrer ungeteilten Aufmerksamkeit gewiss sein. Noch standen die Kinder, die vier Söhne, die er mit ihr zeugen würde, nicht zwischen ihnen und auch der Thron nicht mit seinen Pflichten und der mit ihm einhergehenden Entfremdung von allem, was Yoshihito lieb war. Das junge Paar wurde in Frieden gelassen. Man schirmte es von der Außenwelt ab, ließ ihm sein Glück.
Unter diesen Bedingungen geriet die Meningitis, an der Yoshihito als Kind erkrankt war und deren Folgen ihn sein ganzes Leben hindurch beeinflussten, mehr und mehr in Vergessenheit. Sein gesundheitlicher Zustand verbesserte sich. Die Kopfschmerzen wurden erträglicher. An Sadakos Seite unternahm Yoshihito stundenlange Spaziergänge, ließ sich von ihr so manches Wunder der Flora erklären und sog die Frühlingsluft in tiefen Zügen ein. Gemeinsam mit seiner Frau bewunderte er die Kirschblüten, und in Gesprächen, die sie unter Rücksichtnahme auf seine Labilität zu führen wusste, erlernte er, die Regeln zwischenmenschlicher Konversation besser zu meistern. Seine Angst verblasste in diesen frisch vermählten Jahren. Wenn auch mit schwächlicher Stimme und spürbarer Verzögerung, bald wusste Yoshihito besonnene Antworten zu geben, anstatt ängstlich auszuweichen, wenn die Gefolgschaft oder das Personal Fragen an ihn richteten. Anstelle der ständigen Überforderung, die seine kränkliche Jugend geprägt hatte, trat nun ein Selbstbewusstsein, das eines Kaisers würdig war. Hatte sein Geist früher nicht der Geschwindigkeit folgen können, mit der sich die Erde drehte, so wirkte Yoshihito inzwischen, wenn auch nach wie vor von kränkelnder Natur, wie ein Mann, ein Ehemann, ein Thronfolger, der lernte, mit beiden Beinen im Leben zu stehen. Er würde mehr als bloß ein Narr, ein Geck sein, hoffte man. Es schien nicht länger undenkbar, dass sich Yoshihito eines Tages als Führer eignete.
Von seinem Stottern ließ sich Ôsugi in seiner Berufung als Aktivist nicht aufhalten — so wie auch ich trotz physischer Benachteiligungen, trotz meiner unstattlichen Körpermaße oder schlechten Augen, sogar trotz meines hinkenden Beins die militärische Karriere vorantrieb. Wäre ich damals, 21 Jahre alt, im ersten Jahr Taishô, in der Kadettenschule nur nicht vom Pferd gestürzt … Hätte dieses Ross sich nicht an einem plötzlichen Knall erschreckt, der aus einem Maschinenraum drang … eine Fehlzündung in einer Werkstatt, an der ich in vorbildlicher Haltung vorbeiritt. Wäre dieses mir unbekannte Tier, das ich an jenem Tag zum ersten und letzten Mal ausritt, nicht auf einmal hochgefahren, hätte es nicht wild schnaubend die Vorderhufe in die Höhe und mich von seinem Rücken geworfen; mein Leben wäre anders verlaufen. Ich wäre wohl als Soldat in die großen Kriege gezogen, hätte gegen Chinesen, Koreaner, Russen, Amerikaner gekämpft. Vielleicht wäre ich an der Front gestorben? Schließlich trage ich das Erbe eines uralten Samurai-Geschlechts in mir. Über Generationen hinweg hat meine Sippe dem Kaiser gedient, immer gab es für uns nur diesen einen Sinn im Leben: dem Wohle Japans mit dem Schwert zu dienen und bereit zu sein, sich mit demselben Schwert gegebenenfalls selbst zu richten. Dies hätten mein Leben und mein Tod sein sollen. Stattdessen schlug ich hart, mit ausgedrehtem Knie, auf dem Lehmboden auf. Das verstörte Pferd zertrampelte mich im Stakkato seiner Hufe fast. Ich wälzte mich wie ein Feigling zur Seite und hörte, wie meine Knochen knackten. Mit den Knochen zersplitterten auch meine Träume.
Als Resultat seiner positiven körperlichen und geistigen Entwicklungen erfasste den Kronprinzen, als er mit der zunehmenden Altersschwäche seines Vaters immer unausweichlicher in seine Laufbahn gedrängt wurde, plötzlich eine innere Euphorie. Ein Hochmut, eine Welle des Größenwahns durchströmte ihn. Das kam unerwartet für jeden, der ihm nahestand, selbst wenn man die Launen kannte, deren Opfer Yoshihito sein Leben lang war. Ungefedert musste er die Höhen und Tiefen seiner Existenz hinnehmen. So schnell ein Wallen in ihm auftauchte, so schnell verflog es in der Regel wieder. Auch diesmal würde es so sein, er konnte nicht auf Dauer so übermütig bleiben.
Yoshihito aber geriet diesmal in einen länger anhaltenden Taumel. Anstatt sich vor seinen Pflichten zu verkriechen, wie man es von ihm gewohnt war, gebärdete er sich als künftiger Herrscher, mehr noch, als Reformator. In den kaiserlichen Gemächern saß zum Abendessen die Familie mit einigen Vertrauten beisammen, und Yoshihito verkündete, dass sich unter seinem Zepter alles ändern sollte. Ermuntert durch mehrere Schälchen Reiswein, die er zum Essen getrunken hatte, posaunte er eine Reihe dreister Ankündigungen hinaus.
»Ich werde ein Kaiser des Volkes werden! Die kleinen Menschen, die Kinder, die Frauen, die Ärmsten der Armen, sie werden mich lieben. Weil auch ich sie liebe.«
Die Anwesenden hätten sich am liebsten die Ohren zugehalten. Wo bleiben die Kopfschmerzen, die diesen Spinner zur Räson bringen! Yoshihito war dermaßen überzeugt von seiner Gabe, die Zukunft neu zu schreiben, dass er von einem »Reich der Liebe« und von »gegenseitiger Anerkennung« zu sprechen fortfuhr.
»Alle Japaner, unabhängig ihres gesellschaftlichen Rangs, werden unter meiner Obhut zueinanderfinden«, schwärmte er.
Der zukünftige Kaiser stellte unsere seit Anbeginn der Zeiten vorgegebene Hierarchie in Frage. Statt klarer Ordnung schwebte ihm ein freundschaftliches, ungeregeltes Miteinander vor, und aus dem Ton seiner Stimme war ein umwälzerischer, erscheckender Tatendrang herauszuhören.
Auch Ôsugis Vater hatte bei einer Armeeparade sein Pferd nicht im Zaum halten können. Direkt vor den Augen des Kaisers war ihm der Gaul durchgegangen. Keine Woche später wurde er in die Provinz abgeschoben und kam nie auch nur in die Nähe jener Dienstgrade, die er angestrebt hatte.
Mir drohte Ähnliches. Nie wieder wuchs zusammen, was beim Sturz vom Ross zu Bruch gegangen war. Es fiel kaum auf, dass ich hinkte, trotzdem war ich Invalide. Nicht im Krieg, sondern in der Ausbildung zum Krieg war ich versehrt worden. Ich kämpfte mit allem, was mir blieb, gegen diesen Rückschlag an. Ich machte ihn an anderer Stelle wett. Im Dienst der Kempeitai, der Armeepolizei, die diskret zu agieren und die Ordnung zu sichern verstand, fand ich meinen neuen Lebenssinn. Mein Hinkebein hielt mich nicht davon ab, dem Kaiser zu dienen — so wie Ôsugi trotz seines Stotterns eine verschwörerische Rede nach der anderen verfasste. Ôsugi verfolgte seine Ziele mit gleicher Vehemenz wie ich die meinen — auch wenn ihm wie allen Anarchisten selten klar war, was genau er überhaupt wollte. Fantasiegebilden, Träumereien, hehren Wünschen gaben er und seine Kumpane sich hin. Sie schwenkten rote Fahnen, ohne jemals mit den Bolschewiken an einem Strang zu ziehen. Sie besuchten christliche Messen, weil sie sich Jesus Christus als Rebellen und Kommunisten vorstellten. Sie demonstrierten gegen staatliche Maßnahmen, egal, ob sie diese betrafen oder nicht, nur um sich solidarisch mit dem Volk zu zeigen. Sie trachteten danach, hinter Gitter gesteckt zu werden, und wir taten ihnen den Gefallen — auch wenn es auf Dauer nichts brachte. Keine Läuterung setzte ein. Die Aufwiegler deuteten ihre Haftzeiten als Manifestation der Ungerechtigkeit und spielten sich als Märtyrer auf. Von einem Gefängnis ins nächste wurden sie verfrachtet. Einer blieb bockiger als der andere. Auch Ôsugi. Standhaft bis in den Tod.
Wie konnte mich so etwas verwundern? Ich fühlte mich ja genauso meinen Idealen verpflichtet. Diese unendliche Sturheit auf beiden Seiten. Wohin sollte das führen? Was brachte es mir? Was brachte es Ôsugi? Nichts wurde durch all die Zeit, die er großteils in Einzelhaft verbrachte, besser, nichts änderte sich. Seine Respektlosigkeit fand kein Ende. Man hätte Ôsugi bei seinem ersten Ungehorsam gegen die Staatsgewalt erschießen lassen müssen.