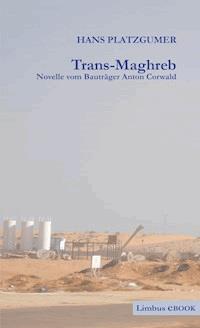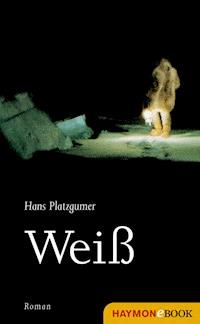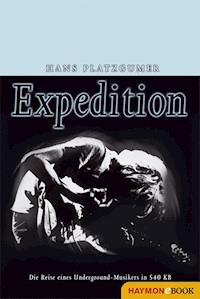
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Haymon Verlag
- Kategorie: Sachliteratur, Reportagen, Biografien
- Sprache: Deutsch
Ich möchte die wattierte Weite des hohen Nordens hören, meine Musik in ihren stummen Schneefall kleiden. Ihre mich umschließende, unendliche Leere soll das Gegenstück bilden zu den komprimierten 540 kb, die mein Leben jetzt gerade einmal misst - diese minimale Datenmenge eines Audiofiles, das nur etwa dreieinhalb Sekunden digitaler Musik entspricht. Hans Platzgumer Eine Expedition durch das Leben des Musikers Hans Platzgumer, der mit seinen musikalischen Projekten wie HP Zinker, hp.stonji oder Queen of Japan die internationale Independent-Musikszene belebt und mitgeprägt hat. In der Grauzone zwischen Erinnern und Vergessen besucht Platzgumer nochmals die Schauplätze seines bisherigen musikalischen Lebens, erzählt von absurden Tour- und Studio-Episoden zwischen New York, Berlin, Tokyo, München und London, von Begegnungen und privaten Reminiszenzen, von den Paradigmenwechseln zwischen Independent Rock, Grunge und Electronica, von künstlerischen Schaffenskrisen und der Inspirationskraft der Leere. Eine rasante Fahrt durch die Biografie eines klangbesessenen Kosmopoliten entlang der Grenzlinie zwischen innerer Getriebenheit und äußerer Reflexion. Mit einem Nachwort von Thomas Ballhausen.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 327
Veröffentlichungsjahr: 2014
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Hans Platzgumer
Expedition
Die Reise eines Underground-Musikers in 540 kb
Vom inneren Nichts ins äußere NichtsVom Parasiten an den Nordpol
Ungekürzte E-Book-Ausgabe
HAYMON Verlag, Innsbruck-Wien 2013
www.haymonverlag.at
© 2005 by Skarabæus Verlag Innsbruck-Bozen-Wien in der Studienverlag Ges.m.b.H.
Erlerstraße 10, A-6020 Innsbruck
e-mail: [email protected]
Alle Rechte vorbehalten. Kein Teil des Werkes darf in irgendeiner Form (Druck, Fotokopie, Mikrofilm oder in einem anderen Verfahren) ohne schriftliche Genehmigung des Verlages reproduziert oder unter Verwendung elektronischer Systeme verarbeitet, vervielfältigt oder verbreitet werden.
Abhängig vom eingesetzten Lesegerät kann es zu unterschiedlichen Darstellungen des vom Verlag freigegebenen Textes kommen.
eISBN: 978-3-7099-3560-6
Buchgestaltung nach Entwürfen von Kurt Höretzeder
Satz: Skarabæus Verlag/Thomas Auer
Umschlag: Gerhard Potuznik
Lektorat: Skarabæus Verlag/Georg Hasibeder-Plankensteiner
Dieses Buch erhalten Sie auch in gedruckter Form mit hochwertiger Ausstattung in Ihrer
Buchhandlung oder direkt unter www.skarabaeus.at.
Inhalt
Der Parasit
Innsbruck
Aufbruch
Wien – Berlin
Go West & East, Young Man
Kleine überschaubare Welt
HP Zinker
I Let Love In
Die Macht der Niederlage
Borderline
Hafen Europa
Aura Anthropica
Der Veteran
Live PA
München
Die japanische Königin
Open Air
Sound
Japan in Echt
Convertible
Der Marathon-Mann
La Canicule
Anhang
Schrecken des Stillstands. Ein Nachwort.
Auch die Wahrheit steht nicht still.
Sie bleibt über die Arroganz des Augenblicks erhaben.
Diese 540 kb sind mit Hilfe von Didi Neidhart entstanden, dessen Inspiration und Idealismus die Expedition in dieser Form erst ermöglicht haben.
Weiterer Dank gebührt folgenden Personen, die in unterschiedlicher Weise zur Entstehung dieses Textes beigetragen haben:
Sandra Bellet, Barbara Schäfer, Paul Divjak, Wolfgang Reitter, André Heller, Gerhard Potuznik, Eva Engel, Chris Gelbmann, Thomas Ballhausen und Georg Hasibeder.
Um den sprachlichen Fluss nicht zu stören, wurden in diesem Buch bei personenbezogenen Bezeichnungen männliche Endungen verwendet. Dies soll keineswegs eine Diskriminierung der Frau bedeuten.
Der Soundtrack zur Expedition ist als Doppel-CD „Hans Platzgumer: Expedition 87–04“ auf Buntspecht erschienen und im Hoanzl Vertrieb erhältlich.
Der Parasit
Unbemerkt hatte es sich wieder angeschlichen, ist ohne Vorwarnung über mich hereingebrochen. Das Nichts. Diese Leere. Der größte Feind meiner musikalischen Produktion. Er hat sich wieder ausgebreitet in meinem Inneren und heimlich all jene Zellen in mir zerfressen, die kreieren wollen. Sie taugen jetzt nichts mehr, zumindest für eine Weile. Ohne Sinn und ohne Auftrag liegen sie brach da, verwirrt, ob und wann sie wieder zu einem Einsatz kommen.
Immer wieder bemerke ich diesen Angriff erst zu spät und kann ihn dann nicht mehr aufhalten, nicht einmal mehr abschwächen. Full Stop. Kein spektakuläres Black-Out, dessen man sich in stolzer Aufregung hätte rühmen können, sondern nur ein langsames, unmerkliches Ausblenden hinein ins Nichts. Manchmal kann ich den kreativen Stillstand etwas hinauszögern, mit letzter Kraft noch das zu Ende bringen, was ich in besseren Tagen voller Elan schon begonnen hatte. Doch dann ist es unweigerlich vorbei, ich kann der Krise nicht mehr entkommen, mich nur mehr einlassen auf sie.
Sie ist keine Erholung nach erfolgreicher Aktivität, keine knisternde Ruhe vor einem neuen Sturm. Man kann nicht einmal behaupten, dass Schleusen verstopft seien und das Durchdringen im Innern brodelnder Kreativität verhindern. Es scheint schlicht kein Potential mehr vorhanden zu sein, um jemals wieder interessante musikalische Konstruktionen zu entwickeln. Nein, es hat keinen plakativen Glam, dieses Einfrieren des Willens, das Geist und Finger gleichzeitig erstarren lässt, mit trockener Selbstverständlichkeit alles nimmt und nur eine Öde hinterlässt, als ob da niemals irgendetwas gewesen wäre und nie mehr etwas nachkommen würde. Schon wirkt es ungeheuerlich, dass ich selbst jemals in der Lage war, Musik zu komponieren und produzieren. Es muss ein anderer Mensch gewesen sein, denn in mir scheint nun keine Musik mehr vorhanden. Nicht einmal Panik verursacht mir dieser Gedanke, es ist mir schlichtweg klar, dass ich höchstens in einem anderen Leben dazu fähig gewesen war, dass ich niemals wieder ein ansprechendes Niveau erreichen würde. In beunruhigender Verborgenheit wurde diese totale Veränderung zusammengebraut, klammheimlich hat sie sich vollzogen. Nichts hat sie verursacht, und doch hat sie mich hineingeworfen in ein Vakuum, das mich lähmt, aus dem ich kein Entkommen finde.
Jedesmal überkommt mich dieser Stillstand ähnlich, niemals jedoch in der Gestalt gleich. Er erlaubt mir nicht, ihn gelassen zu katalogisieren. Jedesmal erscheint mir dieses Schweben in grausamer künstlerischer Leere vollkommen ausweglos. Ich weiß nicht, wie und warum es mich rücklings überfallen hat, und bin ihm wehrlos ausgeliefert, eine ausgehöhlte Fassade, die gierig darauf wartet, wieder belebt zu werden. Die sprudelnden Tage meiner Vergangenheit, die Höhenflüge anderer Musiker kann ich nun nur mehr ehrfürchtig und neidisch betrachten, voll Ungeduld möchte ich mit ihnen mithalten, doch finde ich kein Depot, aus dem ich schöpfen könnte. Ich habe mir selbst nichts mehr zu bieten und kann mich selbst auch nicht belügen, sogar wenn sich meine Außenwelt noch eine Weile täuschen lässt. Meine Fundamente sind bedroht, der Sinn und Zweck meines Daseins in Frage gestellt. Früher haben mich solche Phasen noch in tiefe Depressionen und Minderwertigkeitskomplexe gestürzt, heute bleiben direkte Auswirkungen und erkennbare Re-Aktionen aus. Zu oft habe ich den Kampf dagegen verloren, als dass ich ihn jetzt überhaupt noch zu führen wagen würde. Zu oft habe ich erfolglos versucht, dagegen anzustemmen, hysterisch in jedem Winkel nach Auswegen zu suchen, mich mit kleinen Not-Beschäftigungen und krampfhaften Zwangsarbeiten über die Durststrecken zu retten.
Dieser stille Feind ist einfach stärker als ich. Nichts habe ich ihm entgegenzustellen. Ich kann mich nur mit ihm arrangieren, seine Dominanz und meine Gefangennahme hinnehmen, auf seine Gutmütigkeit hoffen. If you can’t beat them join them. Da ich dieses Loch nicht flicken kann, muss ich es respektieren, blind darauf vertrauen, dass es mich irgendwo hinführen, in einer neuen Welt wieder ausspucken wird. Wie alle Menschen irgendwann sterben, so sterben auch die kreativen Momente aller Künstler früher oder später, seien sie nur ein kurzes einmaliges Aufflackern, eine lange Phase höchster Konzentration oder mehrmals wiederkehrende Wellen gewesen. In jedem Fall muss ich ihren Tod akzeptieren. Ich will ihn lieber bewusst ausleben, als ihn zu ignorieren. Auch wenn ich es insgeheim versuche, ich darf es keinesfalls zulassen, einfach unbeeindruckt weiterzuarbeiten, scheinheilig so zu tun, als ob nichts wäre oder besser gesagt: als ob da inzwischen nicht nur Nichts mehr wäre.
Ohne das Funkeln der Inspiration, mühsam erzwungen, erkämpft statt freiwillig zelebriert, würde meine Musik schnell im verhassten Mittelmaß landen. Es würde mich bald vollkommen übernehmen und auch das noch zerstören, was ich vorher zumindest erreicht hatte. Dann hätte dieser unsichtbare, übermächtige Gegner endgültig gesiegt.
So jedoch hoffe ich, mit ihm leben und von ihm lernen, seine Kraft, die außerhalb meiner Reichweite liegt, für meine Zwecke einsetzen zu können. Ich will ihm diese eine Schlacht schenken und mit ihm als Verbündeten gestärkt weiterziehen. Ich will dieses Nichts, das er mir aufzwingt, als Möglichkeit der Sammlung nutzen. Ich spüre, dass ich von ihm, wie von allem, das außerhalb meiner Limitationen steht, nur lernen kann, wenn ich mich ihm öffne. Ein Fortschritt ist nur möglich, wenn ich nicht nur das Erreichte verarbeiten und Grenzen anerkennen kann, sondern auch das Unverständliche einbeziehe. Das Nichts soll meine Verstärkung, mein Gewinn sein. Dank seiner Hilfe werde ich in Neuland gestoßen. Aus ihm heraus will ich neue Leidenschaft entdecken.
Wie die Phasen des Overloads brauche ich auch jene der Leere, um mein Visier wieder neu öffnen zu können. Und doch muss ich auch darauf gefasst sein, dass es ein endgültiges Versickern meiner kreativen Energie geben wird. Irgendwann werden alle Ressourcen erschöpft sein, irgendwann habe ich alles gegeben, was zu geben ich fähig war, wozu ich die Möglichkeiten hatte. Miles Davis hat mitten in seiner Karriere plötzlich freiwillig fünf Jahre lang pausiert und keinen musikalischen Finger mehr gerührt. Diese Stärke will auch ich besitzen, die Notwendigkeit einer Pause, vielleicht sogar eines endgültigen Abschieds, zu erkennen, um nicht mein eigenes Werk, mein Credo der ständigen Innovation, im Nachhinein noch selbst zu zerstören, mich nicht aus purer Einfallslosigkeit und Langeweile noch zu enthaupten. Bis jetzt haben sich solche Strecken scheinbar wirkungsloser Leere immer noch als mehr oder weniger lange Brücken zu neuer Frische entpuppt, doch ich will auch bereit sein, falls sie mich eines Tages nirgendwo mehr hinführen sollten. Natürlich habe ich Angst vor diesem Augenblick, ich wünsche mir, ihn nicht diesmal schon erreicht zu haben. Doch ich muss ihm auch in die Augen schauen können, die Kühnheit haben, diesen größten Feind als einzig wahrhaften Partner zu betrachten. Denn er kann mein wichtigster Helfer werden, weil nur er mich im sensibelsten Moment in voller Härte zurückdrängt, mich in meine Schranken weist, wenn ich meine Grenzen überschritten, meine Ideale verloren, meine Freiheit verraten habe.
Wir beide sind Wirt und Parasit zugleich. Es ist in mir, das Nichts, es nährt sich von mir und ich mich von ihm. Wir können uns, wir müssen uns aufeinander verlassen.
Innsbruck
Seit ich denken kann, denke ich in Musik, erfahre ich in Klängen. Ich kann nicht anders als hinhören, lauschen, suchen nach Geräuschen, nach Lärm und Stille, nach Melodien und Kakophonien. Es wäre mir stets gleichgültig gewesen, blind zu sein, solange die Welt der Töne, Frequenzen und Harmonien mir nicht verborgen bliebe. Will ich mich auf etwas anderes als das Hören konzentrieren, muss ich krampfhaft versuchen, die Ohren auszuschalten, und entdecke gerade dann in einer künstlichen Stille wieder neue Klangerlebnisse, die mich von allen anderen Beschäftigungen ablenken. Ich muss hinhören, die Augen schließen und ohne Störung durch andere Reize das volle Spektrum der Klänge zu erfassen versuchen.
Es sind vielschichtige Geräusche und ihre ständig variierenden Schwingungen, die in meinem Kopf Kompositionen und subtile Übertöne produzieren. Sie bilden einen wirren Soundtrack, dessen einzelne Komponenten – atonale Frequenzen, dissonante Geräuschfetzen, kleinste pulsierende Rhythmen – ständig um meine Aufmerksamkeit ringen und um ihren Platz in der Klanghierarchie kämpfen. Oft sind es minimale Sound-Partikel, unauffällige Geräusche, die plötzlich ein reichhaltiges Schema produzieren, Kleinigkeiten, die auf einmal übergroße Bedeutung bekommen. Etwas, was ich vorher gar nicht bemerkt hatte, hämmert sich dann unaufhaltsam und vehement in mein Bewusstsein ein, bekommt Strukturen und rhythmische Betonungen, gibt mir plötzlich eine bisher verborgene Form zu erkennen. Die Unschärfen an den Rändern wandern ins Zentrum der Betrachtung. Mit jeder Veränderung meines akustischen Point Of View bekommen sie neue, ungeahnte und mir teils unverständliche Bedeutungen. Oft möchte ich vor solcher Klangfülle aufschreien, dieses momentane Muster schnell durch einen neuen Klang vertreiben. Ich sehne mich nach Ablenkung oder nach totaler Stille, die ich jedoch nirgends finde. Denn insgeheim suche ich schon nach dem nächsten versteckten Geräusch.
Als Kind im Vorschulalter schon wollte ich all diese Hörerlebnisse einfangen. Ich wollte sie, sobald ich die Instrumente und Geräte dafür hatte, festhalten und lernen, sie in Musik umzusetzen. Jeder Windstoß, jeder Straßenlärm, jeder Gesprächsfetzen ließ mich in seiner Musikalität aufhorchen. Das Klappern des Geschirrs meiner Mutter teilte ich mathematisch in Rhythmen ein, ebenso wie das Schnarchen meiner Brüder oder den verhallten Schritt meines Vaters im Treppenhaus.
Ich hatte das Glück, inmitten der Stadt in großer Ruhe aufzuwachsen und meine Sensibilität für die Feinheiten der Geräusche weiter ausbauen zu können. Das Kinderzimmer der elterlichen Wohnung in Innsbruck sah ebenerdig auf eine kaum benützte, riesige Grünanlage. Kein Summen von Insekten, kein Rascheln der Blätter blieb mir da verborgen; ich hörte Flugzeuge, Schießstände und Lawinen in der Ferne als dezente Untermalung für abrupte vordergründige Geräusche wie das Knallen von Türen oder den Lärm aus nachbarlichen Wohnungen.
Innsbruck hat durch seine geografische Lage am Nordrand der Alpen, eingekesselt von hohen Bergketten, die den Föhn ebenso wie den Smog in erdrückender Konzentration stauen, nicht nur ein endloses Transitproblem und die rohe und launische Mentalität seiner Einwohner hervorgebracht, sondern auch eine einzigartige Akustik, in der, wie durch ein Brennglas fokussiert, jedes unscheinbare Flimmern übertriebene Intensität erhält. Bei Föhn scheinen nicht nur die gegenüberliegenden Hänge des engen Tals in all ihren Details greifbar nahe zu rücken, auch jeden noch so entfernten Laut glaubt man durch die warme Luft hautnah spüren zu können. Von beiden Bergketten, nördlich und südlich der Stadt, hallen Geräusche in unzähligen Echos zurück, Flugzeuge und LKWs bringen über die offenen West- und Ostportale der Stadt pausenlos neues Sound-Material in ihre Schallglocke. Die Stadtbewohner schützen sich vor diesem überwältigenden Feedback, indem sie missmutig und engstirnig durch die Tage gehen, Tonnen von Migränetabletten schlucken oder sich hinaufkämpfen auf die höchsten Gipfel, um endlich Auge und Ohr in die Weite schweifen lassen zu können.
Man sagt, als Gott die Welt erschuf und die Menschen darauf verteilte, habe er irgendwann nur mehr dieses aufgefaltete unwirtliche Stückchen Erde und das Tiroler Bergvölklein übrig gehabt. Es wurde ihm bewusst, dass in dieser rauen Region kein Mensch freiwillig bleiben würde, also erfand er das Heimweh und pflanzte es den Tirolern ein. Tatsächlich kenne ich kaum einen Menschenschlag, den es mit solcher Inbrunst immer wieder zurück in die heimatlichen Berge zieht.
Dort wuchs ich also auf, mitten im Wohlstand, wohlbehütet im Wohnzimmer der westlichen Welt, verschont von Armut, Krieg und Naturkatastrophen. Ich konnte mich frei zwischen Bildung, Sport und Kultur bewegen, erkannte jedoch bald, dass alle diese Möglichkeiten mit einem gesellschaftlichen Konformismus verbunden waren, in den ich mich nicht verwickeln lassen wollte.
Ich begann zu rebellieren und generell das zu verneinen, was mir durch meine Herkunft angeboten wurde. Ich versuchte Traditionen wo immer möglich zu brechen und wollte mich von kleinstädtischen Vorgaben nicht einengen lassen. Die Gutbürgerlichkeit meiner Umgebung erschien mir sehr früh schon spießig und beklemmend. Die Sicherheit, die sie mir bot, verabscheute ich schnell als langweilig und konservativ, wenn nicht gar reaktionär. Bald befand ich mich in einem ständigen Kampf gegen allzu viele gesellschaftliche und kulturelle Vorschriften. In meiner jugendlichen Übertreibung begann ich dieses mein soziales Umfeld zu hassen, das mir alles ermöglichte und gleichzeitig nichts Eigenständiges gönnte. Ich beschloss schon als Schulkind, meinen eigenen Weg zu gehen, und akzeptierte von außen keine Einmischung in meine Ideen.
Unser direkter Nachbar war ein großer türkischer Konzertpianist, sein Sohn Oliver schon im Volksschulalter mein bester Freund. Wir fühlten uns unzertrennlich verbunden durch unsere gemeinsame fanatische Liebe zur Musik und geeint durch unser rebellisches Drängen gegen die Gesellschaft, die uns umgab. Da kümmerten wir uns kein bisschen um die Lebensauffassungen unserer Elternhäuser, die entgegengesetzter kaum sein hätten können:
Olivers Vater war Mitglied der kommunistischen Partei Österreichs und neben seiner künstlerischen Tätigkeit oft an politischen Aktionen beteiligt, die meinem Vater, als Beamter traditionell den regierenden Konservativen verbunden, in seiner Arbeit als Sicherheitsdirektor von Tirol in die Quere kamen. Oliver war ein Einzelkind, seine jungen Eltern lebten in Trennung, und häufig alleingelassen mit seiner Großmutter, die mit der Aufsicht über ihn überfordert war, fand er ungewollt genügend Freiraum, seine eigenen Ideen zu entwickeln. Ich wieder war weich eingebettet in ein gutbürgerliches Familienhaus, das milde versuchte, mir konservative Wertanschauungen zu vermitteln, dessen oberstes Credo es war und ist, nur ja, still und fleißig, der gesellschaftlichen Norm zu entsprechen. Meine Eltern waren bereits verhältnismäßig alt und besaßen, in der Erziehung ihres Nachzüglers, ihres vierten Kindes schon gelassen, nicht mehr die nötige Energie und Durchsetzungskraft, um mich nach ihren Idealen zu formen. Umso mehr nahm ich jede Gelegenheit zum Kampf mit ihnen wahr, wollte von Anfang an schon aufgesetzte Harmonien und Hierarchien nicht respektieren und verschaffte mir Platz, wo immer ich ihn als nötig empfand.
Unbewusst und leise versuchten wohl beide Seiten, die Freundschaft zwischen Oliver und mir auseinander zu leiten. Informationen und Meinungen wurden umgefärbt und abgewehrt, um ein Aufkeimen der Ideen aus der anderen Welt erst gar nicht zu ermöglichen. Aber wir entzogen uns so vehement wie möglich dieser Zensur, dieser heimlichen Gehirnwäsche in kleinen Dosen. Wir sonderten uns von beiden Parteien ab und erschufen unsere eigene, autarke Welt. „Shock Me“ in der Melodie eines gleichnamigen Songs von Kiss wurde unser Geheimwort, und sobald es aus einer der beiden Wohnungen zu hören war, war es das Signal für ein Treffen in einem unserer vielzähligen Verstecke. Es waren geheime Plätze und geheime Sprachen, die wir brauchten, um unserer Suche nach Musik frei nachgehen zu können. Verschanzt in den hintersten Kellerwinkeln des 60er-Jahre-Wohnblocks, den wir bewohnten, begannen wir auf Olivers kleinem Kassettenrecorder erste Tonaufnahmen zu machen. Unter dem Projektnamen H2O – was wir als geniales Wortspiel mit unseren Initialen empfanden – produzierten wir, noch bevor wir irgendein Instrument beherrschten, nur für uns allein eine Vielzahl von Kassetten. Wir benutzten Kochlöffel, Kochtöpfe oder Kissen, vor allem aber natürlich unsere Stimmbänder und Münder. Mit jeder Woche füllte sich unsere geheime Kiste mit säuberlichst handbemalten Tonbändern mehr. Diese Strohkiste war unsere erste imaginäre Plattenfirma, ein – im Gegensatz zur Realität – ständig freundlich gesinntes Label, das kritiklos alle Aufnahmen veröffentlichte, die es von H2O bekam.
Musikalisch entwickelten wir jedoch langsam unsere eigenen Ideen, begannen wir – erste Früchte unserer unterschiedlichen Erziehung –, eigenständige Wege zu gehen. Oliver interessierte sich für virtuoses Klavierspiel und hatte offensichtlich von seinem Vater nicht nur großes Talent, sondern auch die nötige Ernsthaftigkeit geerbt. Auch wenn mich seine Fingerfertigkeit beeindruckte, wusste ich schnell, dass dieser disziplinierte Umgang mit Musik nicht der Weg sein konnte, den ich wählen wollte. Freie Entscheidungsmöglichkeiten und ungezügelte Kreativität waren für mich immer schon entscheidender als die Perfektion technischer Fertigkeiten gewesen.
Und – schon damals war mir anscheinend eine Band, ein einziges Musikprojekt nicht genug – so startete ich im zarten Alter von sieben Jahren bereits mein erstes Soloprojekt: meine eigene Band The Dicks – in meinem damals kaum existenten Englisch wohl eher eine ironische Anspielung auf meine Schlankheit als auf das männliche Geschlechtsorgan. Dieses Soloprojekt war so geheim, dass nicht einmal Oliver etwas davon erfuhr. Die Musik der Dicks fand ausschließlich in meinem Kopf statt. Ich wusste haargenau, wie die Songs klangen, kannte alle, teils in realem, teils in Fantasie-Englisch verfassten Texte der Band, erfand ihre Biographie sowie den detaillierten Werdegang der sechs Bandmitglieder, erstellte eine penible Diskografie samt Plattencovern, Presseberichten und Skandalen – alles natürlich realen Bands wie Queen oder Pink Floyd, den tatsächlichen Vorbildern meiner damaligen Träume, nachempfunden. Sogar die Freundinnen der einzelnen Musiker standen mir ganz deutlich vor Augen. Ich begann, die Fantasiegruppe aus Plastilin, Ton und Lego zu konstruieren, und spielte, eingeschlossen in meinem Zimmer, ihre aufwändig inszenierten Konzerte samt Licht- und Pyrotechnikshow und, selbstverständlich, kreischendem Beifall des imaginären Publikums nach. Die ganze Entwicklung dieses Spieles erstreckte sich über einige Jahre. Nie habe ich einem Menschen davon verraten.
Während ich in meinem eigenen Kosmos träumte, lernte Oliver rasch das Klavier immer besser zu beherrschen. Doch auch mir war klar, dass ich ganz ohne musikalische Ausbildung nicht weit kommen würde. Über meinen ältesten Bruder, der Hobbygitarrist war und in diversen Schulbands spielte, bekam ich Zugang zu verschiedenen Instrumenten. Er brachte mir über das dicke Songbook „The Beatles Complete“ – die Fibel aller damaligen „Western“-Gitarristen – die ersten notwendigen Grundlagen auf der Gitarre bei.
So war die Zeit bald reif für unsere erste wirkliche Band, für unsere ersten Aufnahmen mit echten Instrumenten. Mit acht Jahren hatte Oliver bereits seine Begeisterung für den Jazz entdeckt und wir gründeten kurzerhand die Duke Ellington Revival Band – natürlich weiterhin geheim gehalten vor der Außenwelt. Wir schlichen uns, sobald Olivers Vater die Wohnung verlassen hatte, in das Wohnzimmer, wo statt eines Fernsehers oder Couchmöbeln nur ein wunderschöner Flügel stand. Die Erinnerung an den Anblick dieses edlen Instruments lässt mich heute noch ehrfürchtig verstummen. Großteils übernahm Oliver das Musizieren, ich steuerte nur hin und wieder etwas Gitarre bei. Was mich definitiv am meisten interessierte und faszinierte war, in der Manier von John Cage die Spielweise des Klaviers zu manipulieren, die Eingeweide des Flügels verbotenerweise mit Schrauben, Gummibändern oder Radiergummis zu malträtieren. Aus dieser Grundidee der Zweckentfremdung heraus erschloss ich der Duke Ellington Revival Band auch neue Soundquellen wie Klospülungen oder Glastische. Jeder Gegenstand, dem irgendwie ein Klang zu entlocken war, wurde penibel bearbeitet. Schließlich begannen wir sogar, mit Decken, Brettern, Seilen und Töpfen den Flügel und das Wohnzimmer auf jede erdenkliche Art und Weise umzubauen und fertigten in diesem unserem bald auf die ganze Wohnung ausgeweiteten Experimental-Studio die Aufnahmen zu unserer 90-minütigen Kassette „Duke’s First Impressions Went A Long Way“ an. Immer rechtzeitig versteckten wir dann wieder unsere Instrumente, denn wir wussten: Die Tatsache, dass zwei Volksschüler, also echte Knirpse, derartig experimentelle Musik produzieren und einer ewigen Legende des Jazz widmen, hätte in unserer Umgebung keine Begeisterung hervorgerufen. So verheimlichten wir weiterhin unsere Machenschaften und hofften, dass wir speziell von Olivers Vater, dem Besitzer dieses teuren Konzertflügels, nicht entdeckt wurden.
Mit dem Einstieg ins Gymnasium 1979 schloss ich neue Bekanntschaften und es eröffneten sich mir neue Möglichkeiten, meiner Musikbesessenheit endlich auch außerhalb meines Kopfes, in verstaubten Kellerabteilen oder verdunkelten Zimmern nachzugehen.
Um mir die notwendige Technik anzueignen, nahm ich Unterricht in klassischer Gitarre auf dem Innsbrucker Konservatorium, und um auch Rockmusik machen zu können, was mir viel mehr bedeutete, trat ich dem verrufenen Innsbrucker Jugendzentrum „MK“ bei, in dem viele lokale Bands ihre Proberäume hatten. Bald hatte ich erste Kontakte zu den großteils deutlich älteren Musikern geknüpft, und nach kurzem Beschnuppern durfte ich schon an Sessions und Proben teilnehmen. Da es Gitarristen zumeist im Überfluss gab, versuchte ich mich an Orgeln, Schlagzeugen, Violinen oder Tambourins und war bei allem dabei, das mit Musik und Rebellion zu tun hatte.
So lernte ich schnell mehr oder weniger professionelle Kollegen kennen und rutschte in Kreise, die meinen Eltern alles andere als lieb gewesen wären. Dann, im Alter von 12 Jahren, konnte ich endlich die Tagträumereien meiner Plastilin-Band The Dicks ins wirkliche Leben holen und begann Konzerte mit meinen ersten Bands Jonny X and the Cultbrothers, Funk Taxi, Nylon und später den Capers zu spielen, zuerst auf Sommerfesten und Rockfestivals des jesuitisch orientierten Jugendzentrums, dann rasch immer tiefer in die linksradikale Szene des autonomen Innsbrucker Kulturzentrums „Komm“ gleitend. Musik wurde zum Ausdruck meiner Auflehnung gegen eine intolerante Gesellschaft, die Konzerte meist eine Mischung aus großen Ambitionen, chaotischen Umständen und frühen Drogenerfahrungen.
Obwohl ich noch viel zu jung für Alkohol und Drogenkonsum war und mir obendrein der bittere Geschmack von Bier und – als Nichtraucher – der kratzende Rauch eines Joints widerstrebte, das Schlucken eines Trips Angst einjagte, war ich bereit, die ganze Palette auszukosten und jede Chance, die sich für neue Erfahrungen bot, zu nutzen. Da mich die Wirkungen von Marihuana, Alkohol oder LSD schon damals nicht besonders zu beeindrucken vermochten, genoss ich diese verbotenen Substanzen allerdings mehr theoretisch als praktisch. Ich sah sie als Ausdruck meiner Trotzhaltung gegen die konservative Gesellschaft meiner Heimatstadt. Alles was mit Regeln und Traditionen brach, war in unserer Szene begehrt. Die konservative Stadt, immerzu auf ihr touristenfreundliches Image bedacht, bot uns in all ihrer Restriktivität ein ideales Ventil zum Ausleben unseres Anders-Seins. „Punkern“ – und das bedeutete in Innsbruck: auffälligen Jugendlichen jeglicher Couleur –, war es nicht einmal gestattet, sich bei der Annasäule oder anderen Sehenswürdigkeiten im Zentrum der Stadt aufzuhalten, und so reizte es mich natürlich umso mehr, mit bunt gefärbten Haaren und selbst genähten Lederjacken durch die Fußgängerzone zu flanieren und den Touristen stolz eine andere Facette des Urlaubsparadieses zu präsentieren. Der Geist der Auflehnung hatte mich ergriffen. Auch wenn ich bei meinen Provokationen längst nicht so weit ging wie unser großer Punk-Stolz „Gassi“, der einmal den Cockerspaniel einer italienischen Touristin in der Innsbrucker Altstadt vergewaltigte oder „Bullen“ mit Bierflaschen bewarf und deshalb den Großteil seiner Zeit hinter Gittern verbrachte. Auch wechselte ich meine Schuhe nicht so selten wie „Galle“, dem bereits die Zehennägel durch seine DocMartins und die darunter verschmolzene Masse aus Fleisch und Wollsocken gewachsen waren. Doch ich glänzte zumindest mit einem Überfall – bewaffnet mit selbstgebastelten Holzpistolen und Baumstämmen aus Pappe und Karton – auf die lokale Straßenbahn (was ärgerte sich der Zugführer als er die falschen Baumstämme von den Gleisen entfernen musste!), verbrannte nächtens voller Inbrunst Tiroler Flaggen und sprühte Graffities.
Die Stadtverwaltung versuchte damals noch nicht, die Gegenkultur in Randbezirke der Stadt abzuschieben und den Underground damit oberflächlich ruhig zu stellen (eine Ghettoisierung etwa wie Jahre später mit dem Kulturzentrum „Haven“ an einer Innsbrucker Autobahnauffahrt), sondern versuchte vielmehr, mit harter Hand Herr der Lage zu werden. Über mehrere Jahre entwickelte sich so über gegenseitiges Unverständnis ein mehr oder weniger aggressiv geführter Konflikt, der 1987 in den „Chaostagen“ gipfelte, die in dutzenden Festnahmen endeten, als sich hunderte (großteils zugereiste) Punks mit der Polizei eine Straßenschlacht lieferten.
Jede Probe (und damit Zusammenkunft mit Gleichgesinnten) und jeder Auftritt war ein willkommenes Abenteuer für meine junge rastlose Seele, die, einmal Blut geleckt, nun nicht mehr loskam vom Reiz des kulturellen Untergrunds. Ich erlebte im kleinen Kreise damals noch unbekannte Gruppen wie Sonic Youth oder die Toten Hosen, und auch in meinem eigenen Umkreis gab es dutzende Bands, die bizarre Musik produzierten – wenn auch mehr schlecht als recht. Manchmal schien es in diesen Tagen, als ob jeder, der irgendetwas Andersartiges zu bieten hatte, auf eine Bühne gestellt würde und sich an irgendeinem Instrument versuchte. Einer meiner Freunde wurde sogar als Schlagzeuger engagiert, nur weil er den höchsten rotgefärbten Irokesen-Haarschnitt der Stadt hatte – obwohl er noch nie zuvor Schlagzeugstöcke in der Hand gehalten hatte.
An Wochenenden reiste ich mit oder ohne Erlaubnis der Eltern in andere Städte und zu Rock-Festivals, übernachtete auf dunklen Parkbänken, in schmutzigen Backstage-Räumen und Batik-verhangenen Hippie-Kommunen. Was war ich verblüfft, als ich, am Höhepunkt meines unausgelebten pubertären Dranges nach ersten sexuellen Erfahrungen, in einer Salzburger Nudisten-Wohngemeinschaft übernachtete und am Frühstückstisch ausschließlich von nackten Frauen umgeben war, die mir in größter Selbstverständlichkeit ein Frühstücksei zubereiteten.
In der Naivität meines zarten Alters lieferte ich mich offenherzig allen Abenteuern und auch Gefahren aus und sammelte Eindrücke, die ich wohl besser erst mit mehr Lebenserfahrung gesammelt hätte. Umgeben von lauter, verzerrter Musik und exzentrischen Freaks, die mich damals durch allzu große Freizügigkeit oder Aggressivität oft auch schockierten, hatte ich ein schmutziges Underground-Österreich entdeckt, das nichts mit den Skipisten, Sängerknaben, Lipizzanern, Mozartkugeln, Almdudlern, Apfelstrudeln oder Trachten zu tun hatte, mit denen diese Nation sich der Welt gerne präsentierte.
Hin- und hergerissen zwischen der Euphorie, auf Bühnen zu stehen, und der Enttäuschung, nicht das erreicht zu haben, was ich mir vorgenommen hatte, blieb mein Hauptinteresse das Produzieren und Aufnehmen der Musik. Selbstgespielte Musik und Geräusche möglichst eigenständig auf Tonband festzuhalten und somit als dauerhafte Momentaufzeichnung zu hinterlassen, faszinierte mich nach wie vor am meisten. Ich wollte diese akustischen Welten, die sich tief hinter meinen Ohren eröffneten, nicht nur einfangen, sondern auch für andere erreichbar und zugänglich machen, diese Aufnahmen veröffentlichen, sie einer möglichst breiten Menschenmenge mitteilen. Meine Musik sollte Leute erreichen, die mich nicht kannten, nichts von mir wussten. Die Musik und die durch sie hervorgebrachten Welten sollten mir jene Wege erschließen, die ich sonst nie gehen hätte können. Zwar hielt ich meine Aktivitäten vor meiner familiären Umgebung nach wie vor geheim, die große Welt jedoch – das war mein neues Ziel – sollte nun von meinem Schaffen erfahren.
Mitte der 80er Jahre war das Veröffentlichen von Musik bei weitem noch nicht so einfach wie heute. Es gab noch keine selbstgebrannten CDs oder MP3s, und real existierende Plattenfirmen waren für einen Underground-Musiker aus der österreichischen Provinz in unerreichbarer Ferne. Niemand hätte mir die Miete eines Tonstudios bezahlt, digitale Homestudios, wie sie heute jeder Besitzer eines Computers zur Verfügung hat, waren noch nicht erfunden. „Scotti“, der einzige Mäzen der Innsbrucker Subkultur, stellte meiner Band zwar 500 Schilling, also ca. 35 Euro, zur Verfügung – ein außerordentlicher Betrag, den wir damals kaum anzunehmen wagten und durch welchen wir uns noch jahrelang in seiner Schuld fühlten –, doch auch damit kamen wir nicht weit.
In diesem Dilemma war der simple Vierspur-Rekorder eines Freundes meine Rettung. Ich verliebte mich sofort in das kleine Gerät. Liebevoll in orangen Stoff gepolstert, mit wenigen Features wie einer vakuumgesteuerten Fuß-Fernbedienung oder spur-erweiternden Ping-Pong-Techniken ausgestattet, ermöglichte mir diese Maschine, vielfältiger als zuvor mit Klängen und Geräuschen umzugehen und ganze Band-Arrangements alleine zu produzieren. Ich erinnerte mich, dass selbst die Beatles „Sgt. Pepper’s Lonely Heart’s Club Band“ nur mit vier Spuren aufgenommen hatten. Meiner Fantasie und Kreativität schienen plötzlich keine Grenzen mehr gesetzt. Ich spielte mit Natursounds, mit allen greifbaren Instrumenten und Effekten und wollte sie zu einmaliger Popmusik verbinden – das war das einzige, was mich interessierte. Die Schule brachte ich so schnell und einfach wie möglich hinter mich. Das Gitarrenstudium am Konservatorium brach ich nach wenigen Jahren ab. Ich wollte kein Virtuose werden, der mit Noten, aber nur wenig mit Musik zu tun haben würde, sondern ein Klangkünstler, ein Soundwissenschaftler, ein Geräusche-Alchemist. Die Voraussetzungen dafür wollte ich mir selbst beibringen.
Ich hatte eine Vision. Sie hieß „Tod der CD“. Die gerade von Sony eingeführte Compact Disc war sofort zu meinem direkten Feindbild geworden, das meinem subkulturellen Empfinden grundlegend widersprach. Ich wollte unabhängige, schmutzige Musik in den Händen halten, kein steril verpacktes, sauber und flach klingendes Massenprodukt, das nur der Bereicherung der großen Konzerne diente. Ich lehnte sie ab, ähnlich wie ich McDonald’s boykottierte, in der naiven Hoffnung, weltweite Industrien stoppen zu können. Mitten im ersten amerikanischen Fastfood-Restaurant, das in der Innsbrucker Innenstadt in diesen Jahren öffnete, steckte ich mir damals den Finger tief in den Rachen und kotzte. Ich übergab mich mitten unter die verblüfften Besucher, in der Hoffnung, sie nachhaltig zu schockieren und von ihrem nächsten Besuch dieser würdelosen, kapitalistischen Esskultur abzuhalten. (Leider wurde in Folge nur ich selbst von meinem nächsten dortigen Besuch abgehalten – als ich das Lokal mit Handzetteln und Bildern von geschlachteten Kühen und Viehtransporten wieder betreten wollte.) In meiner Agitation gründete ich auch den erfolglosen, an seinem Höhepunkt jedoch immerhin exakt 23 illuminierte Mitglieder zählenden „Club der vereinten CD-Feinde“ und veranstaltete jämmerliche öffentliche CD-Zerstörungen, für die ich leider nur so wenige CDs zusammenbrachte, dass kaum jemand von diesem erbärmlichen Häufchen Plastik Notiz nahm, auf das ich mit einem Hammer einschlug.
Vor allem aber arbeitete ich an meiner ersten Langspielplatte, nach einigen Kassetten meine erste richtige Veröffentlichung, komplett eigenständig produziert und gestaltet. Wirklich „independent“ sollte sie sein, mit allen verfügbaren Instrumenten und technischen Mitteln eingespielt. Ich hatte die Produktion mit geliehenem Geld meiner Großmutter finanziert. (Zur Rückzahlung kam es leider nie.) Ein Bekannter hatte den Kontakt zu der Wiener Plattenfirma Extraplatte geknüpft, und an einem Wochenende Anfang 1987 fuhr ich schließlich mit dem Vierspur-Rekorder und den damit aufgenommenen Bändern im Gepäck nach Linz, um im Studio Fadi Dorningers, eines schon etablierten Musikers der Szene, das „Tod der CD“-Album abzumischen. Mit Hilfe seiner Erfahrung und Ausrüstung konnten wir nun das Maximum aus meinen lärmig-rauschenden Aufnahmen herausholen.
Meine damalige Musik orientierte sich stark an meinen großen amerikanischen Vorbildern. Von verrückten One-Man-Band-Rock’n’Rollern wie Hasil Adkins, in dessen Fanclub ich damals als einziges österreichisches Mitglied sogar offiziell eingetreten war – ein Fanclub, der in seiner Dimension wahrscheinlich meinem hiesigen Club der vereinten CD-Feinde entsprach –, oder dem in fremden Sphären schwebenden Legendary Stardust Cowboy erlernte ich den ungehemmten Umgang mit unkonventionellen Aufnahmetechniken und überraschenden Tempo- und Strukturwechseln. Meine Lieblingsband dieser Zeit, das Straßenmusiker-Trio Violent Femmes aus Millwaukee, beinflusste mich ebenso unüberhörbar. Von ihnen übernahm ich den Gesangsstil sowie viele Ideen der Instrumentierung und der Arrangements. Tag für Tag hatte ich mich in den Proberaum in der „MK“ geschlichen, dort alle Instrumente selber eingespielt und dann verfremdet, soweit es meine Technik und Fantasie erlaubten. Die 18 Stücke des Albums sollten alles beinhalten, was unserer damaligen Untergrund-Musikszene vorschwebte: kurze, verzerrte Popsongs mit rebellischen Texten und dazu jede Menge Beipackmaterial wie Sticker oder Poster. Da ich nicht unnötig in Schulstunden Zeit verlieren wollte, meldete ich mich zur Matura in Kunsterziehung an, um dabei gleich auch an der Gestaltung des Covers arbeiten zu können.
All das geschah in absolut geheimer Mission, worin ich ja schon einige Erfahrung hatte. Niemand in Innsbruck hatte bis dahin völlig auf sich gestellt eine eigene Langspielplatte herausgebracht. Ich wollte einen Knalleffekt, urplötzlich aus dem Nichts heraus alle mit meinem Werk überraschen. Den wenigen Gastmusikern, die an zwei, drei Stellen Instrumente übernommen hatten, die ich nicht selber spielen konnte, gab ich keine Information darüber, dass ich ihre Aufnahmen veröffentlichen wollte. Nach gut einem Jahr heimlicher Produktion bekam ich dann die Testpressungen zugeschickt. Ich konnte es kaum fassen. Jetzt stand der Verwirklichung meines größten Traums tatsächlich nichts mehr im Weg. Nur wenige Wochen später hielt ich dann meine erste Langspielplatte, das, was niemand in meinem Umfeld auch nur zu träumen gewagt hätte, überglücklich in den vor Aufregung schwitzenden Händen.
Im Programmkino „Cinematograph“ organisierte ich den Termin für die Record-Release-Party. Dann erst begann mit Einladungen und Handzetteln mein Leben als öffentlicher Musiker. Meine Freunde und Kollegen bewunderten und hassten mich abwechselnd und gleichzeitig, die lokalen Zeitungen brachten große Artikel und meine Eltern erkannten endlich, wie ernst es mir mit meiner Musik war.
Aufbruch
Von den weit über 1.000 Konzerten, die ich bis heute gegeben habe, prägten sich nur wenige Momente dauerhaft in mein Gedächtnis ein. Zu vergänglich, zu verwirrend und schnell zur Routine geworden war das Leben On The Road. Die guten oder durchschnittlich schlechten Erfahrungen waren bald verdrängt von wenigen außergewöhnlichen Bildern. Besonders gute Momente betrachtete ich cool als Rechtfertigung für jahrelange Mühe, als One-Night-Stands, die bis zum darauf folgenden Tag für gute Laune sorgten, aber keinen langen Eindruck hinterließen. Was dauerhaft blieb waren dagegen die Augenblicke jenes Galgenhumors, der mich immer wieder über vermeintlich ausweglose Situationen rettete und noch Jahre später schmunzeln ließ.
Im Desaster liegt eben das Besondere, im Extremen das Erwähnenswerte. Der Mensch ist ein „Rubbernecker“. Sensationslüstern wird er angelockt von Katastrophen und Skandalen. Er möchte teilhaben an Aufregung und Hysterie, durch die er sich von seiner eigenen Durchschnittlichkeit zu befreien meint. So verschieben sich die Prioritäten der Ereignisse mit dem Laufe ihrer Verarbeitung. Die Daten werden geändert. Wichtige Bestandteile eines Ganzen werden vergessen und verdrängt von stärkeren Eindrücken. Diesem Darwinismus der Realitätsverschiebung fühle ich mich ausgesetzt und will mich ihm auch nicht gänzlich widersetzen, denn er erhält mir die innere Aufregung und den Spaß am Erlebten. Es reicht mir, wenn ich mir regelmäßig darüber bewusst werde, wie ungerecht er ist. So ist auch mein kleines Gehirn im Endeffekt nur ein Boulevardblatt der eigenen Erinnerungen, gefüllt mit Restbeständen meiner subjektiven Wahrnehmung.
Bereits 1982, gleich nach meinem zweiten öffentlichen Auftritt überhaupt – im Alter von 12 Jahren bei einem Sommerfest der „MK“ – wollte ich kurzfristig meine Musiker-Karriere an den Nagel hängen.
Meine Band Jonny X and the Cultbrothers – acht ambitionierte Teenager, die gerade die Volksschule hinter sich gelassen hatten – wurde bei ihrem Versuch, Jazz und Rock zu fusionieren, nicht ernst genommen. Wir eiferten bereits in diesem Alter amerikanischen Fusion-Größen wie Chick Corea’s Return To Forever oder dem Mahavishnu Orchestra nach und konnten es uns gleichzeitig in jugendlichem Überschwang auch nicht verkneifen, Coverversionen wie „Hey, Hey Wickie“ zum Besten zu geben. Dadurch wurden unsere Zuhörer – großteils selbst gerade erst stolz mit ersten Barthaaren geschmückt – natürlich ungewollt erheitert. Bald begleitete uns ein schallendes Gelächter aus dem Publikum durch das gesamte Programm, so dass wir kaum noch unsere eigenen Instrumente voneinander unterscheiden konnten. Jeder falsche Ton sorgte für jubelndes Echo aus den Rängen, lauter als das eigentliche Konzert und kräftiger als unsere schräg groovende Musik. Unser Auftritt wurde zu einer komischen Clown-Nummer, auch wenn der Großteil unseres Programms völlig ernst gemeint war. Diese frustrierenden Reaktionen ließen unsere anfängliche Konzentration bald in Enttäuschung umschlagen. Wir überambitionierten Kinder standen als Opfer des eigenen Übereifers vor einer enthemmten Horde belustigter Beobachter. Deren Lachsalven schmerzten noch lange in meinen empfindlichen Ohren. Die auf uns gerichteten Zeigefinger, die flachen Hände, die inbrünstig auf Oberschenkel schnalzten, erschütterten ein erstes Mal mein Selbstbewusstsein. Doch sie hielten meinen musikalischen Ehrgeiz nicht auf.
Schon drei Jahre später, im Juli 1985, sollte ich mit meiner neuen Formation Funk Taxi vor der größten Menschenmenge meiner gesamten Laufbahn stehen.
Unsere funkige Version der „Neuen Deutschen Welle“ hatte einen Tiroler Bandwettbewerb gewonnen, und wir durften als Vorgruppe der italienischen Rockröhre Gianna Nannini vor 35.000 Besuchern als erste Musiker in der Geschichte im olympischen Skisprung-Areal am Innsbrucker Berg Isel auftreten.
Wir waren unglaublich nervös, als wir nach endloser Warterei endlich durch einen engen Zelt-Korridor auf die Bühne steigen durften. In unserer einstudierten Choreographie war geplant, dass wir einzeln, mit ausgedehnten Abständen nacheinander auf die Bühne kommen sollten. Dem Saxophonisten, der als erster vor diese unüberschaubare Menschenmenge hinaustreten sollte, versagten jedoch gleich einmal die Nerven und er verweigerte seinen Auftritt. Mit zittrigen Händen mussten wir ihn förmlich auf die Bühen stoßen, und zu seinem großen Bedauern dauerte es dann auch noch elendslang, bis er endlich Unterstützung bekam – denn auch der nächste Musiker wagte den letzten Schritt ins Rampenlicht nur zögerlich. Irgendwann standen wir schließlich gemeinsam draußen, am hellen Nachmittag von grellen, heißen Scheinwerfern bestrahlt, umgeben von einem Wald von mir großteils noch völlig unbekannten technischen Geräten. Vorsorglich hatte ich mir mit meinen schulterlangen Haaren einen schützenden Vorhang vor meinen Augen errichtet, der meine Sichtweite auf mein Mikrofon und meine Gitarre begrenzte. Nur so, ohne auch nur ein einziges Mal in die Menge zu schauen, traute ich mich überhaupt zu spielen und zu singen.
Doch diese ungeheure Menschenansammlung vor mir blieb gespenstisch still. Weder zwischen noch während unserer Stücke konnte ich irgendein zustimmendes oder ablehnendes Geräusch von ihr vernehmen. Während ich von meinen Kiss- oder Queen-Live-Alben nur fanatisches Publikumsgeschrei während der gesamten Konzerte kannte, musste ich zu meiner großen Irritation hier das Gegenteil, ein absolutes Desinteresse der Zuschauer, erleben. Und so wandelte sich meine anfängliche Nervosität langsam in fassungslosen Frust, meine ursprüngliche Begeisterung in Resignation. Gegen Ende unserer Darbietung wollte ich die Sache nur mehr möglichst schnell hinter mich bringen. Ich erhoffte mir kein Echo mehr auf unsere Musik. Da ließ mich das plötzliche Losbrechen tosenden Beifalls, ein unverhoffter Begeisterungsschwall, der auf einmal durch die Menge ging, noch ein letztes Mal durch meine Haare hervorblinzeln. Hatten wir sie endlich geknackt, war unser „Funk“ nun doch bei ihnen angekommen?
Bitter enttäuscht musste ich feststellen, dass der Applaus nicht uns galt.
Drei Fallschirmspringer waren mit einem Werbebanner im hinteren Bereich der Skisprung-Arena gelandet, und das gesamte Publikum hatte sie jubelnd empfangen. Zehntausende Rücken waren uns zugewandt. Mir wurde ein für alle Mal klar, dass in Tirol der Sport weit mehr Macht besitzt als die Musik.
Nach diesen demoralisierenden Erfahrungen wollte ich mich mit dem kleinstädtischen Leben in Innsbruck nicht mehr zufrieden geben. Es zog mich aus der von Bergen eingekesselten Stadt in die Welt hinaus. Ich wollte meinen Horizont erweitern, die engen Grenzen überscheiten, an die ich in der Heimat ständig stieß. Im Dickicht fremder Großstädte wollte ich untertauchen, Untergrund-Bahnen fahren und im Underground zu Hause sein.
Wien – Berlin
Hungrig nach größeren Taten zog ich am ersten Tag nach dem Schulabschluss nach Berlin, wohin mich Peter Hollinger, ein renommierter deutscher Free Jazz-Schlagzeuger, eingeladen hatte. Ich hatte ihn kurz zuvor bei einem Konzert seines Avantgarde-Trios um Alfred Harth im Innsbrucker „Bogen 13“ kennen gelernt, wo sich unser beider Energien sofort gegenseitig angezogen hatten.
Er war wie ich besessen von seiner Musik und unterstellte ihr kompromisslos sein gesamtes Leben und alle sozialen Beziehungen. Ich war wie er im Sternzeichen des Skorpion geboren – ein Umstand, den ich bis dato nicht bemerkt hatte, der ihm lustigerweise jedoch besonders wichtig war und durch welchen er unsere Ähnlichkeiten zu erklären pflegte. Hollinger war zu diesem Zeitpunkt genau doppelt so alt wie ich, nämlich 34. Diese Tatsache faszinierte uns wohl beide. Ich gab ihm frische Energie und riss ihn mit meiner geradlinigen Zielstrebigkeit in die Zukunft mit, während er mir mit seiner Erfahrung und seinen Kontakten imponierte. Er lebte in einer schmutzigen Großstadt, wo es eine Graffiti-besprühte U-Bahn gab (das deutlichste Symbol für mein damaliges Verlangen nach urbaner Freiheit und Anonymität) und jeden Abend verschiedene subkulturelle Konzerte zu sehen waren, und reiste mit seiner Musik durch die halbe Welt. Er stellte also genau das dar, wonach ich strebte, und wurde nicht nur zu meinem Partner, sondern zugleich auch zu meinem Idol.