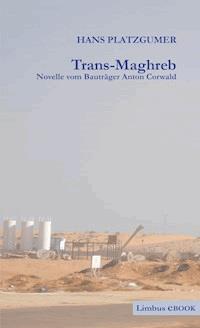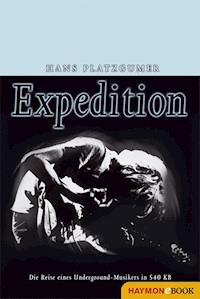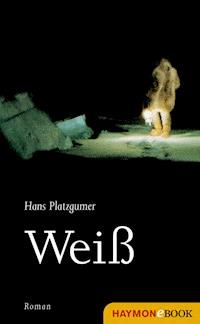
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Haymon Verlag
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Die oberflächliche Betriebsamkeit einer deutschen Großstadt lässt in Sebastian Fehr die Sehnsucht nach einer elementaren Veränderung wachsen, die seinem Leben eine neue Richtung geben könnte. Zu finden hofft er diesen Neubeginn auf einer Reise in die Arktis. Doch im endlosen Weiß der Schneewüste, in der unendlichen Stille und Kälte des Nordens gerät Sebastian Fehr viel weiter an seine eigenen Grenzen, als er gewünscht hätte: Das gleißende Licht blendet ihn und raubt ihm seine Sinne, in der totalen Einsamkeit überkommen ihn Wahnvorstellungen, er läuft Gefahr, sich zu verlieren - der Selbstfindungstrip gerät zum elementaren Überlebenskampf. Hans Platzgumer gelingt in seinem neuen Roman ein grandioses Werk über die faszinierende, raue Schönheit der Arktis, über die unwiderstehliche Anziehungskraft ihrer abweisenden Natur und über die ungeahnten Möglichkeiten der Veränderung.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 350
Veröffentlichungsjahr: 2013
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Hans Platzgumer
Weiß
Roman
INHALT
MØRKETIDEN
SOL DAG
SVALBARD
OSTROW BRJUSA
ALBEDO
ABER BEI SICH
Ungekürzte E-Book-AusgabeHAYMON Verlag, Innsbruck-Wien 2013www.haymonverlag.at
© 2008 by Skarabæus Verlag Innsbruck-Bozen-Wien in der Studienverlag Ges.m.b.H. Erlerstraße 10, A-6020 Innsbrucke-mail: [email protected]
Alle Rechte vorbehalten. Kein Teil des Werkes darf in irgendeiner Form (Druck, Fotokopie, Mikrofilm oder in einem anderen Verfahren) ohne schriftliche Genehmigung des Verlages reproduziert oder unter Verwendung elektronischer Systeme verarbeitet, vervielfältigt oder verbreitet werden.
Abhängig vom eingesetzten Lesegerät kann es zu unterschiedlichen Darstellungen des vom Verlag freigegebenen Textes kommen.
ISBN 978-3-7099-3549-1
Buchgestaltung nach Entwürfen von Kurt HöretzederCover: Skarabæus Verlag/Karin Berner unter Verwendung eines Fotos von Wally Herbert (aus: Wally Herbert: Polarwüsten. Die Erschließung von Arktis und Antarktis. Glasgow 1971)Satz: Skarabæus Verlag/Thomas AuerLektorat: Skarabæus Verlag/Georg Hasibeder
Dieses Buch erhalten Sie auch in gedruckter Form mit hochwertiger Ausstattung in Ihrer Buchhandlung oder direkt unter www.skarabaeus.at.
MØRKETIDEN
Weiß.
Nichts als Weiß.
Schmutziges Weiß.
Fast weiß wie dieses Blatt Papier.
Fast weiß wie das Franz-Joseph-Land in seinem arktischen Winter.
Grelles Weiß. Ein stilles Nichts. Ein starrer Klumpen Eis.
Kein Schnee, den der Polarwind verweht.
Kein eisiges Wasser, das seiner Herkunft entfließt.
Keine Bewegung mehr.
Eine starre Unterlage sein für ein gefrorenes Land. Danach hatte er sich gesehnt.
Er hatte sein Leben zu verachten begonnen, so sehr, dass er ihm eine Existenz als Eisblock vorzog. Er hatte diese Veränderung gesucht und nicht bemerkt, als er sie gefunden hatte.
Sie war zuerst ein pochender Schmerz, ein Brennen seiner Augen, ein Bersten seiner Schläfen. War ein monotones Brummen, das immer lauter wurde in der Stille und hineinführte in das Nichts, in dem er sich schließlich verlor.
Er öffnete dieser Leere seine Augen so weit, dass er sie nicht mehr schließen konnte, nur mehr hineinstarren konnte in sein eigenes Weiß, das seine erweiterten Pupillen aufgesaugt hatten mit ihrem letzten Blick.
Sie gingen unter in diesem Eismeer aus Nichts, in kontrastlosem, gleitendem Weiß, das ihn mit seiner Drift hätte hinübertransportieren sollen in die Einfrierung.
Und als er ohne seine Augen wieder auftauchte, bemerkte er es nicht, verstand nicht, dass er gefunden, was er gesucht hatte.
Weiß war das letzte Bild in seinem alten Leben gewesen.
„Seit Tagen starre ich auf die Bergkuppen des Nordenskiöldlandes. Die Gletscherzungen des Longyearbreens und des Larsbreens, die ins Tal hinunterführen, Eis, Schnee und Geröll abtransportieren. Die Gipfel des Lars Hiertafjellet, des Trollsteinen, des Teltberget, die über ihnen thronen. Die weißen Hänge des Karl-Bay-Fjellet, der sich westlich von mir erhebt. Und natürlich der Nordenskiöldfjellet, der die gesamte Landschaft umschließt. Erstarrt sind sie, diese Berge. Graues Basaltgestein, 80 Millionen Jahre alt, von verschieden dicken Schichten Eis überzogen.
Erste Schneeverwehungen haben die Moose und Flechten zugedeckt, die sich an den Talausläufern während der kurzen Sommerwochen gebildet hatten. Sie verbannen jede wieder alle Farbe aus der Eiswelt, alles wird weiß und grau, in unterschiedlichen Nuancen. Gräuliches Weiß, soweit das Auge reicht. Auch die Fjorde, die in großer Entfernung das Inselland durchschneiden, tragen nicht mehr die Farbe der schwarzen See, sondern schwemmen das erste Packeis heran. Bald wird der Eispanzer das Wasser unter sich begraben haben. Nichts fließt dann mehr. Alles starr und bewegungslos.
Ich starre es an. Seit Tagen und Nächten habe ich diese Eiswüste Spitsbergens studiert. Die schroffen Klippen ohne jegliche Vegetation. Die sanft auslaufenden Schneehänge. Sitze hier und starre sie an. Ich kenne inzwischen all ihre Formen und Schattierungen. Ich könnte meine Augen schließen und genau nachzeichnen, wo die Schneedecke noch offen ist oder Felsbrocken das Schneelicht schlucken, das die Sonne Tag und Nacht auf das Land wirft.
Die Mitternachtssonne kreist nur mehr in flachen Bahnen am Horizont. Bald wird sie im Süden verschwinden. Doch noch erhellt ihr ständiges Licht den arktischen Himmel über mir. Ihre Strahlen schneiden sich durch den Eisnebel, der vom Tal heraufzieht. Es ist ein diffuses weißes Leuchten, das mich, meine Hütte, die gesamte Eislandschaft Tag und Nacht umhüllt. Die Sonnenstrahlen brechen sich auf den weiten Schneefeldern. Die Eiskristalle reflektieren unscharfe Lichtbündel. Das Licht hat kein Zentrum. Es ist überall.
Ich könnte meine Augen schließen und blind die Begrenzungen des Dryad-Gletschers im Süden abmessen, wissen, wo er bei guten Sichtbedingungen den Blick freigibt auf das Hinterland Spitsbergens. Ich könnte meine Augen schließen und blind weiterschauen ins Nordenskiöldland. Doch ich kann nicht wegsehen. Keine Minute will ich missen von diesem stillen Spektakel. Nichts verpassen im Nichts. Wenn meine Netzhäute austrocknen, dann befeuchte ich sie mit Novesine 0.4-Augentropfen. Das anfängliche leichte Brennen geht schnell vorüber. Ich will meine Augen der Schönheit dieses Landes nicht verschließen. Will keine Ablenkung. Nichts, das mich daran hindert, in das Weiß zu tauchen. Die Kälte, die Schmerzen. Sie können mir nichts anhaben. Ich spüre sie nicht mehr. Die Analgetika haben sie abgeschaltet. Haben die Schwäche in mir betäubt. Nichts wird mir im Weg stehen.
Ich sitze auf dem Brettervorbau meiner Hütte und betrachte das Land. Mehr will ich jetzt nicht tun. Mehr kann ich nicht tun. Mehr gibt es nicht zu tun. Manchmal stehe ich auf und gehe in das Weiß hinein, höre den Schnee knirschen unter mir. Dann lege ich mich auf den Boden und starre in den Polarhimmel, bis ich so kalt geworden bin, dass ich kaum mehr aufstehen kann, es kaum mehr zurückschaffe zum Holzofen der Trapperhütte. Ich habe keine Angst vor der Kälte. Keine Angst vor dem Licht. Ich nehme alles hier in mich auf. Brauche nichts anderes mehr. Sitze in meiner Hütte und warte, bis unten im Adventfjorden ein Schiff anlegt. Bis die Sabotin kommt und mich mitnimmt. Weiter hinein ins Eis.“
Ein kalter Nordwind blies Sebastian Fehr ins Gesicht, als er seine wöchentliche Wanderung von Karsons Trapperhütte aus nach Longyearbyen unternahm, um die notwendigsten Einkäufe zu machen. Ein früher Vorgeschmack auf den Winter hatte eine dünne Schneeschicht über das ganze Land gelegt. Es war August geworden und die Mitternachtssonne zog ihre Kreise bereits tief auf dem südlichen Himmel Spitsbergens, der größten Insel des arktischen Archipels Svalbard.
Der Mann hielt einen gleichmäßigen Schritt. Die Windstopper-Jacke eng zugeknöpft. Eine Wollmütze tief ins Gesicht gezogen. Mehrere Schichten Unterwäsche und Pullover hielten seinen Körper warm. Er schwebte nahezu über die Schotterberge ins Tal. Eine Filmtablette Diclobene und ein Voltaren Retard hielten die Schmerzen fern, die das grelle Schneelicht in seinen Kopf brannte.
Er hatte wenig gegessen in den letzten Tagen. Der Proviant war nur langsam ausgegangen, denn sein Magen hatte sich bereits an die zu kleinen Portionen gewöhnt. Sebastian war selbst erstaunt darüber, wie lange man mit so wenig Lebensmitteln auskommen konnte. Man brauchte wenig, wenn man wenig hatte. Wenn man es liebte, wenig zu haben und wenig zu sein.
Alles Leben in der hohen Arktis ist dürftig. Es muss lernen, mit einem Minimum auszukommen, genügsam zu sein, warten zu können. Warten, bis die Schneedecke sich lichtet. Warten, bis es wieder etwas gibt. Warten, bis das Schiff abfährt.
Tagelang verharrt der Eisbär am Atmenloch der Robbe. Wartet, bis sein Fressen eines Tages auftauchen wird. Er hat wochenlang schon keine Beute mehr gemacht.
Hinter ihm wartet in sicherem Abstand der Polarfuchs auf die Reste. An verschiedenen Stellen in seinem Revier hat er Möweneier und andere Beutestücke vergraben – als Notration für die Tage im tiefen Winter, wenn es wirklich eng wird.
Das Svalbard-Rentier wird nur maximal 5 Jahre alt. Es hat ein dickeres Fell und kürzere Beine, aber nur ein Drittel der Lebenserwartung seiner Verwandten in Sibirien, Lappland oder Alaska, den Karibus. 98 Prozent der eisfreien Zeit verbringt es damit, sich mit kleinen Flecken weißen arktischen Mooses einen Winterbauch anzufressen. Dabei beißen die Tiere auf so viel Schotter, dass ihnen die Steine im Lauf weniger Jahre das Gebiss zerstören. Ohne Zähne sind sie dann dem unausweichlichen Tod ausgeliefert. Über das ganze Land verstreut liegen die toten Rentiere, die mit abgewetzten Zähnen keine Nahrung mehr zu sich nehmen konnten. Und da liegen auch kleine Rentier-Babys, die nie geboren wurden. Ihre Mütter haben erkannt, dass das Futter nicht für die Aufzucht eines Kindes reichen würde, und von ihrer Fähigkeit Gebrauch gemacht, das Junge in ihrem Bauch abzutreiben. Die Kadaver liegen auf dem Land verstreut: Futter für die Fleischfresser.
Schneehühner wiederum halten sich – wenn sie ihren Jägern bis in den Winter entkommen sind – unter den Schneeschichten auf, wo sie nach Beeren und Samen scharren. Über ihnen schleicht der Polarfuchs auf der Schneedecke. Er riecht den Hühnerbraten und wartete auf das Tauen des Schnees.
Monatelang wartete auch der Trapper Paul Johan Bjørvig, der 1898 mit einem Kameraden und einigen Schlittenhunden in einer mit Walrosshäuten und Bärenfellen abgedeckten Steinhütte auf Svalbard überwinterte, auf das Ende der Polarnacht. Nachdem sein Kamerad Bernt Bentsen an Skorbut gestorben war, wollte er dessen Leichnam nicht den Hunden und Bären überlassen und bewahrte ihn über die Monate bis zur Rückkehr der Sonne steifgefroren neben seinem Schlafsack auf. „Vielleicht überlebe ich hier ja doch!“, hatte er in sein Tagebuch geschrieben.
Er starb erst 34 Jahre später.
Warten. Warten. Geduld. Geduld. Das lehrt die Arktis.
Sie lehrt ihre Lebewesen, dass es auch mit weniger geht. Mit immer weniger. Bis schließlich nichts mehr übrig bleibt. Nichts mehr geht.
Sebastian Fehr wollte diesen Endpunkt nicht hier auf Spitsbergen erwarten. Die Insel war nur eine Zwischenstation für ihn. Bald würde die Sabotin kommen und ihn weiterbringen. Und bis zu diesem Zeitpunkt, wenn seine Schonfrist auslief, musste er seinen leeren Rucksack nur in die Bergarbeitersiedlung Longyearbyen tragen und im Svalbardbutikken auffüllen.
Eine Kreditkarte erleichtert das Überleben in der Arktis ungemein.
Sebastian hatte aufgehört, frische Lebensmittel zu verlangen. Zu Beginn hatte er noch Lachssteaks eingekauft, Walfleisch und Toastbrot. Milch gab es ohnehin kaum, und auch Obst und Gemüse waren praktisch nicht erhältlich. Dafür waren die Vitamintabletten deutlich günstiger als in Deutschland. Sebastian genügte es mittlerweile, alle ein, zwei Wochen eine volle Mahlzeit im Barentsz Pub einzunehmen. Abwechselnd den Robben-Eintopf oder das Rentier-Steak mit Kartoffelpüree. Und für die Zeit dazwischen hatte er neben Müsli- und Schokoladeriegeln, weichen norwegischen Waffeln, Mors Flatbrød-Pulver, das er mit Wasser zu Fladen anrührte, sowie seinen täglichen Tablettendiäten eine neue Form der Nahrungsaufnahme entdeckt.
Der Svalbardbutikken war nämlich bestens mit Überlebensnahrung ausgestattet. Eine große Auswahl vakuumverpackter Survival-Lunches stand in den sonst spärlich gefüllten Regalen. Hier gab es die ideale Ernährung für Trekker, Extrem-Camper und Abenteurer.
Nein, er war kein Trapper, kein Selbstversorger, der sich mit ausgetüftelten Holzfallen seine Nahrung beschaffte. Er war kein Fangstemen wie Karson, der die Trapperhütte im Endalen vor vielen Jahren errichtet hatte, sondern ein Wartender. Saß in seinem Warteraum aus Ulmenholz, 3 × 6 Meter klein, mit vier kleinen Fenstern. Saß oder lag auf einer mit Schaumgummi bespannten Liegereihe, an einem Brettertisch auf Holzpfählen.
Der Ofen brannte auf der kleinsten Flamme. Das Küchenbrett blieb großteils unbenützt. Das Plumpsklo war außen angebaut, daneben ein guter Vorrat an Brennholz aufgestapelt. Den abgetrennten Eingangsbereich der Hütte, der als Kühlschrank diente, hatte Sebastian Fehr nicht in Verwendung.
Die Nahrung, die er auspackte, wenn er von seiner Einkaufstour nach Longyearbyen ins Endalen zurückkehrte, bedurfte keiner speziellen Lagerung. Sie war für die Ewigkeit verpackt. Noch so große Hitze oder Kälte konnte man diesen metallbeschichteten Vaku-Packs zufügen; ihr dehydrierter Inhalt behielt seine Form. High-Tech-Nahrung für den erhöhten Kalorien- und Nährstoffbedarf in Extremsituationen. „Adventure Food“, entwickelt vom holländischen Abenteurer und Expeditionsprofi Hans van der Meulen. Adventure Food, das nichts mehr mit dem englischen Walfänger „Adventure“ zu tun hatte, der 1656 an diesen Küsten jagte und nach welchem der Adventfjorden Longyearbyens und das Adventdalen benannt wurden.
Die silbernen Mahlzeit-Beutel wogen nur 250 Gramm, weil ihnen durch chemische Verfahren das Wasser vollständig entzogen wurde. Nun musste man ihnen beim Erhitzen nur wieder Flüssigkeit zuführen, und schon hatte man ein abwechslungsreiches Dinner inmitten der Wildnis. Auf dem Küchenbrett der Karson-Hütte stapelten sich Beutel mit verschiedensten Geschmacksrichtungen: Cashew Rice, Curry with Fruit, Leek Hotpot – wahlweise mit oder ohne Schinken –, Rice Satay, Chicken Ceylon, Gulasch, Macaroni Cheese, Spaghetti Bolognese, Walnut Chicken. So unterschiedlich ihre Namen klangen, sie sahen einander zum Verwechseln ähnlich, rochen und schmeckten fast gleich.
Sebastian Fehr war es einerlei. Diese Art der Nahrungsaufnahme gehörte zu seinem neuen Leben. Er aß Globetrotter Lunch „Ungarisch“, „Försterin“, „Gärtnerin“, die Blaubeersuppe, probierte die Reispfanne „Balkan“ oder „Indonesia“ und an besonderen Tagen gönnte er sich Beef Stroganoff oder den Elchfleisch-Gourmet-Topf. Ohne es definieren zu können, nahm er auf diese Weise Eier, Nüsse, Soja, Milchpulver, Fleischfasern und jede Menge Glutamat E621 zu sich. Um noch mehr Abwechslung in seinen Menüplan zu bringen, tröpfelte er schwedisches Albaöl, ein speziell entwickeltes Rapsöl mit Buttergeschmack, auf sein Flatbrød.
Doch eine Erinnerung an seine alten Welt durfte selbst hier im Nordenskiöldland nicht fehlen: Rotwein. Da es zu mühsam gewesen wäre, Weinflaschen auf das Hochplateau zu schleppen, hatte Sebastian Fehr keine Auswahl. Der einzige dehydrierte, in Beutelform verfügbare Wein hieß „Rouge – Getränkepulver Typ Glühwein“. 60 Gramm Pulver, das in 200 ml Wasser aufgerührt ein wein-ähnliches Produkt mit 9,27 Prozent Alkoholgehalt ergeben sollte. Es war in keiner Weise auch nur mit dem drittklassigen Merlot des Barentsz Pubs vergleichbar. Ein erschreckender Gestank machte sich breit, sobald man den Beutel öffnete, und es bedurfte einiger Überwindung, einen Becher davon an den Mund zu führen. Doch er gewöhnte sich daran. Er war nicht in die Arktis gefahren, um kulinarische Leckerbissen zu genießen. Jetzt ging es nur mehr darum abzuschließen mit dem Alten und sich bereit zu machen für das Neue.
Der Einsiedler im Endalen spülte die Tramal Long 200 Filmtablette mit einer Tasse „Rouge“ hinunter und starrte auf das endlose Schneefeld vor seiner Hütte.
Wie schön sie waren, die arktischen Gebirgsmassive.
Wie mächtig und still. Leer und weiß, weiß, weiß, soweit das Auge reichte.
Von seinem Bürofenster aus hatte er die Jahre zuvor noch die Wolkenkratzer der Frankfurter City beobachtet, wie sie in klamme Nebelmäntel gehüllt oder glühende Sonnenuntergänge getaucht wurden. Jeden Tag sahen die Hochhaustürme ein wenig anders aus. Sie wurden alt, sie wurden neu, sie wurden kalt und heiß, sie glänzten und ermatteten. Wie er befanden sie sich ständig in Unruhe und kamen dennoch nicht vom Fleck. Sebastian mochte diese Skyline, die wie von selbst wuchs. Seit ihn eine freie Stelle als Produktionsassistent bei der Rundfunkanstalt hierher gezogen hatte, bestaunte er diese gläsernen Betonklötze. Immer waren sie da. Und doch ließen sie ihn in Ruhe. Er freute sich, wann immer ein neuer Turm gebaut wurde. Von seinem Bürosessel aus beobachtete er die Fensterputzer, die in schwindelnden Höhen ihrer Arbeit nachgingen. Beneidete diese Männer um die Klarheit ihrer Aufgabe. Sie turnten auf ihren Gerüsten hoch über den Dächern der Innenstadt. Sie putzten die Fenster der Hochhäuser, damit die Leute, die hinter diesen Fenstern arbeiteten, sie dafür beneiden konnten.
In den Kabinen unter der Stadt war die Einsamkeit größer als in der Höhe. Die Welt des Sex war lauter, bunter und schmutziger als das Treiben außerhalb ihrer neonbeleuchteten Eingangstüren. Schonungslos führte sie den zu ihr Flüchtenden ihre Verlassenheit vor, entführte sie in Abteile mit 128 Pornokanälen und Taschentüchern.
In auffällig penetrantem Geruch von desinfizierenden Raumsprays, die die Luft nicht zu verbessern, sondern lediglich andere Gerüche gewaltsam zu verdecken hatten, war Sebastian allein mit sich. Allein mit dem Stöhnen der Lautsprecher, den Reißverschlüssen aus den Nachbarkabinen, dem Klimpern der Münzen, wenn die Zeit auslief. Allein mit dem alten Sperma seiner Vorgänger im Müllbehälter.
Er hielt es nicht besonders lange aus in diesen Lustzellen. Bald graute es ihm vor den engen schwarzen Wänden, mit denen er jede Berührung penibel vermied, vor dem abgewetzten Sessel und den Filmen, die er geboten bekam. Er ekelte sich vor seiner Umgebung und vor sich selbst und schlich rasch, so unauffällig wie möglich, wieder hinaus aus diesem Ambiente. Gleich unauffällig, wie er sich zuvor hineingeschlichen hatte.
„Hallo. Guten Tag. Buon giorno! Willkommen im Centro Lingue Mediterranee. Mein Name ist Claudio Ternotti, ich bin ihr Kursleiter. Benvenuto. Um es vorwegzunehmen: Ich bin Deutscher, aber ich komme aus einer italienischstämmigen Familie. Ich freue mich, Sie gemeinsam mit meiner reizenden Assistentin Angela Celina – sie ist native speaker und stammt aus Kalabrien – herzlich zum Frühjahrs-Kurs begrüßen zu dürfen. In den nächsten zehn Wochen werden wir uns hier wöchentlich treffen, um gemeinsam Italienisch zu lernen, zu hören und zu sprechen. Per imparare l’italiano. Wir werden die Scheu davor verlieren, einander in dieser wunderbaren Fremdsprache anzusprechen. Und darüber hinaus werden sich sicherlich auch andere Anlässe und Verabredungen finden, um das Gelernte zu vertiefen.
Italiano. Das ist die Sprache der Liebe und der Gefühle. Welche Sprache könnte sich also besser eignen, um die Partnerin oder den Partner für die nächste Saison oder vielleicht sogar für das ganze Leben kennenzulernen? Dieser Kurs speziell für Singles soll Sie in die Kunst des parlare italiano und die Geheimnisse eines Flirts auf Italienisch einführen. Angela und ich freuen uns, Sie in den kommenden Wochen bei Ihren Fortschritten begleiten zu dürfen.
Sie sind hierhergekommen, um einander näherzukommen und um diese wunderbare südländische Sprache zu erlernen, ihre Lebensart zu praktizieren. Also bitte ich Sie: Seien Sie nicht schüchtern! Der Südländer geht bei Flirts mit großer Romantik, aber auch einer erfrischenden Direktheit zur Sache. Machen wir es ihm nach!
Als erstes wird sich jeder der Gruppe vorstellen und uns Name, Alter und Interessen verraten. Angela wird dies gleich simultan übersetzen, damit Sie hören, wie Sie in Italienisch klingen! Also: Wer will der erste sein?“
„Ja … ich heiße Charlotte Kinsmuth. Mi chiamo Charlotte Kinsmuth. Bin 38 Jahre alt. Ho 38 anni. Sono nata a Wiesbaden ma vivo a Francoforte da più di cinque anni. Lavoro nello studio di un avvocato, non lontano da qui. Si … Bene … Il mio partner ideale non l’ho ancora trovato, ma so che esiste. La fuori lui è sicuramente da qualche parte, forse è addirittura qui nella stanza? Lo potrei immaginare bene, se solo mi girasse intorno. Sono aperta a molte cose. Mi piace il divertimento, vado volentieri al cinema o in discoteca. L’Italia mi attrae molto, il cibo, il mare, il sole, gli uomini. Ci vado almeno una volta l’anno in vacanza. Per questo vorrei imparare l’italiano ancora meglio.“
Die romanischen Vokabeln betörten Sebastian. Wie Aphrodisiakum hallten sie durch Kopf und Körper bis tief in ihn hinein. Charlotte war von Beginn an neben ihm gesessen und versprühte den Duft einer echten Frau. Kein Model aus dem Fernseher. Keine Pornqueen, nein, eine echte Frau aus Fleisch und Blut. Sebastian roch ihre Haut und ihr Parfum. Sie wirkte jugendlich und lebhaft. Dennoch konnte man ihr die 34 kaum abnehmen. Sie verdeckte eine verlorengegangene Jugend unter einer Fassade aus gespielter Naivität und modischer Kleidung. Mit Foundation und Concealer malte sie sich ein junges Gesicht. Die Hände, die sie nicht mehr jünger malen konnte, pflegte sie unter mit den Fingern langgezogenen Langarm-T-Shirts zu verbergen, mit deren Ärmelrändern sie verlegen spielte. Offensichtlich sah sie viele TV-Serien mit reizenden Jugendlichen.
„Nein, Lieblingsfilm habe ich eigentlich keinen bestimmten. Das Schweigen der Lämmer fand ich klasse. Du auch? Aber ich muss gestehen, dass ich eigentlich nur Filme mit Happy End mag. Ich meine jetzt nicht die Schnulzen! Du weißt schon … es ist nur … wenn der Held am Ende stirbt … ich weiß, so etwas muss es auch geben, ja, das ist ja wahrscheinlich auch realistischer hin und wieder … aber das ist dann halt nicht so mein Fall.“
Der Aufwand, den diese Frau mit ihrer Maskierung betrieb, ließ in ihr ein erotisches Verlangen vermuten, das ein suchender Mann, auch wenn er ihre Täuschung entlarvte, in jedem Fall zu honorieren bereit war. Er spürte ihre Nähe, wenn sie im Institut neben ihm saß, wenn sie in der Pizzeria, in die sie regelmäßig nach dem Kurs gingen, neben ihm saß, ihre Insalata mista auf Italienisch bestellte und dabei verlegen kicherte.
Eine Frau saß neben ihm. Gerne hätte er mehr von ihr erfahren, doch sie blieb in ihrer Konversation auf einem dem Kursvokabular entsprechenden oberflächlichen Niveau. Vielleicht hätte auch sie gerne mehr von Sebastian Fehr erfahren, aber er wollte die Stimmung nicht mit Geschichten aus seiner bedrückenden Vergangenheit oder seinem ereignislosen Alltag verderben.
Die Gemeinsamkeiten, die ihnen noch als Gesprächsthema zu taugen schienen, waren nach drei Wochen erschöpft. Dann saß sie aber wenigstens schon in seiner Wohnung neben ihm auf dem Ledersofa, ein Glas Prosecco in der Hand. Zwei Menschen warfen einander unzusammenhängende italienische Floskeln zu, die sie bei ihrer einzigen Gemeinsamkeit, dem Sprachunterricht, aufgegabelt hatten. Sie kicherten. Bis auch diese Unterhaltung verebbte.
Kein Wort mehr dann.
Zum Glück floss Alkohol in ihrem und in seinem Blut.
Sebastians vor Aufregung schwitzende Hand begann ihren rechten Oberschenkel zu streicheln.
In den folgenden Unterrichtsstunden saß Charlotte nicht mehr neben ihm. Sie grüßten einander nur mehr mit ausweichender Höflichkeit. Er war ihr entweder zu weit oder nicht weit genug gegangen.
„Und? Hat sich bei dir mit Charlotte noch nichts ergeben? Ihr scheint euch doch schon prächtig miteinander amüsiert zu haben. Na, collega?“
„Zum Glück habe ich mich weder blamiert noch ein Kind gezeugt“, hätte Sebastian am liebsten geantwortet.
„Hast du die Frankfurt Galaxy am Wochenende gesehen? Das war ein Spiel. Dieses Jahr ist crazy. Die mischen in der Liga so richtig mit. Wenn das so weitergeht, kommen wir noch zum World Bowl, sag ich dir. World Bowl! Yeah. Let’s kick some fucking ass!“
Dieter Begmann, der nun neben ihm saß, erinnerte Sebastian an die Hauptdarsteller aus den Pornofilmen in den Kabinen. Schon deshalb versuchte er, Distanz zu seinem neuen Nachbarn zu wahren.
„Ich bin froh, jetzt hier vorne neben dir zu sitzen. Mit der blonden Tussi da hinten lief sowieso nichts. Italiener stehen ja wohl auf alles, was blond ist. Aber ich habe da einen anderen Geschmack, einen etwas … ausgereifteren Geschmack, wenn du verstehst. Diese Angela Celina zum Beispiel. Mensch … das ist eine süße Maus. Die würdest du wohl auch nicht von der Bettkante stoßen, was? Auch wenn ich kaum ein Wort verstehe, das sie sagt; ich sehe ihr unglaublich gerne beim Reden zu. Da kann sie sich noch so keusch geben. Das tun die ja gerne, die Südländerinnen. Geben sich erstmal schön artig und brav. Aber im Bett, wenn’s dann mal knallt, ich sag dir, dann geht da richtig die Post ab!“
In Dieter Begmann regierte bereits die Ungeduld. Verena Saalt bot sich an. 35, aus Würzburg. Was auch immer. Hennagefärbte, rote Locken. Eng geschnittene Hemdchen. Ihre Lippen formten sich nach jedem Wort zu einem Lächeln, zu einem Kussmund, der, wenn er auch aufgesetzt und verkrampft wirkte, Männerfantasien in Wallung brachte.
Es dauerte nicht lange. So einfach kann es sein, das Liebesleben. Da musste nicht lange um den heißen Brei herumgeredet werden. Zwei Kinokarten zu „Kill Bill“. Caipirinhas. Und dann ab die Post.
Danach tauchte Verena nie wieder im Sprachinstitut auf. Gut gelaunt hatte sie bei Dieter noch geduscht, sich freundlich verabschiedet. Und weg war sie gewesen. Nie mehr wiedergesehen.
Die Kursteilnehmer munkelten, dass sie gar kein Single war, sondern nur ein sexuelles Abenteuer gesucht hatte. Nach erfolgreicher Mission habe sie sich wohl wieder nach Hause verzogen, heim in eine andere Welt, zurück zum Ehemann und eventuell sogar zu ihren Kindern. Man bezweifelte sogar, ob ihr tatsächlicher Name überhaupt Verena war, ob sie in Wirklichkeit nicht etwa Hildegard, Gundula oder gar Mechthild hieße.
Es wurde auch getuschelt, dass sie wegen Dieter Begmanns bizarren sexuellen Vorlieben den Kurs verlassen habe. Sado-Maso und so Zeug. Er habe sie damit vertrieben. „Das kann ich gut verstehen. Ich möchte mich auch nicht im Bett fesseln und schlagen lassen müssen! Ekelhaft.“
So saßen die in ihrer Männlichkeit verwirrten Männer noch wenige Wochen nebeneinander. Ein gebranntes Kind neben dem anderen. Ein großer Abstand zwischen ihnen. Und dann war der eine weg. Zurück im „Dyck Studio“, seinem Fitness-Center in der Städelstraße.
Und bald war auch der andere weg. Zuhause. Zwei Zimmer, 52 Quadratmeter, eine Altbauwohnung im Frankfurter Bahnhofsviertel. Der Besitz, den Sebastian über die Jahre angesammelt hatte und der ihm nichts bedeutete, lag ordentlich gestapelt auf Ikea-Regalen und Ablagen. CDs für die Stereoanlage, DVDs als Futter für seinen Flachbildschirm, ein PC, Bücher, Kleidung, ein Bett und ein schwarzes Ledersofa. Die Dinge waren ihrer praktischen Verwendung nach angeordnet. Standen dort, wo sie am wenigsten Platz brauchten und am besten ihrem Zweck dienen konnten. In Reichweite, was er öfter brauchte, weiter entfernt, was er selten anrührte. In den Kästen unten, was man immer vergaß und ohnehin hätte wegwerfen können.
Sebastian hatte sich an die Müdigkeit gewöhnt, die von dieser Behausung ausging. Auch wenn die Wohnung verhältnismäßig ruhig gelegen war, konnte sie ihm keine Erholung bieten. Beinahe leblos wirkte sie manchmal. Still in einer Ruhe, die keine Entspannung war, sondern lediglich ein Warten, bis plötzlicher Straßenlärm oder Geräusche im Haus die katatonische Stille jäh unterbrachen. Ein Warten, in dem die Zeit nicht fortzuschreiten schien.
Es wurde zwar später, es wurde heller, aber trotzdem hatte die Zeit aufgehört zu fließen. Sie dehnte sich jetzt und zog sich zusammen. Sie lachte ihn aus, diesen Menschen auf seinem Bett, der ihr zuhörte und versuchte, ihr zu folgen. Sein Wecker tickte in ihrem Takt. Aber auch das war nur Schein. Es war kein gleichförmiges Tempo, es war nicht der Takt des Zeitflusses. Es waren Sekundenschläge, die keine Sekunden kannten. Zeiger, die sich verbogen und dabei stotternde Geräusche machten. In der Dunkelheit vergaßen sie ihre starre Disziplin, drehten sich um ihre eigenen Achsen, wanden sich, streckten sich und sprangen auseinander.
Weil sie das tagsüber nicht konnten. Weil sie tagsüber ihre Gesetze nicht brechen durften.
Der schlaflose Mann hörte ihnen zu. Er hörte das Hämmern ihres Spiels. Ein Hämmern, das mit dem ständigen Tropfen des Wasserhahns eigenartige Polyrhythmen spielte. Teils waren sie zusammen, die zwei, gingen Hand in Hand, und dann stritten sie sich, wer langsamer vorankam.
Der Wasserhahn war schwächer als die Zeit.
Dann fuhr Sebastian hoch mit dem Fernseher oder der Klospülung aus der Nachbarwohnung, mit Autohupen, Türenknallen, Schreien oder betrunkenem Gegröle.
In die folgende Stille lauschte er dann konzentriert hinein und bereitete sich auf den nächsten Paukenschlag vor. Der Mensch hörte sich selbst beim Hören zu. Lauschte. Bis die Zeit und der Wasserhahn wieder zu tröpfeln begannen. Sebastian lauschte, als die Nacht verging. In den Wolkenkratzern brannten noch vereinzelte Lichter.
„Fast bin ich schon dort, wo ich sein will. Fast bin ich schon angekommen.
Ich sehe den Süden nicht mehr. Dort, wohin sich die Sonne nun nachts für wenige Stunden zurückzog, sehe ich nichts mehr. Auch östlich von mir sehe ich nicht mehr, wie sich die Gletscherzunge des Bogerbreen vor dem Karl-Bay-Fjellet niederkniet. Die Schneewände des Hiertafjellet im Westen sehe ich mittlerweile mit geschlossenen Augen genauso gut wie mit geöffneten. Ich weiß, wo sich der Felsschutt zwischen den nackten Gesteinsschichten sammelt.
Das Weiß der hohen Arktis leuchtet überall vor mir. Die kalte Luft glitzert. Der Nordwind. Er peitscht mir Schneekristalle ins Gesicht. Die Schneefelder, die Gletscherabbrüche, die Schottermoränen und Eiskuppen. Ich weiß, sie sind da. Sie sind hier. Überall um mich herum. Sie umgeben mich. Ich habe sie so lange gesehen, dass ich nichts anderes mehr sehen kann. Mittlerweile kann ich in allem die Eiswüste erkennen, deren Teil ich geworden bin. Die Herbststürme tragen den Schnee jetzt in jeden Winkel meiner Welt, in jede Ritze der Hütte, in jeden Felsspalt. Alles deckt der Schnee jetzt zu.
Vor einigen Tagen kam ein Rentier ganz nah zur Hütte. Es ließ sich von mir nicht stören bei seiner Suche nach Nahrung. Ich ließ mich von ihm nicht stören. Es war ein unscharfer Fleck auf dem weißen Schneefeld, welches sich von hier bis zu den Abhängen des Bingtoppen erstreckt. Ein Schatten, der sich langsam durch das Weiß bewegte. Vorsichtig näherte sich das Tier, aber irgendwann drehte es ab und machte sich weiter hinten bei den Geröllhalden, die der Gletscher vor sich aufwirft, auf die Suche nach den letzten arktischen Moosen der Saison. Der scharfe Schutt wird dir dein Gebiss zerbrechen, dachte ich. Wenn du frisst, dann bringst du dich um. Wenn du nicht frisst, dann stirbst du bloß früher, schneller, schmerzloser.
Ich für meinen Teil möchte mich nicht zu Tode fressen. Ich will es dem Rentier nicht gleichtun. Ich habe in diesen Wochen gelernt, fast ohne Nahrung auszukommen. Vitamintabletten, Schmerztabletten, Magentabletten, Flatbrød-Pulver, Survival-Lunches. Mehr brauche ich nicht. Wahrscheinlich beneidet mich das Rentier darum. Es muss seine gesamte Zeit dafür aufwenden, sich einen Winterbauch anzufressen. Jeden Tag blicke ich wieder hinüber zu den Schotterfeldern, ob es nun schon tot auf den Steinen liegt. Aber man stirbt wohl nicht so schnell in der Arktis. Ob du frisst oder nicht, der Tod ist hier ein unmerkliches Gleiten hinüber ins Weiß. Kein Spektakel, sondern ein stilles Erkalten. Tagelang sah ich das Rentier noch in der Ferne. Jetzt ist es nicht mehr da, glaube ich. Zumindest kann ich es nicht mehr erkennen. Kann sein graues Fell nicht von dem grauen Schutt unterscheiden, an dem das Tier nagte.
Kein einziges Lebewesen scheint sich in meiner Nähe zu befinden.
Auf einer meiner ersten Wanderungen nach Longyearbyen entdeckte ich noch Eisbärspuren im Schnee. Lang studierte ich den mächtigen Abdruck einer Tatze. Ich kniete nieder und starrte in den Schnee hinein, spähte lange die Umgebung ab. Doch nirgends sah ich ein weiteres Anzeichen eines Bären. Es sei selten, hat man mir gesagt, dass sich die Sommerbären so weit in das besiedelte Gebiet vorwagen. Letztendlich war ich mir nicht mehr sicher, ob es der Abdruck einer Tatze oder von sonst irgendetwas war. Jedenfalls habe ich das Tier selbst nie gesehen. Schade, dachte ich. Denn ich habe keine Angst vor dem Polarbär. Selbst wenn ich kein Gewehr zur Notwehr trage, so wie es das Gesetz des Sysselmannen hier vorschreibt, habe ich keine Angst davor, auf einen Bären zu treffen. Ich würde mich nicht wehren müssen gegen ihn. Er würde mich verstehen so wie ich ihn. Wir würden uns in die Augen schauen und uns gegenseitig in Ruhe lassen. Abdrehen würden wir. Getrennte Wege gehen, der Eisbär und ich.
Manchmal höre ich die Schreie der Möwen vom Fjord zu mir heraufdringen. Über die Distanz klingen ihre Stimmen fast wie das Heulen des Windes. Die Vögel machen sich bereit zum Flug in wärmere Gebiete, wo sie überwintern werden. Bald wird es still sein hier. Noch stiller und leerer als jetzt.
Langsam beginnen sich da unten im Adventfjorden die Packeisschollen zu schließen. Sie sind mein Zeitmesser. Mein Countdown in den Norden. Noch stellt dieses Treibeis kein Hindernis für die Sabotin dar. Das Schiff kann sich mühelos einen Weg durch die Ruinenlandschaft bahnen. Das Septembereis wird es nicht aufhalten. Wird mich nicht aufhalten. Im Gegenteil: Es wird mich weiterbringen. Ich darf nur die Einfahrt des Schiffes nicht verpassen.
Das Packeis ist mein Kalender. Das Ticken meiner arktischen Uhr. Immer wieder starre ich hinunter auf den gefrierenden Fjord. Immer wieder versuche ich durch die ineinandertreibenden Schichten Weiß einen Blick auf den Meerarm zu werfen. Ich muss erkennen, wenn sich da unten ein roter Eisbrecher durch das Wasser schiebt und die Landungsbrücke des Freihafens Longyearbyen ansteuert.
An Tagen, an denen ich vor lauter Weiß, vor lauter Nebel, Schnee und Kälte nahezu gar nichts mehr erkennen kann, hält mich dieses Heft bei Sinnen. Seit ich mit Anbruch meiner Reise angefangen habe, unregelmäßige Notizen zu machen, bin ich dadurch immer wieder in der Lage, mich aufzufangen, wenn ich mich ganz im Weiß zu verlieren drohe. Schon im Viking Hotel auf der Storgata Tromsøs schrieb ich mich aus dem Delirium heraus, in das ich stürzte. Ich schrieb in Longyearbyen. In Nybyen. Schreibe in dieser Trapperhütte, wenn die Tage weder einen Anfang noch ein Ende finden. Ich weiß nicht, wie viele Tage vergehen, aber ich sehe, wie viele Eisschollen den Fjord hereintreiben und wie viele Seiten ich schon vollgeschrieben habe.
Vor ein paar Tagen habe ich aber alle beschriebenen Seiten aus meinem Heft gerissen und im Ofen verbrannt. Ich will das Weiß des Papiers nicht schwärzen. Komme mir wie ein Verräter vor. Wie ein Spion. Ich nehme das Weiß der Arktis und beschmutze es. Ich will nichts für niemanden hinterlassen. Nichts von mir. Nichts für mich. Ich schreibe meine Gedanken nur hin und wieder nieder, um die Zeit aufzuhalten, wenn sie mir zu entgleiten droht. Dann schreibe ich so, wie ich an anderen Tagen mit mir rede. So wie ich an anderen Tage in den Eisnebel rufe oder einen Rouge trinke, um wieder zu Kräften zu kommen. Wenn ich mich so schwach fühle, dass ich es kaum mehr schaffe, meinen Körper aufrecht zu halten.
Kürzlich kam ich in der Küche zu Fall. Ich stürzte und schüttete mir dabei beinahe einen Topf mit kochendem Wasser über das Gesicht. Im Eingangsbereich der Hütte blieb ich auf dem Boden liegen. Ich kauerte mich in einem Eck zusammen und genoss die Stille. Nach einiger Zeit – ich weiß nicht warum – schoss mir ein Abba-Song in den Kopf. Gimme, gimme, gimme a man after midnight. Ich bekam diesen Dreck nicht mehr aus dem Kopf. Immer mehr baute sich das Stück in meinen Gedanken zusammen. Die Geigen, das Schlagzeug, der Gesang. In endlosen Schleifen wiederholte sich das Thema. Auf jeden Refrain folgte eine neue Strophe. Ein neuer Refrain. Immer lauter dröhnte die Musik in meinem Gehirn. Ich konnte es irgendwann nicht mehr ertragen. Abba in meinem Kopf gaben keine Ruhe mehr. Sie sangen und spielten weiter. Immer weiter. Ich konnte sie nicht abschalten. Konnte gar nichts mehr anderes tun, als dieses Lied zu hören. Zuhören, wie es immer wieder von Neuem losging. Gimme, gimme, gimme a man after midnight. Die Geigen, das Schlagzeug, der Gesang. Mein Kopf war dieses verdammte Stück Musik. Ich dachte: Zum Teufel, jetzt liegst du da, mutterseelenallein in der Stille Spitsbergens und kannst nichts mehr anderes tun, als Abba zuzuhören, wie sie immer wieder dieses gottverdammte Lied spielen! Ich dachte, ich komme aus dieser Schleife nicht mehr heraus. Das war’s, dachte ich. Jetzt stirbst du und Abba spielt die Todesmelodie.
Ich habe keine Ahnung, wie lange wir da gelegen sind, Abba und ich, aber irgendwann schaffte ich es, mich aufzuraffen. Ich schleppte mich vor die Tür und kaute grobkörnigen Schnee. So lange und so viel, bis ich mich übergeben musste. Dann kotzte ich Abba und alles andere aus mir heraus.
Fast bin ich schon dort. Ja. Ich weiß es. Doch ich muss aufpassen. Der Schein trügt. Die Ähnlichkeit täuscht.
An manchen Tagen dringt der Lärm von irgendwelchen Maschinen aus Longyearbyen bis zu mir herauf. Warnsignale sind das. Dann weiß ich, dass ich nicht wirklich dort bin, wo ich sein will. Nein, hier bin ich nicht allein genug. Bin nicht der einzige Mensch. Diese Hütte ist zwar weit und breit das einzige Gebäude, aber sie ist nicht das einzige Gebäude Svalbards. Noch brauche ich sie, aber bald ist die Zeit gekommen, wo ich auch ihr Ulmenholz nicht mehr um mich herum benötige. Auch wenn es mir manchmal vorkommt, als hätte ich es schon geschafft; ich bin noch nicht angekommen. Das hier ist nur eine Zwischenstation. Es ist nicht das Ziel der Reise.
Svalbard. Spitsbergen. Das Endalen. Karsons Trapperhütte. Ich liebe sie. Fast ist sie schon Heimat geworden für mich. Wenn ich im Harsch vor ihrem Eingang liege, denke ich schon, dass ich hier nie mehr weg will, nicht weiter will, nur mehr hier bleiben. Für immer hier liegenbleiben im Endalen. Mich zuwehen lassen vom Schnee, den der einfallende Winter auf die Insel legt. Es ist eine Verlockung, der ich widerstehen muss.
Ich habe keine Schmerzen und keine Angst vor ihnen. Keine Angst vor Bären, keine Angst vor dem Schnee. Meine einzige Angst ist, dass Abba wiederkommt. Und dass ich das Schiff verpasse. Dass ich hier nicht mehr wegkomme und mit Abba sterben muss.
Wenn ich diese Gefahr erkenne, dann schreibe ich sie in mein Heft. Und wenn ich ganze Seiten vollgeschrieben habe, dann reiße ich sie heraus und verfüttere sie an meinen Ofen. Dann blase ich meine Erinnerung als kalten Rauch in die arktische Luft.
Ich darf die Abfahrt nicht verpassen, unten im Fjord.“
„Filmregisseur. Verschiedene Produktionen. Fernsehsachen großteils. Auch Werbung hin und wieder. Da ist ja das Geld zuhause. Da kann es den ganzen Firmen noch so dreckig gehen, beim Budget für Werbekampagnen wird nicht gespart. Darf man auch nicht. Nach außen hin, da muss man sich makellos präsentieren. Glitzer. Glam. High-Tech. Sie wissen ja. Sex sells. Da ist einem nichts zu schade. Wie es innen aussieht, das ist eine ganz andere Geschichte. Das soll lieber niemand erfahren. Wenn es zu gut läuft, dann darf es der Fiskus nicht erfahren, wenn es zu schlecht läuft, dann dürfen es die Aktionäre nicht mitkriegen.“
Sebastian hatte sich in einer momentanen Laune auf dünnes Eis begeben. Mit einem Glas säuerlichem Cabernet Sauvignon in der Hand lehnte er an der Theke der Asian Bar des Frankfurter Hilton-Hotels. Jeden Dienstag ab 18 Uhr traf man sich dort zum After-Work-Clubbing. Er unterhielt sich mit einer Frau, die gleichzeitig mit ihm ihren Welcome-Drink bestellt hatte. Lächelnde Ladys in Cat-Suits hatten sie empfangen. Dahinter – ein wenig im Abseits – war ein ernster Herr in schwarzem Anzug zu erkennen. Mit einem Hörknopf im Ohr und einem Funkgerät, das er unauffällig in seiner Linken hielt. Auch er machte einen freundlichen Eindruck.
„So läuft das nunmal in unserem System. Alles Pump. Alles Abschreiben. Alles ist auf Lügen gebaut. Die Wahrheit erfährt man nie. Die kann man höchstens versuchen, irgendwo zwischen den Zeilen rauszulesen. Aber eigentlich … man ahnt ja nicht einmal, was da alles abgeht, ohne dass wir es je erfahren.“
Er drehte sich zur Seite, um eine Schale Nachos zu erreichen.
„Schnell auf- und wieder zugemacht. Niemand hat’s gesehen. So ungefähr läuft das. Und irgendwann fällt dann das Kartenhaus in sich zusammen. Bumms … Entschuldigung, wie war nochmal dein Name?“
Die Dame ohne Namen hatte ihn mit seinen Geschichten alleine an der Bar gelassen. Für sie gab es Besseres zu finden an diesem Abend. Der ganze Laden war auf der Balz, da musste sie sich nicht dem erstbesten Wichtigtuer hingeben.
Schwindelgefühl war neben einer Rötung verschiedener Hautstellen der Haupteffekt, den Rotwein auf Sebastian ausübte. Er bestellte ein zweites Glas. Egal, der Geschmack. Egal, der Effekt.
Er sah sich um. Menschen nippten an Cocktail- und Sektgläsern. Wippten im oder neben dem Takt aus den Lautsprechern. Ein DJ mit ärmellosem Che-Guevara-T-Shirt spielte kubanisch klingende Musik. Mit eckigen, Salsa-ähnlichen Schritten gab sich eine Handvoll Menschen den Rhythmen hin. Es sah nicht geschmeidig aus, was sich da bewegte. Die Qualität der Tänzer entsprach der des Weins. Und auch der Qualität der neuen Konversation, in die Sebastian mittlerweile geschlittert war. Kaum wagte er es, dieses von Hautunreinheiten heimgesuchte Gesicht anzusehen, das über einem langen, schlanken, kaum verhüllten Körper thronte. Mit motorischen Floskeln versuchte er dem zu entgehen, was diese Frau ihn fragte. Oder ihm sagte. Oder meinte. Was immer. Nur in kein Gespräch mit ihr verwickelt werden!
Glücklicherweise fiel es dank der lauten Musik auch leichter, eine Unterhaltung im Nichts verlaufen zu lassen, als sie aktiv voranzutreiben.
Lange konnte er den Geschmack dieses Weins nicht mehr ertragen.
Wie immer in solchen Momenten wurde der Pausenraum, die Toilette zum Zufluchtsort. Männer machten sich dort vor den Spiegeln zurecht, erneuerten das Gel in ihrem Haar und das Deodorant unter ihren Achseln. Die Luft roch nach Rasierwasser und nicht nach Urin.
In einer Unachtsamkeit pinkelte Sebastian sein linkes Hosenbein an. Der längliche, dunkle Fleck sah nicht gut aus. Doch er würde trocknen und nicht weiter stören. Die Asian Bar war dunkel genug, um solches Ungeschick zu verzeihen. Sebastians Wahrnehmung war jetzt angenehm betäubt. Ohne Hektik spuckte er ins Pissoir und beobachtete verzückt, wie die automatische Spülung seine Ausscheidungen in spiralförmigen Strudeln mit sich nahm.
Am Rand der Tanzfläche standen leicht wippend jene Leute herum, die noch nicht ganz abzutanzen wagten, stattdessen am Strohhalm ihres Longdrinks saugten und suchend um sich blickten. Sie bemerkten seinen Urinfleck nicht. Niemandem fiel auf, wie er sich jetzt unmerklich Richtung Ausgang schob. Angetrunken. Angepinkelt. Müde und zufrieden, bereit für die Belohnung: den Austritt aus der Partyzone.
Die Katzenfrauen bemerkten ihn ebenfalls nicht. Nur der Mann im schwarzen Anzug schenkte ihm einen kurzen Abschiedsblick. Du gehörst hier nicht her. Geh heim. Tu, was immer du tun willst, aber tu es daheim, wo dich niemand sieht. Schmeiß dir eine DVD ein. Iss noch eine Kleinigkeit. Trink noch ein Glas. Stell dich unter die Dusche. Schlaf ein vor dem Fernseher. Lieg nackt auf der Couch. Lieg in deinem Bett und hör dem Ticken deines Weckers zu. Dem Tropfen deines Wasserhahns. Hör das plötzliche Geräusch von der Straße. Maschinenlärm. Öffne das Fenster. Die Skyline siehst du, wenn du dich aus dem Fenster beugst. Die Wolkenkratzer sind da für dich.
Sebastian Fehr atmete die kühle Abendluft in tiefen Zügen ein.
Die Abbruchkante des Gletschers leuchtete bläulich. Sie hatte unendlich viele Augen, die ständig in Bewegung zu sein schienen. Dichtes, festgepresstes Eis. Tausende Jahre alt. Von einem Moment auf den anderen brach es weg. Als Wassertropfen oder als Gletscherbruch. Es wurde gekalbt. Stürzte ins Meerwasser. Sein Warten hatte sich gelohnt. Als Eisscholle trieb es hinaus aufs offene Meer. Trieb langsam schwankend in den Süden. Seinem Tod entgegen.
Das Bersten und Krachen von den Fjorden Spitsbergens war bis zu Karsons Trapperhütte hinauf zu hören und riss Sebastian immer wieder aus seiner Lethargie. Dann starrte er hinunter auf den Adventfjorden. Versuchte zu erkennen, ob dort noch etwas anderes trieb als die Eisschollen, die sich an den Ufern zu einer immer dichteren Eisdecke zusammenschlossen. Dem Wachsen des Packeises vertraute er mehr als der Uhr, die die Zeit dehnte und zusammenzog, wie immer es ihr beliebte. Er wollte sich lieber auf die Ankunft des Treibeises und das Schreien der letzten Seevögel verlassen, die sich sammelten für ihren Aufbruch in den Süden.
Je stiller ihre Stimmen wurden, desto näher rückte seine Abfahrt.
Alles Leben verließ jetzt das Nordenskiöldland. Die arktische Wüste bot keinen Platz dafür. Nur kurze Sommerwochen lang hatte Spitsbergen durchatmen können, nun war dieser Traum vorbei. Jetzt zeigte der Nordwind, wer der wahre Herrscher dieses Landes war.
Alle Geräusche trugen sich weit durch die klare Polarluft. Kein Baum, kein Gebäude, keine Hindernisse stellten sich ihnen in den Weg. Bis zu seiner Hütte hinauf hörte Sebastian manchmal den Lärm der Snowmobiles, die in Longyearbyen gestartet wurden. Noch waren es nur Vereinzelte, die ihren Wintereinsatz nicht mehr erwarten konnten und kurz den Motor aufheulen ließen. Wie tickende Zeitbomben lagen die „Arctic Cat“-, „Polaris“- oder „Bombardier“-Scooter unten in der Siedlung und warteten darauf, dass die Schneeschicht dick genug sein würde, um sie über die Insel zu tragen. Sobald sie sich das Eis, das im Winter alles bedeckte, zu Nutzen machen würden, wollte Sebastian von hier verschwunden sein.