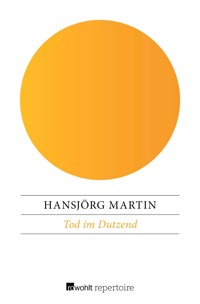9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Rowohlt Repertoire
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
«Die Bucht ist in Gefahr!» erklärte der kleine Deutsche und hob den Zeigefinger. «In Gefahr?» fragte ich. «Sie soll zugebaut werden!» sagte er. «Es gibt ein Konsortium aus hiesigen und – leider – auch deutschen Unternehmern, die das ganze Gelände aufgekauft haben und jetzt eine riesige Feriensiedlung dort bauen wollen. Man spricht von dreitausend Appartements mit siebentausend Betten, von einem Yachthafen, Kinos, Diskotheken, Restaurants … was weiß ich! Jedenfalls viel, viel Beton!» Er seufzte. «Und der Bürgermeister?» fragte ich. «Der will das genehmigen!» sagte der Landsmann und zuckte resignierend die Achseln. «Das alte Spiel», sagte ich, «wahrscheinlich ist der Bürgermeister auch noch Aktionär des Unternehmens. Dann ist der Volksaufstand ohnehin eine Farce!» «Nicht ganz – noch nicht ganz», erwiderte der Kleine, «es gibt noch eine Hoffnung! – Und da ist sie!» schrie er. «Dort – auf dem Wagen!» Ich ließ meinen Blick seiner ausgestreckten Hand folgen. Auf der Ladefläche eines Lieferwagens mitten in der Menschenmenge stand Apollonia. Sie ist die Volksheldin. Sie weigert sich nämlich, ihr Stück Land zu verkaufen. Und ohne dieses Stück können die wunderschönen Pläne des Konsortiums nicht realisiert werden. Man hat Apollonia schon viel Geld geboten. Sie lehnt ab. Da bleibt nur noch ein Mittel: Mord.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 200
Veröffentlichungsjahr: 2018
Ähnliche
rowohlt repertoire macht Bücher wieder zugänglich, die bislang vergriffen waren.
Freuen Sie sich auf besondere Entdeckungen und das Wiedersehen mit Lieblingsbüchern. Rechtschreibung und Redaktionsstand dieses E-Books entsprechen einer früher lieferbaren Ausgabe.
Alle rowohlt repertoire Titel finden Sie auf www.rowohlt.de/repertoire
Hansjörg Martin
Apollonia muß sterben
Ihr Verlagsname
Über dieses Buch
«Die Bucht ist in Gefahr!» erklärte der kleine Deutsche und hob den Zeigefinger.
«In Gefahr?» fragte ich.
«Sie soll zugebaut werden!» sagte er. «Es gibt ein Konsortium aus hiesigen und – leider – auch deutschen Unternehmern, die das ganze Gelände aufgekauft haben und jetzt eine riesige Feriensiedlung dort bauen wollen. Man spricht von dreitausend Appartements mit siebentausend Betten, von einem Yachthafen, Kinos, Diskotheken, Restaurants … was weiß ich! Jedenfalls viel, viel Beton!» Er seufzte.
«Und der Bürgermeister?» fragte ich.
«Der will das genehmigen!» sagte der Landsmann und zuckte resignierend die Achseln.
«Das alte Spiel», sagte ich, «wahrscheinlich ist der Bürgermeister auch noch Aktionär des Unternehmens. Dann ist der Volksaufstand ohnehin eine Farce!»
«Nicht ganz – noch nicht ganz», erwiderte der Kleine, «es gibt noch eine Hoffnung! – Und da ist sie!» schrie er. «Dort – auf dem Wagen!»
Ich ließ meinen Blick seiner ausgestreckten Hand folgen. Auf der Ladefläche eines Lieferwagens mitten in der Menschenmenge stand Apollonia.
Sie ist die Volksheldin. Sie weigert sich nämlich, ihr Stück Land zu verkaufen. Und ohne dieses Stück können die wunderschönen Pläne des Konsortiums nicht realisiert werden. Man hat Apollonia schon viel Geld geboten. Sie lehnt ab.
Da bleibt nur noch ein Mittel: Mord.
Über Hansjörg Martin
Hansjörg Martin (1920–1999) war ursprünglich Maler und Graphiker. Nach dem Krieg arbeitete er als Clown, war Bühnenbildner und Dramaturg, dann freier Schriftsteller. Er schrieb Kriminalromane und Kinder- und Jugendbücher.
Inhaltsübersicht
Die Hauptpersonen
Apollonia
hat einen Dickschädel
Leo Klipp
verliert den Kopf
Paula Schuh
findet, Männer bräuchten häufiger Prügel
Brigitta und Hermann Findeisen
wollen ihr Paradies behalten
Margarita
sieht auch Dinge, die sie nicht sehen sollte
JuanAntonioJosé
drückt schon mal ein Auge zubesäuft sich zu oftist ein Bandit
das Marzipanschwein
ist ein Geschäftsmann
Mr. Ripley
trägt nur den Namen eines Kriminellen
Die Kinder der Heiligen Dreifaltigkeit
sind ständig moralisch
I.
Das erste Mal traf ich Apollonia vor einem Haus, rechts neben der schmalen Straße, die zur Bucht von Dragomontana führt.
Die Frau war mittelgroß, ziemlich umfangreich – nein, nicht dick, eher stämmig-untersetzt, und sie hatte unter dem breitrandigen, zerbeulten Strohhut ein großflächiges Gesicht mit dunklen, kleinen, blitzflinken Augen.
Eine Apollonia – wenn man es in Verbindung zur strahlenden Schönheit Apollos bringen will – war die etwa Fünfzigjährige wahrlich nicht, aber ich fand sie auf Anhieb sympathisch.
In meinem holprigen Spanisch, das einem Feldweg voller Schlaglöcher gleicht, fragte ich sie – nach buenos dias! und perdone, Señora! –, ob das denn noch weit zum Strand sei, denn ich hatte zwei Stunden Fußmarsch in der Sonne hinter mir und keine Lust auf weitere Kilometer.
Da lachte sie.
Ihr Lachen, bei dem sie den Kopf in den Nacken legte, war überwältigend und machte sie noch sympathischer, obschon es ihre Falten um Augenwinkeln und Mund vertiefte.
«No, Señor!» sagte sie, wies mit dem ausgestreckten Arm zum Pinienwald, in dem die Straße verschwand, und erklärte, das gleich dahinter die Playa, der Strand, läge.
Da sie sofort gesehen hatte, daß ich ein Fremder, ein Tourist war – schon deshalb, weil nur Esel und Touristen in der Sonne herumlaufen – sprach sie langsam und laut mit mir, wie man mit Kindern spricht oder mit Schwerhörigen. Ihre Stimme war rauh und guttural – nur bei I-Lauten kippte sie in winzige Quieker um. Aber ich konnte sie gut verstehen, bedankte mich und ging weiter.
Als ich nach fünfzig Schritten zurücksah, stand sie noch immer neben der bunten Natursteinmauer, die den großen Garten des seltsamen Hauses umgab, und blickte mir nach.
Ich winkte. Sie winkte zurück.
Die weite, von weißem Sand gesäumte Doppelbucht, die ich kurz darauf erreichte, war noch schöner, als ich sie mir nach den Schilderungen vorgestellt hatte. Sie war um diese Jahreszeit – Ende Mai – besonders schön, da die Pinien, die vom Strand hügelan standen, hellgrüne Kronen auf ihren dunkelgrünen Köpfen trugen. Sie war auch deshalb ganz besonders schön, weil der sanft im türkisfarbenen Wasser verlaufende Sandstrand menschenleer in der Sonne lag. Weit und breit kein Lebewesen, nicht mal Spuren davon: Kein Verbotsschild am Strand am Ende der Straße, kein Zaun, kein Haus – und eine Stille, daß ich das Klopfen meines Herzens zu hören glaubte.
Es war aber nicht mein Herzklopfen, sondern ein Hämmern auf Holz irgendwo hinter mir, und als ich mich umwandte, entdeckte ich oberhalb der Straße hinter einem riesigen Oleander ein dreistöckiges, weißes Haus, das ich, überwältigt von der Schönheit der Bucht Dragomontana, nicht bemerkt hatte.
Das mußte das kleine Hotel Cormoran sein, von dem mir berichtet worden war, und ich ging in der Hoffnung darauf zu, irgendwas Trinkbares zu bekommen.
Die Treppe führte zwischen mannshohen Palmitos und Agaven auf eine unerwartet große, mit weißen, unregelmäßigen Steinplatten belegte Terrasse, auf der etwa zwei Dutzend Rohrsessel um sechs bis acht Tische standen.
Rechts davon war ein voller Swimmingpool, aber weder auf den Liegen an seinem Rande noch an einem der Tische war ein Mensch.
Das Klopfen klang aus dem Inneren des Hotels, wurde jetzt unterbrochen, und durch eine der Glastüren trat ein junger Mann auf die Terrasse, verzog das schweißglänzende Gesicht zum Grinsen und sagte: «Buenos dias, Señor!»
Dann sah er mich wartend an. Ich fragte mit mehrfachem por favor!, ob das Hotel geöffnet sei und – als er kopfschüttelnd verneinte – ob ich denn, por favor, trotzdem etwas zu trinken haben könne, por favor!
«Sí, Señor!» entschied der Schwitzende, «un momento, por favor!»
Er wies auf die Tische und Stühle und verschwand im Haus. Über der Tür befand sich eine Drahtplastik, die einen Kormoran darstellte.
Ich hatte noch nie einen lebenden Kormoran gesehen, nur die abenteuerlichsten Berichte über die Schwimm- und Tauchkünste dieser Vögel gehört.
Ich nahm mir vor, den jungen Mann zu fragen, ob es hier in der Bucht Kormorane gäbe – oder warum das Hotel diesen Namen trüge.
Während ich im Kopf noch an der Frage – genauer an den Vokabeln für diese Frage – herumdachte und schon drauf und dran war, es aufzugeben, brachte er ein Tablett mit einem Glas und einer Flasche Mineralwasser. Er entschuldigte sich, etwas anderes gebe es im Moment nicht, auch die Kaffeemaschine sei noch nicht angeschlossen, denn das Hotel würde erst in zwei Tagen geöffnet.
Da ich mit meinen zwei einigermaßen korrekten spanischen Sätzen bei ihm den falschen Eindruck erweckt hatte, ich spräche seine Sprache, redete er so schnell, daß ich mehr erriet als verstand, was er sagte.
«Sí, sí!» gab ich zurück. Das konnte nichts schaden. Ich setzte mich, als er wegging, mit dem Rücken zur Hotelfassade in den Schatten, trank das gutschmeckende, kalte Wasser und schaute über die Terrasse auf die Bucht.
An ihrer Westseite, dort, wo es felsig war, kam aus dem Pinienwald ein alter Mann mit einem großen Strohhut, einer Angelrute und einem runden Korb und ließ sich auf den Steinen nieder. Er kramte irgendwas aus dem Korb und streute es ins Wasser. Ich konnte nicht erkennen, was das war – wahrscheinlich altes Brot oder sonstwas als Lockspeise für die Fische. Danach befestigte er einen Köder am Haken, warf die Schnur weit aus, steckte die Angel zwischen die Steine und setzte sich bequem hin, die Ellenbogen auf die Knie, den Blick aufs Meer … Ein Bild des Friedens, wenn auch nicht unbedingt für die Fische.
Hinter mir setzte das Klopfen wieder ein, ging nach kurzer Zeit in ein Sägen über und verstummte dann. Ich dachte an die Hotelpension in Cala Plata, in der ich mich seit drei Tagen über den Straßenlärm und -gestank und über das mittelmäßige Essen ärgerte, rechnete nach, was mich eine vorzeitige Kündigung kosten würde, kam zu dem Ergebnis, daß die wahrscheinliche Einbuße an Geld zu verkraften wäre, wenn ich dafür ein Quartier wie dieses hier eintauschen könnte, und war gerade soweit, mich für den Wechsel zu erwärmen, als die Glastür linker Hand aufging und eine etwa vierzigjährige Frau heraustrat.
Sie glich verblüffend einer jener Porzellanpuppen, die vor zwei bis drei Generationen in den Puppenstuben jedes gutbürgerlichen Mädchens zu finden waren und heute so kostbar sind.
Die Puppenfrau trug das blauschwarze, wie gelackt glänzende Haar hochgetürmt über einem feingeschnittenen Gesicht von elfenbeinfarbener Blässe, in dem große dunkle Augen strahlten – ja, strahlten. Der kleine, ein wenig zu rote Mund lächelte unter einer klassisch geformten, ein bißchen zu großen Nase … Und das Ganze stand in so krassem Gegensatz zu einem grobknochigen, derben Frauenkörper, daß ich Mühe hatte, meine Verblüffung zu vertuschen.
Die Hände der Puppenkopffrau waren wiederum klein und feingliedrig, nichts paßte zusammen, und als sie nun mit einer schön klingenden Altstimme statt einer piepsigen Puppenstimme zu sprechen begann und noch dazu in Englisch, war die Disharmonie perfekt.
Ich kann nur ein paar Dutzend Worte Englisch, da ich eine humanistische Schulbildung genossen, richtiger: überstanden habe. Deshalb sagte ich spanisch guten Tag und fiel in die nächste Überraschung, weil die Frau mir auf Deutsch antwortete:
«Oh, ein Alemán!» sagte sie. «Verzeihung, um diese Jahreszeit sind nur wenige Deutsche hier. Deshalb glaubte ich, Sie seien ein Brite!»
Perfekt! Sogar mit korrektem Konjunktiv!
Ich erhob mich vor so viel Sprachkenntnis und gutem Benehmen, machte einen Diener und nannte meinen Namen.
«Sehr angenehm», gab die Puppenfrau zurück, «ich bin Margarita. Dies ist unser Hotel. Bitte behalten Sie Platz, Herr Klipp!»
«Sie sprechen hervorragend gut Deutsch!» sagte ich und setzte mich wieder. «Wenn nicht der ganz kleine Akzent wäre, würde ich Sie für eine Hamburgerin halten!»
«Gut geraten!» sagte sie lächelnd und setzte sich mir gegenüber. «Wir haben elf Jahre in Hamburg gelebt. Mein Vater hat dort auf der Werft gearbeitet. Ich denke sehr gern daran. Es war eine gute Zeit … nur das Wetter … na ja! Sie sind Hamburger, Señor?»
Ich bejahte und sagte irgendwas Belangloses. Daß hier auf der Mittelmeerinsel ja wirklich besseres Wetter sei – oder so was.
Im Haus wurde wieder gesägt.
«Die letzten kleinen Reparaturen», erklärte Doña Margarita und erhob sich, «in zwei Tagen kommen die ersten Gäste!»
Ich fragte, ob sie noch ein Einzelzimmer frei habe, für zehn Tage und mit Halb- oder Vollpension – egal. «Weil ich mich in Cala Plata nicht wohl fühle, würde ich gerne umziehen!»
«Ja, das geht!» sagte sie. «Sie können übermorgen kommen!» Dann nannte sie mir den akzeptablen Preis, bat mich, mit einem Taxi zu kommen, damit es keinen Ärger geben, wenn sie ihren Hotelwagen schicke, und der Wirt in Cala Plata sei sowieso nicht ihr Freund … kein Wunder, daß es mir dort nicht gefiele. Ob ich denn das Zimmer nicht sehen wolle?
Ich wollte. Es gefiel mir. Der Blick aus dem Fenster im zweiten Stock über der Bucht war ein Traum.
Ich sagte zu. Wir gaben uns die Hand. Ich verabschiedete mich zufrieden.
Es war später Vormittag – die Sonne brannte noch heißer als vorhin, aber der Rückweg fiel mir leichter, denn ich hatte eine hübsche Zukunft in Aussicht.
Dachte ich wenigstens …
II.
Cala Plata soll vor zehn bis zwölf Jahren noch ein kleines, malerisches Fischerdorf gewesen sein, hatte mir der alte Frisör in seinem deutsch-französisch-spanischen Kauderwelsch erzählt, bei dem ich am ersten Urlaubstag zum Haarschneiden gewesen war.
Davon ist heute nichts mehr zu sehen. Den ehemalige Hafen haben sie zum Badestrand gemacht. Tretboote haben die Fischerkähne abgelöst. Die zwei oder zweieinhalb Dutzend Restaurants zwischen den mehr oder minder – meist minder – schönen Hotelkästen beziehen den Fisch, den sie anbieten, über eine Tiefkühlkette. Der Lachs zum Beispiel kommt aus Norwegen.
Neben den ‹Bars›, wie die Restaurants mit ihren schön klingenden Namen (Suremar, Aventura) heißen, gibt es heute bereits eine Dortmunder Bierstube, einen Berliner Keller, eine Rüdesheimer Weinklause und wer will, kann dort schon acht Uhr morgens ‹deutschen Kaffee› und ‹Pfälzer Leberwurstbrot› frühstücken oder später echtes Sauerkraut mit Eisbein vertilgen, was bei dreißig Grad im Schatten die ideale Verpflegung ist.
In drei Papierwarenläden liegen deutsche, englische und französische Boulevardblätter aus, damit auch keiner im Ferienaufenthalt kulturell darben muß.
Die Blätter sind fast doppelt so teuer wie daheim. Aber pünktlich sind sie immer vorhanden – und wer zahlt nicht gern ein paar Groschen mehr, wenn er nur erfährt, daß die Fernsehansagerin Siglinde Streußelbach ihren Mann verlassen hat, weil er sich sonntags nicht rasiert, und außerdem mit ihrem vorigen (dritten) Mann, dem Popsänger Thiro Thymian, Brüderschaft … und so weiter (obwohl sie den haßt, weil der … heiliger Bimbam!).
Kurzum, wer in Cala Plata – zu deutsch Silberbucht – Erholung sucht, braucht nichts zu entbehren!
Die Preise sind allerdings nicht mehr das, was die Insel mit dem schönen Namen ‹Isla de las Flores› für Rechner früher mal so attraktiv gemacht hat.
Seit die Spanier Mitglied der Europäischen Gemeinschaft sind, jenes Wirtschaftsverbundes, der den Völkern das Leben erleichtern soll, kostet der Wein kaum weniger als im Supermarkt zu Hause – von Importwaren ganz zu schweigen.
Der hiesige Maurer könnte sich bei seinem – nicht EG-angepaßten – Lohn einen Zwei-Wochen-Urlaub in Cala Plata jedenfalls bestimmt nicht leisten.
Dafür – zu den stolzen Preisen – gibt es aber in den Läden alles, was ein Touristenherz begehrt: Bunte Ansichtspostkarten sowieso, neuerdings sogar welche mit viel nacktem Busen und neckischen Sprüchen drum herum – aber auch bayerisches Bier, Pulverkaffee, Vollkornbrot und Gewürzgurken.
Der Fremde, so das Credo der Reisemanager, soll sich eben wie zu Hause fühlen und nur gelegentlich – etwa bei der sonnabendlichen großen Flamenco-Show – daran erinnert werden, daß er sich nicht in Gelsenkirchen befindet. Was hier tagsüber die Sonne bewirkt und die anderthalb Quadratmeter Sandstrandstück am Mittelmeer.
Ich war vor fünfundzwanzig Jahren schon mal auf der damals noch nicht so strapazierten Insel gewesen und hatte es seinerzeit hier sehr schön gefunden, weil es noch weite Strecken ursprünglicher Natur gab, die heute zum großen Teil unter der Betonzivilisation begraben sind, und ich war nun – schon am ersten Tag meines zweiten Aufenthaltes – enttäuscht bis entsetzt, mit welch brutaler Rücksichtslosigkeit Wälder, Dörfer, Felsenküsten und Sandbuchten dem großen Geschäft geopfert worden waren.
Richtig sauer war ich drauf und dran, den Urlaub abzubrechen und vielleicht noch eine Woche im Harz oder an einem der holsteinischen Seen Ferien zu machen, zumal auch das Hotel, wie gesagt, sich als Flop erwies.
Aber im Wetterbericht aus den heimatlichen Gefilden war von zwölf Grad Celsius und Regen die Rede, das reizte mich auch nicht – und außerdem machte die Reisegesellschaft natürlich Schwierigkeiten.
Die Charterflugzeuge seien voll, sagten sie, und eine Rückzahlung des gezahlten Geldes käme nicht in Betracht, es täte ihnen ja leid, daß ich so unzufrieden sei – aber gerade über dieses Hotel hätte noch niemand sich beklagt und … und … und …
Der alte Frisör hatte mir, froh, einen Kunden zu haben, der ihn einigermaßen verstehen konnte, auch von der Bucht Dragomontana erzählt und den Weg dorthin beschrieben.
«Dort ist es noch so, wie es hier überall war, Señor, wenigstens vorläufig noch und hoffentlich noch lange!» hatte er gesagt.
Also war ich hingelaufen und hatte mich prompt bei der puppengesichtigen Wirtin im kleinen Hotel Cormoran eingemietet. Übermorgen würde ich umziehen. Darauf freute ich mich.
Am Abend meines zweiten Urlaubstages in Cala Plata schlenderte ich nach dem wiederum höchst mittelmäßigen Abendessen – eine dicke Reissuppe mit Hühnerknöchelchen und kleingeschnittenen Tintenfischringen und danach eine dünne, zähe Rindfleischscheibe, lauwarm mit Grillnarben und pappigen Pommes frites neben einem grünen Salat, der nicht mal mit Essig würzig wurde –, nach diesem Festmahl also schlenderte ich durch die fünf schmalen, sich kreuzenden Straßen der Fußgängerzone des Ortes.
Auf beiden Seiten lag Lokal neben Lokal. Alle hatten Stühle und Tische draußen stehen, weiß oder bunt gedeckt, einige mit echten, andere mit Kunststoffblumensträußchen. Und hinter oder zwischen den nicht voll besetzten Tischen standen die spanischen Kellner in weißen Leinenjacken, taxierten jede Frau, jeden Mann, die vorübergingen und rückten einladend Stühle zurecht, wenn sich jemand näherte. Aus den offenen Türen der Restaurants plärrten Plattenspieler oder Musikboxen. Das Repertoire reichte von Gitarren-Folklore bis zu Militärmärschen. Die Interpreten von Weltrang, Julio Iglesias, Elvis Presley, Frankieboy Sinatra und dergleichen, schmalzten, röhrten, jaulten ihren adäquaten Tiefsinn.
Mozartlieder waren nicht dabei.
Ich steuerte auf einen kleinen freien Tisch an einer der Wegkreuzungen zu. Von einem dienernden Kellner wurde mir ein weißer Kunststoffstuhl in die Kniekehlen geschoben, und dann fragte der Schwarzgelockte auf englisch, ob ich trinken oder essen oder beides wolle.
Er hielt mich auch für einen Briten, und ich wußte so schnell nicht, ob ich mich davon vielleicht geschmeichelt oder gekränkt fühlen sollte. Womit der Beflissene fragte, war nicht auszumachen, denn den unteren Teil seines Gesichtes hatte ein schwarzkrauser Bart so zugewuchert, daß der Mund nicht zu sehen war.
Ich bestellte ein Bier, vorsichtshalber erst mal ein kleines, was den Behaarten enttäuschte, und dachte, während ich darauf wartete, über die tiefschürfende Frage nach, daß Kellner keine Vollbärte tragen dürften, weil man sonst dauernd Haare in der Suppe oder dem Bier zu finden fürchtet.
Wie das beim Philosophieren so geht, brachte mich die Kellner-Vollbart-Frage auf das Problem Bart im allgemeinen und besonderen, und ich stieß auf die Erkenntnis, daß Bärte, Vollbärte vor allem, fast immer psychologischen Ursprungs sein müssen. Denn ohne tieferen Grund läßt sich doch wohl kaum ein normaler Mann so ein atavistisches Gestrüpp im Gesicht wachsen. Noch dazu, da solch ein Bart bei Hitze lästig, beim Suppeessen hinderlich und immer arbeitsaufwendig ist, wenn er nicht unappetitlich wirken soll.
Wo bitte, hirnte ich weiter, liegen dann aber die tieferen Gründe? Wird ein Mann männlicher mit Matratze am Kinn? Signalisiert heftiger Haarwuchs pralle Potenz? Dann aber dürfte die Botschaft erfahrener Damen, daß gerade Männer mit Glatze gute Liebhaber sind, eine Irrlehre sein! Oder ist Vollbart einfach nur eine Imponier-Attitüde … wie Gasgeben, spreizbeinig Laufen, die Rolex am Handgelenk glitzern lassen, Geldscheine zerknüllt aus der Hosentasche kramen?
Die Lösung der Frage fand ich nicht, weil mein Camarero mit dem Bier kam. Es schwamm kein Barthaar darin. Als der Bilderbuch-Spanier das Glas vor mich stellte, fiel mir auf, daß er Hände wie ein Pianist hatte: schmal, langfingerig und erstaunlich feingliederig.
Ich wollte gerade in eine neue Gedankenstraße einbiegen, denn ich fand es interessant, über Hände als Charaktersymbole zu fundamentalen Erleuchtungen zu kommen, da wurde ich von einem mehrstimmigen Gelächter am Nachbartisch abgelenkt.
Einen knappen Meter links neben mir hatten sich vier Männer niedergelassen, die schwer einzuordnen waren.
Bis auf einen, der – rotgesichtig und strohblond – mir am nächsten saß, waren das Spanier oder jedenfalls Südländer, so schwarzhaarig, blauschattig ums Kinn und lautstark-gestenreich, wie sie da saßen.
Arme Leute konnten es nicht sein, dem Goldkettchengebammel an ihren Handgelenken und den teuren Uhren, Maßanzügen und Seidenhemden nach. Vielleicht Kaufleute – aber aus welcher Branche? Oder Beamte, die Posten bekleideten, in denen sie ihre mittelmäßigen Gehälter mit ‹Zuwendungen› aufbessern konnten, die ihnen in diskreten Couverts unter den Gesuchen, Anträgen und Bittschriften überreicht wurden …? Aber was tat der Strohblonde, der offensichtliche Mühe hatte, ihre Sprache zu verstehen, im Kreise der drei heiteren Herren?
Auch mir fiel es schwer, das Gespräch zu verfolgen, da die drei – nachdem sie Wein und gesalzene Mandeln bestellt hatten – sehr schnell redeten und außerdem ihre Rede mit Dialekt-Brocken mischten, einem landesüblichen Dialekt, der dem Spanischen so ähnlich ist wie Ostfriesenplatt dem Hochdeutschen … Und der ebenso dem Wohllaut quakender Frösche gleicht wie das Gerede zwischen Wangeroog und Westrhauderfehn …
Ich gab es nach wenigen Minuten auf, das Rätsel des Nachbartisches lösen zu wollen, denn ich konnte ja zu diesem Zeitpunkt noch nicht wissen, daß das Quartett zu meiner Linken in Kürze von einiger Wichtigkeit sein würde. Zudem fand ich das passierende Publikum vor meinem Tisch viel interessanter.
Ein ununterbrochener Strom flanierender Müßiggängerinnen und -gänger aller Altersgruppen, unterschiedlichster sozialer Stellungen, vieler Nationen, breitgefächerter Schönheit und/oder Häßlichkeit und in den mannigfaltigsten Kostümierungen.
Das reichte vom wabbelbäuchigen Deutschen mit Lodenhut und Hosenträgern überm T-Shirt über die in enganliegendes Schwarz gezwängte rotblonde Französin mit hungrigen Augen und ellenlanger Zigarettenspitze bis zum Khaki tragenden, klapperdürren Engländer unter einer Art Tropenhelm, der nur noch ein Monokel gebraucht hätte, um die komplette Karikatur zu sein.
Kinder trippelten vorüber, die im Stil der Jahrhundertwende (der vorigen) gekleidet waren und sich entsprechend bewegten – und andere, halbnackt, dunkelbraun gebrannt, rennend, schreiend, von genervten Müttern vergeblich zur Raison gerufen.
Die Mütter waren zwar ebenfalls im Urlaubshabit, manche trugen zu bunte, zu enge Shorts über ihren Mamapopos, aber sie schienen die einzig normalen Menschen zwischen den vorbeiwandelnden alleinstehenden, verliebten, von Sonne und Freiheit beschwipsten Männern und Frauen zu sein.
Aus der Mütterrolle schlüpft sich’s wahrscheinlich am schwersten. Besonders dann, wenn die Kinder dabei sind.
Das Faßbier schmeckte einigermaßen – nicht so gut wie deutsches oder tschechisches natürlich, aber immerhin, und ich machte aus dem Leutebegucken ein Spiel, indem ich, wenn sie sich näherten, zu erraten versuchte, welchem Volk sie angehörten.
Bei den Spaniern war das am leichtesten, obwohl einige meiner Spanier sich im Vorübergehen als Italiener entpuppten. Bei den Engländern hatte ich auch acht Treffer bei zehn Leuten, denn so steril in Gestik und Gewandung, so körperlich wie geistig von oben herab können nur Briten sein. Und die Volksgenossen aus Deutschland sind meist am Umfang ihrer Bäuche, Becken und Backen zu erkennen, ehe sie noch zu lärmender Lebenslust die Münder aufmachen.
Schwierigkeiten hatte ich bei den Holländern, die ich mal für Briten, mal für Bundesrepublikaner hielt, und mit den Männern der Grande Nation, die im Gegensatz zu ihren Frauen schwer einzuordnen waren.
Es war ein amüsantes Spielchen, und ich trieb’s mit Vergnügen, zwei Biere und vier Zigaretten lang, ehe ich’s leid wurde.
Die vier Männer am Nebentisch hatten jetzt die Köpfe zusammengesteckt und tuschelten. Ihre Gesichter verrieten nicht, was für Pläne sie schmiedeten. Ich dachte an irgendwelche Klüngeleien am Rande der Legalität, an Baupläne ohne die notwendigen Genehmigungen, an Käufe, Verkäufe nicht ganz astreiner Waren – an politische Durchstechereien … was weiß ich, was es da alles gibt.
An Mord dachte ich nicht.
Kein Mensch denkt an Mord, wenn vier gutbürgerlich wirkende Herren in mittleren Jahren abends vor einem Café auf der Straße bei Wein und Mandeln sitzen und die Köpfe zusammenstecken.
Nicht mal ein Kriminalbeamter kommt darauf, daß da am Nebentisch gerade ein Kapitalverbrechen geplant wird. Auch – oder erst recht – kein Mitarbeiter der Mordkommission … wie ich.
Also ging ich, von der Parade praller Popos, dem Défilé design-kostümierter Damen und Herren amüsiert, aber auch ermüdet, zurück ins Hotel, las noch eine halbe Stunde, suchte auf der Berg-und-Talbahn-Matratze die erträglichste Schlafstellung und schlief schließlich – mit der Aussicht auf den schönen Wechsel – wohlgelaunt ein.
Eine knappe Viertelstunde nach Leo Klipps Abgang brachen auch die vier Männer auf, die an seinem Nebentisch gesessen hatten und ihm ein bißchen rätselhaft erschienen waren.
Sie mußten im Gänsemarsch durch das Gedränge gehen, da die gepflasterten Flanierwege für zwei Leute nebeneinander zu schmal waren, wenn solcher Hochbetrieb war.
Voran lief einer der gutgekleideten Südländer, ein großer, deutlich selbstbewußter Mann in den Fünfzigern. Er lief mit jenem breitbeinigen Schritt, den Seeleute haben, wenn sie nach längerer Schaukelreise an Land kommen.
Ab und zu wandte er den Kopf, als wolle er kontrollieren, ob sein Gefolge noch vollzählig sei. Dann blitzten in den Gläsern seiner getönten Brille die bunten Lichter der Restaurants und Boutiquen, die den Weg links und rechts säumten.
Als zweiter ging im Watschelgang übergewichtiger Männer der rosafarbene Blonde. Er trug eine teuer aussehende Kollegmappe.
Das Utensil wirkte seltsam fremd in dieser Umgebung, denn nicht ein einziger der Aufundabwandelnden hatte so eine Aktentasche bei sich.
Dem Blonden machte es offenbar Mühe, das Tempo zu halten, das der Große an der Spitze der Truppe einschlug. Er schwitzte, schnaufte und nahm alle paar Meter seine Mappe in die andere Hand.
Der dritte des Quartetts war ein mittelgroß-molliger Mensch. Er mochte auch etwa fünfzig Jahre alt sein, hatte sich das glänzend schwarze Haar bis auf den Kragen wachsen lassen, rauchte einen dünnen Zigarillo, der ihm zwischen den wulstigen Lippen hing, und ließ seinen blonden Vordermann nicht aus den Augen.
Einem argwöhnischen Beobachter hätte es vorkommen können, als bewache er einen Delinquenten.