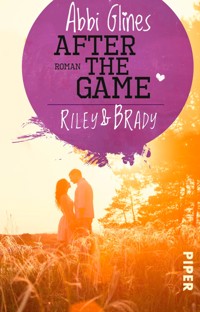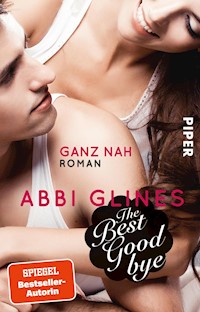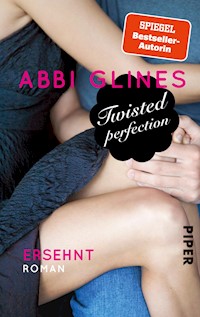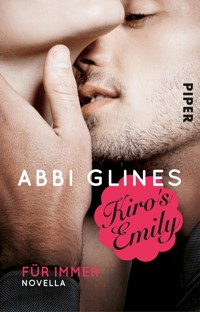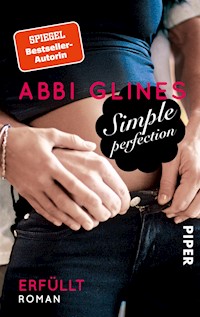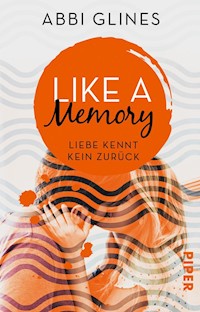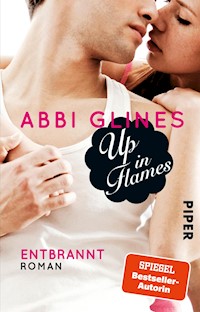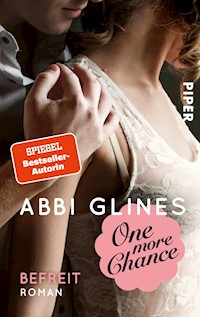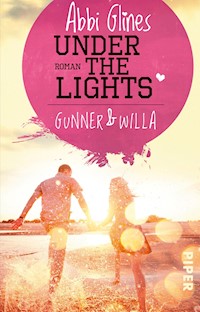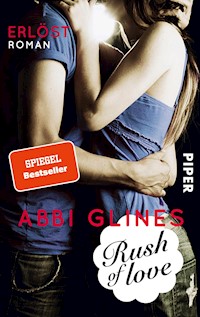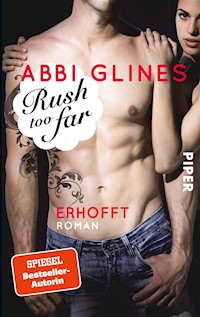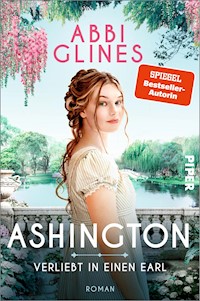
9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Piper ebooks
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Die Ballsaison ist eröffnet! Die SPIEGEL-Bestseller-Autorin Abbi Glines wollte nicht nur schon immer Britin sein, sie ist auch bekennender »Bridgerton«-Addict. Mit ihrer ersten Regency Romance erfüllt sich die New Adult Autorin einen lange gehegten Traum – und die LeserInnen sind begeistert! Prunkvolle Bälle, edle Abendgarderobe, die noble High Society. Doch hinter all dem glitzernden Schein verbergen sich fein gesponnene Intrigen, süße Rache und heimliches Verlangen ... London 1815: Ein bezauberndes Lächeln, vielsagende Blicke, ein Wimpernschlag im richtigen Moment – Miriam weiß, wie man einen wohlhabenden Ehemann findet. Doch alles in ihr sträubt sich dagegen. Das Einzige, was sie davon abhält, ihre Sachen zu packen und zurück aufs Land zu ihren Büchern zu fliehen, ist ihre kleine Schwester. Für sie wird sie bleiben. Für sie wird Miriam eine Verbindung eingehen, die es ihr ermöglicht, den finanziellen Ruin der Familie nach dem Tod des hoch verschuldeten Vaters abzuwenden. Für sie ist Miriam bereit, jedes Opfer zu bringen. Er weiß, was von ihm erwartet wird, und er wird niemanden enttäuschen. Obwohl Hugh Compton, Earl of Ashington, den Titel nie wollte, hat er vor zwei Jahren sein Erbe angetreten. Sein Vater war unerwartet gestorben, und das einzig Gute daran war, dass Hugh endlich seine Stiefmutter aus dem Herrenhaus jagen konnte. Nun ist es an der Zeit, seinen Verpflichtungen zu folgen – zu heiraten und einen Erben zu zeugen. Er hat auch schon eine passende Braut auserkoren, jetzt muss sie nur noch seine Frau werden. Viele mögen den arroganten Earl nicht, aber niemand hasst ihn so sehr wie sein Halbbruder. Als der kaltherzige Earl seine Mutter wie Abfall aus dem Haus geworfen hat, schwor Nicholas Compton verbittert Rache. Jetzt nimmt er an der Londoner Ballsaison in der Absicht teil, seinem heiratswilligen Bruder die langweilige Lydia Ramsbury auszuspannen. Doch schon bald stellt Nicholas zu seiner Überraschung fest, dass eine andere Debütantin die volle Aufmerksamkeit seines Bruders erregt hat – eine gewisse Miss Miriam Bathurst. Noch nie war Rache so süß.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2022
Ähnliche
Mehr über unsere Autorinnen, Autoren und Bücher:
www.piper.de
Wenn Ihnen dieses Buch gefallen hat, schreiben Sie uns unter Nennung des Titels »Ashington – Verliebt in einen Earl« an [email protected], und wir empfehlen Ihnen gerne vergleichbare Bücher.
Für Emerson – du, mein wildes, blitzgescheites und willensstarkes Töchterchen, bist Emma.
© Abbi Glines 2021
Titel der amerikanischen Originalausgabe: »Glitter«,
Abbi Glines Publishing, Fairhope, 2021
© Piper Verlag GmbH, München 2022
Redaktion: Carina Heer
Covergestaltung: t. mutzenbach design, München
Covermotiv: Shelley Richmond / Trevillion Images und Shutterstock.com
Konvertierung auf Grundlage eines CSS-Layouts von digital publishing competence (München) mit abavo vlow (Buchloe)
Sämtliche Inhalte dieses E-Books sind urheberrechtlich geschützt. Der Käufer erwirbt lediglich eine Lizenz für den persönlichen Gebrauch auf eigenen Endgeräten. Urheberrechtsverstöße schaden den Autoren und ihren Werken. Die Weiterverbreitung, Vervielfältigung oder öffentliche Wiedergabe ist ausdrücklich untersagt und kann zivil- und/oder strafrechtliche Folgen haben.
Inhalte fremder Webseiten, auf die in diesem E-Book hingewiesen wird, macht sich der Verlag nicht zu eigen und übernimmt dafür keine Haftung.
Inhalt
Inhaltsübersicht
Cover & Impressum
Prolog
Sechs Monate vorher
Miriam Bathurst
1. Kapitel
Miss Miriam Bathurst
2. Kapitel
Der Earl of Ashington
3. Kapitel
Miss Miriam Bathurst
4. Kapitel
Mr Nicholas Compton
5. Kapitel
Der Earl of Ashington
6. Kapitel
Miss Miriam Bathurst
7. Kapitel
Mr Nicholas Compton
8. Kapitel
Miss Miriam Bathurst
9. Kapitel
Mr Nicholas Compton
10. Kapitel
Der Earl of Ashington
11. Kapitel
Miss Miriam Bathurst
12. Kapitel
Mr Nicholas Compton
13. Kapitel
Der Earl of Ashington
14. Kapitel
Miss Miriam Bathurst
15. Kapitel
Mr Nicholas Compton
16. Kapitel
Miss Miriam Bathurst
17. Kapitel
Der Earl of Ashington
18. Kapitel
Miss Miriam Bathurst
19. Kapitel
Mr Nicholas Compton
20. Kapitel
Miss Miriam Bathurst
21. Kapitel
Der Earl of Ashington
22. Kapitel
Miss Miriam Bathurst
23. Kapitel
Der Earl of Ashington
24. Kapitel
Miss Miriam Bathurst
25. Kapitel
Der Earl of Ashington
26. Kapitel
Miss Miriam Bathurst
27. Kapitel
Emma Marie Compton
28. Kapitel
Der Earl of Ashington
29. Kapitel
Miss Miriam Bathurst
30. Kapitel
Der Earl of Ashington
31. Kapitel
Miss Miriam Bathurst
32. Kapitel
Der Earl of Ashington
33. Kapitel
Miss Miriam Bathurst
34. Kapitel
Mr Nicholas Compton
35. Kapitel
Miss Miriam Bathurst
36. Kapitel
Der Earl of Ashington
37. Kapitel
Miss Miriam Bathurst
38. Kapitel
Miss Miriam Bathurst
39. Kapitel
Der Earl of Ashington
Epilog
Sechs Jahre darauf
Danksagung
Einige Anmerkungen von Abbi …
Buchnavigation
Inhaltsübersicht
Cover
Textanfang
Impressum
Alle Augen waren auf sie gerichtet, dessen war sich Miriam bewusst, ganz gleich, ob sie nun eine ganze Drehung vollführte oder auch nur leicht die Hand bewegte. Es fiel ihr schwer, ihr Lächeln aufrechtzuerhalten, und gewiss entging das auch ihrem Tanzpartner nicht.
Das war er also. Der letzte Ball, den sie als Miss Miriam Bathurst besuchte. Für weiteres Grübeln blieb keine Zeit. Ihre Entscheidung war gefallen.
Unwillkürlich versteifte sich Miriam in den Armen des Mannes, dessen Heiratsantrag sie an diesem Morgen im Rosengarten ihrer Tante angenommen hatte. Denn sie liebte einen anderen und nicht ihn, selbst wenn sie es sich noch so sehr gewünscht hätte. Andererseits konnte sie nicht ewig darauf warten, dass der Mann, dessen Liebe sie mitunter zu spüren geglaubt hatte, sich zu einer Entscheidung durchrang. Ihrer Mutter und Schwester zuliebe musste sie heiraten. Als sie aufblickte und ihrem Tanzherrn in die schönen grünen Augen sah, lächelte sie aufrichtig, wenn auch traurig.
Heute Abend würde sie zum letzten Mal ungezwungen seine Freundschaft und Gesellschaft genießen können. So vieles würde sich ändern, und sie hoffte, sie würde ihre Entscheidung nie bereuen müssen.
Denn wenn sie erst einmal seine Gattin war, würde der Mann, den ihr verräterisches Herz liebte, sie hassen. Ein Gedanke, der ihr unsagbare Schmerzen bereitete. Doch sie wusste, seine Wahl wäre nie auf sie gefallen. Das hatte er durch sein Versäumnis, sich zu erklären, deutlich gemacht.
Sechs Monate vorher
Miriam Bathurst
achtzehn Jahre und einen Monat alt
Man könnte meinen, im Leben einer jungen Dame gäbe es nichts Schöneres, als – eingedeckt mit eleganten Gewändern und einem hübschen Gesicht dazu – nach London zu reisen und auf den Heiratsmarkt geworfen zu werden. Zumindest wenn es nach meiner Mutter ging. Wäre jemandem an meiner Meinung gelegen gewesen, was offenkundig nicht der Fall war, hätte man anderes zu hören bekommen. Ich machte mir nichts aus all dem Mumpitz, den eine Londoner Saison versprach. Wer wollte schon in Ballkleider gezwängt werden, die unsäglich schwer und unbequem waren, und das Gewicht des hoch aufgetürmten Haars ertragen, das mit Perlen, Blumen und dergleichen mehr aufgeputzt war? Das alles klang so grauenhaft, dass ich liebend gern auf alles und jedes davon verzichtet hätte.
»Wie wahrhaft magisch muss es sein, inmitten all dieser Herrlichkeit zu tanzen. Kannst du dir vorstellen, wie sie alle schimmern, schillern und glitzern müssen?«, fragte meine zwölfjährige Schwester Whitney mit verträumter Stimme. Wie stets meldete sich umgehend mein schlechtes Gewissen. Es erinnerte mich daran, dass das, wovor mir so graute, eben das war, was Whitney sich so inständig wünschte – jedoch nie erleben würde. Seit einem schrecklichen Sturz vom Pferd mit neun Jahren zog sie ein Bein nach und würde daher nie in einem Ballsaal tanzen können. Sie würde nie eine Tanzkarte an ihrem zarten Handgelenk tragen, auf der die Namen derer standen, die einen Augenblick in ihrer Gegenwart verbringen wollten. Sie würde nie als die wahre Schönheit angesehen werden, die sie war – es sei denn, ich änderte etwas daran. Es lag allein an mir, meiner Schwester das erträumte Leben doch zu ermöglichen. Für sie würde ich alles tun. Sogar mein eigenes Leben opfern.
Ich setzte ein Lächeln auf und drehte mich zu ihr um. Sie saß auf dem Sofa unseres gemeinsamen Schlafzimmers und sah mir beim Packen zu. Seit dem Tod unseres Vaters im vergangenen Jahr hatte sich unsere Welt auf den Kopf gestellt, was vor allem daran lag, dass mein Vater ein Spieler gewesen war und einen Berg Schulden hinterlassen hatte. Nun hatten wir nicht nur keine Dienstboten mehr im Haus, nein, auch Tafelsilber besaßen wir keines mehr. Um die Schulden zu begleichen und Essen auf den Tisch zu bringen, hatte Mutter alles verkauft, was ihr an Wertvollem in die Hände fiel. Ich störte mich nicht an der einfacheren Lebensweise, begrüßte sie sogar. Weniger Aufhebens um die Garderobe. Keine förmlichen Tischsitten. In meinen Augen unerwartete, glückliche Erleichterungen. Es machte mir nichts aus, mir mein Frühstück selbst zu holen und meiner Mutter und meiner Schwester die Mahlzeiten zu servieren, die ich zuzubereiten vermochte. Nach so manchem Missgeschick in der Küche war ich inzwischen zumindest imstande, eine ordentliche Kanne Tee zuzubereiten.
In London würde das alles nicht so einfach sein.
»Du wirst frischen Wind nach London bringen, Miriam«, schwärmte meine Schwester aufgeregt. »Wenn ich doch nur mit dabei sein könnte!«
Wehmut, gepaart mit Traurigkeit, lag in ihrer Stimme, und ich wünschte mir nichts sehnlicher, als dass Whitney alles bekäme, was sie wollte. Oft haderte ich mit Gott, dass es Whitney war, die mit einem hinkenden Bein geschlagen war und nicht ich. Ich wäre nämlich durchaus zufrieden gewesen, allein auf dem Land zu leben, Romane zu schreiben und die Einsamkeit zu genießen.
Ich war kein großer Freund der Menschen. So einfach war das. Ihr Verhalten ärgerte mich. Ich bevorzugte Wahrheiten, doch die meisten der Menschen, die ich bislang kennengelernt hatte, nahmen es damit nicht so genau. Zumeist kam es ihnen lediglich auf ihre Wirkung auf andere an. Allen außer Whitney.
Wenn es denn überhaupt ein vollkommenes Geschöpf gab, dann war sie es: selbstlos, freundlich, klug, voller Hoffnung. Mit ihrer Anwesenheit erhellte sie jeden Raum. Noch war mir kein zweiter Mensch wie sie begegnet. Sie war das wahre Juwel in dieser Familie, und ich würde dafür sorgen, dass der Augenblick kam, an dem sie erstrahlen konnte.
Ich besaß keine ihrer Eigenschaften; dem würde meine Mutter zustimmen, die mich oft wegen meines kecken und unhöflichen Benehmens ausschalt. Und mir widerstrebten die Dinge, die sie sich für mich wünschte. Genau das hatte im Lauf der Jahre immer wieder für Konflikte gesorgt. Früher einmal hatte ich mich danach gesehnt, dass Mutter mich ebenso liebevoll ansah wie meine Schwester. Aber mit der Zeit erkannte ich, dass Whitney im Gegensatz zu mir leicht zu lieben war.
Wann immer Mutter laut wurde, um sich über meine Manieren oder mein Verhalten zu echauffieren, war Whitneys liebe Stimme das Einzige, das mich im Zaum hielt. Sie war es, die ich nicht enttäuschen wollte. Anderen mochte das unlogisch erscheinen, aber die hatten auch keinen Einblick in unser Familienleben und wussten nicht, was wir durchgemacht hatten. Unser Vater war über keine seiner beiden Töchter glücklich gewesen. Er hatte sich einen Sohn gewünscht.
Dieser Wunsch schien in Erfüllung zu gehen, als meine Mutter ein Zwillingspaar gebar – doch mein Bruder überlebte nur wenige Tage. Mehr als einmal in meinem Leben hatte ich mir von meinem Vater anhören müssen, er wünschte, ich wäre anstelle meines Bruders gestorben. Ich wagte niemandem gegenüber zuzugeben, wie sehr mich das verletzte. Oft fragte ich mich, ob ich wohl Whitney ähnlicher wäre, wenn mich mein Vater weniger abgelehnt hätte. Ihr hatte er einfach keine Beachtung geschenkt, weshalb sie immerhin nie so harsche Worte zu hören bekommen hatte wie ich. Ihr sanftes Wesen machte es unmöglich, an ihrem Verhalten etwas auszusetzen.
Dieser Gedanke ließ mich auch verschmerzen, dass Mutter Whitney mehr Zuneigung entgegenbrachte als mir. Whitney brauchte das, denn sie war nicht so dickhäutig wie ich und hätte es nicht überlebt, eine ungewollte Enttäuschung zu sein.
»Onkel Alfred wird bestimmt nichts dagegen haben, nach dir zu schicken, da bin ich mir gewiss. Gleich nach meiner Ankunft werde ich ihn darum bitten. Ich kann den Gedanken an unsere Trennung nicht ertragen!«
Whitney sah strahlend zu mir auf. Ihr Lächeln war einfach zum Niederknien. Hätte ich auf Schönheit Wert gelegt, dann hätte ich sie für dieses zauberhafte Lächeln gewiss beneidet. Doch auf mein Aussehen gab ich nichts. Mein Gesicht diente nur dem einen Zweck, einen wohlhabenden Ehemann zu finden, um meine Schwester und meine Mutter gut versorgt zu wissen. Onkel Alfred hatte sich bereit erklärt, ihnen unter die Arme zu greifen, wenn auch nicht so, wie ich es mir gewünscht hätte. Zumindest, was Whitney anging. Ich hatte mich in der Bibliothek meines Vaters stundenlang in medizinische Fachzeitschriften vertieft und wusste daher, dass es Verfahren gab, die das Hinken meiner Schwester, wenn auch nicht vollkommen beseitigen, so doch zumindest lindern konnten. Was hieß, dass all ihre Träume wahr werden konnten! Mit ihrem märchenhaften Ansehen gehörte Whitney in schöne Gewänder und sollte in dem Licht tanzen, das nach ihren Vorstellungen aufs Wundersamste glitzerte.
Soweit es in meiner Macht stand, ihr das zu ermöglichen, würde ich es tun. Für meine Schwester würde ich mich einer Kugel in den Weg stellen, und manchmal hatte ich das Gefühl, es wäre ohnehin dasselbe. Vielleicht war die Kugel sogar vorzuziehen? Ich hatte nicht das Gefühl, als ob ich jemals in die Rolle passen würde, die ich jetzt zu spielen hatte.
Ich wandte mich wieder meiner Ausstattung zu, um meine finstere Miene bei dem Gedanken, mich mit einem Mann abgeben zu müssen, zu verbergen. Ich mochte Männer nicht. Schließlich hatte mir mein Vater die Grausamkeit des anderen Geschlechts vor Augen geführt. Da vertiefte ich mich lieber in meine Bücher oder griff zur Feder und verfasste Geschichten über mutige und einfallsreiche Frauen.
»Oh, glaubst du, er wird es tun? Wirklich?«, fragte Whitney, während ich ein weiteres Kleid zusammenfaltete und in meinen Koffer legte. Ich hatte noch nie selbst gepackt und bezweifelte, dass ich es richtig machte. Ich tat es aber so, wie ich es von den wenigen Gelegenheiten in Erinnerung hatte, bei denen Anna, meine ehemalige Zofe, es für mich getan hatte. Ich vermisste Anna so sehr. Sie hatte immer ein offenes Ohr für mich gehabt! Hoffentlich hatte sie eine gute neue Anstellung gefunden und wurde ordentlich behandelt. Mutter hatte mir zwar versichert, sie habe dafür gesorgt, dass alle Bediensteten gut untergebracht würden, aber bei meiner Mutter stellte sich immer die Frage, wie viel man ihr glauben sollte. Ich hatte sie schon bei so mancher Unwahrheit erwischt.
»Ja, da bin ich sicher. Nach allem, was ich gehört habe, hat Onkel Alfred das Herz auf dem rechten Fleck.«
»Weißt du irgendetwas über Tante Harriet? Mutter sagt, sie ist Amerikanerin.« Whitney sagte das so, als müsste jemand aus Amerika äußerst exotisch sein. Ich lächelte.
»Mutter ist ihr bisher nur einmal begegnet und hat mir wenig über sie erzählt«, erwiderte ich aufrichtig, verschwieg jedoch Mutters pikierte Miene, als sie mich davon unterrichtete, dass Onkel Alfred mir eine Anstandsdame zur Seite stellen würde, um mir den Einstieg in die Gesellschaft zu erleichtern. Mutter billigte die Wahl ihres Bruders bei der Ehefrau eindeutig nicht. Was nur heißen konnte, dass ich Tante Harriet bestimmt ins Herz schließen würde.
»Ohne dich wird es in diesem Zimmer so einsam sein!« Der melancholische Ton, den Whitneys Stimme angenommen hatte, versetzte mir einen Stich ins Herz. Ich wollte sie nicht verlassen. Sie war der einzige Mensch auf der Welt, den ich wahrhaftig liebte. Ich legte eines der wenigen schöneren Tagesgewänder, die ich noch in den Koffer packen musste, auf das Bett und drehte mich zu ihr um.
»Ich werde dich schrecklich vermissen, und ich verspreche dir, dich so bald nach London zu holen, wie ich nur kann. Dass ich überhaupt gehe, tue ich auch für Mutter, aber hauptsächlich für dich. Ich wünsche dir alles Glück der Erde. Ich liebe dich!« Weder meine Mutter noch mein Vater hatten diese drei Worte je ausgesprochen, und ich sagte sie auch nicht oft genug. Dabei hatte ich von dem Moment an, als Mutter mir zum ersten Mal die in eine weiche gelbe Decke gehüllte Whitney gezeigt hatte, begriffen, was Liebe wirklich bedeutete. Selbst im zarten Alter von sieben Jahren hatte ich gewusst: Für dieses kleine Wesen würde ich alles tun. Ich würde es vor jedem Schaden bewahren, koste es, was es wolle.
»Ach, guck nicht so trübsinnig. Das hätte ich nicht sagen sollen. Ich wollte nur, dass du weißt, wie sehr du vermisst werden wirst.« Whitney zwang sich zu einem Lächeln, das ihre Augen nicht erreichte.
»Bis wir uns wiedersehen, werde ich jeden Tag traurig sein. Ich verspreche, dir in meinen Briefen von all den schönen Menschen, den belebten Straßen und den Klatschgeschichten zu berichten, die ich zweifelsohne hören werde«, versuchte ich, ihre Stimmung zu heben.
»Und von all den schönen Ballkleidern! Ich muss alles darüber wissen, wie sie funkeln und schimmern. Und auch den Grosvenor Square musst du mir ausführlich schildern.«
»Was denkst du denn? Ich werde ihn dir bis ins kleinste Detail beschreiben«, versprach ich und hoffte, dass ich ihren Erwartungen auch gerecht werden konnte. Ob ich das Gepränge, von dem sie träumte, überhaupt wahrnehmen würde? Meine Ansichten über den Heiratsmarkt standen in scharfem Gegensatz zu ihren.
1. Kapitel
Miss Miriam Bathurst
Ohne dass ein Klopfen mich darauf vorbereitet hätte, schwang die Tür zu meinem Zimmer im Haus meines Onkels in Mayfair auf, und meine Tante Harriet kam hereingestürmt. Sie trug ein Kleid im reinsten Himmelblau und lächelte so breit, dass oberhalb ihrer Zähne das Zahnfleisch zu sehen war. Das tat sie gerne und oft. Inzwischen wusste ich, dass sie dieses Lächeln vorausschickte, wenn sie in ihrem seltsamen amerikanischen Akzent etwas anzukündigen hatte. Dabei sprach sie grundsätzlich in einer Lautstärke, als hielte ich mich im Zimmer nebenan auf. Ich fragte mich, ob sie es machte, weil ich mich mit ihrem Akzent und vielen der Ausdrücke, die sie benutzte, manchmal schwertat. Mein Onkel hatte sein Vermögen mit dem Export von Whisky, Tabak und Baumwolle aus New Orleans gemacht und dort auch meine Tante kennengelernt. Ich hatte schon viele Bücher über Amerika gelesen, die mich jedoch nicht auf meine Tante vorbereitet hatten. Sie war, wie Whitney erwartet hatte, in der Tat sehr … exotisch.
»Es ist angekommen, Honey, und es ist wunderschön!«, verkündete sie und breitete am Fußende meines Bettes ein Meer aus Stoff aus. »Ich sagte, das Kleid müsse einer Prinzessin gerecht werden, und die Schneiderin hat den Auftrag perfekt umgesetzt!« Sie stutzte. »Herrje, wie heißt sie gleich wieder? Es ist ein französischer Name, das weiß ich immerhin noch.« Tante Harriet biss sich auf die Unterlippe, eine weitere Angewohnheit von ihr neben der, mit mir wie mit einer Schwerhörigen zu sprechen.
»Marguerite Badeaux«, half ich ihr auf die Sprünge, obwohl mir klar war, dass Tante Harriet den Namen nicht behalten würde. Namen und auch andere Dinge vergaß sie oft. Erst gestern hatte sie ihre Hausschuhe gesucht, die sie, wie so oft, ausgezogen hatte, dabei hatte sie beide die ganze Zeit über in der linken Hand gehalten.
»Ja, ja, sie hat sich genau nach meinen Wünschen gerichtet. Sieh doch bloß!« Sie deutete seufzend auf das Kleid auf meinem Bett und hielt sich beide Hände dramatisch an die Brust.
»Du wirst einfach traumhaft aussehen. Noch atemberaubender als bei deiner Vorstellung vor der Königin, und dabei hast du da schon alle bezaubert. Wie eindeutig du doch ihren Beifall gefunden hast! Andererseits, wie denn auch nicht? Dein Gesicht ist das eines Engels. Ich hätte es nicht für möglich gehalten, dass ein anderes Kleid das von jenem Tag überstrahlen könnte, und doch schafft es dieses hier, und zwar über die Maßen. Du wirst im Handumdrehen unter der Haube sein!«
Whitney hätte einfach alles an diesem Kleid geliebt. Tante Harriet hatte recht, es war wunderhübsch. Doch da ich vor dem heutigen Abend eine Heidenangst hatte, konnte ich das überhaupt nicht schätzen.
Inzwischen weilte ich seit fast zwei Monaten in London und bereitete mich nun auf den eigentlichen Saisonbeginn vor. Tatsächlich hatte sich diese Zeit als faszinierender erwiesen als erwartet, da mir Onkel Alfred entgegen Mutters Aussage doch keine englische Anstandsdame zur Seite gestellt hatte. Stattdessen hatte er mich der Obhut Tante Harriets übergeben, was an sich schon unterhaltsam war. Sie wusste nichts über die Regeln und Einschränkungen der feinen Londoner Gesellschaft. Selbst an meinen trübseligsten Tagen zauberte sie mir mit ihren Malheuren und ihrem wunderlichen Verhalten ein Lächeln ins Gesicht. Insofern hatte ich die Zeit hier weit mehr genossen, als ich es je für möglich gehalten hatte.
Whitney hatten meine Briefe über meine Ausflüge mit Tante Harriet – das schloss ich aus ihren Antworten – sehr amüsiert. Fast glaubte ich, ihr melodiöses Lachen zu hören, wenn sie meine Beschreibungen der Tage las, die ich in Mayfair verbrachte. Ich vermisste sie schrecklich und hoffte, sie würde bald zu einem Besuch eingeladen. Doch Mutter sorgte sich viel zu sehr um meine Einführung in die Gesellschaft, als dass Whitney so bald hätte herkommen und mich ablenken dürfen. Mich lenkten ja die in mich gesetzten Erwartungen schon ab! Doch mein Zuhause vermisste ich schmerzlich, obwohl mir Tante Harriet täglich Unterhaltung bot.
»Ich schicke Betsey gleich zu dir hinauf. Du hast von Haus aus bezauberndes Haar, aber ich glaube, wenn man Betsey Zeit lässt, schafft sie es mit ihren Frisierkünsten, dass selbst eine Krone dagegen blass aussieht.«
Vermutlich ging ihre Fantasie mit meiner Tante durch, andererseits störte es mich auch nicht, dazusitzen und mich von Betsey frisieren zu lassen. Von meinem lang gehegten Wunsch, mir meine Haare kürzer schneiden zu lassen, wollte meine Mutter nichts wissen. Dabei bereiteten mir meine schweren kupferroten Locken oft Kopfschmerzen. Mutter allerdings schien sie für einen meiner größten Vorzüge zu halten. Wenn ich anderer Meinung war, so zählte das offenkundig nicht.
»Danke, Tante Harriet«, antwortete ich schlicht. Denn ich war dankbar. Für so vieles. Dafür, dass sie keine überspannte Langweilerin war. Dass sie glücklich darüber war, dass mein Onkel ihr die Aufgabe aufgehalst hatte, mich mit einem gut situierten und rechtschaffenen Mann zu verehelichen. Und dass ich, wenn ich mich gut anstellte, eine reelle Chance hatte, meiner Schwester ein besseres Leben zu ermöglichen.
»Ich kann nicht umhin zu bemerken, dass du über all das nicht glücklich wirkst.« Meine sonst immer so vergnügte Tante furchte die Stirn, und ich bekam ein schlechtes Gewissen, dass ich das verursacht hatte.
»Ich bin dankbar«, erwiderte ich, denn ich konnte mich nicht reinen Gewissens als glücklich bezeichnen, »ich vermisse nur meine Schwester«, gestand ich. »Aber ich bin so dankbar, dass Onkel Alfred und du mir diese Chance gebt. Mein größter Wunsch ist, meinen Beitrag dazu zu leisten, dass Whitney gut versorgt ist.«
Meine Tante sah weiterhin düster drein. »Und was ist mit dir, Honey? Du sprichst immer nur über das Glück deiner Schwester, was an sich ja sehr lobenswert ist, aber wie sieht’s mit deinem eigenen aus? Willst du die Londoner Saison nicht genießen und als Ballschönheit gelten? Gehen dir denn keine Träume über deine Zukunft im Kopf herum? Alle jungen Mädchen haben doch Träume. Ich war schließlich auch mal eines. Und an meine Träume kann ich mich noch sehr gut erinnern.«
Ja, auch ich hegte Träume. Träume, aus denen nichts würde, weil aus ihnen nichts werden konnte. Ich wusste, wenn ich Tante Harriet davon erzählte, hätte sie Verständnis und würde nicht auf mich herabsehen. Aber es waren meine Träume, meine Geheimnisse, und so sollte es auch bleiben.
»Ich träume davon, einen Mann zu finden, der gütig zu mir und meiner Familie ist«, schwindelte ich. Aus diesem Grund war ich hier. Ich betrachtete es als meine Pflicht, aber es war nicht mein Traum.
Seufzend kam Harriet zu mir und tätschelte mir die Schulter, als ob sie mich trösten müsste.
»Vielleicht merkst du eines Tages, dass ich eine gute Zuhörerin bin. Ich habe mehrere jüngere Schwestern, weißt du? Und ich habe mehr auf dem Kasten, als es den Anschein hat.« Mit diesen Worten drehte sie ich um und rauschte mit raschelnden Röcken aus dem Raum. »Betsey!«, rief sie noch viel zu laut, bevor sie die Tür hinter sich zuzog.
Angesichts ihrer schrillen Stimme fuhr ich zusammen und musste mir dann die Hand vor den Mund halten, um mein Lachen zu dämpfen. Die Geschichten, die ich nach dem heutigen Ball in meinem Brief an Whitney zum Besten geben würde, würden in der Tat … schillernd sein. Ohne es darauf anzulegen, würde Tante Harriet allen die Show stehlen. Ob sie wohl jeden so anbrüllte, mit dem sie sprach? Ich hoffte es wirklich. Es würde mir Unterhaltungsstoff für zwei Wochen bieten – mindestens!
Ich stand auf und ging zu dem blauen Kleid hinüber. Noch nie hatte ich ein so schönes Kleid besessen. Als ich jünger war, viel jünger noch als Whitney, hatte auch ich davon geträumt, so etwas zu tragen. Diese Unmengen an Seide! Ich berührte das Kleid kurz und lächelte. Whitney wäre hin und weg davon. In meinem nächsten Brief würde ich es ihr in allen Einzelheiten beschreiben.
Meine Eltern hatten beileibe nicht aus Liebe geheiratet. Und somit war ich bislang auch nicht davon ausgegangen, dass das zu einer Ehe dazugehörte. Doch mein Onkel betete seine Frau förmlich an, und sie vergötterte ihn schon fast. Es war erhebend, die beiden zu erleben, und es stand zu befürchten, dass ich mir für mich, je länger ich mich in ihrer Nähe aufhielt, insgeheim auch eine Liebesheirat wünschte. Doch der Gedanke war unrealistisch, und ich konnte meine Zeit auch nicht mit der höchst schrulligen Idee verschwenden, ich könnte mich verlieben. Was wusste ich schon von der Liebe? Wahrhaftig sehr wenig. Da besann ich mich besser auf andere Dinge und ließ nicht zu, dass mein Egoismus und meine Eitelkeit die Oberhand gewannen.
Wie immer herrschte auf der Straße vor meinem Fenster reges Treiben. Gern beobachtete ich die Leute, die in ihren Tagesgewändern vorbeiflanierten, um gesehen zu werden. Wie sehr sich hier doch alles von meinem Leben auf dem Land unterschied! Dort hatten wir nur selten Gäste, und das Bedürfnis, andere in den Schatten zu stellen, war einem fremd. An den meisten Tagen fand ich mich in der Küche wieder, wo ich versuchte, etwas Essbares zustande zu bringen, oder Bettzeug wusch. Seit Vaters Tod hatten wir alle Arbeiten im Haushalt selbst übernommen. Während sich meine Mutter oft darüber beklagte und vor Überdruss seufzte, fühlte ich mich dadurch nützlich. Ich genoss es, dass mein Dasein dadurch an Sinn und Zweck gewann.
In dem Treiben unten auf der Straße hingegen konnte ich weder einen Sinn noch einen Zweck erkennen. Bis auf die Frage, was sie auf dem nächsten Ball tragen oder welches der Klatschblätter, die ihnen in die Finger kamen, sie lesen sollten, drückten die Menschen dort doch keinerlei Sorgen. Ich ließ mich auf die Fensterbank sinken und seufzte einmal mehr. Zu genau so einer Person würde ich mich nun auch entwickeln. Mir stand eine äußerst langweilige Zukunft bevor, da half alles Schönreden nichts!
2. Kapitel
Der Earl of Ashington
Als ich das letzte Mal bereits am Vormittag ein Glas Brandy getrunken hatte, geschah das zur Feier des Umstandes, dass ich meine Stiefmutter aus dem Haus geworfen hatte, und um mich innerlich auf die Rückkehr meines erzürnten Bruders aus Paris vorzubereiten. Heute gab es nichts zu feiern, ich bereitete mich lediglich auf den Ballbesuch an diesem Abend vor. An den albernen Veranstaltungen, die mit der Londoner Saison einhergingen, nahm ich für gewöhnlich nicht teil. Ihr Besuch hatte in der Regel allein den Zweck, sich möglichst passend zu verheiraten, und daran hatte ich bis vor Kurzem keinen Bedarf gehabt.
Die Tatsache, dass eine Heirat und die Geburt eines Erben bedeuteten, dass mein Bruder nach meinem Ableben nicht die Nachfolge als Earl of Ashington anträte, war für mich zwar durchaus ein Ansporn gewesen, Brautschau zu halten. Als wirklich dringlich hatte ich die Angelegenheit jedoch nie erachtet, sonst hätte ich das Ganze mit mehr Elan vorangetrieben. Doch inzwischen hatte ich etwas Wichtigeres als einen Titel zu schützen, und es war in der Tat an der Zeit zu heiraten.
Eine Frau zu finden, die die Rolle der Countess einnehmen konnte, wäre an sich kein Kunststück gewesen. Junge Damen, die eben darauf vorbereitet wurden, fanden sich in London zuhauf. Doch in meinem Fall musste die Kandidatin auch noch eine andere, für mich weit wichtigere Rolle ausfüllen. Eine derartige Dame ausfindig zu machen erwies sich schon als wesentlich schwieriger.
Eine Countess zu werden war eine Sache, meine Gemahlin zu sein eine ganz andere. Mich gab es nämlich nur mit einer Beigabe, was aber niemandem bewusst war … noch nicht. Ich trank einen weiteren Schluck Brandy und lehnte mich mit einem langen, tiefen Seufzer in meinem Sessel zurück. Das vergangene Jahr war weiß Gott chaotisch gewesen, und meine Geduld war auf eine harte Probe gestellt worden. Zweifellos hatten nur Erinnerungen an meine Kindheit dazu beigetragen, dass ich nicht das Handtuch warf und mich vor meiner Verantwortung drückte.
Nunmehr war Eile geboten. Nach zahlreichen Nachforschungen war meine Wahl auf eine gewisse Miss Lydia Ramsbury gefallen. Sie war die Enkelin eines Dukes und von sanftem und ruhigen Gemüt, zudem durch und durch englisch und genau das, was dieses Haus brauchte. Die Wahl einer Mutter für meine Kinder nahm ich nicht auf die leichte Schulter, und ein hübsches Gesicht reichte keineswegs.
Die schwere Tür zu meinem Büro wurde schwungvoller geöffnet als nötig, und auch ohne hinzusehen, wusste ich sofort, welches Persönchen da hereingeplatzt kam. Es war über meine abendlichen Pläne unterrichtet worden und hatte nun zweifellos eine Menge Fragen auf dem Herzen. Ich setzte mich aus meiner entspannten Position auf und begegnete dem neugierigen Blick meiner Inquisitorin.
»Du gehst auf einen Ball?«, fragte sie. Bei der Erwähnung des letzten Wortes leuchteten ihre Augen auf. Ihre Vorstellungen von einem Ball waren weit von der Realität entfernt, da war ich sicher.
»Mylord, es tut mir leid. Miss Emma sollte eigentlich ein Schläfchen halten. Ich habe leider zu spät bemerkt, dass sie mir wieder einmal entwischt ist«, entschuldigte sich Alice, die wohl strapazierfähigste Gouvernante Englands, die hinter Emma in den Raum geeilt kam.
»Ich möchte auch auf einen Ball gehen!« Emma drehte sich kichernd vor meinem Schreibtisch im Kreis, dass die goldenen Locken flogen. »Schau, ich tanze wie eine Prinzessin!«
Ich nickte und sorgte dafür, dass das Lächeln, das Emma mir so oft entlockte, deutlich zu sehen war. Davon hatte sie in ihrem kurzen Leben noch nicht viel zu sehen bekommen, und ich wollte ihr nie eines vorenthalten. Schließlich wusste ich nur zu gut, was Kälte bei einem Kind anrichtete. Mein Bruder und ich konnten ein Lied davon singen.
»Miss Emma, um an Bällen teilzunehmen, seid Ihr noch zu jung. Es ist Zeit für Euer Nickerchen. Und nun kommt!«, befahl Alice in dem für sie typischen strengen Ton.
Völlig unbeeindruckt bedachte Emma Alice mit einem finsteren Blick und wandte ihre Aufmerksamkeit wieder mir zu. »Gehst du allein hin?«
Ich nickte. »Ja, ich besuche ihn allein.«
Das schien sie zu beunruhigen, denn sie blickte noch finsterer drein. »Du wirst dich einsam fühlen!«
»Emma, Seine Lordschaft wird dort vielen Freunden begegnen und auch Damen, mit denen er tanzen kann. Darüber braucht sich ein Kind nicht den Kopf zu zerbrechen. Für Euch heißt es jetzt ein für alle Mal: Ab ins Kinderzimmer!« Noch immer bemühte sich Alice, so zu klingen, als hielte sie die Zügel fest in der Hand. Dabei wussten wir alle drei, dass ihr die Kontrolle über das Kind längst entglitten war. Mir allerdings genauso.
»Alice ist unhöflich!« Emma machte wiederum ein düsteres Gesicht. »Sie ist oft unhöflich, Ashington«, meinte sie, und dieses Mal versuchte ich, mein Lächeln zu verbergen.
»Miss Emma!«, rief Alice entsetzt aus. »Wie oft habe ich Euch schon gesagt, dass Ihr den Earl mit Lord Ashington anreden sollt?«
Achselzuckend stemmte Emma ihr kleines Händchen in die Hüfte. »Was weiß denn ich, wie oft! Ich kann ja nur bis zehn zählen und, wenn ich will, manchmal bis zwanzig.«
Unwillkürlich lachte ich auf, wofür ich von Alice einen missbilligenden Blick erntete. »Wenn meine Erziehung Früchte tragen soll, Mylord, dürfen wir sie nicht in diesem … rebellischen Verhalten bestärken. Es ist inakzeptabel!«
Alice hatte diese Arbeitsstelle erst angenommen, nachdem sie sich vergewissert hatte, dass mir klar war, dass sie von Emma erwartete, sich so zu verhalten, als wäre sie die legitime Tochter eines Earls. Alice wollte, dass Emma ein Leben führte, das meinem Rang entsprach, und zu gegebener Zeit in die Gesellschaft aufgenommen wurde.
Die warf in diesem Moment ihr langes blondes Haar zurück und strahlte mich an. Sie genoss es, wenn ich über ihre Mätzchen lachte und im Gegenzug von Alice gescholten wurde.
»Sie ist doch erst vier«, erinnerte ich Alice. Im Grunde war ich durchaus stolz darauf, wie intelligent und schlagfertig Emma in diesem zarten Alter schon war.
»Die Angabe in ihrer Geburtsurkunde zweifele ich an, Mylord. Für so ein junges Alter ist sie schon viel zu … reif und schwierig!«
Ich hingegen hegte keinerlei Zweifel. Dafür kannte ich den Zeitraum, in dem ihre Mutter mit ihr schwanger geworden sein musste, nur zu gut. Solange Bisset war gut über ein Jahr meine Mätresse gewesen, bevor wir unser »Übereinkommen« beendet hatten. Als Emma dann vor einem Jahr vor meiner Tür gestanden hatte, waren ihre Augen der einzige Beweis, den ich brauchte. Ihre Farbe und die Art, wie Emma mich ansah, sagten mir, dass sie eine Compton war.
»Emma, es wird Zeit, dass du mit Alice ins Kinderzimmer gehst. Beim Frühstück morgen berichte ich dir ausführlich von dem Ball. Na, wie klingt das?«
Ihr kleines, rundes Gesicht hellte sich auf, und sie nickte begeistert. So voller Energie, wie sie steckte, bezweifelte ich, dass Alice Emma heute dazu bringen würde, ein Schläfchen zu halten. Die Kleine drehte sich um und eilte zur Tür. »Beeilen Sie sich, Alice, ich muss ein Nickerchen machen!«
Angesichts des erschöpften Blicks, den Alice mir zuwarf, musste ich schmunzeln. Ja, Emma konnte einen auf Trab halten! Sie brauchte eine Mutter, keine Frage. Solange war ihr keine wirkliche Mutter gewesen, ehe sie sie in die Hände einer Fremden gegeben hatte. Ich würde nicht zulassen, dass ein weiteres Compton-Kind so behandelt wurde, wie ich in diesem Haus behandelt worden war. Ich bemühte mich sehr, ihre Illegitimität zu vertuschen, konnte mir aber nicht sicher sein, dass meine Lüge nicht irgendwann auffliegen würde. Vor allem angesichts der Tatsache, wie gut Emma sich schon ausdrücken konnte, befürchtete ich, dass sie vielleicht selbst Dinge ausplauderte, über die ich lieber den Mantel des Schweigens gebreitet hätte. Außerdem war das Gedächtnis dieses Kindes unglaublich, und das bedauerte ich insofern, als es Dinge gab, die sie besser vergessen hätte.
Die Tür schloss sich mit einem leisen Klicken, und ich griff erneut nach meinem Getränk. Mit Emma hatte sich für mich alles verändert. Vor allem mit Blick auf meine Zukunft. Ich durfte keine Zeit mehr verschwenden. Der Groll, den ich einst gegen meine Stiefmutter gehegt hatte, war vergessen. Mit dem Reitunfall, der sie letztes Jahr das Leben gekostet hatte, hatten sich all meine Ressentiments gegen diese Frau in Rauch aufgelöst. Und der Hass, der mir vonseiten meines Halbbruders entgegenschlug – nach dem Tod seiner Mutter zumal, als ob es meine Schuld gewesen wäre –, war nicht von Belang. Nicht, wenn ich an Emma denken musste. Nach ihrer Ankunft hier hatte ich eigentlich bei entfernten Verwandten auf dem Land ein gutes Zuhause für sie finden wollen. Einen Ort, wo sie behütet aufwachsen und zu einer Gouvernante oder einer ähnlich respektablen Position ausgebildet werden konnte.
Doch schon zwei Wochen darauf wusste ich, dass Emma hierbleiben würde. Wie konnte man sie wegschicken, wenn man ihr hier das Leben bieten konnte, das sie verdiente? Ich hatte die Möglichkeit, ihr ein schönes Zuhause zu schaffen und sie aufzuziehen, wie es sich geziemte, und genau das hatte ich auch vor. Ganz zuoberst auf meinem Plan stand, eine geeignete Frau zu finden, die bereit war, Emma als mein Kind zu akzeptieren. In Lydia schien ich sie gefunden zu haben. Hoffentlich irrte ich mich nicht.
3. Kapitel
Miss Miriam Bathurst
Ich kannte den Begriff »Opulenz« und war mir über seine Bedeutung im Klaren. Es war ein faszinierendes Wort, das ich gerne laut aussprach, doch bis zu diesem Moment hatte ich noch nie am eigenen Leib erlebt, was Opulenz wirklich bedeutete.
In meinen Büchern waren Bälle in adeligen Häusern nicht angemessen beschrieben worden. Jetzt erkannte ich, dass Whitneys fantasievolle Ideen vielleicht mehr Wahrheiten enthielten als geglaubt. Es war ein derartiges Glänzen, ein Wirbeln und Funkeln, dass ich nach meinem Eintreten in den Ballsaal für einen Augenblick geblendet war. Was London an Glanz, an Seide und Juwelen zu bieten hatte, gab sich offenbar in diesen Räumlichkeiten ein Stelldichein.
Während ich alles in mich aufnahm, verfasste ich im Geiste bereits einen Brief an sie. Nichts durfte ausgelassen werden! Ich war fest entschlossen, ihr solche Gesellschaftsbälle eines Tages zu ermöglichen. Doch bis dahin würde ich sie ihr so schildern, dass sie das Gefühl hatte, selbst dabei zu sein.
Tante Harriet stand neben mir, und ich musterte sie verstohlen. Ob sie von unserer Umgebung wohl ebenso beeindruckt war? Doch sie trug dieselbe Miene zur Schau wie sonst auch. Nun wandte sie sich mir lächelnd zu. »Na dann, auf, auf!« Sie machte eine Geste, als würde sie mich einladen, mich an einem Büfett zu bedienen. Tatsächlich aber war ich völlig ahnungslos, was wir jetzt zu tun hatten, und vielleicht hatte meine Mutter ja genau deshalb eine geeignete Anstandsdame für mich erbeten. Denn Tante Harriet war sich über den weiteren Ablauf offenbar auch im Unklaren.
»Lady Wellington, nehme ich an?« Bei der Nennung des offiziellen Titels meiner Tante drehten wir uns beide um. Zu meiner Erleichterung gluckste diese darauf nicht gleich los wie sonst so oft.
Vor uns stand die Gastgeberin des heutigen Abends, die Duchess of Rothesborne. Ich war ihr zwar noch nie begegnet, doch dank meiner gründlichen Vorbereitungen auf die Saison erkannte ich sie sofort.
»Ja, hallo …«, begann meine Tante, und ich machte rasch einen Knicks, damit Harriet nicht gleich ins nächste Fettnäpfchen treten konnte. »Euer Gnaden«, sagte ich, und meine Tante bemerkte ihren Fehler und tat es mir nach.
»Euer Haus ist wunderschön«, schwärmte Tante Harriet viel zu laut und schenkte der Herzogin dazu ein allzu breites Lächeln mit viel sichtbarem Zahnfleisch. Dass sich das nicht ziemte, verstand meine Tante natürlich nicht. Ich fügte dies sogleich dem Brief hinzu, den ich Whitney in Gedanken bereits schrieb.
Der einschüchternde Blick der Duchess war nun auf mich gerichtet, und ich versuchte, Ruhe zu bewahren. »Sie sind Miss Bathurst«, stellte sie fest, als ob sie mich über eine wichtige Neuheit informierte. »Ich war neugierig auf Sie.«
Unsicher, wie ich darauf reagieren sollte, behielt ich mein Lächeln bei, schwieg aber. Was hätte ich darauf auch erwidern sollen?
»Sie machen sich gut!«, fügte die Duchess hinzu. »Genießen Sie den Abend.« Noch ein kurzes Neigen des Kopfes, dann bewegte sie sich mit einem sanften Rascheln ihrer Röcke an uns vorbei.
»Mir schwirrt jetzt schon der Kopf«, raunte mir meine Tante zu, während sie weiterhin ihr allzu breites Lächeln zeigte.
»In der Tat«, stimmte ich zu.
Ein Gentleman, nicht viel älter als ich, trat auf mich zu. »Verzeihung, aber ich hoffe sehr, auf Ihrer Tanzkarte ist noch ein Platz frei«, sagte er mit einer angedeuteten Verbeugung.
Tante Harriet versetzte mir einen leichten Rippenstoß, und ich versuchte, nicht zusammenzuzucken, als sie dazu auch noch kicherte. Ich bezweifelte stark, dass sich dieser Mann als Retter meiner Familie erweisen würde. Dafür war er bei Weitem zu jung. Gleichwohl musste ich gesehen werden, um die Aufmerksamkeit anderer möglicher Bewerber auf mich zu ziehen.
Doch schon bald war ich des Tanzens und der ständigen Unterhaltungen über Belanglosigkeiten müde, und das Flanieren im Park oder am Square kam mir gar nicht mehr so töricht vor. Eigentlich war es als Zeitvertreib allemal vorzuziehen, man musste dabei ja lediglich hübsch dreinschauen und kam um die lästige Konversation herum. Dass sich nun mehrere Männer um mich scharten und auf mich einredeten, empfand ich hingegen als zermürbend. Um einen Ehemann zu finden – und deswegen war ich nun einmal in London –, war das zwar erforderlich, doch je länger es sich hinzog, desto klarer wurde mir, dass meine Vorliebe für das Einsiedlertum dabei ein großes Hindernis sein könnte.
»Ich bitte um Verzeihung, Gentlemen, aber mich dünkt, ich bin der Nächste auf der Tanzkarte der Dame.« Mit diesen Worten brachte eine tiefe Stimme die anderen zum Schweigen, und wie auf Kommando wichen die anderen Bewerber vor ihrem Besitzer zur Seite. Meine Überraschung darüber legte sich, sobald der Gentleman vor mir stand. Er strahlte etwas Einschüchterndes aus. Im Übrigen wusste ich genau, dass sein Name nicht auf meiner Tanzkarte stand. Das Verhalten der Umstehenden verriet mir jedoch, dass ich es hier mit dem Träger eines gewichtigen Titels zu tun hatte. Allerdings konnte ich mich keiner Anrede entsinnen, die zu diesem Gesicht gepasst hätte.
»Wenn Ihr gestattet, Lord Ashington, ich glaube, ich bin der Nächste auf Miss Bathursts Karte«, meldete sich ein Mann, der sich als Mr Fletcher vorgestellt hatte, mit leicht bebender Stimme zu Wort.
Ohne von ihm Notiz zu nehmen, stand Lord Ashington abwartend vor mir. In seinem Blick lag eine Herausforderung, die wohl an mich gerichtet war. Sollte ich ihm zuliebe etwa schwindeln? Meinen künftigen Ehegatten sah ich in Mr Fletcher zwar nicht, aber er war freundlich und hatte sich, wie das nervöse Beben in seiner Stimme verriet, für seinen Einwand gerade einen gehörigen Ruck geben müssen. Ich würde ihn jetzt nicht zugunsten eines einflussreicheren Mannes einer Peinlichkeit aussetzen, wenngleich Lord Ashington offensichtlich davon ausging. Arroganz war jedoch nie reizvoll, zumindest in meinen Augen nicht.
»Ich bin mir überaus sicher, dass Mr Fletcher recht hat.« Ich sah zu dem hochgewachsenen dunkelhaarigen Mann auf und weigerte mich, mich von seinem selbstsicheren Blick einschüchtern zu lassen. Bislang hatte ich mich hauptsächlich über diejenigen Mitglieder der vornehmen Gesellschaft kundig gemacht, deren Häuser wir diese Saison aufsuchen würden. Der Name Ashington befand sich nicht darunter. Sein Gesicht sagte mir gar nichts, doch die Reaktionen der anderen auf ihn ließen vermuten, dass er von Bedeutung war. Das war ja alles gut und schön, aber deshalb tanzte ich noch lange nicht nach seiner Pfeife!
Lord Ashington musterte mich einen Augenblick mit hochgezogener Augenbraue. »Ein Versehen meinerseits«, meinte er dann, wandte sich wieder Mr Fletcher zu und nickte leicht.
»Ich werde, äh, Lord Ashington, ich werde auf meinen Tanz verzichten, äh, wenn Sie es wünschen«, stammelte Mr Fletcher. Das war so armselig, dass ich am liebsten die Augen verdreht hätte. War Mr Fletcher ein solcher Weichling? Was konnte ihm Lord Ashington anhaben, dass ihm so die Nerven flatterten? Hatte ich ihm zuliebe Lord Ashington nicht gerade abgewiesen?
»Das wird nicht nötig sein, Fletcher. Meine Aufmerksamkeit hat sich anderweitig verlagert, merke ich gerade.« Mit diesen Worten stolzierte Lord Ashington durch den Gang davon, den die anderen für ihn gebildet hatten.
Oh, là, là, das hatte gesessen. Eine weitere Unterhaltung würde es wohl kaum geben!
Jemand berührte mich nicht gerade dezent am Ellbogen, und als ich mich umdrehte, entdeckte ich meine Tante, die Lord Ashington mit besorgter Miene nachsah.
»Herrjemine, was hast du zu Lord Ashington gesagt?«, flüsterte sie mir zu.
»Er hat behauptet, er wäre der Nächste auf meiner Tanzkarte, was aber nicht stimmt. Er steht ja nicht einmal darauf!«
Tante Harriet kaute unruhig auf der Unterlippe. Woher stammte ihre plötzliche Besorgnis? Es beunruhigte mich etwas, dass sie Lord Ashington überhaupt kannte. Das Gesicht der Duchess hatte ihr vorhin nichts gesagt. Warum also seines?
Mr Fletcher trat auf mich zu und bot mir den Arm. »Darf ich bitten?«, fragte er, und so gern ich mir auch Tante Harriets Erklärung angehört hätte, hatte ich gegenüber Mr Fletcher doch eine Verpflichtung.
Schon bald nach dem Tanzbeginn begriff ich, dass Mr Fletcher nicht nur kein großer Redner, sondern auch äußerst angespannt war. An mir konnte es nicht liegen, daher schob ich es auf die Begegnung mit Lord Ashington. Das trübte meine Laune zwar ein wenig, doch verderben lassen wollte ich sie mir dadurch nicht.
Ende der Leseprobe