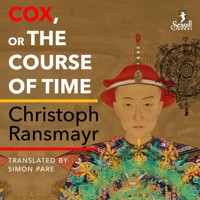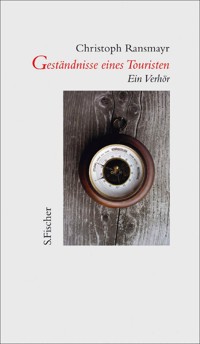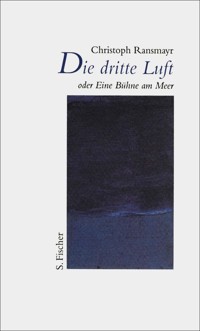9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: FISCHER E-Books
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
- Veröffentlichungsjahr: 2012
Ein großer erzählter Weltatlas. Christoph Ransmayrs ›Atlas eines ängstlichen Mannes‹ ist eine einzigartige, in siebzig Episoden durch Kontinente, Zeiten und Seelenlandschaften führende Erzählung. »Ich sah…«, so beginnt der Erzähler nach kurzen Atempausen immer wieder und führt sein Publikum an die fernsten und nächsten Orte dieser Erde: In den Schatten der Vulkane Javas, an die Stromschnellen von Mekong und Donau, ins hocharktische Packeis und über die Passhöhen des Himalaya bis zu den entzauberten Inseln der Südsee. Wie Landkarten fügen sich dabei Episode um Episode zu einem Weltbuch, das in Bildern von atemberaubender Schönheit Leben und Sterben, Glück und Schicksal der Menschen kartographiert.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 459
Ähnliche
Christoph Ransmayr
Atlas eines ängstlichen Mannes
FISCHER E-Books
Inhalt
Geschichten ereignen sich nicht, Geschichten werden erzählt.
In den siebzig Episoden dieses Atlas ist ausschließlich von Orten die Rede, an denen ich gelebt, die ich bereist oder durchwandert habe, und ausschließlich von Menschen, denen ich dabei begegnet bin, Menschen, die mir geholfen, die mich behütet, bedroht, gerettet oder geliebt haben. Mit einer Ausnahme: Ein einziges Mal kommt hier auch ein Ort zur Sprache, an dem ich niemals war, der mir aber durch die Beschreibungen meiner Frau vertraut geworden ist. Daß ich den Namen dieses Ortes für mich behalte, soll daran erinnern, daß wir vieles, was wir von unserer Welt zu wissen glauben, nur aus Erzählungen kennen und: daß (fast) jede Episode dieses Buches auch von einem anderen Menschen, der sich ins Freie, in die Weite oder auch nur in die engste Nachbarschaft und dort in die Nähe des Fremden gewagt hat, erzählt worden sein könnte.
Gewidmet ist dieser Atlas meiner Frau Judith – ohne ihre Liebe wäre ich zumindest von einer Reise nicht mehr zurückgekehrt – und der Erinnerung an Johanna, meine Lebens- und Reisegefährtin über viele Jahre: Ohne sie hätte ich mich vielleicht nie auf den Weg gemacht.
Kollmannsberg Alm, im Frühjahr 2012
CR
Fernstes Land
Ich sah die Heimat eines Gottes auf 26° 28´ südlicher Breite und 105° 21´ westlicher Länge: eine menschenleere, von Seevögeln umschwärmte Felseninsel weit, weit draußen im Pazifik. Mehr als dreitausendzweihundert Kilometer waren es von diesen umbrandeten, baum- und strauchlosen Klippen ohne Süßwasser, ohne Gras, ohne Blütenpflanzen und Moos bis zur chilenischen Küste, von wo mein Schiff vor einer Woche mit Kurs auf Rapa Nui, die Osterinsel, ausgelaufen war.
An die Reling gelehnt, an der ich mich wegen der hohen Dünung immer wieder mit beiden Händen festhalten mußte, beobachtete ich seit einer Stunde, wie der am Ende kaum dreißig Meter aus dem Wasser ragende Umriß der Insel zwischen Wellenbergen aufgetaucht, wieder versunken und schließlich doch über den Horizont gestiegen war und nun dem Schiff so nahe kam, daß die verwehenden Wasserstaubfahnen der gegen die Felsen donnernden Brecher Bullaugen und Ferngläser beschlugen.
Daß dieses unter der Märzsonne glühende, wüste Stück Land überhaupt in Sicht gekommen war, lag an einem Hunderte Seemeilen langen Ausweichmanöver, mit dem der Kapitän die Ausläufer eines riesigen, von Kap Hoorn ausgehenden Sturmtiefs umschiffen wollte. Die Dünung, selbst hier und bei strahlendem Himmel immer noch acht bis zehn Meter hoch, ließ bedrohliche Rückschlüsse auf die Wellenhöhen und Sturzseen in unserem ursprünglichen Fahrwasser zu.
Der Name Friedlicher oder Stiller Ozean, hatte der Kapitän seine allmorgendlichen, über Bordlautsprecher bis an festgeschraubte Betten und Frühstückstische übertragenen Durchsagen zu Position, Luftdruck, Seegang und Kurs beendet, sei schon zur Zeit seiner ersten Befahrung durch europäische Seeleute bloß der Name einer vergeblichen Hoffnung gewesen. Der Pazifik, hier im Süden oder Tausende Seemeilen weiter in alle Richtungen der Windrose, sei weder stiller noch friedlicher als andere, auf weniger schöne Namen getaufte Meere und erhebe sich nicht anders als diese unter dem Druck von Stürmen und der Anziehungskraft des Mondes zu Wassergebirgen, die man ohne Not besser nicht durchquerte.
Aus kartographischer Sicht war die vulkanische Felsformation vor uns nur der kahle, umtoste Gipfel eines dreitausendfünfhundert Meter aus der Tiefsee hochragenden Berges, der auf den Seekarten als Salas y Gómez verzeichnet war und so an zwei, am Ende doch vergessene, spanische Kapitäne erinnern sollte – der eine hatte die nur wenige hundert Meter messende Felsformation als erster Europäer gesichtet, der andere hatte sie ein Lebensalter danach betreten und kartographiert.
Aber die Rapa Nui, sagte ein erschreckend dünner Mann, der sich neben mir an der Reling festhielt, jenes rätselhafte Volk, das um den Preis des eigenen Untergangs die Osterinsel mit nahezu tausend Steinstatuen geschmückt hatte, seien schon Jahrhunderte vor diesen vermeintlichen Entdeckern mit Binsenflößen über eine Distanz von fast vierhundert Kilometern immer wieder hierher gesegelt und gerudert und hatten diesem Ort einen schöneren, viel schöneren Namen gegeben: Manu Motu Motiro Hiva. Das sei manchmal mit Vogelinsel auf dem Weg in fernstes Land, aber auch mit Insel auf dem Weg in die Unendlichkeit übersetzt worden. Denn aus welchen Tiefen der polynesischen Inselwelt die Rapa Nui ursprünglich auch immer gekommen waren, sagte der dünne Mann, am Ende hatte sich in ihren Überlieferungen wohl jede Erinnerung an den Ort ihres Ursprungs und an alles Festland verloren und der Überzeugung Platz gemacht, daß es außer ihnen keine Menschen auf dieser Welt gab und in einem unendlichen Ozean unter einem unendlichen Himmel kein Land neben ihrer eigenen Insel.
Ich hatte Mühe, den dünnen Mann zu verstehen. Nicht allein wegen des Tosens von Wasser und Wind oder weil jene seltsame Mischung aus Englisch und Spanisch, die er sprach, immer auch Worte aus einer oder mehreren Sprachen enthielt, die ich noch nie gehört hatte, sondern vor allem, weil auch jetzt und wie schon bei unseren Begegnungen in den vergangenen Tagen, stets in der Schwebe blieb, ob er mit mir oder bloß mit sich selber sprach – über die Reling hinweg aufs Meer.
Was für ein Schock mußte es gewesen sein, sagte er, als die Rapa Nui auf einem ihrer ausgedehnten Fischzüge, vielleicht auch bloß nach einer durch Strömungen und Stürme erzwungenen Irrfahrt, auf diese Vogelinsel gestoßen waren. Ein Schock, der sie am Ende glauben ließ, die Heimat eines Gottes gefunden zu haben. Denn wenn es in dieser Unendlichkeit tatsächlich noch ein zweites Land gab, dann mußte dort, sichtbar oder unsichtbar, der wohnen, dem das Dasein der fernen Heimat und von Himmel und Erde und allem, was im Wasser oder an der Luft lebte, zu verdanken war – ein Allmächtiger, den sie Make-Make nannten.
Der dünne Mann war auf dem Weg von Puerto Montt nach Hause, nach Hanga Roa, dem nach einer jahrhundertelangen Geschichte der Entvölkerung einzigen noch bewohnten Ort der Osterinsel. Sein Vater, hatte er schon am ersten Abend nach dem Auslaufen aus Puerto Montt in der Bar auf dem Achterdeck erzählt oder auch bloß vor sich hin gesagt, sei ein Argentinier gewesen, der sein Leben auf Ölbohrinseln verbracht habe, seine Mutter aber eine Rapa Nui.
Das weite, mit Meeresfischen auf tiefblauem Grund bedruckte Buschhemd, das den dünnen Mann umflatterte, war durchnäßt von der Gischt, die manchmal bis zum Handlauf der Reling hochschäumte, und wenn der Wind den nassen Stoff für einen Augenblick an seinen Brustkorb drückte, erschien seine Gestalt noch zerbrechlicher und abgezehrter. Der dünne Mann war mir bereits am ersten Morgen nach dem Auslaufen am Frühstücksbüffet aufgefallen, als er ein Stück Lachs, dann ein Stück Schinken, dann ein Stück Honigmelone auf seinen Teller gelegt, einen Augenblick innegehalten und dann Schinken, Lachs und Melone doch wieder auf den überladenen Altar des Büffets zurückgelegt und zu einer Schale Tee nur ein Stück dunkles Brot gegessen hatte.
Richtig, sagte er später, es war im Verlauf eines langen Abends, am dritten oder vierten Tag unserer Bekanntschaft, Essen sei für ihn oft eine quälende Verpflichtung. Eigentlich habe er niemals Hunger und müsse sich manchmal selbst zum Trinken zwingen. Und dennoch verfolge ihn das Gefühl, so schwer und massig wie eine der Moais, der kolossalen Steinfiguren auf der Osterinsel, zu sein, für deren Herstellung und Transport die Rapa Nui über die Jahrhunderte alle ihre Kräfte erschöpft und ihre Palmenwälder, ihre Fischgründe, ihre Gärten und Felder und schließlich sogar den Frieden zwischen den Clans der Insel geopfert hatten.
Diese Figuren, die alle dem Meer den Rücken zuwandten und so ausnahmslos ins Landesinnere und damit vielleicht sogar ins Innerste ihrer Bewohner starrten, seien lange Zeit Monumente eines Ahnenkults gewesen, der die Gegenwart mit der Ewigkeit verbinden sollte. Aber nach und nach seien sie zu Macht- und Statussymbolen verkommen und gewachsen und größer, immer größer geworden und hatten schließlich das Leben auf der Insel aufzufressen begonnen.
Im Tuffsteinbruch Rano Raraku, aus dem fast alle der Moais geschlagen und dann zu den über die ganze Osterinsel verstreuten Zeremonialplattformen, Ahus, geschleppt worden waren, sagte der dünne Mann, seien noch heute nebeneinander und übereinander und immer noch mit dem Fels verwachsene Kolosse von zwanzig Metern Höhe und mehr zu sehen – und konnten dort nun bis in alle Ewigkeit darauf warten, endlich vom Fels gelöst, aufgerichtet und in mühseligen Prozessionen auf rollenden Palmenstämmen zu ihren Ahus transportiert zu werden. Denn am Ende hatten die Rapa Nui, versklavt von ihren eigenen steinernen Geschöpfen, ihre Insel in ein baum- und strauchloses Ödland verwandelt und hatten keine Mittel und keine Kräfte mehr für die Fertigstellung und Bewegung der vermeintlich mächtigsten, in Wahrheit aber bloß letzten Kolosse.
Der Hunger!, war der dünne Mann überzeugt, der Hunger sei vielleicht die verborgene und wahre Bestimmung dieses Volkes, seines Volkes, gewesen. Denn als alles, was zu fällen war, gefällt, alles, was zu fischen und zu jagen war, gefischt und erjagt, die Palmenhaine verschwunden und nicht einmal genug Holz geblieben war, um noch Fischerboote zu bauen, waren die Clans, die das Inselreich bis dahin unter sich geteilt und bestellt hatten, übereinander hergefallen, hatten die unter unsäglichen Mühen errichteten Moais der jeweiligen Nachbarn gestürzt, enthauptet und sich am Ende nicht nur gegenseitig umgebracht, sondern auch gefressen. Daß durch die Ruinen der Welt der Rapa Nui schließlich noch Kolonialherren trampelten, die riesige Schaf- und Rinderherden über das entvölkerte Land trieben, die letzten Bewohner der Insel in umzäunte Areale verbannten oder als Sklaven zum Guanoabbau an die peruanische Steilküste verschleppten, war nur die Vollendung eines Unheils, das im Herzen der Insel und nicht irgendwo in der Ferne begonnen hatte.
Seine Mutter, sagte der dünne Mann, sei vor vier Jahren nach ärztlichem Befund zwar an einer Blutvergiftung gestorben, in Wahrheit aber wohl verhungert. Jahrelang habe sie fast alles, was sie zu sich nahm oder was der Vater sie bei seinen seltenen Besuchen zu essen zwang, heimlich wieder erbrochen. Manchmal habe er noch jetzt dieses Würgen im Ohr, das nach jeder Mahlzeit zu hören war, wenn er ihr durch einen engen dunklen Gang des Elternhauses auf Hanga Roa zur Toilette nachschlich.
Aber vielleicht sei dieses Hungern, sei dieses Fasten auch bloß der verzweifelte Versuch gewesen, sich vom Schicksal ihres Volkes zu lösen und sich in einen, ja, Astralleib, habe sie gesagt, in einen Astralleib zurückzuziehen, der endlich frei war von der unseligen Abhängigkeit von ein paar Bissen Brot. Denn wer nicht nach Brot hungerte, hatte auch keinen Hunger nach Feldern, Weidegründen, Macht, wollte niemanden beherrschen, niemanden töten, niemanden fressen. Vielleicht war es das, was die Moais sahen, wenn sie dem Pazifik, dem mächtigsten Element dieser Erde, den Rücken zukehrten, um allein ins Innere der Insel und ihren Bewohnern ins Herz zu blicken.
Und er, sagte der dünne Mann, er habe nach dem Tod seiner Mutter, ohne es zu wollen und zunächst auch ohne sich dessen bewußt zu sein, die Appetitlosigkeit wohl als Erbe übernommen und dadurch vielleicht ihren lebenslangen Traum erfüllt. Denn anders als sie, die manchmal doch der Freßgier erlegen war, wenn sie in den Nächten heimlich und schlaftrunken in der finsteren Küche in sich hineinschlang, was immer sie fand, dann aber doch jeden Bissen wieder erbrach, habe er alle Lust am Essen vielleicht für immer verloren.
Der dünne Mann umklammerte die Reling so fest, daß seine Fingerknöchel sich weiß abzeichneten. Als die Gischt seine Handrücken benetzte und glitzern ließ, erschien seine Haut so zart, ja gläsern wie die von feinsten Adern durchzogenen Netzflügel einer Florfliege.
Was habe denn näher gelegen, sagte er und schwankte vor und zurück, ohne den Handlauf loszulassen, als sich in Zeiten der Not, in Zeiten des Hungers auf den Weg in die Heimat des Gottes zu machen und um Beistand, um Erlösung von diesem allesfressenden Hunger zu bitten – auf den Weg nach Manu Motu Motiro Hiva, zur Insel, hinter der die Unendlichkeit begann? Wie viele Rapa Nui waren wohl auf dieser Wallfahrt verschwunden? Auch wenn sie es meisterhaft verstanden, nicht nur die Sterne, sondern auch das Relief und die Farbe der Wellen, die Strömungen, Windstärken, selbst die Ornamente des Vogelflugs in ihr navigatorisches Kalkül einzubeziehen, war es doch eine Fahrt auf einem Binsenfloß geblieben, auf einem Schilfbüschel!, bei einem Seegang wie diesem hier.
Rußseeschwalben, sagte der dünne Mann und zeigte auf stumme, möwenähnliche Vögel mit schwarzweißen Schwingen, die von einem kotbedeckten Felsturm aufgeflogen waren und unser Schiff neugierig umkreisten, Rußseeschwalben seien den Rapa Nui heilig gewesen. Mit ihrem Erscheinen begann der Frühling oder das, was auf der Osterinsel als Frühling gefeiert wurde. Das ganze Jahr, ja die Zeit selbst sei von diesen Vögeln sozusagen in Gang gesetzt worden. Vielleicht waren es auch die hier brütenden, geheiligten Rußseeschwalben gewesen, die zum Glauben geführt hatten, hier wohne ein Gott. War es nicht bemerkenswert, was für ein Leben es auf diesen vulkanischen Klippen gab, und bemerkenswert, welche wunderbaren Namen dieses Leben führte – Weihnachtssturmtaucher, Maskentölpel, Meerläufer, Feenseeschwalben … Sie alle brüteten hier.
Als der dünne Mann in die Brusttasche seines Hemdes griff und daraus ein von der Gischt getränktes Stück dunkles Brot hervorzog, glaubte ich, er würde versuchen, die Rußseeschwalben zu füttern, die hier, so weit draußen und fern aller nautischen Routen, vielleicht weder Menschen noch Schiffe kannten. Aber der dünne Mann führte das nasse Brot zum Mund und begann langsam, den Blick unverwandt auf die schwarze, auf und ab tanzende Insel gerichtet, zu essen.
Reviergesang
Ich sah eine ferne Gestalt vor einem verfallenen Wachturm jenes fast neuntausend Kilometer langen Verteidigungswalls, der im Land seiner Erbauer Wanli Chang Cheng – Unvorstellbar lange Mauer, vom Rest der Welt aber Chinesische Mauer genannt wird.
Am Morgen hatte es geschneit, und ich wanderte seit Stunden auf der Mauerkrone zwischen Simatai und Jinshanling in der Provinz Hebei durch das Yan-Gebirge. Wie eine vom Wind verwehte und dann an Gipfeln und Graten hängengebliebene Girlande wand sich die Mauer hier mit ihren Zinnen, Wach- und Alarmfeuertürmen durch unbewohntes Bergland, fiel über schroffe Höhenzüge steil in menschenleere Täler ab, aus denen sie ebenso steil wieder aufstieg, und änderte mit dem Verlauf eines Höhenrückens ihre Richtung, um nach einem abermaligen Wechsel wieder auf die Ideallinie verschollener Baumeister und Generäle einzuschwenken.
Hätte der frühe Schnee nicht alles Dunkle, Mauerwerk, Ruinen, Felsen, noch schärfer hervortreten lassen, wäre mir die Gestalt auf diese Entfernung wohl kaum aufgefallen. Aber nun glaubte ich sogar zu sehen, daß, wer immer dort stand, ein Fernglas vor die Augen hob und in meine Richtung sah.
Ich war auf meiner Wanderung über einen Mauerabschnitt, der wegen seiner Steilheit und seiner verfallenen Passagen wenig begangen wurde, seit nahezu zwei Stunden keinem Menschen begegnet und nun überrascht, auf jemanden zu treffen, der offensichtlich aus entgegengesetzter Richtung auf mich zukam; die dünne Schneedecke vor mir trug keine Spuren.
Die Gestalt rührte sich nicht von der Stelle, während ich in einem schattigen Abstieg und Wiederaufstieg im Naßschnee eine Senke durchquerte, und so befürchtete ich schon, am Wachturm einem Soldaten oder einem Aufseher zu begegnen, der mir die Fortsetzung meiner Wanderung wegen der Brüchigkeit des Mauerwerks verbieten würde. Das größte Bauwerk der Menschheit hatte den Bewohnern angrenzender Landstriche immer wieder als Steinbruch gedient, noch Mao Tse-tungs Volksbefreiungsarmee hatte Mauersteine für den Bau von Brücken und Nachschubwegen verwendet, aber seit der Wall unter Denkmalschutz stand, versahen Bewacher, auch freiwillige Kontrollposten, manchmal noch in den entlegensten Gegenden Dienst.
Ich hatte in Peking von Wettbewerben unter Mauerläufern gehört, bei denen zum Sieger erklärt wurde, wer die längste Strecke ohne Unterbrechung auf verbotenen, gesperrten Abschnitten zurücklegen konnte. Den etwa fünfhundert Kilometern gut erhaltener oder gut restaurierter, jederzeit zugänglicher Mauerabschnitte lagen Abertausende Kilometer eines oft überwucherten, in der Wildnis kaum noch als Architektur erkennbaren Trümmerwalls gegenüber.
Als ich aber nach meinem mühsamen Aufstieg über eine Passage, die steil wie eine an die Wand gelehnte Leiter war, die Gestalt endlich erreichte, traf ich weder auf einen Soldaten noch einen Mauerläufer, sondern auf einen weißhaarigen Europäer, der trotz der Kälte keine Mütze trug und nach einer freundlichen Begrüßung den Schnee zu verfluchen begann.
Mr. Fox aus der walisischen Grafschaft Swansea war ein Birdwatcher, ein Vogelfreund, und seit dem frühen Morgen auf der Mauerkrone unterwegs, um Singvögel zu beobachten, zu fotografieren und ihre Gesänge, Warnrufe oder Haßlaute mit einem winzigen Digitalrekorder aufzuzeichnen. Es war der einundvierzigste Mauerabschnitt, den er auf diese Weise entlangwanderte.
Aber was, sagte Mr. Fox, sollte bei diesem Schnee schon groß zu sehen und zu hören sein? Er konnte sie ja verstehen: Die meisten Singvögel haßten den Schnee ebenso wie er und saßen jetzt in ihren Verstecken aufgeplustert still, um Kräfte zu sparen an einem Tag, an dem die Nahrung unerreichbar in einem kalten Weiß begraben lag. Eine Asiatische Kurzzehenlerche, Calandrella cheleensis, eine Rotkehldrossel und ein Paradiesfliegenschnäpper … das sei an diesem Morgen alles gewesen.
Mr. Fox hatte in Hongkong bis zur Rückgabe der Kronkolonie an die Volksrepublik China als Verfasser und Übersetzer von Gebrauchsanleitungen gelebt und war nach seiner Pensionierung mit seiner Frau, einer Archäologin, die sich immer wieder mit der Großen Mauer befaßt hatte, in ihre Geburtsstadt gezogen, nach Shanghai. Von dort war er vor drei Tagen mit dem Nachtzug in Peking angekommen und hatte sich vom Busbahnhof Dong Zhi Men ohne Aufenthalt zu diesem Mauerabschnitt, dem letzten, der ihm in der Provinz Hebei noch fehlte, auf den Weg gemacht. Und dann begann es heute zu schneien. Schnee im Oktober!
Dabei wollte Fox in diesen Tagen seine Stimmensammlung weiter vervollständigen, ein Album, das idealerweise sämtliche Singvogelarten enthalten sollte, die im Schatten der Mauer lebten: einen ungeheuren Vogelschwarm, der den Großen Drachen umflatterte. In China werde die Mauer ja gelegentlich mit einem Drachen verglichen, der seine Zunge ins Wasser des Gelben Meeres tauchte, während er mit seinen Schwanzschlägen die Dünen der Wüste Gobi zu Sandstürmen hochpeitschte.
Wanli, sagte Mr. Fox, der chinesische Ausdruck für die Länge der Großen Mauer, bedeute ja nach einer alten Maßeinheit, die unter jeder Dynastie anders definiert worden war und ebenso für dreihundert wie für knapp sechshundert Meter stehen konnte, nicht nur zehntausend Li, sondern Li war auch ein Zeichen für das Unendliche, das Unvorstellbare, eine zehntausend Li lange Mauer also zehntausendmal unvorstellbar lang.
Natürlich habe es immer Streit darüber gegeben, wieviel denn die in Kilometern gemessene Mauerlänge genau betrage, ob dabei diese oder nur jene Bauperiode zu berücksichtigen sei und etwa Gebirge, Ströme und Seen, die als natürliche Barrieren sozusagen in die Wanli Chang Cheng eingebaut worden waren, mitgemessen werden durften oder nicht, aber das sei für ihn ohne Bedeutung. Er folge den Gesängen der Vögel entlang der Linie des Großen Drachen, der je nach Dynastie, Thronfolgen und Kriegsverläufen einmal dahin und dann wieder dorthin gekrochen war. Und diese Linie war fast neuntausend Kilometer lang.
Whiskey? Wollte ich einen Schluck? Fox ging nie auf die Mauer ohne einen Flachmann mit irischem Whiskey. Der irische, der aus der Republik, aus dem Süden, nicht der aus dem bombengefährlichen Norden, sei der mildeste und ihm liebste.
Genaugenommen war das alles ja eine Idee seiner Frau gewesen. Er hatte sie, das war vor fast dreißig Jahren, in die Provinz Ningxia begleitet. Die Mauer verlief dort immer wieder durch ziemlich trostlose Gebiete, Industriezonen, Raffinerien und entlang dampfender Mülldeponien. Aber ausgerechnet in Ningxia hatte ein Vogel, Turdus mandarinus, die Chinesische Amsel, so betörend schön gesungen, daß sie beide wie verzaubert gewesen waren und er an seinen Vater denken mußte, der oft mit seiner Stirnlampe unter den Bäumen Swanseas gesessen und fieberhaft versucht hatte, rasende Melodien auf Notenpapier mitzuschreiben, wenn eine Nachtigall oder eine Amsel in der Dunkelheit zu singen begann. Sein Vater hatte die diatonischen Intervalle, die Dreiklangmotive und chromatischen Tonreihen beispielsweise des Amselgesangs dann in seine Kompositionen für Blasmusik eingearbeitet.
Dabei dienten die Lieder der Singvögel doch nicht bloß der Liebe und der Erhaltung der Art, sondern waren weit mehr noch Reviergesang und mußten durch ihre weithin hörbare Lautstärke, ihre Vielfalt, Virtuosität, einen Rivalen entweder auf Abstand halten oder ihn in die Flucht schlagen. Na ja, das hatte die Blasmusik seines Vaters in gewisser Weise ja wohl auch getan. Amseln konnten jedenfalls etwa ein Dutzend anderer Vogelstimmen, selbst Geräusche aus der Menschenwelt nachahmen, das Weinen eines Kleinkinds, ferne Motoren, Gelächter, Sirenengeheul … und besangen so ihre Reichsgrenzen, als ob sie damit gleichzeitig alle Plumpheit, Erdgebundenheit und jeden verspotteten, der nicht das unbeschreibliche Glück hatte, ein engelgleich gefiedertes, engelgleich singendes Wesen zu sein, das die Freiheit genoß, sich jederzeit in die Luft zu erheben oder sich von höchsten Türmen, Bäumen und Klippen in die Tiefe zu stürzen, im Fallen die Schwingen auszubreiten, plötzlich zu schweben und sich vom Aufwind zurücktragen zu lassen in den Himmel.
Er und seine Frau hatten damals in Ningxia gebannt gelauscht, und dann hatte sie mit einem Blick auf einen von dichtem Buschwerk überwachsenen Rest der Großen Mauer gesagt: Gesang. Das wäre auch eine Möglichkeit gewesen. Reviergesang statt zinnenbewehrter Mauern!, Tonfolgen anstelle von Steinen, Grenzgesänge!
Gemeinsam hatten sie sich vorgestellt, diese unvorstellbar lange Mauer durch einen einzigen, aus lückenlos aneinandergereihten Reviergesängen bestehenden Chor zu ersetzen: einen Wall aus Liedern, zart und glasrein die einen, verspielt, trällernd die anderen, alle aber Sequenzen einer unüberhörbaren, unüberwindlichen Melodie, die jeden Eindringling oder Angreifer entweder so überwältigen mußte, daß er bang das Weite suchte – oder so betörte, daß er seine Gier, seinen Haß oder seine Kampflust vergaß und zu nichts anderem mehr fähig war, als hingerissen zu lauschen.
Was für eine Vorstellung, sagte Mr. Fox, den unter den Dynastien der Qin und der Han und wie sie alle hießen, der Wei, der Zhou, der Tang, der Liao und der Ming, errichteten Mauerabschnitten Gesänge zuzuordnen, Vogellieder, die weiter und weiter und immer noch gesungen wurden, wenn selbst die stärksten Mauern und vermeintlich unbezwingbare Wehrtürme bereits zu Schutt zerfallen waren.
Vielleicht konnte das Reich eines so unmusikalischen Menschen wie Mao Tse-tung schon allein deswegen keinen Bestand haben, weil es das erste und einzige aller bisherigen chinesischen Reiche war, in dem Singvögel nicht bloß aus blöder Freßgier wie in manchen Ländern Europas, sondern ausnahmslos alle Vögel als Getreidefresser und Ernteschädlinge in sämtlichen Provinzen dieser sogenannten Volksrepublik zu Millionen und Abermillionen getötet worden waren. Es habe hierzulande einen Frühling gegeben, in dem der Himmel über Peking tatsächlich vogelfrei gewesen war. Vogelfrei! Was für eine Freiheit.
Während Mr. Fox von Dynastien und Reichen erzählte, die keine noch so langen, noch so mächtigen Wälle vor dem Lauf der Zeit hatten schützen können, von Vögeln und Menschen erzählte, war es still geblieben, schneestill auf der Mauerkrone. Aber als er mir den Flachmann zu einem Abschiedsschluck reichte, war in einer Baumkrone unter uns, aus der die Sonne jetzt Schneepolster abfallen ließ, wieder die Rotkehldrossel zu hören, deren Stimme er bereits am Morgen aufgezeichnet hatte. Herbstgesang, wie Fox sagte: leiser und weniger raumfordernd, aber kunstvoller, lustvoller als die Gesänge des Frühjahrs, weil zumindest von einigen mit der Schneeschmelze verbundenen Zwecken, Liebeswerbung etwa und Fortpflanzung, befreit. Es war ja, ein bißchen zumindest, wie bei den Menschen, wie bei ihm selber: Ein Herbstvogel mußte niemandem mehr groß imponieren. Der sang, wenn er denn sang, mehr für sich als für oder gegen irgend jemand anderen.
Der Drosselgesang klang uns noch eine Weile nach, als wir uns auf dieser unvorstellbar langen Mauer wieder voneinander entfernten und jeder seinem Ziel entgegenging, er nach Simatai, ich nach Jinshanling, jeder in der Spur des anderen.
Herzfeld
Ich sah ein offenes Grab im Schatten einer turmhohen Araukarie. Der Baum überragte alle anderen Bäume eines von Eukalyptuswäldern umrauschten Bergdorfes im brasilianischen Bundesstaat Minas Gerais bei weitem. Wenn ein Windstoß in seine Krone fuhr und dort ein kaum hörbares, an den Atem eines Schläfers erinnerndes Geräusch erzeugte, lösten sich immer wieder Schauer goldbrauner, tropfenähnlicher Samen aus unzähligen, an schuppigen Zweigen haftenden Zapfen und regneten auf eine kleine Trauergemeinde herab, regneten auf das Schindeldach eines Fachwerkhauses, das ebensogut im Süden Deutschlands hätte stehen können, auf Blumenbeete, Korbstühle, auf einen dicht am Grab geparkten Pick-up, dessen Wagentüren weit offenstanden, und klopften so immer wieder auch an den zugenagelten, bereits in die Erde gesenkten Holzsarg, in dem Senhor Herzfeld in einem blauen Morgenmantel lag. Er war am frühen Morgen dieses Tages in den Armen seiner Frau gestorben und durfte nun im Garten seines Hauses beerdigt werden. Der Bürgermeister, er war gerade auf Amtswegen in Belo Horizonte unterwegs, hatte seine Erlaubnis dazu am Telefon und der Hitze wegen ohne weitere Formalitäten erteilt.
Ich hatte Herzfeld vor drei Tagen auf einem Gartenfest in São Paulo an einer weiß gedeckten, blumengeschmückten Tafel unter weißen Sonnenschirmen kennengelernt. Er hatte mir einen kleinen Teller voll gekochter, geschälter Araukariensamen, die wie Pinienkerne schmeckten, gereicht und gesagt, diese Samen enthielten nicht nur die Kraft und den Lebenswillen eines der evolutionsgeschichtlich ältesten Bäume der Erde, sondern auch sein himmelstürmendes Wesen: Vierzig Meter hoch und höher könne sich eine brasilianische Araukarie nach dem Himmel strecken, nach der Sonne, den Sternen, und in dieser herrlichen Pose Hunderte, ja tausend Jahre alt werden. Er habe sein Sommerhaus in den Bergen von Minas in den Schatten einer solchen Araukarie gebaut.
Senhor Herzfeld, Sohn eines Nähnadelfabrikanten aus Brandenburg, war als junger Mann mit seiner Schwester aus Deutschland über England, Frankreich und dann auf einem überfüllten Auswandererschiff zu einer Zeit nach Brasilien gekommen, in der seine Heimat und mit ihr so viele Länder Europas für tausend Jahre ans Hakenkreuz genagelt werden sollten. Aber selbst als diese tausend Jahre zu wenigen, endlosen Schreckensjahren geworden und in einem Weltkrieg verraucht waren, wollten Senhor Herzfeld und seine Schwester nicht mehr in ein Land zurück, das ihre Eltern und sieben Verwandte ihrer Herkunft, ihres Namens wegen umgebracht hatte. Nach all den Toten konnte dort doch nichts wieder werden, wie es war.
Gemeinsam mit einem Freund aus Pernambuco begann Senhor Herzfeld mit Leder, Edelhölzern, Achaten und den vielen Rohstoffen seiner neuen Heimat zu handeln und konnte so an einem Nachmittag im August mit einem Smaragdring in der Faust auf einem Pier in Rio de Janeiro mit klopfendem Herzen zusehen, wie ein Mädchen aus Deutschland über das Fallreep eines aus Hamburg ausgelaufenen Transatlantikliners herabschritt. Als er dieses Mädchen dann auf dem Pier nach vier Jahren zum erstenmal wieder in seinen Armen hielt und auch nicht losließ, als er das feine Klingen des Smaragdringes hörte, der ihm aus der geöffneten Faust gefallen war, glaubte er zu wissen, daß es in seinem Leben keinen glücklicheren Moment mehr geben konnte.
Ich hatte den Teller gekochter Araukarienkerne zu einem und noch einem Glas Zuckerrohrschnaps leergegessen, und Herzfeld erzählte – von den seltsamen, labyrinthischen Mustern auf den breiten Krawatten seines Vaters, der niemals eine Synagoge betreten hatte, aber Sonntag für Sonntag mit diesen Labyrinthen geschmückt zur Kirche gegangen war; erzählte von den Händen seiner Mutter, die, wenn sie stillsaß, stets weiß wurden, schneeweiß, aber niemals kalt, und erzählte vom winzigen Fuß einer Porzellantänzerin mit roten Schuhen, dem Bruchstück einer Figur aus Meißen, das er jahrelang als Talisman mit sich herumgetragen und erst nach seiner Hochzeit bei Santos ins Meer geworfen hatte – ein Polizist in Zivil hatte diese Tänzerin in der Wohnung seiner Eltern bei der Verhaftung des Vaters zerschlagen … und erzählte, bis auf dem Gartenfest Lampions angezündet wurden und ein Gast nach dem anderen sich in den Abend und in die Nacht verabschiedete. Als Herzfelds Frau, das Mädchen aus Deutschland, zum Aufbruch drängte, weil zu Hause ein Hund und zwei hungrige Katzen warteten, bot er mir an, ihn am nächsten Tag in seinem Büro im Stadtteil Higienópolis zu besuchen. Dort wollte er weitererzählen, ich sollte dort weiterschreiben.
Und Herzfeld erzählte am nächsten Tag in einem dunklen, mit Quarzen und geschliffenen Achaten, Amethysten, glitzernden Drusen und den schönsten Schmucksteinen Brasiliens dekorierten Büro tatsächlich weiter, bis auch dieser Tag zu Ende ging, ohne daß er je in der Gegenwart ankam. Es war bereits dunkel, als er mir anbot, unser Gespräch doch in seinem Sommerhaus in Minas Gerais weiterzuführen, in dem er die kommenden, in São Paulo unerträglich heißen Tage verbringen werde. Sein Schwiegersohn wolle ihn schon übermorgen dort besuchen und könne mich in seinem Wagen mitnehmen.
Aber als am Morgen der geplanten Abfahrt das Telefon in meinem Hotelzimmer klingelte, machte dieser Schwiegersohn eine rätselhaft lange Pause nach der Nennung seines Namens und sagte dann, daß Herzfeld in der Nacht in seinem Sommerhaus gestorben sei. Er und seine Frau suchten gerade in den Kleiderschränken des Verstorbenen nach einem Anzug für das Grab, um dann nach Minas zu fahren. Herzfeld werde dort noch vor Sonnenuntergang bestattet.
Der Schwiegersohn, auch er ein Gast auf dem Gartenfest, das plötzlich weit, weit zurückzuliegen schien, war weder erstaunt, noch stellte er Fragen, als ich ihn bat, mich wie vereinbart mitzunehmen, und so fuhren wir in einem schwarzen Jeep aus der Stadt und dann stundenlang über die Dörfer, während Herzfelds Tochter das Leben ihres Vaters endlich in die Gegenwart führte, als sie von seiner Angst vor den Tropen sprach, die ihn trotz seiner Geschäfte mit Waren aus Bahia, Amazonas, Mato Grosso oder Alagoas daran gehindert hatte, jemals auch nur einen einzigen Schritt über die geographische Breite von Rio de Janeiro hinaus in den tropischen Norden zu tun. Wir hatten auf dieser Fahrt nach Minas auch einen Auftrag von Herzfelds Frau zu erfüllen: Einen Sarg sollten wir unterwegs besorgen, im Dorf gab es keinen Schreiner. Und so hielten wir an einem der Läden, vor denen in vielen Dörfern unterwegs Särge in allen Farben, Holzarten und Ausstattungen entlang der Straße zur Schau gestellt waren.
Der Schreiner, er versah auch den Dienst eines Bestatters, trug einen Arm in der Schlinge, die Hand in einem dicken, blutigen Verband: Er habe sich an diesem Morgen beim Reinigen seines Revolvers in die Hand geschossen und könne uns zwar jeden Sarg verkaufen und uns auch zu dem Verstorbenen begleiten, dann aber weder bei der Einsargung noch bei der Bestattung helfen, sondern uns nur Anweisungen geben.
Einen Sarg aus Eukalyptusbrettern auf das Dach des Jeeps gebunden, fuhren wir zu viert weiter. Der Bestatter mahnte uns vergeblich, doch wenigstens ein Ave-Maria zu beten. Jetzt erzählte keiner mehr.
Als wir das Ziel erreichten, erwartete uns Herzfelds Frau an einem weiß gestrichenen Gartentor: das Mädchen vom Fallreep, das Mädchen aus Deutschland. Sie war sehr blaß. Leon sei in der Nacht aufgestanden, um ein Glas Wasser zu trinken, und lange, zu lange, nicht wiedergekommen. Sie ging ihn suchen und fand ihn an den Kachelofen gelehnt sitzen. Er atmete noch, kaum hörbar, und hielt die Augen geschlossen und gab keine Antwort mehr, als sie sich zu ihm setzte und ihm helfen wollte, sich doch zu erheben, ihm zurückhelfen wollte ins Bett, ins Leben. Aber allein konnte sie ihn, wollte sie ihn nicht lassen, keine Sekunde allein, auch nicht, um Hilfe zu rufen. Und so habe sie ihn gehalten und manchmal gewiegt und ihm zugeflüstert und ihn gebeten, zu bleiben, bei ihr zu bleiben, nur ein bißchen noch bei ihr zu bleiben, bis er diesen tiefen Seufzer tat, nach dem es totenstill wurde.
Draußen brannte die Sonne, aber im Inneren des Hauses flackerte eine Kerze bei geschlossenen Vorhängen in der Zugluft. Senhor Herzfeld lehnte am Kachelofen seines Hauses wie an den Winterabenden, an denen es auch in Minas kalt werden konnte. Über seinem Gesicht lag ein weißes Taschentuch, in das Initialen gestickt waren, die weder zu dem Namen seiner Frau noch seinem eigenen Namen paßten. Das Tuch glitt zu Boden, als sein Schwiegersohn mich um Hilfe bat und wir ihn auf ein mit Kissen überhäuftes Sofa betten wollten. Sein Mund war leicht geöffnet, auf dem Schmelz eines Schneidezahns glomm der Widerschein der Kerze, ein winziger Stern.
Die Totenstarre ließ nicht zu, daß wir ihn in den mitgebrachten Anzug kleideten, und so versuchten wir, Senhor Herzfeld in der Haltung eines Schläfers in seinem blauen Morgenmantel in den Sarg zu legen. Wie schwer ein Mensch wog, der sich seinen Trägern mit keiner Bewegung und keinem Atemzug leichter machen konnte.
Der Schreiner wies uns an, dirigierte uns mit seiner verbundenen Hand und sprach gleichzeitig hastig auf den Toten ein, bat ihn flüsternd um Verzeihung für die Störung seiner eben angebrochenen ewigen Ruhe, bat ihn, er möge doch hier noch ein wenig und dort noch ein bißchen nachgeben, bat ihn um Gottes Barmherzigkeit willen, es uns, seinen Helfern, seinen ergebenen Dienern, nicht so schwerzumachen, ermahnte uns aber auch, unsere Hemmungen endlich aufzugeben und den Toten mit aller Kraft in die Enge des Sarges zu drücken, die Zeit der Schmerzen sei für Senhor Herzfeld doch für immer vorüber.
Dann rief er nach den beiden Gartenarbeitern, die das Grab unter der Araukarie ausgehoben hatten. Die beiden betraten das Trauerhaus mit nacktem, schweißnassem Oberkörper, bekreuzigten sich und flüsterten ein Gebet. Als wir dann gemeinsam mit ihnen den Sarg aus der Dämmerung des Hauses in das grelle Licht des Gartens hinaustrugen, wartete dort bereits eine kleine Trauergemeinde, zehn, zwölf Menschen in hellen, leichten Sommerkleidern, einige mit verweinten Gesichtern. Ein Nachbar hatte seinen Pick-up an den Grubenrand gefahren und die Türen weit geöffnet. Als wir den Sarg an Hanfstricken in die rote Erde hinabließen, klang aus den in diese Türen eingebauten Lautsprechern Näher mein Gott zu dir.
Wenn jeder der Araukariensamen, die in dieser Stunde auf die Trauergemeinde, auf das Grab, auf den Blumengarten, das Dach des Sommerhauses und den Sarg herabregneten, die Möglichkeit eines tausendjährigen Baumlebens enthielt, dann fiel – während Herzfelds Tochter ein Goethe-Gedicht so leise vortrug, daß ich in den Windstößen kaum ein Wort verstand, und seine Frau ein letztes Mal zu ihrem geliebten Leon über das offene Grab hinweg ins Leere sprach – mit diesen Samen eine Art Ewigkeit aus den Zweigen auf uns herab.
Sternenpflücker
Ich sah einen gestürzten Kellner auf dem Parkplatz eines Straßencafés in der kalifornischen Küstenstadt San Diego. Der Mann hatte ein mit Getränken beladenes Tablett eben noch scheinbar mühelos über seiner Schulter balanciert und war dann über ein Kabel gestolpert, das eine Autobatterie mit einem Teleskop verband. Nun lag er in den Scherben von Gläsern, Flaschen und Tassen, die er jenen Gästen hatte servieren wollen, die von der Theke ins Freie gelaufen waren oder schon seit Stunden zwischen geparkten Autos auf mitgebrachten Klappstühlen saßen und durch ihre Ferngläser, Teleskope und mit bloßem Auge zum Abendhimmel emporblickten, an dem die ersten Sterne glitzerten.
Obwohl seine Hose an einem Knie zerrissen war und aufgedruckte Klatschmohnblüten an seinem Hemd an Blutflecken denken ließen, schien der Mann unverletzt. Stumm, ohne Klage, aber auch ohne jeden Fluch, richtete er sich auf, zog das große, kreisrunde Messingtablett, das bei seinem Sturz unter ein geparktes Kabriolett geklirrt war, wieder unter dem Wagen hervor und begann auf allen vieren, die von Kaffee, Wein, Fruchtsäften und bloßem Wasser tropfenden Scherben aufzusammeln und auf das Tablett zu häufen.
Über den Abend- und Nachthimmel dieser Märztage zog einer der strahlendsten Kometen der vergangenen tausend Jahre, ein Himmelskörper von kaum sechzig Kilometern Durchmesser, der mit einem goldgelb leuchtenden Staubschweif und einem blauen Gasschweif eine fünfzig Millionen Kilometer lange Spur an den Nachthimmel schrieb. Der Besenstern hatte am Vorabend seinen erdnächsten Punkt in einer Entfernung von etwa zweihundert Millionen Kilometern passiert und raste nun wieder in jene Abgründe des Raumes zurück, aus denen er emporgestiegen war. Nach Monaten, in denen er neben dem großen Sirius als hellstes Licht am Nachthimmel erschienen war, würde er nun allmählich wieder kleiner und unscheinbarer werden, schließlich verschwinden und dann erst um das Jahr 4535 wiederkehren. Der Komet war nach seinen beiden Entdeckern Alan Hale und Thomas Bopp, die ihn während einer Vermessung des Kugelsternhaufens M70 im Areal des Schützen unabhängig voneinander beobachtet hatten, Hale-Bopp getauft worden – und schon kurze Zeit nach seinem Eintritt ins Blickfeld des bloßen Auges war gewiß, daß in der Geschichte der Menschheit kein Himmelslicht jemals so viele Blicke auf sich gezogen hatte.
Ich hatte Hale-Bopp in den vergangenen Wochen, auf langen Wanderungen durch die Mojave-Wüste und in der Sierra Nevada, oft über den Silhouetten verschneiter Gebirgszüge oder den schwarzen Weiten der Wüste gesehen und im Radio meines Geländewagens immer wieder Berichte von Ängsten, Hoffnungen, Träumen und astronomischen Vermutungen gehört, die mit diesem wandernden Licht verbunden wurden. Religiöse Phantasten und Sektenanhänger, hieß es, sähen in diesem Kometen nicht bloß ein Himmels-, sondern ein göttliches Zeichen, das den nahen Untergang der Welt oder das Kommen eines allmächtigen Erlösers ankündigte.
Der Besenstern mit seinem Doppelschweif – ein dritter, aus Natrium bestehender Schweif zeigte sich nur in den Teleskopen der größten Sternwarten – war innerhalb von beinahe sechshundert Tagen, in denen man seine zu- und wieder abnehmende Strahlkraft auch mit freiem Auge beobachten konnte, zu einer so vertrauten Erscheinung am Himmel geworden, daß sich an diesem Abend wohl kaum ein solches Publikum auf dem Parkplatz des Straßencafés eingefunden hätte, wäre da nicht noch ein zweites Schauspiel in unmittelbarer Nachbarschaft des Kometen zu verfolgen gewesen – eine von Sternfreunden und Astrofotografen sehnsüchtig erwartete Mondfinsternis.
Die Lage des Straßencafés auf einem Hügel mit weitem Blick auf die Lichter der Stadt und des Himmels hatte mehr als hundert Gäste und Beobachter angezogen, die schon am späten Nachmittag begannen, ihre Fernrohre, Stative und Kameras zwischen Wagenburgen aufzubauen und bei Wein, Bier oder Fruchtsäften an den kreisrunden Tischen des Cafés die Wahrscheinlichkeit zu besprechen, ob die wechselnde Bewölkung dieses Tages das Schauspiel verhüllen würde und ein rechtzeitiger, gerade noch möglicher Aufbruch ins wolkenärmere Wüstenland nicht das Gebot der Stunde sei. Wie langsam über solchen Gesprächen die Zeit verging.
Aber als es zu dämmern begann, dunkel wurde, Nacht wurde und alle Wolken wie an Schnüren gezogen verflogen und den Kometen, den Sternenhimmel und einen noch schattenlosen Mond freigaben, begann die Zeit schneller zu laufen. Und als dann der auf die Sekunde berechnete Zeitpunkt kam, an dem der Mond träge und unaufhaltsam in den Erdschatten glitt, dabei mehr und mehr von seinem Licht verlor und so den Kometen noch heller glänzen ließ, begann die Zeit zu fliegen. Die Rufe der auf dem Parkplatz versammelten Zeugen der Verfinsterung Der Mond! Der Mond! Es beginnt! klangen wie Alarmgeschrei und ließen die letzten Gäste aus dem Café hinausstürzen ins Freie.
Und dann war da plötzlich nur noch das wolkenlose Firmament und ein dunkler Platz voll Menschen, die schweigend zu den Sternen aufsahen, zwischen denen der hellste Komet des Jahrtausends an einem verfinsterten Mond vorüberzog – und war da trotzdem und immer noch hinter einer erleuchteten Glasfront diese lange leere Theke, von der ein Kellner sein schwer beladenes Tablett in die Nacht hinaustrug, dann zwischen Autos und Teleskopen dahinhuschte und dabei seinen Blick immer wieder gegen den Himmel richtete, bis plötzlich dieses böse Klirren zu hören war und der Gestürzte in einer Scherbensaat lag.
Aber während so weit, weit draußen im Raum das Himmelsschauspiel ungerührt seinen Lauf nahm, der Erdschatten, unser eisiger Schatten, über die Mondwüsten glitt und Hale-Bopp mit einer Geschwindigkeit von fast einhundertsechzigtausend Stundenkilometern unseren Planeten wieder hinter sich ließ, begann auf dem ölfleckigen nächtlichen Parkplatz ein Gegenschauspiel, das von einer anderen Helligkeit war.
Denn obwohl es lange, sehr lange dauern würde bis zu einer nächsten vergleichbar schönen Finsternis und obwohl der fliehende Komet nach seinem allmählichen Verblassen und Verschwinden erst nach mehr als zweitausendfünfhundert Jahren wiederkehren, aber niemals, niemals wieder in der Geschichte dieses Universums in so enger Gemeinschaft mit einem verfinsterten Mond zu sehen sein würde, wandten sich …, nein, nicht alle Zeugen und Zuschauer, aber doch viele, viel mehr als zu erwarten waren, von dieser Einzigartigkeit, einem unwiederholbaren kosmischen Ereignis, ab und dem gestürzten Kellner zu, kehrten dem Himmel den Rücken, beugten sich zu dem stummen, beschämten Mann hinab, boten ihm ihre ausgestreckten Arme und sanken, als er nicht aufstehen, sondern bloß auf allen vieren die Scherben einsammeln wollte, neben ihm auf die Knie und lasen gemeinsam mit ihm die selbst im verfinsterten Mondschein noch blinkenden Scherben vom schwarzen Asphalt, als pflückten sie Sterne.
Die Himmelsbrücke
Ich sah eine Kette schwarzer, felsiger Hügel, an die Sanddünen brandeten. Der baumlose Höhenzug war im Verlauf einer zweistündigen Geländewagenfahrt durch die nördlichen Ausläufer der marokkanischen Sahara aus einer Sand- und Geröllwüste emporgewachsen, bis auch die mächtigen Steinkegel erkennbar wurden, die viele der Hügelkuppen krönten. Auf einem flachen Felsrücken erhob sich eine ganze Reihe solcher Kegel und gab ihm das Aussehen eines ungeheuren, mit Reißzähnen bewehrten Kiefers.
Der schwarze Geröllstrom, der von diesen Zähnen zu jener windgeschützten Mulde herabfloß, in der nun das Fahrzeug entladen und ein Zelt aufgeschlagen werden sollte, war ohne jeden Bewuchs. Selbst Dornsträucher, Disteln und Flechten fehlten. Der in eine indigoblaue Daraa, die Tunika der Nomaden, gehüllte Fahrer des Wagens wand sich ein schwarzes Tuch um Kopf und Gesicht, bis nur noch ein schmaler Sehschlitz freiblieb, bedeutete mir, ihm zu folgen, und machte sich an den Aufstieg.
Obwohl er nur Ledersandalen trug und ein böiger Wind seine bodenlange Daraa immer wieder in ein Segel verwandelte, fand er mühelos, manchmal fast tänzelnd selbst dann noch Halt, wenn ein Stein unter seinen Sandalen wegkippte oder ein Windstoß ihn für einen Augenblick aus dem Gleichgewicht brachte. Dabei blieb ihm trotz der Steilheit des Aufstiegs genug Atem, um seine während der Fahrt begonnenen Erzählungen fortzusetzen.
Aus dem Westen trieb eine fahlgelbe Sandwolke auf uns zu, die sich höher und höher in das Blau des Himmels fraß. Wir mußten uns beeilen, wollten wir nicht Gefahr laufen, auf dem Rückweg zum Lager in wirbelnden Schleiern aus Sand die Orientierung zu verlieren.
Dreitausend Jahre und älter, manchmal tausend Jahre älter, sagte der Fahrer, seien diese Steinkegel, Grabhügel, errichtet von einem Wüstenvolk, dessen Name die Zeiten nicht überdauert hatte. Geblieben seien allein diese Gräber. Manche Tote, das hätten Ausgräber entdeckt, hatte man wohl über Hunderte Kilometer durch die Wüste getragen, über Hunderte Kilometer durch ein glühendes, menschenleeres Land, nur um sie in dieser Verlassenheit zu bestatten.
Der Grund dafür, sagte der Fahrer, sei eine Erzählung gewesen, die durch die Jahrtausende überliefert worden war und von einem Stern, einem Meteoriten berichtete, der vom Nachthimmel fiel und in jenem Becken zersprang, das nun von dieser Kette schwarzer Hügel eingefaßt wurde. Der weithin sichtbare Feuerschweif mußte den Augenzeugen, Nomaden, die diese Gegend schon damals durchstreiften, als eine alle Sterne überglänzende Brücke aus Licht erschienen sein, die Himmel und Erde für einen Atemzug verband.
Auch wenn diese Himmelsbrücke noch im Erstrahlen wieder erloschen war, mußte sie in den Augen der Zeugen nicht nur ein nachleuchtendes Blendungsbild hinterlassen haben, sondern eine unauslöschliche Erinnerung, die weiter und weiter und durch die Jahrhunderte überliefert wurde, bis sie selbst die entferntesten Ränder der Wüste erreichte und überall dort, wo man sie hörte, Trauernde dazu brachte, sich hierher auf den Weg zu machen.
Gab es denn einen hoffnungsvolleren, friedvolleren Ort für eine letzte Ruhestätte als das irdische Ende einer Brücke, die aus der leidvollen, ausgedörrten, von Sandstürmen und Kriegen zerrissenen Welt zu den Sternen führte? Und erwies man den Toten dann nicht einen letzten und vielleicht größten Liebesdienst, wenn man sie durch die Wüste trug, Wochen, Monate durch die Wüste, um sie hier unter Steinkegeln, deren Spitzen zu den Sternen wiesen, zu bestatten?
Heute nacht, sagte der Fahrer und zeigte auf die Front aus Sandwolken, die den Höhenzug im Westen allmählich zu verschlingen begann, heute nacht würden über unserem Lagerplatz im Schein unserer Lampen nur Sandwirbel zu sehen sein, aber wer von dieser Brücke aus Licht jemals auch nur gehört habe, der konnte sie in seiner Vorstellungskraft auch in Sandstürmen wiedererrichten als den kürzesten Weg zu den Sternen.
Tod in Sevilla
Ich sah einen schwarzen andalusischen Kampfstier an einem strahlenden Palmsonntag in der großen Arena von Sevilla. Als ob er die Nabe an einem aus mehr als zwölftausend Zuschauern bestehenden Rad wäre, das sich brausend um ihn drehte, stand er bewegungslos, schwer atmend, verstrickt in ein tief in den Sand eingegrabenes Muster aus Kampfspuren, und schien wie versunken in den Anblick seines Feindes, eines berittenen Toreros, der ihn fünf oder sechs Pferdelängen entfernt erwartete. Zwischen den Schulterblättern des Bullen steckten sechs Banderillas, armlange, mit buntem Papier umwickelte Spieße, die an einen Strauß geknickter Blumen erinnerten. Mit jedem seiner Atemzüge stieg Blut aus den Stichwunden und kroch in wirren Spuren über das Fell zu den Hufen hinab.
Drei Rejoneadores, Toreros zu Pferd, sollten an diesem Sonntagnachmittag die Stierkampfsaison eröffnen, indem sie im Sattel die älteste Form dieses Kampfes vorführten und dabei in sechs aufeinanderfolgenden Corridas sechs Stiere töteten. Anders als einem Matador im Kampf zu Fuß standen einem berittenen Torero keine Picadores mit ihren Lanzen und gepanzerten Pferden zur Seite und keine Banderilleros mit ihren bunten Spießen. Alles, was an tänzerischer, strengen Regeln unterworfener Todesarbeit zu tun war, mußte ein Drama bleiben allein zwischen dem Reiter, seinem Pferd und dem Stier. Ein Rejoneador schwenkte weder eine Capa noch eine Muleta, keines der rosafarbenen und roten Tücher, mit denen der Stier im Kampf zu Fuß getäuscht und geführt werden mußte, sondern an einem Nachmittag wie diesem ersetzte der ungeschützte Körper des Pferdes jedes Tuch und bot dem Stier jenes Angriffsziel, das mit allen Figuren der Hohen Schule andalusischer Reitkunst vor seinen Hörnern bewahrt werden mußte.
Fünf Stiere waren an diesem Palmsonntag bereits getötet und von Maultiergespannen aus der Arena geschleift worden, als dieser letzte, nun schwer atmende, blutende aus dem Dunkel des Corrals in die Arena hinausgestürmt war und weit draußen in der Leere plötzlich innehielt, als wäre er überrascht, verwundert, ja entsetzt, daß er nicht wieder auf seine Weide hoch über dem Golf von Cádiz entlassen worden war, wo er die bisherigen vier Jahre seines Lebens verbracht hatte, sondern in diese nackte, tosende Weite, in der Blutspuren dahin und dorthin führten. Dennoch war er den Zurufen des Rejoneadors zunächst erwartungsgemäß gefolgt und gegen den Reiter und seinen prachtvollen Schimmel angerannt. Aber anders als die Angriffe der fünf vor ihm Getöteten hatten die seinen den Eindruck erweckt, er stürme nicht, um niederzuwerfen, zu durchstoßen, zu töten, sondern bloß, um ein Hindernis aus jenem Weg zu schaffen, der zurück auf die Weide führte. Und seine Angriffe waren müder und müder geworden, als, was ihm diesen Weg versperrte, weder zu erreichen noch wegzustoßen war, sondern nach ihm stach und ihn verletzte.
Zweimal hatte der Reiter die Zügel schleifen lassen, war mit wie zum Jubel erhobenen Händen, in denen er die Banderillas hielt, an den Stier herangesprengt und hatte ihm die bunten, mit Widerhaken versehenen Spieße aus vollem Galopp zwischen die Schulterblätter gestoßen. Aber auch der Schmerz hatte den Stier nicht in jene Angriffswut versetzt, die von ihm gefordert war – und so verlangte schließlich das Publikum im Chor, seine Trägheit, seine Feigheit mit den banderillas negras zu bestrafen – mit schwarzem Papier, der Farbe der Schande, umwickelten Spießen, die, mit längeren Widerhaken versehen, tiefer ins Fleisch drangen.
Erst als diese Banderillas wie zwei schwarze Blitze aus den Händen des Rejoneadors auf ihn niedergefahren waren, verfiel der Stier endlich in jene Raserei, die dem Reiter zur Begeisterung der Zuschauer alle seine Kunst abverlangte. In fliegendem Galoppwechsel, in Pesaden und Levaden, in Seitengängen und Courbetten ließ er die Stierhörner oft bis auf eine Handbreit an seine Stiefel, an die Flanken des Pferdes herankommen, bevor er den Schimmel mit einer kaum wahrnehmbaren Straffung der Zügel oder einem Schenkeldruck in eine graziöse, rettende Ausweichbewegung tänzeln ließ.
Die Todesdrohung, die über jeder Figur dieses Tanzes lag, bei dem Pferdebäuche durchstoßen und aufgerissen werden, Darmschlingen in den Sand platzen, ein Reiter von seinem tödlich verwundeten Tier erdrückt oder, im Steigbügel gefangen, vor Hufe und Hörner geschleift und aufgespießt oder zerstampft werden konnte, ließ die Beherrschung des Pferdes ohne Peitsche und Gerte, die Unterdrückung seiner Todesangst, noch ungeheuerlicher erscheinen.
Das Publikum tobte, als der Rejoneador nach einer Folge virtuos parierter Angriffe seinen Schimmel exakt im Tempo eines neuerlichen Ansturms im Seitengang zurücktänzeln und den Stier dabei so nahe herankommen ließ, daß er sich plötzlich weit aus dem Sattel beugen und dem Angreifer seinen Ellbogen zwischen die Hörner setzen, sich auf den Stierschädel stützen! konnte und so seinen Körper in eine Brücke zwischen einem schwarzen, wütenden Bullen und einem weißen, zu Tode geängstigten Pferd verwandelte. Dann richtete er sich im Bruchteil einer Sekunde wieder auf, ließ das Pferd hochsteigen und den Stier an einer Pirouette vorbei ins Leere stoßen.
In der rasenden Geschwindigkeit aller Bewegungen war zunächst unbemerkt geblieben, daß der Schimmel dabei doch von einem Horn getroffen, gestreift worden war. Ein langgezogener, im Chor ausgestoßener Seufzer erfüllte die Arena, als der breite Blutbach sichtbar wurde, der die rechte Flanke hinabfloß und ihr Weiß noch verletzlicher und kostbarer erscheinen ließ. Aber der Rejoneador winkte ab. Er wollte kein frisches Pferd, sondern beugte sich tief über die zu Zöpfen geflochtene Mähne, über den schneeweißen Hals und küßte beide Ohren des Tieres, bevor er ihm etwas zuflüsterte, ein besänftigendes Wort, ein Kommando, vielleicht eine Bitte. Und noch einmal seufzte die Arena, als der blutende Schimmel nach dieser Einflüsterung plötzlich auf die Knie sank, mitsamt seinem Reiter auf die Knie vor dem Stier. Und der setzte sich mit einem Ruck in Bewegung, als wollte er diese Geste der Demut – oder war es eine der Verhöhnung? – zerstampfen, und stürmte, flog auf das Pferd zu, das schon verloren schien, als der Reiter es im letzten, allerletzten Augenblick auf- und in die rettende Wendung springen ließ.
Der dem Kampf vorsitzende Präsident, er saß irgendwo im Jubel unter einem Baldachin, hatte das Zeichen zum tercio de la muerte, dem letzten, dem Todesdrittel der Corrida gegeben, und der Rejoneador hatte die kurze Lanze, die er zum Todesstoß in den Strauß der Banderillas versenken sollte, bereits von einem Gehilfen an der Bande in Empfang genommen, als in einem Augenblick des erschöpften Innehaltens, in dem sich Reiter und Pferd wie ein Standbild aus dem Muster der Kampfspuren im Sand erhoben und der Stier in einer Entfernung von fünf oder sechs Pferdelängen wie versunken schien in die Betrachtung seines Feindes – ein Schrei zu hören war, er kam von den billigen Rängen hoch oben, und es war nicht zu unterscheiden, ob es der Schrei eines Mannes oder einer Frau war: Indulto! Gnade! Begnadige ihn!
Mit einem Ruf wie diesem forderte das Publikum selten, sehr selten Gnade für einen Stier, der so beherzt, so mitreißend gekämpft hatte, daß ihm die Entlassung aus der Arena, die Pflege seiner Wunden und ein friedvolles Leben auf den Weiden seiner Herkunft zu gönnen war. Indulto! Aber eine solche Gnadenforderung mußte in einer Arena wie der von Sevilla von einem Chor aus Tausenden Stimmen erhoben werden und nicht bloß von einer Stimme wie jener dünnen, einzigen an diesem Palmsonntag.
Zwar hob der Rejoneador den Kopf und blickte um sich und in die Weite, aber als auch diese eine Stimme im gespannten Schweigen der Arena verstummte, richtete er sich im Sattel auf und hob seine Lanze, als gäbe er dem Stier damit bloß ein seit Jahrhunderten abgesprochenes Zeichen. Und der setzte sich noch einmal und zunächst wie aus einer großen Müdigkeit in Bewegung, kam dann aber schneller und schneller und unaufhaltsam auf ihn zu.
Gespenster
Ich sah Gespenster. Es waren sieben, nein: acht! Nahezu gestaltlos, baumhoch, turmhoch und dicht nebeneinander wirbelten sie über eine der Lava- und Steinwüsten, die das zentrale, menschenleere Hochplateau Islands bedecken.
Es war ein stürmischer Nachmittag im Oktober und die Jahreszeit für längere Fahrten und Wanderungen durch die Wüsten des Hochlands schon fortgeschritten, aber weil die Meteorologen stabile Luftdruckverhältnisse vorhergesagt hatten, war ich seit Tagen mit einem Fotografen aus Reykjavík in einem Geländewagen – und in unbefahrbarem Bergland zu Fuß – auf verworrenen Routen zwischen den Inlandgletschern Langjökull, Hofsjökull und dem großen Vatnajökull unterwegs. Die Nächte verbrachten wir im Windschatten von Felstürmen in unserem Zelt oder in einer der verstreuten, seit Wochen nicht mehr besuchten Hütten und Biwakschachteln, die den Zufluchtsuchenden in der isländischen Wildnis offenstehen. An eisigen Abenden badeten wir manchmal in heißen Quellen.
Der Fotograf wollte die Schönwetterperiode nützen, um einer Leidenschaft nachzugehen, die ihn immer wieder nicht nur in die Einöden Islands, sondern in die Gebirge und Wüsten aller Welt geführt hatte: Er fotografierte Wegzeichen, jüngste wie älteste, prähistorische und neuzeitliche Steinmale, Steinkegel, Steinsäulen oder in Felswände geschlagene Orientierungszeichen und sammelte so Bild um Bild von allem, was einem Menschen helfen konnte, sein Ziel zu erreichen oder wenigstens einen Rückweg oder Fluchtweg zu finden.
Wir waren uralten, seit Jahrhunderten befahrenen, aber auch längst aufgegebenen, von neuen Pistenführungen ersetzten Routen gefolgt und hatten an von schwarzem Sand überwehten Kreuzungen und Weggabelungen Steinmänner gesehen, die einst von den Gesetzen der Insel so streng geschützt worden waren wie das Leben selbst: Die Zerstörung oder Versetzung dieser Zeichen war mit Tod oder Verstümmelung bestraft worden, denn alle Wege durch die Wüste führten irgendwann ans Meer, und nur in Küstennähe war Nahrung zu finden, Zuflucht, die Gesellschaft von Menschen. Wer die Wege dorthin verwirrte, hatte diese Gesellschaft und mit aller Gnade auch sein eigenes Leben verwirkt.
Während er unseren Wagen im Kriechgang durch Geröllfelder manövrierte, hatte mir der Fotograf von den Vogelfreien und Ausgestoßenen des alten Island erzählt, die ins Hochland verbannt worden waren und sich hier gegenseitig bekriegten oder über die wenigen Reisenden herfielen, die gezwungen waren, die Einöde zu durchqueren. Einer der berüchtigtsten dieser Verbannten sei zum Helden einer der unzähligen isländischen Sagas geworden – ihm hatte der Scharfrichter auch noch ein Bein abgehackt, bevor man ihn aus der Menschenwelt warf. Aber nach der Heilung seiner Wunde begann er einbeinig durch die Wildnis zu hüpfen und sich im Geröll und Lavasand immer sicherer und schneller zu bewegen, bis er auf die Kunst des Radschlagens verfiel, in der er es über die Jahre in der Einsamkeit zu einer solchen Vollkommenheit brachte, daß er schließlich, eine in Staub gehüllte, radschlagende Gestalt, schneller war als jedes seiner flüchtenden Opfer. Wer den ihn umhüllenden Staubwirbel wie ein Irrlicht auf sich zutanzen sah, war verloren.
In unseren Zeltnächten, in kahlen, kalten Hütten oder während er mit scheinbar unerschöpflicher Geduld auf das beste Licht wartete, in dem er die Reste eines Steinmals im Nirgendwo abbilden wollte, hatte mir der Fotograf die Hochlandwüsten aber nicht bloß als das Reich der Ausgestoßenen beschrieben, sondern auch als das der Feen, der Trolle und Geister und hatte mir dazu von seinen Helden der altisländischen Sagas erzählt, von dem mit Axt und Schwert kämpfenden Dichter Gunnlaug etwa oder von Egill, der schon als Siebenjähriger einem Feind den Schädel spaltete, von Grettir, dem Starken, der einen ausgewachsenen Ochsen auf seinen Schultern tragen konnte, und von Gísli, der, aus tiefsten Wunden blutend, noch weiter kämpfen und kämpfen – und seine Feinde zerstampfen konnte.
Aber seltsam, hatte der Fotograf gesagt, der für alle Schattierungen des Tageslichts einen Namen wußte, seltsam, daß viele dieser Helden, nachdem sie alle Schlachten überlebt, durch Ströme von Blut gewatet waren, am Ende einer uralten, kindlichen Angst zum Opfer fielen – der Angst vor der Dunkelheit. Diese Angst habe einige der