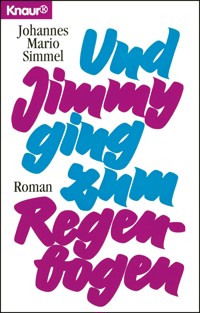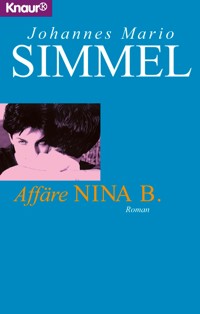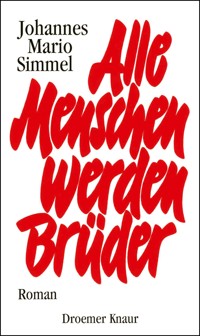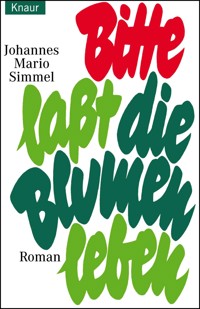6,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Knaur eBook
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Ein bewegender Roman über Ausgrenzung, Flucht und die Suche nach Heimat in einer von Hass und Gewalt geprägten Welt. In seinem aktuellen Roman thematisiert Johannes Mario Simmel den Terror gegen Ausländer und Asylbewerber, Neonazis, die Molotowcocktails schleudern und jüdische Grabstätten schänden. Inmitten dieser Atmosphäre der Angst und des Hasses sieht Klempnermeister Mischa Kafanke, Sohn eines russischen Juden und einer preußischen Mutter, keine Zukunft mehr für sich in Deutschland. Er, der geniale Erfinder eines Öko-Klos, fasst einen folgenschweren Entschluss: Er verlässt seine Heimat und begibt sich auf eine gefahrvolle Odyssee rund um die Welt, auf der Suche nach einem Ort, an dem er in Frieden leben kann. Mit einfühlsamen Worten und scharfsinniger Gesellschaftskritik erzählt Simmel die Geschichte eines Mannes, der für seine Würde und seinen Platz in der Welt kämpft. Auch wenn ich lache, muß ich weinen ist ein ergreifender Roman, der die brennenden Fragen unserer Zeit auf eindringliche Weise verhandelt.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 872
Veröffentlichungsjahr: 2012
Ähnliche
Johannes Mario Simmel
Auch wenn ich lache, muß ich weinen
Roman
Knaur e-books
Inhaltsübersicht
Gewidmet Wolfgang Ebert,
der mir für dieses Buch eine wahrhaft
explosive Idee schenkte
»Ich trinke auf das Wohl aller weisen Politiker und tapferen Generäle, aller wunderbaren Ideologen und verehrungswürdigen Bewahrer sämtlicher Religionen, die in dieser Welt seit Jahrtausenden um Frieden, Freiheit, Glück und Gerechtigkeit kämpfen – und auf das Wohl aller armen Schweine, die diesen blutigen Schlamassel auszubaden haben.«
Aus diesem Buch
Erstes Buch
1
Der Junge läuft und springt und tanzt die Hauptstraße von Rotbuchen hinunter, die nach Kaiser Wilhelm und Hitler und Lenin nun wieder Schiller zum Namenspatron hat, und er lacht und singt und ist völlig außer sich vor Seligkeit und Glück. Alle Menschen, denen er begegnet, starren ihm nach, der hat den Verstand verloren, der arme Kerl. Hat er nicht. Was ist das Leben wunderbar, muß er immerzu denken, wie ist die Welt herrlich!
»Crazy for you«, singt er, ein Lied David Hasselhoffs, der Mann wird zur Zeit verehrt und bewundert von allen im Alter des Jungen, und die Worte sagen genau, was der im Augenblick fühlt: »I’m crazy for you, you’re crazy for me, you and I belong together like the sand and the sea …«
So singt und tanzt er in die Müritzstraße hinein, und nach der Müritzstraße in die Treptowstraße. Hier stehen viele Häuser so schief da, als wollten sie jeden Moment umfallen, verkommen sind sie und dreckig, Kopfsteinpflaster hat die Straße, das ist an vielen Stellen seit Jahrzehnten voller Löcher, und alles ist grau, grau, grau. Doch der Junge, der tanzt und singt: »You, you have made a dream reality, I, I can feel your love surrounding me.« Hier begegnen ihm nur wenige Menschen, aber die betrachten ihn noch sorgenvoller als die in der Schillerstraße, manche schauen ihn richtig böse an. Was hat der so fröhlich zu sein? »You, you can touch a rainbow in the sky, I, I will feel as though I’ve learnt to fly«, und nun ändert sich die Gegend vollkommen, und der Junge hat weites, offenes Land mit Bäumen und Wiesen und Blumen und kleinen Giebelhäuschen erreicht. Im Dunst der Ferne liegen die Kasernen der Sowjetarmee, bis 1945 hieß sie Rote Armee. Eine Garnisonsstadt ist Rotbuchen, 32 Kilometer nördlich von Berlin.
Im wasserlosen Tal heißt diese Siedlung, weiß keiner, warum, die Häuschen in Reih und Glied sind noch unter Hitler gebaut worden zwischen 1934 und 1938, das war eines dieser Raus-aus-der-Stadt- und Jedem-Deutschen-seinen-Volkswagen-Programme, und auf eines der Häuschen tanzt der Junge nun zu, durch den Garten, an einer Laube mit Tischen und Stühlen vorbei hinein in die Diele – »you, you will give me love I’ve never heard« – und in die ebenerdige Küche. Eine blasse Frau steht da am Herd, nun fährt sie herum, eine Hand an die Brust gepreßt, links, wo das Herz ist.
»Gott, Martin, hast du mich erschreckt! Was ist passiert?«
Der Martin läßt seine Schultasche fallen, aus hellblauer Plaste ist die, scheußlich sieht sie aus, und er läuft auf die nervöse Frau zu und umarmt sie, und die Seligkeit, die ihn erfüllt, ist fast nicht mehr auszuhalten, als er ruft: »Sie hat mich geküßt, Mami! Auf die Wange! Nach der Mathestunde, im Hof hinter der großen Kastanie! Geküßt hat sie mich! Ich bin so verliebt! Und sie ist es auch! Und sie hat gesagt, morgen geht sie Eis essen mit mir!«
»Mein Junge«, sagt die Mutter und streicht sich eine Strähne blondes Haar aus der Stirn, erst sechsunddreißig ist sie, aber sie sieht viel älter aus, seit achtzehn Monaten auf Nulltarif gestellt, in einem Betrieb hat sie gearbeitet, der Zahnräder für den Trabant produzierte. Der Trabant wird nicht mehr gebaut, den Betrieb hat die Treuhand abgewickelt, den VEB ihres Mannes ebenfalls. War das schön, als der Emil noch da war, jetzt muß er in Stuttgart arbeiten, weil es hier keine Arbeit für ihn gibt, und bis Stuttgart sind es 635 Kilometer Autobahn und dann noch die Landstraße dazu. Deshalb kommt der Emil nur alle drei Wochen über Samstag und den halben Sonntag nach Hause, oft muß sie weinen, die Olga Nawroth, wenn sie allein ist oder wenn der Junge schläft, schöne blaue Augen hat sie, doch in den Augen sind die Menschen immer am traurigsten.
»Mami!«
Von weit, weit her kehrt ihr Blick zurück, und sie sieht und hört ihn wieder, den Martin, sechzehn Jahre alt ist er, ihr guter, lieber Junge. Wenn sie den nicht hätte.
»Ja, Martin«, sagt sie und bringt ein Lächeln zustande, ein elendiglich schwaches Lächeln. »Also verliebt biste, das ist schön. Da freue ich mich aber!«
Der Martin läßt sie los und tritt einen Schritt zurück, jetzt ist er erschrocken.
»Mami! Warum weinst du?«
Schrecklich, das hat sie sich doch strengstens verboten, vor dem Jungen, und mit bebenden Lippen lächelnd sagt sie: »Ich weine doch nicht.«
Mit einer Hand streicht er über ihre Wange. »Und das? Sind das keine Tränen?«
»Nein«, sagt die Mutter. »Ich weiß gar nicht, wo das herkommt. Von den Zwiebeln wahrscheinlich.«
Er lacht, sofort wieder befreit. »Ich muß auch immer weinen bei Zwiebeln! Ach, Mami, verliebt sein ist das Schönste, was es gibt, nicht?«
»Ja, Junge.« Rotbuchen-Stuttgart 635 Kilometer.
»Es ist … Ach, man kann es gar nicht beschreiben.«
»Nein.« 635 Kilometer. Alle drei Wochen Samstag und den halben Sonntag. Und immer kommt er zum Umfallen müde an.
»Wie war das bei dir und Vati? Als ihr euch kennengelernt habt? Sag doch! War das auch so, daß man es gar nicht beschreiben kann?«
»Genauso, Junge. Genauso«, sagt sie und nickt, und die Haarsträhne ist ihr wieder in die Stirn gefallen, und sie schiebt sie wieder zurück. Nein, nicht daran denken! »Verliebtsein, ja, das ist herrlich. Ohne die Liebe …« Sie schluckt und ballt beide Hände zu Fäusten. »Ohne die Liebe kann man nicht leben.«
Und mit der Liebe? Wie soll das weitergehen, wenn sie den Emil jetzt auch in Stuttgart entlassen? Das letzte Mal, als er hier war, hat er erzählt, im Westen geht’s längst nicht mehr so wie früher, und es ist schon von Kurzarbeit und Rationalisierung, von Einsparung und Kündigungen die Rede gewesen in der Kantine. Und das ist noch nicht das Schlimmste. Auch nicht, daß Gas und Strom und Heizung und Lebensmittel, daß einfach alles immer teurer wird, nein, auch das nicht. Das Schlimmste ist die Angst, die ihr Tag und Nacht den Hals zuschnürt.
Jedesmal, wenn es klingelt und ein fremder Mensch steht draußen am Zaun, fürchtet sie, daß sie ohnmächtig wird. In diesem Häuschen hat nämlich vor ihnen jemand anderer gewohnt, natürlich, viele andere Leute haben in dem Häuschen gewohnt, seit es gebaut wurde, besonders nach 1945. Dann, 1975, hat es geheißen, die letzten, die da wohnten, seien abgehauen in den Westen, und das Häuschen könne gekauft werden von den Werktätigen. Haben der Emil und die Olga Nawroth all ihr Erspartes zusammengekratzt und das Häuschen gekauft. Denn da wünschten sie sich schon sehr ein Kind, und das sollte es besser haben als sie, die in dem dreckigen Berlin aufgewachsen waren. Frische Luft und Wald und Wiese für das Kind!
So sind sie eingezogen ins Häuschen, jeder Mensch will etwas Eigenes, etwas, das ihm gehört. War viel zu reparieren, und was sie zum Reparieren gebraucht haben, konnte man nur mit List und Tausch bekommen, so viel Arbeit steckt in dem Häuschen, alle Wochenenden und jede freie Stunde haben sie herumgewerkt. Der Emil ist so geschickt, alles Schöne, was es hier gibt, hat er selber gemacht, mit seinen Händen, auch die Laube im Garten und den Anbau, die Garage für den Trabbi, den sie einmal kriegen würden, Lieferzeit fünfzehn Jahre, was waren schon fünfzehn Jahre! Immer schöner haben wir alles hier gemacht, denkt die Olga Nawroth, für uns und das Kind.
Und jetzt?
Jetzt kommen jeden Tag Leute aus dem Westen und sagen, solche Häuser wie unseres, aber auch viel größere, gehören ihnen. Sie haben sie einmal genauso gekauft wie die, die jetzt drin wohnen, und sie wollen ihren Besitz zurück. Uns hat der Staat aber nur das Haus verkauft, nicht den Boden, Boden wurde niemals verkauft, der gehörte dem Volk. Und ich weiß genau, die Leute vor uns, die haben dieses Haus auch gekauft, vielleicht gab es sogar vor denen noch andere, und die leben noch. Ein grauenhaftes Durcheinander ist das, keiner weiß Bescheid, keiner lebt in Sicherheit.
Und wenn nun bloß die direkten Vorgänger kommen, es heißt im Gesetz doch »Rückgabe geht vor Entschädigung«, dann müssen wir raus hier. Dann sitzen wir auf der Straße, dann …
Olga Nawroth würgt es in der Kehle, und sie denkt, was sie schon oft gesagt hat, zu ihrem Mann, nachts: Dann bring’ ich die um, die da kommen – und uns drei auch! Ja, das tu ich. Denn hier rausmüssen, das ertrag’ ich nicht! Nein, sagt sie sich jetzt, nicht daran denken, nur nicht daran denken, und sie streicht dem Jungen über das Haar und fragt: »Wie heißt denn das Mädchen?«
»Claudia.«
»Claudia?«
»Ja, Mami. Claudia Demnitz. Sie wohnt in der Straße der Republik – ich vergesse immer, wie sie jetzt heißt, die Straße, Kurfürstenstraße heißt sie jetzt. In der Kurfürstenstraße wohnt die Claudia! Was ist los? Ist dir übel, Mami?«
Sie sieht plötzlich noch blasser aus, ihre Lippen sind ganz schmal, und vollkommen kraftlos ist sie auf eine Bank beim Fenster gesunken, vor dem gar nicht weit entfernt langsam ein Schäfer mit seiner weißen Herde und einem kleinen schwarzen Hund vorüberzieht.
»O Gott, Junge«, sagt sie.
»Was ›o Gott‹?« Weg ist die Seligkeit, verschwunden die Freude. Da kommt etwas Schreckliches, der Martin fühlt es.
»Das … das geht nicht …«
»Was geht nicht?«
»Das muß ich dir verbieten.«
»Was? Was mußt du mir verbieten?« Er hat ja gewußt, da kommt etwas ganz Schlimmes.
»Die Claudia …« sagt die Mutter.
»Du mußt mir die Claudia verbieten?« Vor Schreck setzt er sich neben sie.
»Ja, Junge. Ich muß dir den … den Umgang mit diesem Mädchen verbieten.« Den Umgang! Wie rede ich denn? O lieber Gott, ist das eine Zeit, ist das ein Leben!
»Aber warum, Mami? Warum?«
»Ich kenne die Eltern.«
»Und?«
»Die waren bei der Stasi.«
»Das ist nicht wahr!« Der Martin springt auf.
»Doch.«
»Nein!«
»Ganz bestimmt.«
»Woher weißt du das?« ruft er zornig.
»Die Leute sagen es.«
»Was für Leute? Mami? Was für Leute?«
»Alle«, sagt sie. »Alle Leute.«
Und dann schweigen sie und schauen einander nicht an, und draußen auf der großen Wiese ist der alte Mann zu sehen mit den vielen weißen Schafen und dem kleinen schwarzen Hund, der um die Herde kreist.
2
Am nächsten Tag sitzt Martin mit der dunkelhaarigen, blauäugigen Claudia in der Kreuzkammerstraße vor der neueröffneten Eisdiele »Bruno«. Die liegt nahe bei der Schillerstraße und war vor kurzem noch ein Parteilokal der SED. Der Italiener Bruno Cavaletti hat sich gleich nach der Wende um dieses Lokal bemüht und eine Erlaubnis zum Eisverkauf erhalten. Den großen Raum hat er hellgrün und weiß gestrichen, den Boden und das Glas der Schaufenster erneuert, die zierlichen weißen Sessel und Tischchen bekam er von seiner Familie aus Neapel. Das Teuerste war die Eismaschine, die hat ihm eine Westfirma gegen vielmonatige Ratenzahlung verkauft, lange wird er noch brauchen, bis er sie abgestottert hat. Das Eis, das Bruno macht, ist die reine Wonne, alle haben ihn gern, er strahlt, das Lokal ist immer voll, und Brunos deutsche Freundin serviert. Im Winter werden sie die Eisdiele in ein Café verwandeln.
Schoko-Erdbeer-Pistazie hat Claudia bestellt, eine Riesenportion steht vor ihr, im höchsten Punkt des Eisbergs steckt ein kleiner, bunter Papierschirm, um den löffelt sie herum, langsam und andächtig, welch eine Masse Wonne für 4 Mark 50!
Martin hat nur Zitrone verlangt, auf Zitrone ist er ganz wild, das ist sein Höchstes, sogar heute, wo ihm so furchtbar elend zumute ist. Immerzu muß er die Claudia anschauen, die sein Lieblingskleid, das blaue mit den weißen Tupfen, trägt, geliebte, herrliche Claudia, schönstes Mädchen, das es gibt auf der Welt! Ach, ist dem Martin zum Heulen.
An diesem Freitag, dem 10. Mai 1991, wird der Bundeskanzler Helmut Kohl bei einem Besuch in Halle von Randalierern, die hinter den Absperrungen stehen und geschützt sind durch die Menge um sie und durch die Juso-Fahnen der deutschen Sozialdemokratie, mit Eiern, Tomaten und Farbbeuteln beworfen. Zum Entsetzen der Sicherheitsbeamten stürmt der Kanzler in seinem Zorn auf eine dieser Absperrungen los, gerät mit den Leuten dahinter ins Handgemenge, erwischt natürlich die Falschen, und Filmaufnahmen dieser Geschichte werden dann abends auf die Fernsehschirme vieler Länder ausgestrahlt. Das mit den Eiern und Tomaten und Farbbeuteln ist eine Sauerei, finden die Menschen – immerhin, die Kerle hätten ja auch Handgranaten oder Messer schmeißen können –, und überhaupt, diese Art der politischen Auseinandersetzung ist mehr als dreckig, aber, so sagen viele, daß die Menschen in den »fünf neuen Ländern« enttäuscht und verbittert sind und sich geleimt fühlen, das kann man gut verstehen, denn vor den ersten freien und geheimen Wahlen in Ostdeutschland, am 18. März 1990, hat der Kanzler versprochen, daß es vielen besser und keinem schlechter gehen wird, und gewiß hat die CDU deshalb in vier von fünf Landesparlamenten die Mehrheit erreicht. Sicher, einem Haufen cleverer Herren geht es seither besser, aber Hunderttausenden geht es schlechter als vor der Wende, in manchen Gegenden ist die Arbeitslosenrate mittlerweile auf über 30 Prozent gestiegen, und die meisten der 17 Millionen Ostdeutschen haben sich das Zusammenleben mit den Brüdern und Schwestern im Westen ganz anders vorgestellt damals am 3. Oktober 1990 um 0 Uhr 00, als vierzehn Jungen und Mädchen in Berlin eine sechzig Quadratmeter große schwarz-rot-goldene Flagge vor dem Reichstagsgebäude an einem vierzig Meter hohen Mast emporzogen und das deutsche Volk wieder vereint war in Frieden und Freiheit. Das größte Feuerwerk, das es je in Berlin gab, ist danach losgegangen, mit Krachen und Zischen, auch das und den Jubel und das Glück und den Gesang der Brüder und Schwestern aus Ost und West haben Fernsehstationen in die ganze Welt übertragen. Auf dem ehemaligen Prachtboulevard Unter den Linden hat es ungeheuerlich viele Imbißbuden und Verkaufsstände gegeben, zu Füßen des Denkmals von Friedrich dem Großen sind Grillwürste und Crêpes, Bier und Sekt tonnen- und hektoliterweise verkauft worden, die Menschen haben bis in den Morgen hinein gefeiert wie bereits Silvester, als einige auf das Brandenburger Tor kletterten. Dabei ist die Quadriga arg beschädigt worden, und ein paar Besoffene sind heruntergefallen und mußten in Krankenhäuser gebracht werden. War das schön, war das wunderbar, lang, lang ist’s her.
Nein, eben gar nicht lang, leider.
Der Martin Nawroth hat seinen eigenen schrecklichen Kummer an diesem 10. Mai 1991, während er da bei »Bruno« sitzt mit der vierzehnjährigen Claudia. Viele bittere Tränen hat es bei ihm zu Hause gegeben, und er hat der Mutter versprechen müssen, mit Claudia sofort Schluß zu machen, aber ein Versprechen unter solchem Zwang, das darf doch nicht gelten! Was können Kinder dafür, wenn ihre Eltern für die Staatssicherheit gearbeitet haben?
Wenn sie haben!
»Alle Leute sagen es …«
Was sagen die Leute nicht alles, gerade in diesen Monaten? Oft scheint es dem Martin, als ob hier auf einmal jeder gegen jeden kämpft. Früher war das nicht so, im Gegenteil, da haben die Menschen zusammengehalten gegen die Bonzen und einander geholfen. Jetzt werden immer neue alte Rechnungen beglichen, fast jeder hat einen andern auf dem Kieker, und viele Ossis haben viele Wessis auf dem Kieker, weil viele von diesen Besser-Wessis sagen, daß die Ossis blöd sind und faul und selber schuld an dem Elend in ihrem Land. Bereits nach so kurzer Zeit gibt es richtigen Haß auf die räuberischen Wessis, die das bißchen, was noch da ist in dieser armen DDR, der ehemaligen, brutal ausschlachten.
Und im Westen ist es keine Spur besser, da haben jeden Tag mehr Menschen einen Riesenrochus auf die im Osten und die ganze Wiedervereinigung, denn der Kanzler und seine Leute haben ja auch versprochen, daß diese Wiedervereinigung den Menschen im Westen keine Steuererhöhungen bringen wird und keine Sonderabgaben und daß nichts teurer werden wird, ach wo, das machen wir doch mit links! Ja, aber jetzt, wo sie sehen, wie sehr sie sich verrechnet (oder wie sehr sie gelogen) haben, da gibt es natürlich Steuererhöhungen und jede Menge Sonderabgaben und jeden Tag etwas Neues dazu, zum Beispiel diese sogenannte Gesundheitsreform, die Familien, Alten und Rentnern nur weitere Belastungen bringt. Und die Mieten sausen derart in die Höhe (Bonn hat das Wohnungsbauprogramm zusammengestrichen, obwohl es zu wenige Wohnungen gibt), daß junge Paare nicht mehr ein noch aus wissen (und alte Leute erst recht nicht). Ja, da kommt Wut auf, und natürlich nicht auf die Lügner in Bonn, ach nein, natürlich auf die Brüder und Schwestern im Osten, denen der Westen pro Jahr 200 Milliarden überweisen muß, ohne daß man merkt, es tut sich was in den »neuen Ländern«. Jetzt schreien die, sie brauchen mehr, mehr, viel, viel mehr, wo soll das noch hinführen mit diesen Brüdern und Schwestern, wohin?? Typischerweise ist der Textilschlager in West-Berlin 1991 ein T-Shirt, auf dem steht: ICH WILL MEINE MAUER WIEDERHABEN! Und das ist kein Spaß, das ist ein Geschäft mit dem Haß.
Der Martin hat so einen Haß nicht, aber er ist eine Ausnahme, die meisten Jungs reden wie ihre Eltern, und schon wenn sie neun oder zehn Jahre alt sind, brauchen sie jemanden, den sie hassen können – wie jeder Mensch.
Warum? Warum muß jeder Mensch jemanden zum Hassen haben? denkt Martin jetzt todunglücklich und löffelt eilig sein Eis. Wenn man am liebsten abkratzen möchte, dann schmeckt Zitroneneis noch besser als sonst.
Reden muß er mit Claudia, unbedingt, und er seufzt tief.
»Was ist denn?« fragt die Schöne und leckt sich Schokoladeneis von den Lippen.
»Nichts.« Er traut sich nicht.
»Klar ist was. Das Seufzen. Dein Gesicht: Was hast du, Martin?«
Er löffelt und löffelt und schaut sie nicht mehr an und brummt etwas.
»Was hast du gesagt?«
Es muß sein. Alle Kraft nimmt er zusammen und stottert los: »Das … das wollte ich dich … fragen wollte ich dich das, Claudia …«
»Was?«
Schweigen.
»Was?« fragt die Claudia, und jetzt sieht sie ihn sehr ernst an.
Also raus damit! »Waren deine Eltern Stasispitzel? Aber reg dich nicht auf!«
Reg dich nicht auf! Da soll man sich nicht aufregen!
Claudia kriegt dunkelrote Ohren und verschluckt sich an einem Mundvoll Schoko-Erdbeer-Pistazie, sie würgt die Hälfte hinunter, die andere Hälfte spuckt sie auf das weiße Tischchen, und dann starrt sie den Martin ein paar Sekunden lang an. Jesus, ist die wütend, denkt er entsetzt, und da knallt sie ihm schon eine, aber fest, so viel Lärm macht die Ohrfeige, die sie ihm gibt, daß andere Eisesser sich neugierig umdrehen.
»Claudia …« stammelt er. »Claudia …«
»Nix Claudia!« schreit sie. »Das ist ja die größte Gemeinheit, die’s gibt!«
»Bitte, Claudia! Bitte! Schrei nicht so! Alle schauen her. Alle hören zu.«
»Sollen sie doch! Sollen sie doch!« Die Claudia ist aufgesprungen und wirft den Löffel hin und schreit weiter, und immer mehr Schluchzen mischt sich ins Schreien. »Wie du alles verdrehst, das ist so gemein!«
»Was verdrehe ich?«
Die Leute, die Leute, sie starren und lauschen, ist das peinlich … »Alles verdrehst du«, schluchzt Claudia. »Alle Tatsachen.«
»Was für Tatsachen?«
»Das weißt du genau!«
»Nichts weiß ich! Darum habe ich ja gefragt …«
»Ja, ja, ja, du hast gefragt. Ich will dir mal was sagen: Ich bin hergekommen zum Eisessen, obwohl meine Mutter mir den Umgang mit dir verboten hat. Obwohl ich ihr mein Ehrenwort habe geben müssen, daß ich dich nie mehr sehe.«
»Aber … aber warum?«
»Weil deine Eltern Stasispitzel gewesen sind!« Jetzt rinnen Tränen über ihr Gesicht.
»Meine …?«
»Ja, deine, deine, deine! Stasispitzel! Alle sagen das, alle Leute. Und du fragst mich, ob meine welche waren! Du drehst das einfach um. Nie, nie, nie will ich dich wiedersehen! Nie hätte ich herkommen dürfen. Wie recht hat meine Mutter gehabt!« Und damit rennt die Claudia Demnitz in ihrem wunderschönen blauen Kleid mit den weißen Punkten aus Brunos Eisdiele auf die Kreuzkammerstraße hinaus, und ihre Schultern zucken, der Martin kann von hinten sehen, wie sehr sie weinen muß.
10. Mai 1991.
219 Tage nach der Wiedervereinigung in Frieden und Freiheit. Deutschland, einig Vaterland.
3
Allmächtiger!
Martin wirft entsetzt zwei Fünfmarkstücke auf den Tisch und rennt hinter Claudia her, so schnell er kann, denn er hat rechts von sich seine Mutter und die Eltern von Claudia die Kreuzkammerstraße herunterkommen sehen.
Claudia rennt die Kreuzkammerstraße links hinunter. Hoffentlich haben die Eltern nichts bemerkt. Martin saust ihr nach wie die Katrin Krabbe mit oder ohne Anabolika, und als er nahe genug an Claudia herangekommen ist, brüllt er: »Deine Eltern … meine Mutter … Verstecken … wir müssen uns verstecken. Schnell … da vorn das Geschäft, die Tür steht offen …«
In Gefahr und größter Not führt der Mittelweg zum Tod. So etwas wissen die meisten von uns aus Instinkt. Das haben wir im Bauch seit Jahrmillionen. Die Claudia beginnt kein Streitgespräch, schreit nicht, klagt nicht, wehrt sich nicht, sondern rennt stolpernd neben dem Martin her. Gemeinsamer Feind eint.
Da, der Laden!
»Los, rein!«
Schon sind sie im Geschäft. Tür zu!
Gleich darauf stehen sie starr, überwältigt, schnappen nach Luft. Kann einen aber auch glatt umhauen, was es zu sehen gibt in dem Riesenraum.
Blitzende Klosettschüsseln mit Deckeln und seltsamen Aufbauten, die allesamt Namen haben, Namen! Sie stehen auf Täfelchen vor ihnen: »Moderna«, »Capella«, »Vienna«, »Magnum«, »Piano«, »Grangracias«, »Opera«, »Marina«, »Closomat Rio«, »Closomat Lima«, »Closomat Samoa« … Das hältst du im Kopf nicht aus, Klos in Weiß, in Rosa, Blau, Hellgrün, Gelb, Schwarz, verziert, vergoldet … Wo sind denn da die Wasserkästen, die bei allen Klos hier in Rotbuchen oben an der Decke hängen? Nichts hängt oben an der Decke, auch keine Kettenschnur mit Porzellangriff zum Ziehen. Außer diesen noch nie gesehenen Klos gibt es in den gleichen Farben kloähnliche Gebilde ohne Brille und ohne Deckel, mit goldenen Hähnen und Bodenventilen, sie sehen aus wie Fußbadewannen für Riesen, und auf den Täfelchen vor ihnen stehen gleichfalls Namen, »Bidet Aurora«, »Bidet Romantic«, »Bidet de Luxe«, »Bidet Princess«, was ist das? Und da drüben die Massen von Waschbecken, »Marmara«, »Ronette«, »Maddalena«, »Aphrodite« (das sieht aus wie eine Riesenmuschel), o Gott, und die Badewannen! Große, kleine, runde, eckige, ovale, mit Treppen darin, nierenförmig, sechseckig, achteckig, solche zum drin sitzen. Wie das alles blitzt, und wieder die Goldhähne, und wieder die schönen Namen: »Kronjuwel«, »Corpoline«, »Ergonova«, »Brillant«, »Bellion«, »Turbo-Whirl«.
So überwältigend ist das alles, daß Claudias Blick verschwimmt, und dann muß sie sogar kurz so keuchen, wie das die berühmte Tennisspielerin Monika Seles tut, xmal hat man es ihr schon verboten, weil es einem Keuchen gleicht, das nichts mit Tennis zu tun hat, aber die Seles sagt, sie kann nichts dafür, sie muß, und die Claudia muß jetzt auch, da ihr flackernder Blick zu den Duschkabinen geirrt ist, solchen aus Glas, die ausschauen wie Telefonzellen, aber mit Leisten in Rosa, Blau, Gold, Hellgrün, »Romylux«, »Gianola«, »Tollux«, oder solche, die runde Wände haben, zusammenklappbare Wände, Zellenwände, Gleitwände, lila, schwarz, silbern, »Corona«, »Spirella«, »Pirouette«, »Koralle«, »Optima«, »Holydoor«. Was ist »Holydoor«, eine Duschkabine für Kirchen vielleicht, für geistliche Herren?
Und da! Der Martin weist mit einem Finger, es hat ihm die Sprache verschlagen. Da! Also, das weiß die Claudia, was diese Dinger sind, die Mutter träumt von ihnen seit dem Elften Plenum, wie sie sagt, Waschautomaten sind das, aber was war das Elfte Plenum? Etwas ganz Schlimmes muß das gewesen sein vor langer Zeit, die Claudia war noch nicht auf der Welt. Weiß, weiß, weiß sind die herrlichen Waschautomaten, »Bianca«, »Adorina«, »Adorina de Luxe«, »Mirella«, »Prestige« heißen sie. Und Wäschetrockner, »Lavinox Star«, »Wega«, »Orion« und auch noch Massen von goldenem und silbernem Zubehör: Rohre, Hähne, Mischbatterien, Ventile – Hilfe! – Rosetten, Kupplungen, Klemmverschraubungen, Steuerungen, Brausen, Seifenspender, Spiegelschränke, Haltegriffe, Haken, Pumpen, »Oederin«, »Pax«, »Kuglofit …«
Und über all dieser Herrlichkeit schwebt ein marineblaues Transparent, auf dem steht in weißen Buchstaben: NUN ENDLICH SCHÖNER LEBEN!
»Guten Tag, die Herrschaften«, sagt eine Stimme.
Die beiden fahren herum. Hinten kann man durch eine geöffnete Tür in den Hof hinausblicken, und der ist, so weit man sehen kann, ebenfalls vollgepackt mit diesen Wirtschaftswunderweltwaren, und durch jene Tür ist ein kleiner Mann eingetreten, ein winziges Radio, nicht größer als zwei Streichholzschachteln, hält er in der Hand, und aus dem erklingt eine unirdisch schöne Musik. »Ist das nicht herrlich!« sagt der kleine Mann, der Bluejeans und ein verwaschenes gelbes Hemd über der Hose trägt, und während er das kleine Radio, aus dem eine fünfzig Zentimeter lange Antenne ragt, so zärtlich streichelt, als wäre es das Liebste, was er auf Erden sein eigen nennt (und das ist es auch), fügt er mit freundlicher, sanfter Stimme hinzu: »Mozart, Hornkonzert Nummer vier in Es-Dur, Allegro maestoso. Für Naturhorn geschrieben, heute ein kaum mehr gespieltes Instrument. Das Naturhorn hatte noch keinen Ventilmechanismus, also mußte der Spieler die in der Naturtonreihe nicht vorkommenden Zwischentöne durch Stopfen hervorbringen, das heißt durch Einführen der Hand oder der Faust in den Schalltrichter, und die Töne, die so entstanden, waren viel schöner. Hört doch bloß dieses Cantabile!« Der kleine Mann lächelt und streichelt das Radio. »Hermann Baumann am Horn, alles Originalinstrumente, Nikolaus Harnoncourt dirigiert, Sender Freies Berlin.«
Ganz fest hält Martin Claudias Hand, also schön, wir sind verrückt geworden, beide zur gleichen Zeit, so was kommt selten vor. Vielleicht aus Liebe? All den Prunk und all die Pracht mitten in unserem heruntergekommenen Rotbuchen, dieser armseligen Garnisonsstadt der Sowjetarmee, das kann es doch einfach nicht geben, unmöglich! Eben haben wir noch im »Bruno« Schoko-Erdbeer-Pistazie und Zitroneneis gegessen, und jetzt spielt uns dieser Mann etwas von Mozart vor aus einem winzigen Radio und erzählt vom Stopfen. Wir können nur verrückt geworden sein, denkt Martin, mir soll’s recht sein, der Claudia bestimmt ebenso, wenn unsere Eltern uns nur beisammenlassen und nicht trennen, weil sie bei der Stasi gewesen sind. Und dieser kleine Mann da, der hat sie sicher auch nicht mehr alle, so weit wie der hinausgewandert ist in ein Leben voll Schönheit und Wohlklang und Harmonie. Alle Menschen sollten verrückt sein wie der, denkt Martin, und sie lauschen zu dritt dem Allegro maestoso des vierten Hornkonzerts von Wolfgang Amadeus Mozart zwischen all den Kloschüsseln und Badewannen und Duschkabinen.
Claudia – Frauen haben einfach mehr gesunden Menschenverstand als Männer – schaut dabei immer noch zur Eingangstür und der Auslagenscheibe, ob da nicht ihre Eltern oder Martins Mutter auftauchen, aber nein, sie tauchen nicht auf, die sind entweder schon vorbeigegangen oder in eine andere Richtung gelaufen, womit die Gefahr natürlich keinesfalls gebannt ist. Und während sie wieder einmal zur Fensterscheibe blickt und das Allegro maestoso weitererklingt, hört sie Martin fragen: »Ist das Ihr Laden?«
»Ja«, sagt der Mann.
»Die Klos, die Badewannen … das alles gehört Ihnen?«
»Leider«, sagt der kleine Mann und schaltet das Radio aus, und er ist gar nicht so verrückt, wie der Martin gedacht hat. »Fini«, sagt der Mann, »das hier ist kein Krimi wie ›Derrick‹ oder ›Columbo‹, meine Lieben, und wenn ihr mir nicht sofort sagt, was mit euch los ist, fliegt ihr achtkantig raus in Nullkommajosef.«
»Wir erklären Ihnen alles, Herr …« beginnt Claudia und sieht den kleinen Mann an.
»Kafanke«, sagt der. »Mischa Kafanke.«
»Ich heiße Claudia Demnitz, und das ist mein Freund Martin Nawroth. Alles erklären wir Ihnen, Herr Kafanke. Nur bitte, bitte, schmeißen Sie uns nicht raus, sonst erwischen uns noch unsere Eltern.«
»Eure Eltern?« fragt Mischa Kafanke stirnrunzelnd. »Was heißt denn das, sie erwischen euch? Seid ihr ausgerissen?«
»Ja«, sagt der Martin.
»Was habt ihr ausgefressen?«
»Nichts! Überhaupt nichts, Herr Kafanke.«
»Warum reißt ihr dann aus?«
»Wegen der Stasi«, sagt der Martin.
»Wegen der Stasi?« wiederholt Mischa Kafanke entsetzt, die Beine tragen ihn nicht länger, er setzt sich auf ein Klo, das »Capella« heißt. »Ich will nichts zu tun haben mit der Stasi, unter keinen Umständen«, sagt er. »Also los, los, los, verschwindet!«
»Das können wir nicht, Herr Kafanke«, sagt Claudia.
»Warum könnt ihr das nicht?«
»Weil wir Hilfe brauchen, Herr Kafanke. Ihre Hilfe!« sagt Claudia.
»Meine Hilfe«, sagt Mischa, lacht idiotisch und bewegt sinnlos die Beine hin und her. »Warum gerade meine?«
»Weil wir doch bei Ihnen gelandet sind«, sagt Claudia, und da ist sie auf einmal eine erwachsene Frau, die ihn anlächelt, und diesem Charme und diesem Lächeln kann kein Mann widerstehen, auch Mischa nicht.
Abgrundtief seufzt der auf dem bildschönen »Capella«-Klo. »Bei mir gelandet«, sagt er gramvoll. »Warum ausgerechnet bei mir?« Und er hebt die traurigen Augen zur Decke, wo das marineblaue Transparent hängt: NUN ENDLICH SCHÖNER LEBEN! »Alles passiert immer mir, warum? Nichts als Zores hab’ ich.«
»Nichts als was?« fragt Martin.
»Nichts als was ›was‹?«
»Was Sie gesagt haben, daß Sie haben.«
»Zores«, sagt Mischa. »Weißt du denn nicht, was das sind, Zores?«
»Nein, Herr Kafanke.«
»Glückliches Kind«, sagt Mischa. »Sorgen«, sagt er. »Sorgen sind Zores, Unannehmlichkeiten sind Zores.«
»Was ist denn das für ein Wort?« fragt Martin. »Ich meine, aus welcher Sprache? Wo wird die gesprochen?«
»In einem schwierigen Land«, sagt Mischa. »Und jetzt will ich auf der Stelle wissen, was mit euch los ist.«
»Wir erzählen es Ihnen, Herr Kafanke«, sagt Claudia. »Alles. Sofort.«
4
Also eigentlich ist dieser Mischa Kafanke der menschgewordene Angehörige einer besonders beliebten Hunderasse, nämlich der Basset, über die man alles in dem großformatigen, vierfarbigen, 900 Seiten starken Standardwerk »Kynos-Atlas. Hunderassen der Welt« erfahren kann. Auf Seite 152 folgende heißt es da, daß der Basset, wörtlich, »wie der Dachshund oder der Beagle ein außergewöhnlich großes Maß an Popularität als Familienhund hat. Dies ist möglicherweise auch darauf zurückzuführen, daß er häufig in Werbekampagnen Verwendung findet. Der Hush-Puppies-Schuhe-Symbolhund zum Beispiel ist ein Basset, und sein sanftes, trauriges, ansprechendes Gesicht scheint eine ganze Menge Schuhe verkaufen zu können.« (Einen Spaß haben die Autoren hier gemacht, einen kleinen Spaß.) »Die großen melancholischen Augen des Basset finden nicht ihresgleichen in der gesamten Tierwelt … Alle echten Basset-Freunde sind dieser Rasse verfallen.«
Ja, so steht es da, wörtlich, auf Seite 155 gegenüber dem seitenfüllenden Porträt eines Basset Hound, und wer auch nur jenes Bildnis gesehen hat, der ist dem Basset bereits verfallen. Diese unendlich seelenvollen Augen! Dieses schmale Gesicht! Diese ungeheuren Schlappohren, deren erste Hälfte vom Ansatz zum Kinn reicht, während die zweite Hälfte vom Kinn an weiter abwärts hängt. Braun sind die Augen des Bassets, braun die Schlappohren, braun-weiß-sandfarben ist das Gesicht. Ein Hund sieht dich an, so gütig und milde, so weise und ergeben ins arge Leben wie kein anderer Hund, und seine »melodische Stimme klingt in den Ohren aller wahren Basset-Freunde wie Himmelsmusik …« Seitenlang drängt es einen weiterzuzitieren, jedoch und ach, ach und jedoch, auf den Basset trifft alles zu, das mit der Zuneigung und dem Entzücken und dem Verfallensein – auf den menschgewordenen Angehörigen dieser so beliebten Hunderasse jedoch, auf Mischa Kafanke, trifft es leider überhaupt nicht zu. Rätselhafte Welt, unergründliches Menschenherz!
5
Während Claudia erzählt, gehen sie alle drei in den Hof hinter dem Laden, und nachdem Mischa die Eingangstür versperrt und ein Schild GESCHLOSSEN an die Klinke gehängt hat, hockt er jetzt auf einer Badewanne Marke »Brillant«, die beiden anderen sitzen auf den Rändern der Badewannen »Kronjuwel« (Claudia) und »Corpoline« (Martin), und sie sind umgeben von anderen Badewannen, Waschbecken, Klos und Bidets, die sich drei- und vier-, ja fünffach übereinandertürmen und an manche jener Kunstwerke erinnern, die der Westberliner Senat 1987 für ein paar hunderttausend Mark pro Exemplar aus Anlaß der 750-Jahr-Feier von progressiven Damen und Herren erworben hat. Mischa und die Kinder wissen das nicht, sie haben diese Dinge nie gesehen, denn 1987 gab es ja noch die Mauer und den Todesstreifen und kein einig Vaterland, nicht die Rede davon. So ist ihnen der Anblick jener Kunstwerke erspart geblieben.
In diesen alten Zeiten vor der Wiedervereinigung in Frieden und Freiheit, als das Wünschen auch nicht geholfen hat, gab es jede Menge anderer Sonderlichkeiten, so zum Beispiel den Befehl jenes westdeutschen Zeitungs-Cäsars an seine Redakteure, in allen Blättern die DDR immer und ausnahmslos zwischen Gänsefüßchen zu setzen, also »DDR«, womit kundgetan werden sollte, daß es im Osten des grundsätzlich unteilbaren Deutschlands so etwas wie die DDR gar nicht gab, sondern daß eine Verbrecherhorde, die dort hauste, nur behauptete, es gebe sie.
Nachdem Martin und Claudia abwechselnd erzählt haben, ist es lange Zeit so still in dem vollgeräumten Hof, daß man weiter hinten, in einem ausgedehnten Ruinenfeld, in dem nur ein paar tote, verkrüppelte Bäume stehen, einen Vogel singen hört. Aber der Vogel scheint so verzagt zu sein wie Claudia und Martin und der menschliche Basset, zu dem Martin nun abschließend sagt: »… und jetzt möchte ich bloß wissen, wer von unseren Eltern bei der Stasi war.«
Mischa Kafanke schweigt und betrachtet das Liebste, was er sein eigen nennen darf auf Erden, das winzige Radio. TIME steht auf dem Apparat, eine Werbegabe also vom größten Nachrichtenmagazin der Welt, das verschenkt solche Sachen an jeden, der ihm einen neuen Abonnenten verschafft. Der Mischa hat »Time« keinen neuen Abonnenten verschafft, aber er ist gleich nach der Maueröffnung nach Westberlin gefahren, weil er es mal wieder so dringend nötig hatte. Einer hat ihm gesagt, daß es in der Straße des 17. Juni einen prima Strich gibt, schicke Bienen und nicht zu teuer, und dort zwischen Siegessäule und Salzufer hat der Mischa sich ein Mädchen ausgesucht, das hielt jenes kleine Radio in der Hand und hörte Musik, gerade »Moonlight Serenade«, als Mischa fragte, wieviel, und sie sagte es ihm, D-Mark natürlich, und dann gingen sie in den Tiergarten, wo unheimlich viele Präser rumlagen und an Zweigen hingen. So liebevoll und zärtlich war dieses Mädchen, wie es der Mischa noch bei keinem Menschen erlebt hat, und als er zahlte, vorher natürlich, hat sie ihm das Radio geschenkt, weil er es so bewunderte. Später mußte er feststellen, daß sie ihm sein ganzes Geld geklaut hatte, aber das kleine Radio hatte sie ihm gelassen, und das war derart menschlich von ihr, daß es Mischa niemals vergessen wird.
»Herr Kafanke!«
Claudia hat das gesagt, sehr laut.
Der menschliche Basset schreckt auf. »Ja?«
»Wie finden Sie denn das, Herr Kafanke?«
»Zuerst die Eltern, dann die Kinder. Nicht einmal die Kinder bleiben verschont«, murmelt der unglücklich. Natürlich hat er keine Schlappohren, aber doch außerordentlich große Hörorgane, und seine Nase ist stärker vorgezogen als die meisten Nasen, die man bei Menschen sieht, und häufig schnüffelt er auch, und seine Augen – ach, Mischas Augen! So etwas von treu und traurig, sanft und nachdenklich und ergeben ins arge Leben, ein Basset eben, mit kräftiger, kurzbeiniger Statur. »Nicht einmal die Kinder«, sagt er noch einmal und schüttelt betrübt den Kopf. »Schlimm. Ganz schlimm.«
»Nicht wahr«, sagt Claudia und ergreift Martins Hand, und jetzt sind sie wieder ein Liebespaar, sie gehören zusammen like the sand and the sea, keiner darf dem anderen böse sein, denn keiner von ihnen kann etwas für die Lage, in die sie gekommen sind. Und wieder schaut Claudia mit ihren schönen Augen den Mischa wie eine erwachsene Frau an und sagt: »Und darum werden Sie uns ganz bestimmt helfen, Herr Kafanke.«
Mischa springt erregt auf vom Rand der Badewanne und weicht zwei Schritte zurück und ruft: »Helfen? Wenn eure Eltern bei der Stasi waren? Bei der Stasi!«
Das ist ein furchtbares Wort, krank macht es und irre, nur Unglück und Leid bringen kann es, bedrängen, quälen, vernichten. Wie eine riesige Krake hat es sich über dieses Land gelegt, das die Redakteure auf Geheiß jenes Verleger-Cäsars in seinen Zeitungen stets nur zwischen Gänsefüßchen erwähnen durften, auf daß jedermann wisse, dieses Land gibt es gar nicht. Und jetzt erfahren von Tag zu Tag mehr Menschen schlimm und am eigenen Leib, daß es dieses Land und seine Stasi sehr wohl gegeben hat.
»Also wirklich«, sagt Mischa, »vor zehn Minuten haben wir uns noch nicht gekannt! Ihr schneit einfach hier rein, ich hör’ euch zu – leider –, gleich rausschmeißen hätte ich euch sollen, und jetzt verlangt ihr, daß ich euch helfe. Helfe!« wiederholt er, gibt der »Brillant«-Badewanne einen Tritt und sagt voll Bitterkeit: »Großer Gott, seid ihr da an der falschen Adresse!«
»Wieso, Herr Kafanke?« fragt Claudia.
»Weil ich keinem Menschen auf der Welt helfen kann«, sagt der Menschen-Basset, »nicht einmal mir selber.«
Und der unsichtbare Vogel in einem der toten Bäume auf dem Ruinenfeld ruft »kiwitt! kiwitt!« das heißt: So ist es! So ist es!
»Also«, sagt nun Martin (sie wechseln sich jetzt ab, er und Claudia, sie haben sofort gemerkt, daß sie bei einem gelandet sind, der niemanden abweisen kann, und wenn es ihm selber noch so elend geht, der wird helfen, nur nicht lockerlassen jetzt, der ist ja knapp vor dem Umfallen, schau bloß seine Augen an!), »also Herr Kafanke, ich habe ja nur mein Taschengeld, aber ich wette zehn Mark, daß Sie uns helfen und sagen können, wie wir trotz dieser Stasigeschichte zusammensein und uns liebhaben dürfen.« Er lacht, zu laut und zu fröhlich. »Zehn Mark wette ich!«
»Die hast du schon verloren«, sagt der Mischa und setzt sich, weil seine Knie zu zittern begonnen haben vor Schwäche und Traurigkeit. Die beiden da, die lieben sich, denkt er beinahe eifersüchtig. So jung und schon eine so große Liebe. Und was passiert? Kaum, daß zwei sich lieben, machen andere diese Liebe kaputt. Hassen dürfen die Menschen einander, soviel sie wollen, ja, hassen sollen sie sich, das ist gut, das ist richtig, so ist es den Großkopferten recht. Aber lieben? Wo kämen wir denn hin, wenn die Menschen einander alle lieb hätten, denkt Mischa und thront auf einem funkelnden Prachtbidet der Marke »Princess«. »Wieso habe ich die schon verloren?«
»Weil«, sagt der Mischa, »wenn ich von etwas garantiert keine Ahnung habe, wenn ich über etwas garantiert nicht Bescheid weiß, dann ist das vom …« Er bricht ab und schaut auf seine Fingernägel.
»Ist das von was?« fragt Martin.
Der Mischa schweigt.
Ganz leise und behutsam fragt Claudia: »Vom Zusammensein und vom Liebhaben?«
Der Mischa nickt.
»Aber Sie sind doch ein Erwachsener!« sagt Martin. Nur nicht lockerlassen! »Alle Erwachsenen wissen da Bescheid. Meine Mutter sagt immer, ohne die Liebe kann man nicht leben.«
Und der Mischa schweigt.
»Jeder hat doch einen zum Liebhaben.«
Der Mischa bewegt sich nicht.
Fragt die Claudia so leise, daß man es kaum hört: »Sie haben niemanden?«
Der Mischa schaut auf den dreckigen Hofboden.
»Verzeihen Sie, Herr Kafanke«, flüstert Claudia, »verzeihen Sie bitte!«
»Aber wenn meine Mutter …« beginnt Martin, doch Claudia schüttelt heftig den Kopf, das heißt: Sei ruhig! Martin ist bloß nicht ruhig, und feinfühlig wie die Claudia ist er erst recht nicht. Dieser Kafanke, der will sich doch nur drücken, der will einfach nicht reingezogen werden in so eine Stasi-Sache, und was wird aus uns? »Meine Mutter«, sagt Martin laut, »hat die also nicht recht, Herr Kafanke? Sie leben doch! Kann man denn leben auch ohne die Liebe?«
»Ja«, sagt der menschliche Basset und senkt den Kopf, als ob er sich schämen würde. Und wieder ist es unwirklich still in dem großen Hof mit all den Klos und Badewannen und Waschbecken, endlos lange bleibt es still, unerträglich ist das. Martin hält es zuletzt nicht mehr aus, er geht hin und her, gräßlich ist ihm zumute. Was machen wir jetzt, der Kafanke schaut aus, als wollte er nie wieder reden, verflucht. Ich muß etwas sagen, unbedingt, das kann doch nicht das Ende sein, denkt Martin, und er sagt das Nächstbeste, was ihm einfällt, es ist egal, was er sagt, nur weiterreden jetzt, nur nicht aufgeben: »Herr Kafanke, hrr … rrm! Die ganze Zeit schon will ich Sie fragen …«
»Ja?« fragt Mischa und schaut ihn gramvoll an.
»Was ist das, auf dem Sie sitzen?«
»Bitte?« fragt Mischa verblüfft.
»Das, auf dem Sie sitzen, was ist das?«
»Das ist ein Bidet«, sagt Mischa.
»Ja!« sagt Martin begeistert. Na also, er spricht wieder! Weiter! Weiter jetzt, schnell! Und schnell redet er weiter: »Das habe ich vorhin gelesen, daß das ein Bidet ist, ein Bidet ›Princess‹. Aber was ist das, ein Bidet ›Princess‹, Herr Kafanke?«
6
Martins Trick gelingt, und der menschliche Basset erklärt, dabei ein paarmal schnüffelnd, sehr dezent und doch erschöpfend diese Einrichtung, die der intimen Körperreinigung dient. Nur zu gern läßt er sich von der schlimmen Realität ins ungefährlich Sanitäre entführen. Claudia hat begriffen, was Martin vorhat, beide lauschen interessiert, und nachdem Mischa die Segnungen eines Bidets erläutert hat, kommt er dann – hurra! – in fließendem Übergang auf die modernen Klos zu sprechen …
»… die haben eben nicht mehr den Wasserkasten oben an der Decke mit dem Schwimmer und keine Metallkette mit Porzellangriff, das ist ja vorsintflutlich, diese neuen Klos – neu! im Westen gibt es sie schon seit dem Adenauer –, die haben den Wasserkasten hinter dem Sitz integriert, und auch der Knopf oder der Drücker, mit dem man das Wasser strömen läßt, ist integriert, oft seht ihr ihn gar nicht, so gut ist das gemacht.« Schnüffeln. »Ja, es gibt sogar Klos, da wird nachher zuerst alles mit lauwarmem Wasser absolut rein gespült und dann mit einem Warmluftgebläse getrocknet, kein Papier mehr!« Der Mischa lächelt wie in einem wunderbaren Traum. »Solche habe ich nicht, die sind nichts für uns, aber es gibt sie! Ihr habt ja keine Ahnung, was es alles gibt!«
»Also, wir, wir haben noch den ollen Kasten an der Decke …«
»Fast alle haben wir noch den ollen Kasten, Martin. Warum? Hinter dem Mond haben wir gelebt, alles für die Rüstung, nur die Bonzen in Wandlitz, die hatten solche modernen Klos, ich habe sie selber gesehen. Aber jetzt, wo wir in einer Demokratie leben und im einig Vaterland, müßte Schluß sein mit Wasserkästen und Metallketten zum Ziehen und all dem alten Gerümpel. Jetzt müßte es auch bei uns das Neueste vom Neuen geben, zum Beispiel Whirlpool-Wannen …« Und da versickert Mischas Stimme, plötzlich sinkt er zusammen, traurig und hoffnungslos schaut er den Dreck auf dem Boden an.
»Das ist ja wunderbar für Sie!« ruft Claudia schnell.
»Wunderbar«, wiederholt er. »Wunderbar?«
»Na, das steht doch ganz groß in Ihrem Laden: ›Nun endlich schöner leben!‹ Nicht? Mit den vielen Sachen, die Sie haben fürs schönere Leben, endlich, Klos und Wannen, Waschautomaten und alles, das geht doch reißend weg jetzt!«
»N – n«, macht der menschliche Basset und schnüffelt gramvoll.
»N – n?« fragt Claudia besorgt.
»N – n«, macht der Basset. »Müßte, habe ich gesagt, erinnere dich! Müßte Schluß sein, und alles müßte gehen, nicht muß! Gar nichts geht. Hin und wieder ein Klo oder eine Wanne, ja, gut, aber nie ein Whirlpool oder ein … So große Pläne, so große Hoffnungen, und jetzt … Hat doch keiner Geld für all das …« Der Mischa richtet sich auf. Vorbei die Ablenkung, im Eimer der Aufheiterungstrick. »Was ist das für ein blödes Gerede? Interessiert euch doch alles nicht! Und ich Idiot falle auch noch darauf rein. Nein, nein, nein, ich kann nichts für euch tun. Traurig, traurig, aber viel zu riskant – weiß Gott, in was für einen Schlamassel ich da gerate, und ich habe, Gott weiß es, schon genug Schlamassel, nein, nein, nein!«
»Sie haben Angst«, sagt Martin. Jetzt versuchen wir es mal so. Keiner gibt zu, daß er Angst hat, keiner.
Der Mischa schon. »Ja«, sagt er prompt.
»Weil Sie uns helfen sollen?«
»Deshalb auch«, sagt Mischa.
»Und weshalb noch?«
»Überhaupt«, sagt Mischa. »Ich hab’ immer Angst.«
»Aber wovor, Herr Kafanke? Wovor?«
»Man braucht in unserer Zeit keine.Gründe, um immer Angst zu haben, weißt du«, sagt Mischa, und »kiwitt! kiwitt!« piepst der verzagte Vogel draußen in dem toten Baum auf dem Ruinenfeld. So ist es! So ist es!
»War das schon immer so bei Ihnen?« fragt Claudia. »Ihr ganzes Leben lang?«
»Ja. Aber nicht so schlimm. So schlimm erst später.«
»Später – wann?« Konversation! Zeit gewinnen! Der hilft uns. Der hilft uns. Schau ihn dir bloß an, den armen guten Kerl!
»Seit ich diesen Vertrag mit dem Freundlich geschlossen habe gleich nach der Wiedervereinigung«, sagt Mischa leise, plötzlich weit, weit weg mit seinen Gedanken.
»Mit was für einem Freundlich?«
»Dem von den Clo-o-form-Werken in Wuppertal. Weil nämlich – aus!« ruft der Mischa, wieder in die Gegenwart zurückgekehrt mit seinen Gedanken. Auch ein Wurm rebelliert, wenn er zu oft getreten wird. »Was soll denn das?« Schniefen, abgrundtiefes Schniefen und danach fast so etwas wie ein winziger Aufschrei: »Ich will euch ja helfen – aber womit? Ich will ja, daß man euch beisammen läßt – aber wie?«
»Erpressung«, sagt Martin.
»Was?« fragt der Basset.
»Bleibt uns nichts anderes übrig, Herr Kafanke. Wir müssen unsere Eltern erpressen.«
»Aha«, sagt Mischa. »Erpressen«, sagt er. »Die Eltern«, sagt er.
»Und wie?«
»Wir kommen nicht mehr nach Hause, wenn sie uns nicht beisammen lassen.«
Claudia nimmt die Idee sofort auf: »Wir schreiben ihnen einen Brief. Sie müssen sich verpflichten, uns nicht dafür büßen zu lassen, daß sie bei der Stasi gewesen sind – wenn sie gewesen sind. Es wird doch so viel gelogen heutzutage.«
»Und wenn sie nicht nachgeben?«
»Dann leben wir versteckt«, sagt Martin.
»Aha«, sagt Mischa mit einem sehr unguten Gefühl. »Versteckt. Und wo?«
»Na, bei Ihnen, Herr Kafanke! Wo wir uns schon so gut kennen. Hier sucht uns keiner.«
Jetzt ist es raus.
»Du bist wohl verrückt geworden?« Der Mischa regt sich auf. Und wenn er sich aufregt, wird sein Schniefen stärker. »Bei mir geht das auf keinen Fall! Verflucht nochmal, ich Idiot! Sofort rausschmeißen hätte ich euch sollen, sofort!«
»Aber Sie haben’s nicht getan.«
»Eben, weil … weil ich ein solcher Idiot bin.«
»Sie sind kein Idiot, Herr Kafanke«, sagt Claudia und schaut ihm fest in die Augen. »Ein guter Mensch sind Sie. Darum haben Sie uns nicht sofort rausgeschmissen!«
»Halt den Mund! Guter Mensch!« Der Mischa wird immer aufgeregter, immer mehr muß er schniefen. »Verstecken! Erpressen! Mich reinziehen!« Da hat er einen grandiosen Einfall – glaubt er. »Und die Schule? Was ist mit der Schule?«
»Was soll mit der sein?«
»Ihr müßt doch in die Schule gehen!«
»Also, das ist unsere geringste Sorge«, sagt Claudia: »Die Schule! Sie haben ja keine Ahnung, was unsere Schulen für ’ne Kacke sind.«
»Das Letzte«, sagt Martin. »Das Allerletzte! Unsere Lehrer!« Er verdreht die Augen. »Ein Jammer, daß man Erwachsene nicht abtreiben kann. Dann wären wir diese Lumpen los. Schon als wir sechs Jahre alt waren, haben sie uns eingetrichtert: Sozialismus gut, Kapitalismus böse! Schön, haben die meisten von uns gedacht, wird schon stimmen, Lehrer lügen doch nicht!«
Martins Stimme verklingt für Mischa, dem ein alter Witz eingefallen ist. Frage: Was ist der Unterschied zwischen Kapitalismus und Kommunismus? Antwort: Im Kapitalismus wird der Mensch vom Menschen ausgebeutet. Im Kommunismus ist das genau umgekehrt! Ach, denkt der Mischa, gar nicht komisch ist dieser Witz. Die Stimme Martins kehrt an sein Ohr zurück …
»Aber jetzt, mit der Wende, da haben sich auch die Lehrer gewendet. Wenn man sie direkt angeht auf das, was sie gestern gesagt haben und daß sie heute genau das Gegenteil sagen, dann behaupten sie, gestern hat man sie eben brutal gezwungen zu all dem, sie sind auch – na was sind auch die Lehrer heute, Herr Kafanke?«
»Was sind sie denn?« stammelt der überwältigt.
»Opfer natürlich! Lauter Opfer, Herr Kafanke! Nicht nur die Lehrer! Alle, alle! Aber mit den Lehrern haben wir am meisten zu tun!«
Die Claudia sagt: »Und das halten viele Kinder einfach nicht aus. Sie werden krank, seelisch, meine ich. Ist ja wirklich nicht auszuhalten! Die Leistungen werden immer schlechter, natürlich auch, weil immer mehr sagen: ›Was habe ich denn davon, wenn ich gut lerne – später bin ich doch arbeitslos!.‹«
»Oder der Golfkrieg«, sagt Martin. »Friedensgebete haben wir in der Schule gemacht, aber die ganze Beterei war umsonst. Jetzt ist der Krieg aus. Der Hussein ist immer noch da und bringt die Kurden um, und die reichen Saudis in Kuweit bringen die eigenen Leute um, weil die angeblich mit dem Hussein zusammengearbeitet haben, und der Boden und das Meer sind voll Öl, die Umwelt ist zerstört, so viele Menschen sind gestorben und geflohen – aber unsere Lehrer?«
»Was, eure Lehrer?« fragt Mischa und fühlt sich noch elender.
»Na«, sagt Martin, »glauben Sie, mit denen haben wir vielleicht diskutieren können über den Golfkrieg, oder wer schuld ist an ihm? Keiner hat was gesagt! Keiner! Vor dem ganzen Krieg haben sie sich gedrückt, weil sie Angst gehabt haben, etwas gegen die Amis zu sagen.«
»Oder gegen den Hussein«, sagt Claudia. »Oder für ihn und für die Amis. Oder gegen beide. Diese feigen Hunde! Die meisten von uns verachten die Lehrer nur noch still.«
Martin schüttelt den Kopf. »Nein, nein, Herr Kafanke, da machen Sie sich bloß keine Gedanken, wenn wir nicht in die Schule gehen! Schule – da kann man heute wirklich nur noch kotzen!«
»Meine Oma«, meint Claudia, »die sagt, das Beste an der Einheit ist die Marmelade. Bißchen wenig für ein einig Vaterland, wie?«
»Also«, sagt Martin und ist plötzlich von gräßlicher Unrast erfüllt, »würden Sie uns bitte Papier und einen Stift geben, Herr Kafanke? Damit wir die Briefe schreiben können und Sie sie dann unseren Eltern bringen.«
Der Mischa schnieft laut auf vor Schreck, denn er war tief in ganz anderen Gedanken. Jetzt sagt er total verstört: »Ich soll euren Eltern die Briefe bringen?«
»Ach, bitte, bitte, Herr Kafanke!« sagt Claudia. »Mit der Post dauert es doch so lange! Unsere Eltern kennen Sie nicht, und Sie sagen, zwei junge Leute haben Ihnen die Briefe auf der Straße in die Hand gedrückt und sind weggerannt.«
»Aber in Wahrheit bleibt ihr hier?« fragt Mischa, der abwechselnd rot und weiß im Gesicht wird.
»Also, darüber haben wir nun doch wirklich schon geredet!« sagt Martin.
Der Mischa steht auf. »Aus«, sagt er. »Schluß«, sagt er. »Das ist ja der Wahnsinn im Quadrat! Ich denke nicht daran, euch bei diesem Irrsinn zu helfen. Eure armen Eltern, die ängstigen sich zu Tode, wenn ihr nicht kommt.«
»Das steht ja nun auch fest, daß wir nicht kommen«, sagt Martin.
»Felsenfest«, sagt Claudia.
»Na schön«, sagt Mischa, »wenn das felsenfest steht, dann rufe ich jetzt sofort die Polizei an, damit sie euch hier abholt. Ich mache mich ja noch strafbar!«
»Die Polizei anrufen? Das werden Sie nicht tun«, sagt Claudia.
»Und ob ich das tun werde«, sagt Mischa. Er hat genug. Ja, die beiden lieben sich. Ja, das ist schön. Ja, ich beneide sie, zugegeben. Aber ich darf mich da nicht reinziehen lassen. Auf keinen Fall. Mit meinen Sorgen. Ausgerechnet einer wie ich. Als ob der Freundlich nicht schon Grund genug zum Selbstmord wäre. Nein, nein, nein! denkt er. Kommt nicht in Frage.
Und er geht hinein in den Ausstellungsraum und ruft das nächste Revier an. Er nennt seinen Namen und seine Adresse und erzählt die ganze Geschichte.
»Wir kommen sofort«, sagt der Polizist am Telefon. Der Mischa legt den Hörer auf und geht zurück in den Hof, und da sieht er, daß die beiden verschwunden sind.
»Claudia!« schreit er, so laut er kann. »Martin! Kommt zurück!« Wieder und wieder schreit er.
Nichts.
Nur der Vogel auf dem toten Baum ist noch da: »Kiwitt! Kiwitt! Kiwitt!«
Ich gottverfluchter Idiot, denkt Mischa verzweifelt.
Eine halbe Stunde später wird er schon auf dem Revier vernommen.
7
Name?«
»Mischa Kafanke.«
»Geboren? Alter?«
»17. März 1962. 29 Jahre.«
»Wo geboren?«
»Hier in Rotbuchen. Martin-Luther-Krankenhaus.«
»Beruf?«
»Klemp … eh, Installateur, Geschäft für sanitäre Anlagen.«
»Also selbständig.«
»Selbständig, ja.« Der Mischa hat langsam genug, und darum sagt er höflich: »Steht alles in dem Personalausweis und auf dem Geburtsschein, den ich Ihnen gegeben habe, Herr Sonderberg. Sie können es einfach abschreiben.«
Dieser Sonderberg, der ist neu hier, Mischa hat ihn noch nie gesehen. Alles ist neu, auch hier, die ganze Polizei haben sie umgekrempelt. Früher, im real existierenden Sozialismus, da hat es den ABV gegeben, den Abschnittsbevollmächtigten, der Mischa erinnert sich noch an »seinen«. Kiesel hat der geheißen, ein lieber Mensch, Giselher Kiesel, Offizier. Die Institution gab es schon seit den fünfziger Jahren.
So ein ABV wie der liebe Kiesel, also der hatte seinen Kiez. Und in seinem Kiez hat er sein Kiezbüro gehabt, nicht auf einem Revier, einfach ein Büro. Gewohnt hat ein ABV auch in seinem Kiez, und deshalb kannte er einfach jeden, die Kinder und die Säufer und die Ehen, wo es immer nur Krach gegeben hat, die Fleißigen, die Faulen und die Schwulen und die Krakeeler: »Na, wat denn, wat denn, Herr Krause, imma noch Stunk mit’m Hausmeesta? Nee, Vasöhnung? Det is aber scheen.« Und die, die gegen die SED gewesen sind, die hat er natürlich auch gekannt, und er hat der Stasi alles über sie gemeldet, klar. Der Kiesel hat eben seine Pflicht getan wie unter den Nazis wohl so ein Blockwart oder Ortsgruppenleiter oder wie die geheißen haben, aber freundlich ist er immer gewesen, der ABV, dauernd im Kiez unterwegs auf seinem Dienstmoped Schwalbe, das hat ausgesehen wie eine alte Vespa, war aber höchstens 45 Stundenkilometer schnell.
Den ABV Giselher Kiesel, den konnte man zu Kaffee und Kuchen einladen, auch zum Abendessen. So war das in den alten Zeiten. Seit der Wende gibt’s den ABV nicht mehr. Seit der Wende gibt’s nur noch so was wie diesen Kerl da, denkt Mischa, so einen Streber und Wichtigtuer, Kontaktbereichsbeamter heißt das jetzt.
»Das kann ich eben nicht, Herr Kafanke«, sagt der Kontaktbereichsbeamte Sonderberg hinter seiner Schreibmaschine, einer ganz neuen, elektrischen. Alles neu macht der Mai und kommt aus dem Westen auch bei der Polizei, sogar die Uniformen. Der Sonderberg – nie vorschnell einen Menschen beurteilen, verurteilen, Mischa! –, der hat auch seine Mühen und Sorgen mit der neuen Zeit. Die Volkspolizeiuniformen zum Beispiel, die waren zwar aus Plaste und Elaste, aber wenigstens weit und schlabbrig zugeschnitten. Die neuen Westuniformen sitzen knapp auf Taille, bester Stoff, sicher, sicher, aber eben ungewohnt eng sind sie nach all den Vopojahren, und bei einer Hitze wie heute, da pieken Hemd und Hose, da schwitzt man, da ist man gereizt, und jetzt auch noch so einer, wie man ihn sich wünscht, mit Ratschlägen und Widerrede. »Das kann ich eben nicht, Herr Kafanke, das geht nach Vorschrift. Frage, Antwort, Vergleich mit dem Dokument, das müssen Sie schon mir überlassen.« Verflucht, piekt das Hemd, zwickt die Hose die Eier ein!
»Natürlich«, beeilt sich Mischa zu erwidern. Schniefend erklärt er: »Ich wollte es Ihnen nur leichter machen, Herr Sonderberg. Aber klar, verstehe, Vorschrift ist Vorschrift. Bitte um Verzeihung.« Schniefen noch einmal. Arschloch, blödes!
»Ist das alles, was Sie haben an Papieren?« fragt der Kontaktbereichsbeamte Sonderberg, gereizt durch die prompte feige Schleimerei von diesem Kafanke, aber nicht nur deshalb. Fritz Sonderberg ist immer gereizt seit der Wende. Wegen diesen Ungerechtigkeiten. Bitte sehr, da arbeiten drei westdeutsche Kollegen auf dieser Wache, die kriegen 2800 Mark im Monat. Er und die sechs anderen ostdeutschen Kollegen mit genau derselben Arbeitszeit bekommen 1950 Mark. Ist das eine Gerechtigkeit? Scheiße ist das. Einig Vaterland.
»Mehr Papiere habe ich nicht, Herr Sonderberg«, sagt jetzt Mischa, auch nicht eben freundlich. Dieser Giselher Kiesel, auswendig gekannt hat der mich und alle im Kiez, und wir ihn. Ein ganz ein anderes Verhältnis gewesen ist das, von vornherein. Der da, dieser Kontaktbereichsbeamte Sonderberg, der stammt nicht mal von hier, sächsisch redet der, Leipzig oder Dresden, könnte der Mischa schwören. »Sie sind neu hier, Herr Sonderberg, wie?«
»Ja. Aus Leipzig überstellt.« Na also, wer sagt’s denn! »Wieso haben Sie keinen Paß?«
»Weil ich noch keinen habe.«
»Jetzt kann aber jeder einen haben.« 1950 wir, 2800 die. Und dieses Dreckskaff Rotbuchen mit seinen Preußenkasernen und der Sowjetarmee drin. Zum Kotzen. Alles. Auch die Polizeireform. Den Kontaktbereichsbeamten, den haben sie im Westen schon seit dem RAF-Mord an Schleyer, heißt es, da wollten die eine »bürgernahe Polizei«, natürlich auch zum Observieren der Bürger. Was ist denn besser daran, daß die Kontaktbereichsbeamten keinen Kiez haben und kein eigenes Büro, sondern nur dies Loch auf der Wache, und auch keine Schwalbe, nein, zu Fuß müssen sie alles erledigen. Einheitliches Polizeirecht. Von wegen! Die Westkollegen kriegen mehr Geld, weil sie im Beamtenverhältnis stehen, wir Ossis sind bloß Angestellte, deshalb kriegen wir weniger. So was sorgt natürlich gleich für eine herrliche Arbeitsatmosphäre. Das Ganze ist außerdem schon sprachlich eine einzige Idiotie: Ich bin ein Kontaktbereichsbeamter, aber kein Beamter, sondern Angestellter. Kontaktbereichsangestellter müßte ich heißen. Herrgott, schwitzen tu’ ich wie ein Schwein, und einen Wolf werde ich mir auch noch holen in diesen engen Hosen, wenn ich jetzt herumrennen muß bei der Hitze. »Also noch keinen Paß beantragt. Staatsangehörigkeit?«
»Deutsche Demokra …«
»Na!«
»’tschuldigung! Deutschland meine ich natürlich.« Eben die neue Zeit. Keine Widerrede, wenn so ein Bulle fragt. Freundschaft, Freundschaft. Nun endlich schöner leben! Dem Kiesel, dem ollen ABV, konnte man auch mal einen schweinischen Witz erzählen. Hm. Der hat natürlich mächtig viele bei der Stasi angeschwärzt, ja ja, das schon, darum haben sie ihn auch gefeuert gleich nach der Wende.
»Wohnhaft?«
»Kreuzkammerstraße 46, hinter dem Geschäft.«
Diese Westuniformen, die sind ja wirklich todschick und luftdurchlässig. Aber wenn man so lange das Voposchlabberzeug, das bequeme, gewöhnt war …
»Familienstand?«
»Ledig.«
»Religionsgemeinschaft?«
»Keine.« So was hat man früher gern gehört in der DDR.
»Was heißt keine?« fragt Sonderberg mürrisch auf der anderen Seite der Holzbarriere, vor welcher Mischa steht. Hört man’s jetzt nicht mehr gerne?
»Heißt, was es heißt«, sagt Mischa mit einem gewinnenden Hush-Puppies-Lächeln, denn vor dem, was jetzt kommt, hat er Angst, und das kommt so sicher wie das Amen im Gebet.
»Atheist?«
»Nein, das auch nicht.«
»Nie getauft?«
Das geht dich doch einen Dreck an, will Mischa sagen, aber er sagt es nicht. AEG, aus Erfahrung glug. »Nie, nein.«
»Hm«, macht Sonderberg.
Also, die Vopos, die hätte auch das gefreut. Den da freut es nicht, und dabei war er doch vermutlich vor der Wende auch Vopo. Jetzt hat er Kommunisten auf dem Kieker, so was geht bei uns im Handumdrehen. Was haben diese beiden vorhin von ihren Lehrern erzählt?
»Und Ihre Eltern?«
»Was, meine Eltern?«
»Auch keine Religionsgemeinschaft?«
»Das weiß ich nicht, Herr Sonderberg.«
»Was heißt, das wissen Sie nicht?«
»Meinen Vater habe ich nie gesehen, und meine Mutter ist bei der Geburt gestorben.«
»Wieso haben Sie Ihren Vater nie gesehen, Herr Kafanke?«
Na also. »Der war in der Sowjetunion, als ich reden und laufen lernte.«
»Verschleppt?«
Klingt das irgendwie lüstern? »I wo! Heimgekehrt.«
»Heimgekehrt? Sie meinen, als Soldat?«