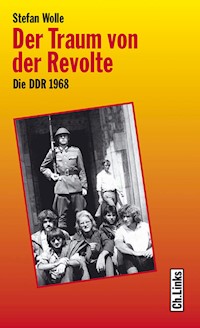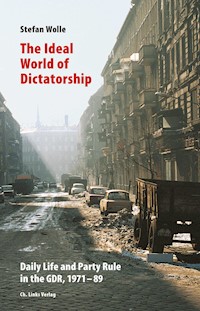9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Links, Ch
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Serie: Alltag und Herrschaft in der DDR
- Sprache: Deutsch
Am 13. August 1961 schnappte die Mausefalle zu. Die DDR war eingemauert. Doch war das nicht auch eine Chance? Die Sowjetführung verkündete 1961 den Aufbau des Kommunismus. So utopisch das war, auch in der DDR begann 1962/63 eine Zeit der Reformen. Die Wirtschaft sollte modernisiert werden. Dazu brauchte die Partei die Intellektuellen und die Jugend. In der Filmkunst und der Literatur taten sich erstaunliche Dinge. Doch wie weit konnten diese Veränderungen gehen? Der Einmarsch in Prag 1968 gab die Antwort.
Der Historiker Stefan Wolle lässt die aufregenden sechziger Jahre lebendig werden. Er greift dabei nicht allein auf Akten zurück, sondern lässt das gesamte Material – von Kinderzeitschriften über Filme und Schlager bis hin zur Literatur – zu Wort kommen. Das Buch schließt unmittelbar an seinen Bestseller »Die heile Welt der Diktatur« an. Im nächsten Jahr soll die DDR-Trilogie durch einen Band über die fünfziger Jahre abgeschlossen werden.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 702
Veröffentlichungsjahr: 2012
Ähnliche
Stefan Wolle
Aufbruch nach Utopia
Alltag und Herrschaft in der DDR 1961–1971
Ch. Links Verlag, Berlin
Editorischer Hinweis
Im gesamten Buch wird durchgehend die neue Rechtschreibung verwendet, auch die Zitate werden entsprechend angepasst.
Auslassungen sind mit … gekennzeichnet.
Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet
diese Publikation in der Deutschen Nationalbibliografie;
detaillierte bibliografische Daten sind im Internet
über http://dnb.d-nb.de abrufbar.
1. Auflage 2012 (entspricht der 1. Druck-Auflage von 2011)
© Christoph Links Verlag GmbH
Schönhauser Allee 36, 10435 Berlin, Tel.: (030) 44 02 32-0
www.christoph-links-verlag.de; [email protected]
Umschlaggestaltung: KahaneDesign, Berlin unter Verwendung eines Fotos
vom Entwurf des Innenwandgemäldes von José Renau »Der sozialistische
Mensch unter den Bedingungen der wissenschaftlich-technischen Revolution«
aus dem Jahr 1969, das für das Wissenschaftliche Informations- und
Bildungszentrum in Berlin-Wuhlheide vorgesehen war, jedoch nicht verwirklicht
wurde
eISBN: 978-3-86284-115-8
Inhalt
Prolog: Das Zeitalter der großen Erwartungen
Erster Teil: Zerrissene Zeit
Berlin vor dem Mauerbau
Die neue Klasse
Ein verregneter Sommer
Zweiter Teil: Mauerbau
Klappe zu, Affe tot
Leben mit der Mauer
Ruhe und Ordnung
Dritter Teil: Unsere Welt von morgen
Flug zu den Sternen
Die Eröffnung des kosmischen Weltalters
Licht aus dem Osten
Stalinismus ohne Stalin
Der Feind
Vierter Teil: Laborversuch Sozialismus
Die Sorgen und die Macht
Wirtschaftsreformen
Die wissenschaftlich-technische Revolution
Die sozialistische Stadt als Plan und Wirklichkeit
Fünfter Teil: Die neue Gesellschaft
Das entwickelte System des Sozialismus
Die Hausherren von morgen
Die Liebe in den Zeiten der Diktatur
Sechster Teil: Wandel ohne Annäherung
Entspannungspolitik
Kalter Krieg
Vietnam
Siebenter Teil: Produktivkraft Kunst
Kunst und Revolution
Der Bitterfelder Weg
Ein Hauch aus Prag
Achter Teil: Spiegelbilder
Prometheus
Faust und Mephisto
Kafka
Neunter Teil: Reform und Beharrung
Kahlschlag
Wissenschaft im Umbruch
Sozialistische Hochschulreform
Zehnter Teil: Das Jahr der unruhigen Sonne
Weltrevolution der Studenten
Die APO und die SED
Keine Opposition, nirgends?
Elfter Teil: Der Frühling war es wert
Aufbruch in Prag
Der Einmarsch
Gleichgültigkeit und Empörung
Zwölfter Teil: Aufbruch in die Stagnation
Nachtfrost
Kampf gegen die schleichende Konterrevolution
Das Ende der Ära Ulbricht
Epilog: Abschied von Utopia
Anhang
Anmerkungen
Personenregister
Prolog Das Zeitalter der großen Erwartungen
Das zerbrochene Glas
Der italienische Schriftsteller Umberto Eco unternimmt in seinem Roman »Die geheimnisvolle Flamme der Königin Loana« ein faszinierendes Gedankenexperiment. Er lässt einen Mann im Krankenhaus aus dem Koma erwachen. Wie Eco selbst, ist sein literarisches alter ego ungefähr sechzig Jahre alt, Inhaber eines gutgehenden Antiquariats, seit dreißig Jahren verheiratet, Vater von zwei Töchtern und mehrfacher Großvater. Doch an nichts aus seinem konkreten Leben kann er sich erinnern. Er weiß, wann Napoleon gestorben ist, kennt den Lehrsatz des Pythagoras und eine erstaunliche Menge von Zitaten aus der gesamten Weltliteratur. Doch sein eigener Name ist ihm so fremd wie die freundliche Signora, die ihm als seine Gattin vorgestellt wird. Sein Arzt klärt ihn darüber auf, dass es zwei Arten von Erinnerung gäbe: »Die eine ist das, was man heute gern das semantische Gedächtnis nennt, ein öffentliches Gedächtnis, kraft dessen man weiß, dass eine Schwalbe ein Vogel ist und dass die Vögel fliegen und Federn haben.«1 Die zweite Art ist das autobiographische oder episodische Gedächtnis. Der Professor sucht nach einem einfachen Beispiel und fragt den Rekonvaleszenten nach dem Namen seiner Mutter. Natürlich konnte dieser sich nicht erinnern. Er wusste zwar, dass jeder Mensch eine Mutter hat, aber er konnte sich an die eigene nicht erinnern.
Der Romanheld wird aus dem Krankenhaus entlassen, lernt seine Wohnung kennen, geht wieder in seinen Buchladen und trifft alte Bekannte. Er findet sich im Leben gut zurecht, doch seine episodische Erinnerung bleibt stumm. Auf Anraten seiner Frau fährt er auf ein vom Großvater ererbtes Landgut. Die alte Haushälterin erzählt ihm Einzelheiten aus seiner Kindheit. In einer zugemauerten Kapelle findet er Berge von gebündelten Zeitungen, illustrierten Zeitschriften, Comic-Heften, Kinderbüchern, Schulaufsätzen, Zigarettenbildern, bebilderte Teedosen, Schallplatten und Reste einer Briefmarkensammlung. Aus diesen Erinnerungsstücken beginnt er, seine Biographie zu rekonstruieren. Er liest die Elogen auf Mussolini, die er selbst als Schuljunge geschrieben hat, vertieft sich in die Abenteuerromane seiner Jugend, blättert in den alten Comics und hört auf dem altersschwachen Grammophon die Schnulzen der Kriegs- und Nachkriegszeit. Er fragt sich, ob er die patriotischen Phrasen der Schulbücher geglaubt hat. Für einen mit hochtrabenden Redensarten gespickten Schulaufsatz hat er sogar einen Preis bekommen. Der Zehnjährige schildert es als seinen größten Wunsch, für den Sieg des faschistischen Italien zu sterben. Was von alledem war Phrase und was echter Glaube? In alten Zeitungen vertieft er sich in die Kriegspropaganda jener Jahre, die angesichts der militärischen Katastrophe den Endsieg beschwor. Aus fünfzig Jahren Distanz ist das überdeutlich, doch konnte der Schuljunge von damals bereits zwischen den Zeilen lesen? Hat er wie sein Großvater die italienischen Sendungen der BBC gehört, die regelmäßig über die wahre Kriegslage berichteten? Schließlich stößt er auf einen Aufsatz, der in verschlüsselter Form das Zerbrechen des Glaubens an den Duce beschreibt.
Der damalige Schüler, und hier erzählt Eco ganz offenbar ein Stück der eigenen Biographie, schreibt in einem »Erlebnisaufsatz«, seine Mutter hätte ihm ein Glas gekauft, dass als unzerbrechlich angepriesen worden war. »Das war für mich wie ein Zauberwort«, schreibt Ecos AlterEgo.2 Eines Tages kommen Bekannte zu Besuch. Er holt das Glas aus der Küche und verkündete im Ton eines Zirkuskünstlers: »Ich präsentierte Ihnen ein ganz spezielles, unzerbrechliches, magisches Glas. Ich werde es jetzt auf den Boden werfen, und Sie werden sehen, dass es nicht zerbricht.«3 Er wirft das Glas zu Boden, und es zerspringt in tausend Stücke. Das Kind in der Erzählung starrt entgeistert auf die Scherben und beginnt zu weinen.
»Es war eine der ersten Geschichten«, schreibt Ecos literarischer Doppelgänger, »die wirklich von mir waren, nicht die Wiederholung angelesener Klischees und auch nicht die Beschwörung irgendwelcher schöner Abenteuerromane. … In jenen Scherben, die trügerisch im Schein des Kronleuchters wie Perlen schimmerten, zelebrierte ich als Elfjähriger mein Vanitas vanitatum und bekannte mich zu einem kosmischen Pessimismus. Ich war der Erzähler eines Scheiterns geworden … Ich war auf existentielle Weise, wenn auch ironisch bitter geworden, radikal skeptisch.«4
Ecos Romanfigur findet während ihrer Spurensuche in der Bilder- und Sprachwelt den Keim für ihr inneres Aufbegehren gegen die faschistische Erziehung. So entsteht die kollektive Biographie der Kriegsgeneration. Der Zeichentheoretiker Eco entziffert die Geheimschrift der kleinen Dinge, die verborgenen Botschaften der Zigarettenbilder, Filmplakate, Schlagertexte, Comic-Figuren, Romanhelden, Nachschlagewerke und Schulbücher. Die Zeitreise in die Vergangenheit wird zur Decodierung eines Systems verborgener Zeichen. Seine Jugendliebe Lila Saba taucht im Gedächtnis auf. Einmal nur hatte er mit ihr gesprochen. Er hatte vor ihrem Haus auf sie gewartet, und als sie endlich auftauchte, bekam er nur die Frage über die Lippen, ob hier ein gemeinsamer Schulkamerad wohne. Sie hatte kühl und sachlich geantwortet: »Nein.« Kurze Zeit später verließ sie mit ihren Eltern die Stadt, und der Romanheld hat sie nie wiedergesehen.
Eco bringt sein Romanexperiment zu Ende, indem er seinen Helden einen neuerlichen Gehirnschlag erleiden lässt, der ihm das episodische Gedächtnis zurückgibt. Es beginnt ein bunter Reigen von Traumbildern und Erinnerungssplittern. Die Gestalt seiner Jugendliebe Lila Saba verbindet sich nun mit der Königin Loana aus einem eigentlich »saublöden« Kinderbuch, wie es Eco selbst nennt. Doch während der Suche nach der Erinnerung hatte ihn immer wieder ein geheimnisvoller heiliger Schauer ergriffen, wenn von jener Königin die Rede war. Ihre Gestalt vermischt sich mit jenem Mädchen Lila Saba, mit dem er nur wenige Worte gewechselt hat. Der Erzähler begreift, dass er in allen Abenteuern seines Lebens, in allen Frauen und in allen Büchern immer nur jene erste Liebe gesucht hat.
Vertiefen wir uns also in die Zeichensysteme der sechziger Jahre zwischen dem Mauerbau vom 13. August 1961 und dem tragischen Ende des Prager Frühlings am 21. August 1968 und dessen Nachklängen. Versuchen wir die Bilder zu decodieren, das episodische Gedächtnis anhand von Dokumenten zu verifizieren, die vielfach gelöschten und überschriebenen Texte wie auf einem mittelalterlichen Pergament durch die Infrarotstrahlen der kritischen Analyse wieder lesbar zu machen.
Ein Sieg im Friedenskampf
Wie jeden Morgen plärrten auch am 13. August 1961 die Lautsprecher durch das Pionierferienlager »M. I. Kalinin« am Frauensee: Kampflieder der Arbeiterklasse, Schlagermusik, Durchsagen der Lagerleitung und im stündlichen Rhythmus die Nachrichten des Demokratischen Rundfunks, wie sich die Sender der DDR damals selbst nannten. Das ewige Dröhnen der Tonanlage gehörte zum Lagerleben wie die Kiefern, der märkische Sand und der Badesee. Für einen Zehnjährigen waren es an diesem Morgen die gleichen Parolen wie immer. Bonner Ultras … Sicherung des Friedens … Spionagezentrale West-Berlin … Schutz der Republik. Doch die Erwachsenen wirkten nervös. Irgendetwas war passiert. Sie standen in Gruppen herum. Einige versuchten aufgeregt, mit Berlin zu telefonieren. Damals schrie man bei Ferngesprächen noch ins Telefon: »Fräulein, verbinden Sie mich mit …«. Doch die Leitungen waren offenbar hoffnungslos überlastet. Eine der Erzieherinnen, ein hübsches junges Mädchen, heulte laut und hemmungslos. Die anderen redeten auf sie ein, vermochten sie aber nicht zu beruhigen. Irgendwen würde sie nun nicht mehr besuchen können, jammerte sie, waren es ihre Eltern oder ihr Freund?
Dann wurde zum sonntäglichen Fahnenappell getrommelt. Alle traten gruppenweise auf dem Appellplatz an. Es erfolgte die Meldung: »Lagerfreundschaft ›M. I. Kalinin‹ vollzählig angetreten.« »Für Frieden und Völkerfreundschaft! Seid bereit!«, rief der Freundschaftsratsvorsitzende zackig. »Immer bereit!«, tönte es im Chor zurück. Alle hoben zum Pioniergruß die angewinkelte Rechte über den Kopf. Auf das Kommando »Heißt Flagge!« stieg eine blaue Fahne mit dem Pionier-Emblem am weißen Fahnenmast hoch. Dann trat der Lagerleiter nach vorn. Auch er war keineswegs in Jubelstimmung. Doch er erklärte, warum es eine bittere Notwendigkeit gewesen sei, die Staatsgrenze der Republik zu sichern. Jugendliche aus der DDR seien verleitet worden, in West-Berlin krumme Geschäfte zu betreiben. In den Grenzkinos würden sie sich Wildwestfilme anschauen. Durch diese primitive Verherrlichung der Gewalt würden sie verroht werden. Manche von ihnen seien in der französischen Fremdenlegion gelandet, um in Algerien ihre Haut zu Markte zu tragen. Schieber und Spekulanten hätten die Läden im Demokratischen Sektor leergekauft und dadurch Unzufriedenheit gestiftet. Grenzgänger hätten im Westsektor gearbeitet und ihr Geld eins zu vier umgetauscht, aber gleichzeitig von den billigen Mieten, den kostenfreien Gesundheitseinrichtungen und niedrigen Lebensmittelpreisen im Osten profitiert. Die Regierung der DDR sei mit ihrer Geduld am Ende. Vorläufig sei West-Berlin gesperrt, erklärte der Lagerleiter. Sollten doch die Schieber, Wechselstubenbesitzer und Menschenhändler unter sich bleiben. Im Grunde sei es vollkommen normal, dass jeder Staat selbst entscheidet, wie er seine Grenzen zu schützen gedenke. Die Rechte der Westalliierten wären von den Maßnahmen der DDR nicht berührt. Übrigens würden sie ja recht gelassen reagieren. Sie sollten sich von dem Frontstadthetzer Willy Brandt nicht verrückt machen lassen.
Auch die Lagerleitung demonstrierte Gelassenheit. Der Tagesablauf im Pionierferienlager würde wie üblich seinen Gang nehmen. Einigen besorgten Eltern, die angerufen hatten, sei gesagt worden, es gäbe hier immer noch genug zu Essen, alle Teilnehmer des Durchgangs wären wohlauf, und auch das Wetter verspräche nun allmählich besser zu werden. Fröhliches Gelächter. Wegtreten zum Baden. Die heile Welt der Diktatur war wieder in Ordnung.
Ganz wie bei Umberto Ecos Romanfigur erfolgt die Schilderung der Wortwahl natürlich aus der Retrospektive. Was der Zehnjährige gedacht und empfunden hat, muss spekulativ bleiben.
Beim Blättern im »Neuen Deutschland« vom August 1961 fand ich nach einem halben Jahrhundert eine Erklärung für die Bemerkung des Lagerleiters. Vier Tage zuvor war der Oberbürgermeister von Groß-Berlin – wie sich der Ostsektor formell nannte – Friedrich Ebert zu einem Kurzbesuch im Ferienlager am Frauensee gewesen. Aus dem Artikel »Zu Gast bei Ferienkindern« erschließen sich einige Zusammenhänge. Das Zeltlager wurde vom Werk für Fernsehelektronik (WF) Berlin-Oberschönweide als Betriebsferienlager geführt. In den 103 Zelten verbrachten im zweiten Durchgang 687 Kinder mit ihren 209 Erziehern, Helfern und Betriebsangestellten ihre Ferientage. »Aber von den vielen Kindern sind längst nicht alle zu sehen«, berichtet das Zentralorgan. »In Arbeitsgruppen hat sie der Sonnenschein in die idyllische Umgebung gelockt.«5 Weiter schreibt das »Neue Deutschland«, dass sich im Zeltlager auch französische Kinder aus Paris befinden würden. »Es ist inzwischen Mittag geworden. An über 30 langen Tischen sitzen Kinder in dem modernen Speiseraum. Jedes hat eine lange Bratwurst auf dem Teller. Dazu gibt es Kartoffeln, Kraut und Obst. ›Werdet ihr alle satt, und schmeckt euch das Lageressen?‹, fragt der Oberbürgermeister. ›Ja‹ ist die Antwort. Und als sie hören, dass die West-Berliner Zeitung ›Der Tag‹ am Mittwoch geschrieben hat, ihr Lager am Frauensee sei wegen Versorgungsschwierigkeiten geschlossen worden, da lachen selbst die Kleinsten mit. ›Das ist ja wieder mal eine schöne Ente‹, ruft ein Mädel laut dazwischen.«6
Tatsächlich hatte »Der Tag« am 9. August 1961 unter der Überschrift »Zone schließt Ferienlager« gemeldet, dass einige Pionierlager in der Umgebung Berlins wegen »der mangelhaften Lebensmittelversorgung und der schlechten ärztlichen Betreuung« schließen würden.7 Die Zeitung berief sich auf den SPD-Pressedienst. Im Osten war man über jede Falschmeldung dieser Art hellauf begeistert und spießte sie als sogenannte Ente auf. Die RIAS-Ente war zur vielgebrauchten Propagandafloskel geworden. Der Begriff wandelte sich sogar von der Sachbezeichnung zur Personenbezeichnung. Wohl einige Monate nach den hochsommerlichen Ereignissen, jedenfalls mitten im Schuljahr, wurden wir angehalten, Kinder, deren Eltern sich zu unterschreiben geweigert hatten, keine Westsender zu empfangen, mit dem Sprechchor: »Rias-Enten … Rias-Enten!« förmlich aus der Schule zu jagen. Wenigstens wurde dies geduldet, oder noch vorsichtiger ausgedrückt, das Rudel handelte im Glauben einer wohlwollenden Duldung durch die Leitwölfe. Wieder stellt sich die Frage von Umberto Ecos fiktivem Alter Ego: Was hat der Zehnjährige dabei empfunden? Das wohlige Gefühl der Eintracht mit der Autorität, die Freude, Schwächere zu demütigen? Oder war irgendwo der Keim eines Widerspruchs gelegt?
Zurück ins Pionierlager am Frauensee: Auch die Erinnerung an den hohen Besuch aus Berlin ist, wenn er denn überhaupt in dieser Form stattgefunden hat, vollkommen verschwunden. Verdächtig scheint die Mitteilung, es hätte Kartoffeln gegeben. Tatsächlich war die Kartoffelkrise dramatisch, wovon noch die Rede sein wird. Allein die französischen Kinder sind mir im Gedächtnis geblieben. Es hieß, sie seien von der kommunistischen Kinderorganisation in die DDR zur Erholung geschickt worden. Die kleinen Franzosen, die wohl etwas älter als wir waren, wurden natürlich von allen deutschen Kindern angehimmelt. Einer von ihnen konnte auf der Gitarre klimpern und dazu Chansons singen. Ich hätte ihm so gerne etwas geschenkt und durchwühlte meine Habseligkeiten, bis ich irgendeine Winzigkeit fand. Ich überreichte sie ihm mangels französischer Sprachkenntnisse wortlos. Er lachte ebenso wortlos, aber freundlich, vielleicht in bisschen ironisch, dann hob er die geballte Faust zum kommunistischen Gruß. Diese Geste kannte der Zehnjährige nur aus Filmen. Sie war in der DDR vollkommen ungebräuchlich und hinterließ das Gefühl einer heimlichen Übereinstimmung mit einer großen und schönen Sache.
»Davon leben wir!«
Einige Tage nach dem 13. August 1961 wurde im Kinozelt des Ferienlagers der 1960 gedrehte DEFA-Spielfilm »Fünf Patronenhülsen« gezeigt. Während des Spanischen Bürgerkrieges schlägt sich ein Trupp versprengter Interbrigadisten hinter den Linien der Faschisten zu den eigenen Leuten durch. Sie haben den Befehl, eine wichtige Botschaft zu überbringen. Der Kommandeur hatte sterbend die Nachricht in fünf Teile zerrissen und auf fünf Patronenhülsen verteilt, die er mit einem kräftigen Biss verschloss. Jeder der Männer trägt nun einen Schnipsel der Botschaft mit sich. Die Gruppe wird von den Faschisten erbarmungslos gejagt. Die Franco-Söldner bewachen alle Wasserstellen. Von Hitze und Durst geplagt, eingekesselt und zur Übergabe aufgefordert, wirft den Interbrigadisten ein falangistischer Legionär einen Beutel mit Apfelsinen und anderen Köstlichkeiten über die Gefechtslinie. Dazu legen Sie einen Zettel, auf dem steht: »So leben wir. Seid nicht blöd! Kommt zu uns!« Doch die Helden der Internationalen Brigade lassen sich nicht korrumpieren. Sie stopfen ein Büschel trockenes Gras in den Beutel, schreiben auf den Zettel: »Davon leben wir. Trotzdem kommen wir nicht.« Dann schmeißen sie den Beutel zurück über die Linie. Der Film endet heroisch. Nachdem sich vier der Versprengten zu den republikanischen Truppen durchgeschlagen haben, fügt der Kommandeur die Fragmente des Zettels zusammen. Die Botschaft lautet: »Bleibt zusammen, dann werdet ihr leben.«
Am nächsten Tag fand die Auswertung des Films mit dem Geschichtslehrer statt. Dieser erklärte anhand der Szene, in der die Helden das Anerbieten des Feindes stolz ablehnen, dass der Kampf für den Frieden wichtiger sei als nahtlose Nylonstrümpfe, die tatsächlich damals nur im Westen zu bekommen waren. Genau wie die Spanienkämpfer würden auch unsere Grenzsoldaten Beutel mit Bananen und Apfelsinen über die Mauer zurückwerfen. Der Topos von der Versuchung ist aus der christlichen Hagiographie und Ikonographie als Temptatio wohlbekannt. So wie der Heilige Antonius gegenüber lockender Weiblichkeit, Schlemmerei, geistigem Hochmut und anderen Gaukeleien des Bösen standhaft bleibt, so warfen auch die Helden am Schutzwall Westzigaretten, Südfrüchte oder Süßigkeiten zurück. In einer Szene des 1967 gedrehten Episodenfilms der DEFA »Geschichten jener Nacht«, über den noch zu reden sein wird, gibt es eine solche Versuchungsszene. Ein West-Berliner Rowdy wirft den Männern der Kampfgruppe, die den Mauerbau beaufsichtigen, eine Schachtel Westzigaretten vor die Füße. So eine Packung Nato-Lullen – wie man damals sagte – war nicht zu verachten. Der Kommandeur der Kampfgruppeneinheit, der von Erwin Geschonneck verkörperte Große Willi, hebt die Zigaretten auf. Darauf verstummt der Krakeel der Achtgroschenjungen, wie die Ostpropaganda protestierende West-Berliner gern bezeichnete. Auch unter den Bauarbeitern und Kämpfern auf der östlichen Seite herrscht nun gespannte Aufmerksamkeit. Der Große Willi lässt sich einen Stein und eine Maurerkelle reichen, drückt die NATO-Lullen in den Mörtel, streicht mit seiner Kelle darüber und legt einen schweren Mauerstein darauf. Die Symbolik des Bildes will sagen: Die Mauer ist nicht aus Steinen erbaut, sondern aus hehren Idealen und großen Gefühlen.
Die Agenten, Schieber, Wechselstubenbesitzer und Grenzkinobetreiber hatten am 13. August 1961 eins auf die Pfoten bekommen. Gut so! Die Bonner Kriegstreiber und Frontstadthetzer, wie Konrad Adenauer, Franz Josef Strauß und Willy Brandt, die sich in den Karikaturen der Ostpresse kaum von Adolf Hitler und seinen Spießgesellen unterschieden, waren in ihre Grenzen gewiesen worden. Bravo! Nur wer sich von Comics, Schmökern und Wildwestfilmen den Kopf hat verdrehen lassen, konnte darüber jammern. Der Rückkehr der Junker und Konzernherren musste ein Riegel vorgeschoben werden.
So ähnlich hatte es wohl auch mein Vater erklärt. Einige Tage vor dem 13. August 1961 hatten wir an dem auf das Pflaster gemalten Strich am Brandenburger Tor gestanden. Der Autoverkehr flutete ungehindert durch das Tor, Spaziergänger nutzten den Sommertag zu einem Gang in den Tiergarten. Doch für einen pflichtbewussten Mitarbeiter des Zentralkomitees der SED und seine Familie galt der Grundsatz: Bis hierher und keinen Schritt weiter. Selbst die Fahrt mit der S-Bahn durch die Westsektoren nach Potsdam war den hauptamtlichen Parteimitarbeitern untersagt. Brav nahmen wir bei Familienausflügen nach Sanssouci den von Karlshorst um West-Berlin herumfahrenden »Sputnik«, der vor dem 13. August 1961 noch gähnend leer war. In den Köpfen der SED-Funktionäre spukte immer noch der Geist des illegalen Kampfes. Ihre Namen standen auf höhere Weisung nicht im Telefonbuch, und die Telefonnummer sollte nicht weitergegeben werden. Sogar den Kindern war eingeschärft worden, sie hätten sich am Telefon mit »Hallo« zu melden, nicht mit dem Familiennamen. Am Gartentor sollte kein Türschild sein, und ursprünglich war es sogar untersagt worden, an Staatsfeiertagen die Fahne aus dem Fenster zu hängen. Das allerdings führte zu Nachfragen der zuständigen Wohnparteiorganisationen der SED, die für die Beflaggung zuständig war. So wurde die widersinnige Weisung stillschweigend ignoriert. Der geistige Bürgerkrieg in Deutschland hatte im Alltag seltsame Auswirkungen.
Immer wieder im August
Sieben Jahre nach dem bewegten Sonntag im Pionierferienlager »M. I. Kalinin« schien sich das hochsommerliche Szenario zu wiederholen. Wieder lag ein schwüler und verregneter August über dem Land. Auch die Weltpolitik hatte sich nach den Turbulenzen der ersten Jahreshälfte scheinbar in die Sommerpause verabschiedet. Da wurde die Ferienidylle von dramatischen Rundfunkmeldungen zerrissen.
Mich weckte am Morgen des 21. August 1968 die Stimme des Nachrichtensprechers aus der Nachbarwohnung. Die Armeen des Warschauer Paktes waren in die Tschechoslowakei eingefallen. Die ersten Meldungen klangen verwirrend. Im DDR-Rundfunk wurde ein endloses Kommuniqué verlesen, in dem behauptet wurde, eine Gruppe tschechoslowakischer Kommunisten hätten die Bruderstaaten gegen die einheimische Konterrevolution zu Hilfe gerufen. In den Westsendern war die Rede von sowjetischen Panzern in Prag, von Schüssen vor dem Rundfunkgebäude, von Todesopfern und Aufrufen an die Bevölkerung, die Ruhe zu bewahren. Die Meldungen aus Ost und West erweckten den Eindruck, dass auch Kampfeinheiten der Nationalen Volksarmee auf dem Territorium der Tschechoslowakei operieren würden. Das war dreißig Jahre nach dem Münchener Abkommen für viele ältere Deutsche ein Schock.
Seit den Morgenstunden des 21. August 1968 hagelte es Proteste aus aller Welt. Es waren nicht die westlichen Staatsmänner, deren Wort in diesem Zusammenhang Gewicht hatte, obwohl auch sie irgendwann ihre Protestnoten einreichten. Von ihnen erwartete niemand etwas anderes als Krokodilstränen über das Scheitern des demokratischen Sozialismus. Auch die martialischen Sprüche aus Peking hatten einen eher exotischen Reiz. Es waren linke Persönlichkeiten, bekannte Schriftsteller aus Ost und West und vor allem die großen kommunistischen Parteien Europas, die sich von der Gewalttat des Sowjetblocks mehr oder weniger deutlich distanzierten. Die Fronten des Kalten Krieges waren gründlich durcheinandergeraten.
Auf der ganzen Welt hatte die Linke das tschechoslowakische Experiment begrüßt. Die orthodoxen Betonkommunisten waren in die Defensive geraten. Auch in der DDR hatten seit dem Januar 1968 viele Menschen die Entwicklungen sehr aufmerksam verfolgt, teils skeptisch, teils hoffnungsfroh. Es mag eine schweigende Mehrheit gegeben haben, die schon immer gewusst hatte, dass Sozialismus ohne Unterdrückung der Freiheit nicht möglich wäre. Doch diese Mehrheit schwieg so tief und konsequent, dass sie kaum noch wahrnehmbar war. Sie hatte sich innerlich aus der Geschichte verabschiedet und wartete nun auf bessere Zeiten.
Gerade unter jungen Menschen, Studenten und Intellektuellen überwog die Sympathie für die Prager Reformkommunisten. Diese Zustimmung war nicht unbedingt von großen Theorien gespeist, sondern weit mehr von einer elementaren Sehnsucht nach einem kleinen bisschen Luft zum Atmen. Endlich öffnete sich das Fenster wenigstens einen Spaltbreit, und es wehte ein leiser Hauch von Freiheit durch die Stickluft des Mauerstaates. Am 21. August 1968 wurde dieses Fenster zugeschlagen. An jenem Tag flossen viele Tränen. Immer wieder stößt man in Erzählungen auf diese einfache und schlichte Reaktion. Es war der Tag der Wut und Trauer über die Unbelehrbarkeit der Regierenden. Für viele war es auch ein Tag der Angst. Bei älteren Leuten wurden böse Erinnerungen wach, als sie die Sondermeldungen im Radio hörten. In der Küche stand meine Großmutter über das Abwaschbecken gebeugt und weinte still vor sich hin. »Immer wenn die Ernte vom Halm ist, gibt es Krieg«, schluchzte sie. Zweimal hatte sie es so erlebt, im August 1914 und im September 1939. Der 13. August 1961 war insofern präsent, als dass die Eltern damals überstürzt aus der Hohen Tatra zurückkehren mussten, um ihrer Partei in der Stunde der Gefahr zur Seite zu stehen. Auch am frühen Vormittag des 21. August 1968 waren sie bereits auf ihrem Posten. Doch in den folgenden Tagen offenbarte sich ein elementarer Unterschied. Angesichts der Sicherung der Staatsgrenze am 13. August 1961 herrschte eine finstere Entschlossenheit. Wollten sie die DDR retten – und das wollten sie –, war Härte angesagt. In der ewigen Klassenschlacht zwischen Proletariat und Bourgeoisie hatte es eine neue Runde gegeben, und das Proletariat hatte diesmal gesiegt. So einfach war das. Sieben Jahre später dominierte eine seltsame Trauer. Selbst wenn die militärische Intervention in der Tschechoslowakei als politische Notwendigkeit akzeptiert wurde, so wussten sie doch, dass der Gegner nicht der Imperialismus war, sondern ihr Unvermögen, einen menschlichen und wirtschaftlich erfolgreichen Sozialismus aufzubauen. Die Panzer rollten nicht gegen den Feind, sondern gegen die eigenen Ideale.
In Prag starb der Sozialismus
Das bleibende Grunderlebnis jenes Tages ist der groteske Widerspruch zwischen der inneren Aufgeregtheit und der äußeren Ruhe. Größere Menschenansammlungen gab es an diesem Tag nur an den Badestränden. Das Leben ging seinen Gang. Die Stadt lag träge im Dunst des schwülen Sommertages. Am Nachmittag zogen Gewitterwolken auf, und Regenschauer kündigten sich an. Einer jener riesigen Panoramabusse aus West-Berlin, die man während der Reisezeit stets sah, fuhr im Schritttempo durch das Stadtzentrum. Neugierige Touristen starrten durch die grünlich getönten Scheiben auf die matten Lebenszeichen im Ostsektor. Sicherlich hatten auch sie morgens in ihrem West-Berliner Hotel die Rundfunkmeldungen gehört. Doch warum sollten sie deswegen die bereits gebuchte Busfahrt durch die Hauptstadt der DDR absagen?
Auch in dem legendären »espresso« an der großen Kreuzung, die hier von der Prachtmeile Unter den Linden und der Friedrichstraße gebildet wurde, herrschte hochsommerliche Leere. Während des Semesters ging es in dem Kaffeehaus zu wie im Taubenschlag. Das Ambiente war eher einfach, das kulinarische Angebot selbst für DDR-Verhältnisse bescheiden, doch hier im Zigarettendunst war der Weltgeist zu Hause. Am Schnittpunkt aller Wege zwischen Humboldt-Universität, Staatsbibliothek, den Akademieinstituten und den großen Buchhandlungen gelegen, führte kaum ein Weg an der Kaffeestube vorbei. Wie man Jahrzehnte später in den Akten lesen konnte, beobachtete auch die Stasi das »Objekt Linde« genau. Sehr gern führten die Kämpfer an der unsichtbaren Front hier ihre konspirativen Treffen mit Inoffiziellen Mitarbeitern durch. Vielleicht verlieh das ihrer Tätigkeit das Flair von Agentenfilmen. Auch Westbesucher aus der linken Szene kamen gern hierher, um zufällig oder gezielt Gesprächspartner zu treffen. Sie erzählten mit leuchtenden Augen von ihrer Revolte gegen das Establishment. Einige hatten sogar im Pariser Quartier Latin auf der Barrikade gestanden. Sie wirkten wie Kinder, die aufgeregt von ihren Erlebnissen auf dem Spielplatz erzählten. Allein die grünen Parkas, die verwaschenen Bluejeans, die langen Haare und die kreisrunden Nickelbrillen, der gnadenlos intellektuelle Sprachgestus, die vielen unverständlichen Wörter, die Respektlosigkeit gegenüber allen Autoritäten – all das reichte, um die Gäste aus dem fremden Sonnensystem mit einer Aura von Weltläufigkeit zu umhüllen. Von der DDR hielten sie genau wie wir nicht viel. Doch erklärten sie uns oft: »Historisch gesehen, seid ihr schon einen Schritt weiter. Ihr müsst weiter vorangehen und eine neue Gesellschaft aufbauen, ohne ökonomische Zwänge und Ausbeutung, demokratisch, menschlich, freiheitlich. Dann haben die Reaktionäre auch bei uns verspielt.« Ich weiß noch, dass ich es damals versprochen habe. Heimlich dachte ich: »Eines Tages werden wir euch die Show stehlen. Die eigentliche Schlacht wird im Osten geschlagen werden – in Prag, Budapest, Warschau und eben bei uns.« Es gibt die Auffassung, ohne die Pariser Kaffeehäuser hätte die Französische Revolution niemals stattgefunden. Das mag übertrieben sein, doch sicher überliefert ist, dass am 14. Juli 1789 der bekannte Redakteur Camille Desmoulins auf einen Tisch eines Cafés kletterte und mit pathetischen Worten zu den Waffen rief. Einige Stunden später fiel die Bastille. So hat sich das der Siebzehnjährige auch für das »espresso« vorgestellt.
Am späten Vormittag des 21. August 1968 hatte sich niemand von den westlichen Revolutionshelden hierhin verirrt. Sicherlich waren sie noch in den Semesterferien, irgendwo zwischen Portugal und Griechenland oder sonst wo auf der Welt. Im Kaffeehaus war nicht viel los. Der Lyriker Hermann K. saß einsam und traurig an einem der Tische. Sonst war er von nicht zu bremsender Sprachgewalt. Oft saß er hier umgeben von Jüngern, die den Berichten lauschten, wie die Stasi die Veröffentlichung seiner philosophischen und literarischen Werke hintertrieben hat. Seine Schmähreden gegen Partei und Staat glichen elementaren Naturereignissen. An jenem Tag war er still und in sich gekehrt. »Aus Trauer um den Sozialismus trinke ich heute meinen Kaffee schwarz«, meinte er melancholisch und rührte verzweifelt in der trüben Brühe, die hier als Kaffee ausgeschenkt wurde. Nichts wäre ihm so abwegig erschienen wie der Gedanke, irgendwo Protest anzumelden, Briefe an die Obrigkeit zu schreiben oder Zettel zu verteilen. Den Glauben an irgendeine Veränderung der Verhältnisse hatte er längst aufgegeben.
So zog der Siebzehnjährige weiter durch die sommerlich träge Stadt. In den Hinterhöfen des Prenzlauer Bergs hatte sich die stickige Schwüle verfangen. Misstrauisch schauten die alten Leute, die hier wie jeden Tag am Fensterbrett lehnten, dem fremden Besucher hinterher. Waren vor mir schon andere Besucher da gewesen? Hatten jene allgemein bekannten auffällig-unauffälligen jungen Männer hier bereits vor der Haustür gestanden, um das Kommen und Gehen zu registrieren? Die Wohnungstüren waren verschlossen. Die Vögelchen waren schon ausgeflogen. Einige meiner Bekannten sind in der folgenden Nacht von der Stasi verhaftet worden. Sie hatten mit bunten Filzstiften Parolen auf Zettel geschrieben und diese in Hausbriefkästen geworfen. Auf den Blättern aus den kleinkarierten Rechenblocks, die vorher im Schreibwarenladen gekauft worden waren, stand: »Helft dem roten Prag!« oder »In Prag ist Pariser Kommune«. Mit solchen Losungen wollten sie die Massen aufrütteln. Die Stasi hatte schon an der nächsten Ecke gestanden, um die Straftäter festzunehmen. Die Aktionen passten ihr gut ins Konzept. Sie zeigten, dass auch in der DDR eine »schleichende Konterrevolution« gedroht hatte. Es folgten Gefängnisstrafen, Ausschlüsse von Oberschulen und Universitäten, Abbrüche beruflicher Laufbahnen.
Jener Geschichtslehrer, der nach dem 13. August 1961 das Konsumdenken der westlichen Gesellschaft so verdammenswert fand, dass er allen Zweifeln zum Trotz dem Osten die Treue hielt, versuchte just an jenem welthistorischen 21. August 1968 über die Tschechoslowakei nach Österreich zu entkommen. Ein österreichischer Trucker versteckte ihn unter der Motorhaube seines Lasters. Dort wurde er mit schweren Verbrennungen hervorgezogen, von Freunden heimlich in ein Krankenhaus gebracht und operiert. Doch die Aktion war von Spitzeln des MfS verraten worden. Als er in die DDR zurückkehrte, wurde er verhaftet, zu einer Gefängnisstrafe verurteilt und später vom Westen freigekauft.
Es gibt Tage, über denen scheint ein Fluch zu liegen. Was man an diesem Tag tut, ist man verdammt, ein Leben lang zu tun. So wie die Seeleute auf Wilhelm Hauffs Gespensterschiff, die verflucht waren, jede Nacht von neuem zu meutern und ihren Capitano an den Mastbaum zu binden, um anschließend mit wildem Geheul als Unglücksboten die wilde See zu durchmessen.
Wer an diesem Tage allein war, sollte es lange bleiben, wie es in Rainer Maria Rilkes Gedicht »Herbsttag« heißt. Wer an diesem Tag feige war, sollte es ein Leben lang sein. Wer damals beschloss, auf bessere Zeiten zu warten, musste lange warten. Wer sich an diesem Tag in stille Betrachtung zurückzog, sollte lange so verharren. »Warten, lesen, lange Briefe schreiben«, wie es bei Rilke heißt. Wer an diesem Tag die Konfrontation mit der übermächtigen Staatsmacht wagte, fand nur selten den Weg zurück in die Anpassung. Ein Abgrund tat sich auf, der sich nie wieder schließen sollte. Ein nicht enden wollender Herbsttag begann damals.
Das sowjetische System hatte durch den Einsatz seiner Panzerdivisionen bewiesen, wie erbärmlich schwach es war. Die Invasion im August 1968 zeigte seine Unfähigkeit zur inneren Wandlung. Gerade junge Menschen haben das damals intuitiv mit großer Klarheit gesehen. So wurde dieser 21. August 1968 zu einem historischen Wendepunkt, dessen Bedeutung weit über den unmittelbaren Anlass hinausging. In Prag starb an diesem Tag der Sozialismus als Utopie, und es wurde der »real existierende Sozialismus« geboren. Jener seltsam resignative und defensive Terminus begleitete die nächsten einundzwanzig Jahre der DDR. Es führte kein Weg mehr zurück zu den emanzipatorischen und freiheitlichen Wurzeln der kommunistischen Idee.
Auch in den Medien der DDR – sieht man von Karl-Eduard von Schnitzlers Sondersendungen ab – dominierte nicht jener triumphierende und aggressive Machtrausch von 1961, sondern eher Verunsicherung und Orientierungslosigkeit. Zwar wurde versucht, in ganzseitigen Artikeln den Bonner Revanchisten und speziell den Sozialdemokraten die Schuld an der Konterrevolution in die Schuhe zu schieben, über die internen Vorgänge in der Tschechoslowakei aber herrschte tagelang betretenes Schweigen. Die Polemik war ohne Biss und vor allem fast immer anonym, wusste doch niemand zu sagen, welche Persönlichkeit an der Spitze der tschechoslowakischen Kommunistischen Partei Agent des Imperialismus war und wer bald schon als treuer Freund der Sowjetunion mit Bruderküssen bedacht über rote Teppiche schreiten würde.
Die kleinen Hexenjäger, Spitzel und Denunzianten aus dem Reich der niederen Dämonen taten sich zwar eifrig hervor, viele der »alten Genossen« aber zogen sorgenvolle Gesichter und bekannten sich wenigstens im kleineren Kreis zu ihren Zweifeln. Sie hatten ihren Sozialismus und ihren Staat in dem Glauben verteidigt, dass eines Tages, wenn die Anfangsschwierigkeiten überwunden wären, in der DDR der wahre Sozialismus aufzurichten wäre, vielleicht in ganz Deutschland oder sogar in der ganzen Welt. Der tschechische Schriftsteller Pavel Kohout, einer der intellektuellen Vertreter des Prager Frühlings, begründet in seinen späten Erinnerungen, warum er Anfang der fünfziger Jahre nach dem Verlust aller Illusionen Mitglied der Kommunistischen Partei geblieben ist: Er »und seine nahen Freunde bestärkten sich wie Tausende von Gesinnungsgenossen gegenseitig in der Annahme, dass man in diesem gespaltenen, aber immer noch mächtigen Verein bleiben und für ihn gemeinsam eine Grundlage schaffen müsse, wenn man einen gangbaren Weg aus der historischen Falle finden wollte. Ein Ausstieg hätte damals bedeutet, dass gerade die ihre Positionen räumen würden, die die ganze Gesellschaft von dem Maulkorb und der Leine des Totalitarismus befreien wollten und auch konnten. Zu bleiben erforderte natürlich auch, sich taktisch zu verhalten. Es ist schön, Liebe und Wahrheit zu predigen, sollten die jedoch je Hass und Lüge besiegen – das wissen alle, die es probiert haben! –, geht es nicht ohne Zugeständnisse und Geduld. Es graute ihnen vor den steigenden Zahlen der Toten von Berlin über Posen bis nach Budapest. Und eine Warnung war auch das Resultat der unterdrückten Widerstandsversuche, das überall gleich war: der Terror ultrakonservativer Kräfte. In der Tschechoslowakei, die erst anfing, sich aus deren Umklammerung herauszumanövrieren, durften sie keinen Vorwand bekommen, der sie wie in Ungarn berechtigt hätte, sowjetische Hilfe einzuholen!«8
In diesen und ähnlichen Worten wurde das Credo des klugen Abwartens und des stillen Wirkens auch in der DDR oft formuliert. Doch damit war nun Schluss. Aus dem Noch-nicht war über Nacht ein Nichtmehr geworden. Pavel Kohout und seine Gesinnungsgenossen, wie er sie selbst nennt, haben nach 1968 die Konsequenzen gezogen und einen hohen Preis bezahlt. In der DDR krochen die demokratischen Kommunisten zurück in ihre Deckung und entdeckten ihre freiheitlichen Ideen erst wieder, als eigentlich schon alles vorbei war.
In der historischen Perspektive rücken die beiden Ereignisse, der Mauerbau und die Invasion in die Tschechoslowakei, dicht zusammen. Doch psychologisch war der Unterschied riesengroß. Was war in den sieben Jahren zwischen dem Mauerbau und dem Ende des Prager Frühlings geschehen?
Die wilden Sechziger
Die sechziger Jahre waren in der ganzen Welt eine Zeit rasanten Fortschritts, großer Zukunftsentwürfe und turbulenter kultureller Wandlungen. Überall begann eine neue Generation die großen Verheißungen einzufordern, wie sie John F. Kennedy in seiner Antrittsrede am 20. Januar 1960 formuliert hatte. Zunehmend stießen sich junge Amerikaner an dem Missverhältnis zwischen deklarierten Menschenrechten und der Realität des Rassenkonflikts in den Südstaaten. Der Vietnamkrieg wurde zum Fanal einer neuen Generation, die auf der ganzen Welt in unterschiedlicher Form ihren Widerspruch gegen die Welt der Väter artikulierte.
Der Begriff Revolution hatte Hochkonjunktur, obwohl weder in der westlichen noch in der östlichen Hemisphäre eine wirkliche Revolution stattfand. Es gab die sexuelle Revolution, die wissenschaftlich-technische Revolution, die Kulturrevolution, die Medienrevolution. In die Weltgeschichte wurden nachvollziehend zahlreiche Revolutionen projiziert. Das begann mit der neolithischen Revolution, in der jungsteinzeitliche Jäger und Sammler sesshaft wurden, setzte sich fort mit der Leserevolution des 18. Jahrhunderts, und es endete mit der industriellen Revolution des beginnenden 19. Jahrhunderts. Ohne das Schlagwort von irgendeiner Revolution zu bedienen, durfte sich kein Sozialwissenschaftler mehr an die Öffentlichkeit wagen. Vor allem aber wurde vielerorts Revolution gespielt. Rudi Dutschke und seine Genossen wollten West-Berlin zur Räterepublik machen, die zum Zentrum der Weltrevolution werden sollte. War das eine »Spaßrevolution« oder ein gefährlicher Angriff auf die Demokratie? Sie holten die Symbole der Revolution aus dem Geschichtsarsenal, schmückten sich mit roten Fahnen, Sowjetsternen und den Bildnissen der Revolutionäre der Weltgeschichte. Revolution wurde zum Popphänomen.
Allerdings distanzierten sich die Beatles in ihrem Song »Revolution« im Herbst 1968 deutlich von der revolutionären Gewalt »We all want to change the world / But when you talk about destruction / Don’t you know that you can count me out« – ein ungewöhnlich klares politisches Bekenntnis für eine Beatgruppe. »But if you go carrying pictures of chairman Mao / You ain’t going to make it with anyone anyhow.« Vier Jahre später sang John Lennon »Power to the people«, mit einem Text, der – wenn man ihn denn ernst nehmen wollte – kaum mehr als die ständig wiederholte rhythmische Parole enthielt.
In der DDR war Revolution eine abstrakte geschichtliche Kategorie. Man hatte alle geschichtlich notwendigen Revolutionen hinter sich gebracht. Und für die Revolutionen im Westen waren allein die kommunistischen Parteien zuständig und keineswegs radikale Revoluzzer, anarchistische Bohemiens und Studenten. So gerne die Theoretiker des DDR-Sozialismus über die Revolution philosophierten und immer noch neue erfanden, wie die frühbürgerliche Revolution des 16. Jahrhunderts oder die antifaschistisch-demokratische Revolution von 1945, so suspekt war ihnen der revolutionäre Gestus der westlichen Linksradikalen. Sie nannten ihn pseudorevolutionär, und schnell waren sie mit dem Lenin-Wort vom »Linksradikalismus als der Kinderkrankheit des Kommunismus« bei der Hand. Vor allem war die Konterrevolution allgegenwärtig. Angesichts der Reformbemühungen in der Tschechoslowakei erfanden die SED-Propagandisten das Wort von der »schleichenden Konterrevolution«.
Wo verliefen bei all den Revolutionen und Konterrevolutionen damals die Fronten? Hatte die Aufbruchsstimmung der Jugend viel zu tun mit den systemimmanenten Modernisierungsversuchen in den Ländern des Sowjetblocks? Die sowjetische Parteiführung verkündete seit 1961 den friedlichen Wettstreit der Systeme, trompetete Zukunftsvisionen in die Welt und berauschte sich an den Erfolgen bei der Eroberung des Kosmos. Die DDR, eingeklemmt zwischen dem Aufbruch der Jugend im Westen und den Reformanstrengungen im Osten, geriet ins Spannungsfeld dieser Konflikte. Wenn die Epizentren dieser tektonischen Beben auch außerhalb des Landes lagen, so waren die seismischen Störungen doch deutlich zu spüren.
Eine neue Generation war herangewachsen, die höhere Ansprüche an die Gesellschaft stellte. Und der Führung war klar, dass dies alles nicht möglich sein würde ohne ein Aufbrechen der erstarrten Strukturen. Viele junge Menschen maßen die Realität an den großen Worten, mit denen sie aufgewachsen waren. Der utopische Zeitgeist, der in der ganzen Welt junge Leute auf die Straße trieb, war als zarter Hauch selbst in dem Land hinter der Mauer spürbar. Es waren nicht die Schlechtesten, die meinten, man müsse die Partei beim Worte nehmen. Wolf Biermann schrieb damals in seinem Lied: »Warte nicht auf bessre Zeiten«: »Und das beste Mittel gegen / Sozialismus, sag ich laut, ist, dass ihr den Sozialismus / Aufbaut! Aufbaut! Aufbaut!«9
Es war eine Zeit des Glaubens an die Wissenschaft. Und doch herrschte eine vorwissenschaftliche Theorie mit pseudoreligiösen Zügen. Hochschul- und Akademiereform rollten erbarmungslos über die Einrichtungen der DDR hinweg, und unter dem Vorwand, alte Zöpfe abzuschneiden, wurde viel traditionell Bewährtes durch modischen Schnickschnack ersetzt. Die Arbeiterklasse und deren vorgebliche Kultur waren Maßstab aller Dinge, aber es machte sich in den Gesellschaftswissenschaften ein unverständlicher Soziologenjargon breit. Es war die Zeit der großen Worte und der kleinen Abkürzungen. Neue Begriffe schwirrten inflationär durch die Debatten der Zeit. Die Parteiführung erklärte die junge Generation zu den »Hausherren von morgen«, doch das Land wurde von dem Greis Walter Ulbricht regiert, der am 30. Juni 1968 seinen fünfundsiebzigsten Geburtstag wie einen Staatsfeiertag zelebrieren ließ. Statt der Jugend Vertrauen zu schenken, wurde sie in kleinlichster Weise reglementiert. Pessimismus und Skeptizismus galten als dekadent, also als Verbrechen gegen die wahre Lehre. Haartracht und Rocklänge, Lesestoff und Musikgeschmack, Kunst und Literatur und möglichst noch das Liebesleben wurden von der Partei vorgeschrieben. Die Partei schuf sich selbst ihre Feinde, die sie dann mit viel Aufwand bekämpfte. Am 9. April 1968 wurde über eine Verfassung abgestimmt, die auch das Grundrecht auf freie Meinungsäußerung garantierte. Doch Bürger, die sich gegen die neue Verfassung aussprachen, wurden verhaftet und wegen staatsfeindlicher Hetze eingesperrt. Der Konflikt zwischen Freiheit und Diktatur wurde seitens des Staates mit den Mitteln geheimpolizeilicher Überwachung und politischer Strafjustiz ausgetragen. Konnte man unter diesen Bedingungen von einer Öffnung des Systems, gar von einer Liberalisierung sprechen, wie es auch westliche Beobachter taten? Ging es nicht allein um eine effizienter gestaltete Parteidiktatur? In der Tschechoslowakei war seit dem Januar 1968 die sozialistische Reformbewegung zur nationalen Freiheitsbewegung geworden. Erst die Panzer des Warschauer Paktes konnten dieser Entwicklung Einhalt gebieten. Die Vision eines Sozialismus mit menschlichem Antlitz war unter den Ketten der Sowjetpanzer zermalmt worden. War die DDR tatsächlich auf diesem Weg gewesen, wie später die parteiinternen Kritiker von Ulbricht behaupteten, als sie in Moskau dessen Sturz betrieben? Hatte es jemals eine Chance gegeben, den Sozialismus sowjetischer Provenienz zu modernisieren und zu demokratisieren? Waren diese Versuche nicht lediglich eine Variante der totalen Herrschaft der Partei? Die heutige Analyse lässt sich nicht einfach in die Zeit zurück projizieren. Jede Epoche ist unmittelbar zu Gott, meinte Leopold von Ranke, der Altmeister der deutschen Geschichtswissenschaft. Moderner ausgedrückt könnte man sagen, jede Zeit ist in sich selbst autonom. Sie sollte nicht vom Ergebnis her bewertet werden, sondern aus der Perspektive der Zeitgenossen, als die Geschichte ihrer Hoffnungen, Träume und Ängste von damals, als Geschichte der Menschen. »Die Geschichtsschreibung ist mit der Geschichte der Gesellschaft, nicht mit der Geschichte des Menschen befasst«, schrieb der tschechische Romancier Milan Kundera in seinem Essay »Die Kunst des Romans«. »Deshalb werden die historischen Ereignisse, die in meinen Romanen vorkommen, von den Geschichtsschreibern oft übersehen.«10 Wie soll man die Lebenswirklichkeit in die Geschichtsdarstellung zurückholen? Wie soll man den schmalen Grat zwischen subjektiver Erinnerung und historischen Abläufen wahren?
Das parallaktische Prinzip oder warum der Mond immer mitkommt
Es mag zehn Jahre oder etwas länger her sein. Während einer nächtlichen Zugfahrt betrachtete unsere kleine Tochter die vor dem Abteilfenster vorüberziehenden Lichter. Plötzlich stellte sie eine verblüffende Frage: »Warum kommt denn der Mond immer mit?«
Es war in der Tat ein beeindruckendes Bild. Ein kugelrunder, sattgelber Mond raste mit affenartiger Geschwindigkeit durch die kahlen Äste der Bäume, huschte leichtfüßig zwischen den Signallichtern und Stellwerken hindurch, verschwand für Bruchteile von Sekunden hinter einer Böschung oder einer Brücke – doch tauchte er immer in gleicher Höhe wieder auf und grinste böse in das Zugabteil.
»Das hängt mit der Entfernung zusammen«, versuchte ich zu erklären. »Die Bäume am Bahndamm rasen so schnell vorbei, weil sie so nah sind, die Lichter am Horizont ziehen etwas langsam vorbei, der Mond ist so weit weg, dass er fast stillsteht. Das nennt man Parallaxe«, fügte ich hinzu, ohne damit zur Erhellung des Problems beizutragen.
Ich verhedderte mich in den schwierigen Erläuterungen, und das Kind begann ungeduldig zu werden: »Warum fliegt der Mond denn nun durch die Bäume?« Mir fiel in meiner Not ein einfaches Experiment ein. »Man muss konzentriert auf die eigene Nasenspitze schauen und dann im schnellen Wechsel jeweils ein Auge zukneifen. Linkes Auge zu … rechtes Auge zu … linkes Auge zu. Die Nasenspitze springt im schnellen Wechsel durch das Blickfeld, weiter entfernte Punkte dagegen bleiben unbeweglich stehen. Das ist das parallaktische Prinzip. Nach diesem Prinzip lässt sich die Entfernung zu den Sternen und zum Mond errechnen«, erklärte ich und erntete nun die Begeisterung unserer Tochter. Bis ihr schwindlig wurde berechnete sie intensiv die Entfernung zum Mond, legte schließlich ermüdet fest, er sei »Mijonen« weg und wandte sich anderen Dingen zu. Ich notierte mir das Stichwort Parallaxe, um es in der noch aus Schülertagen stammenden »Kleinen Enzyklopädie Mathematik« nachzuschlagen. Dort fanden sich die nötigen Definitionen. Bewegt sich der Standpunkt eines Beobachters durch den Raum, dreht sich das Gesichtsfeld. Es verändert sich also der Beobachtungswinkel. Wenn hinter dem Beobachtungsobjekt in weiter Ferne ein Hintergrund liegt, so hat es den Anschein, als rücke das Objekt auf demselben fort, und zwar in entgegengesetzter Richtung zur Bewegung des Betrachters. Diese scheinbare Bewegung ist umso stärker, je näher das Beobachtungsobjekt liegt. Umgekehrt gesagt: Je weiter ein Objekt vom Beobachter entfernt ist, desto geringer ist seine scheinbare Bewegung.
Überträgt man das Prinzip der Parallaxe auf die Zeit, so heißt das, je ferner ein Ereignis zurückliegt, desto subjektiv näher, wichtiger und unveränderlicher wird es im Vergleich zu der flüchtig vorüberhuschenden Gegenwart. Die Vergangenheit wird mit wachsendem Abstand nicht unwichtiger oder unwirklicher, sondern sie gewinnt an Wichtigkeit und Wirklichkeit. Die flüchtigen Punkte am Bahndamm der Gegenwart, die ferner liegenden Landschaften und die immer mit uns ziehenden Himmelspunkte bilden ein unauflösbares Amalgam.
Wir wissen seit Heraklit, dass wir nicht zweimal in denselben Fluss steigen können, denn alles fließt. Noch mehr trifft das für eine Reise in die Vergangenheit zu. Die Bilder des inneren Archivs ändern sich bei jedem Zugriff. Vergessen ist nicht das Gegenteil, sondern eine Form der Erinnerung. Es sind zwei Seiten einer dialektischen Einheit. Wie die Zugfahrt durch die flimmernden Lichter der Nacht wird die Zeitreise zu einer Irrfahrt durch ein Labyrinth kryptischer Zeichensysteme, mit denen wir unseren Standort zu bestimmen suchen. So müssen wir die Geheimschrift der Dokumente, der Bilder, die Assoziationen jedes Mal von Neuem entziffern. Geschichte wird so zu einer verwirrenden Form der Zeichendeutung.
Es gibt auf dieser Fahrt keinen Streckenplan und kein Kursbuch. Selbst die Richtung der Fahrt bleibt dialektisch doppeldeutig. Die Fahrt im Schnellzug der Zeit geht von der Gegenwart zurück in die Vergangenheit, die Geschichte aber läuft der Zukunft entgegen. So mischen sich Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft. Vor allem aber mischt sich beim Blick aus dem nächtlichen Fenster das eigene schwarz konturierte Spiegelbild mit der vorbeiziehenden Landschaft. Wie der scheinbar stillstehende Mond begleitet es die Reise in die Vergangenheit.
Erster Teil Zerrissene Zeit
Berlin vor dem Mauerbau
Ideologische Frontlinien
In den Schulstuben der DDR hingen in den frühen sechziger Jahren Weltkarten, auf denen der unaufhaltsame Siegeszug des Sozialismus dargestellt war. Das sozialistische Lager einschließlich der Volksrepublik China war tiefrot eingefärbt. Die rote Fläche vom Gelben Meer bis Marienborn hatte die Form eines Panthers im Sprung, der seine Schnauze gegen Westeuropa streckte, um den kleinen Wurmfortsatz der eurasischen Landmasse demnächst zu verschlingen. Dazu schwamm seit Beginn der sechziger Jahre das sozialistische Kuba wie ein kleiner roter Fisch im gigantischen Haifischmaul des Golfs von Mexiko. Ein Drittel der Menschheit lebte bereits im Sozialismus, wie immer wieder triumphierend verkündet wurde, und der weltrevolutionäre Prozess würde eines Tages auch das reaktionäre Regime Konrad Adenauers in Bonn hinwegfegen, auch wenn es zur Zeit noch nicht danach aussehe.
Die Märchenwelt der kommunistischen Propaganda war fein säuberlich in Gut und Böse geteilt. Auf den Plakaten und in den täglich erscheinenden Karikaturen trugen die Imperialisten Zylinderhüte und gestreifte Hosen. Sie saßen mit langen Hakennasen auf Geldsäcken mit dem Dollarzeichen oder wateten im Blut der unterdrückten Völker. Die Bonner Ultras als besonders verabscheuungswürdige Spezies trugen Stahlhelme der Nazi-Wehrmacht und waren durch Hakenkreuze und SS-Runen kenntlich gemacht. Sie dürsteten nach Revanche für den verlorenen Krieg und streckten ihre spinnenartig dürren Finger gen Osten aus. In der Sprache der Agitation ausgedrückt, gab es zwischen der faschistischen Diktatur und der scheindemokratischen Spielart des staatsmonopolistischen Imperialismus nur einen taktischen Unterschied. Die politische Macht lag in den Händen des gleichen Monopolkapitals, das Hitler in den Sattel gehoben hatte und nun mit Unterstützung der verräterischen Sozialdemokratie regierte. Eine der vergessenen Kuriositäten der deutsch-deutschen Propagandaschlacht bestand darin, dass man der »SP« aufgrund ihres »nationalen Verrates« das »D« im Parteinamen aberkannt hatte. Immerhin wurde eingeräumt, dass die westdeutsche Arbeiterklasse teilweise der Sozialdemagogie erlegen sei und die siegreichen Schlachten zur Befreiung des Proletariats noch auf sich warten ließen.
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!