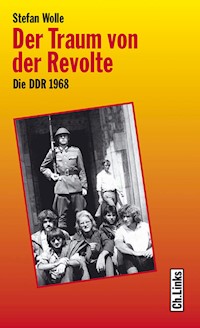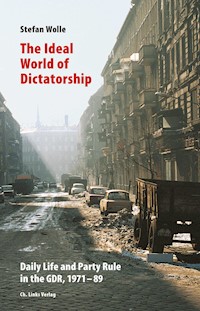12,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 12,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 12,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Ch. Links Verlag
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Deutsch
Die Hauptstadt der DDR existiert nur noch in der Erinnerung und ist doch überall im heutigen Berlin präsent. An jeder Ecke lauern Bilder und geheimnisvolle Zeichen, die wie übertünchte Inschriften an Häuserwänden immer wieder durchschlagen. Stefan Wolle, der die meiste Zeit seines Lebens in Berlin gelebt und gearbeitet hat, flaniert durch Zeit und Raum und besucht zentrale Orte: den Alexanderplatz, die Straße Unter den Linden und das Brandenburger Tor, die Machtzentren der SED ebenso wie die Treffpunkte der Subkultur. Den Hintergrund für die Biografie der Stadt bilden historische Ereignisse von der Kapitulation der Wehrmacht im Jahr 1945 bis zur Friedlichen Revolution 1989. Der Autor beschreibt das Alltagsleben, den Einkauf, Ausflüge am Wochenende und die Wohnungssuche. Zitate aus Akten, literarischen Werken und Songtexten komponiert er zu einem vielstimmigen Chor.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 313
Veröffentlichungsjahr: 2020
Ähnliche
Stefan Wolle
OST-BERLIN
Biografie einer Hauptstadt
Ch. Links Verlag
Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen Nationalbibliografie; detaillierte bibliografische Angaben sind im Internet über www.dnb.de abrufbar.
1. Auflage, März 2020,
entspricht der 1. Druckauflage vom März 2020
© Christoph Links Verlag GmbH
Prinzenstraße 85 D, 10969 Berlin, Tel.: (030) 44 02 32-0
www.christoph-links-verlag.de; [email protected]
Lektorat: Jana Fröbel, Ch. Links Verlag
Umschlaggestaltung: Nadja Caspar, Ch. Links Verlag, unter Verwendung eines Fotos von Harald Hauswald: Teenager am Brunnen der Völkerfreundschaft auf dem Berliner Alexanderplatz, 1983 (Harald Hauswald/OSTKREUZ)
Satz: Agentur Marina Siegemund, Berlin
ISBN 978-3-96289-084-1
eISBN 978-3-86284-477-7
Inhalt
Prolog
Der Riesenwal Goliath oder Die Kunst des Verirrens
Erster Teil
Der sowjetische Sektor von Berlin 1945 bis 1949
Erstes Kapitel: Kriegsende und Teilung
Zweites Kapitel: Neubeginn
Drittes Kapitel: Heimkehr in die Fremde
Viertes Kapitel: Der Kampf um Berlin
Zweiter Teil
Der Demokratische Sektor von Groß-Berlin 1949 bis 1961
Erstes Kapitel: Staatsgründung
Zweites Kapitel: Die Stalinallee
Drittes Kapitel: 17. Juni 1953
Viertes Kapitel: Alltag in der Viersektorenstadt
Fünftes Kapitel: Mauerbau
Dritter Teil
Metropole des Sozialismus 1962 bis 1970
Erstes Kapitel: Nach dem Mauerbau
Zweites Kapitel: Das sozialistische Stadtzentrum
Drittes Kapitel: Jugendkultur
Viertes Kapitel: XX. Jahrestag der DDR
Vierter Teil
Die Hauptstadt 1971 bis 1986
Erstes Kapitel: Internationale Anerkennung
Zweites Kapitel: Weltfestspiele
Drittes Kapitel: Palast der Republik
Viertes Kapitel: Leben in Berlin
Fünfter Teil
Das Ende von Ost-Berlin 1987 bis 1990
Erstes Kapitel: Stabilität und Krise
Zweites Kapitel: Opposition und Kirche
Drittes Kapitel: Rockmusik und Freiheit
Viertes Kapitel: Herbstrevolution
Fünftes Kapitel: Mauerfall
EpilogSilvester auf dem Mont Klamott
Anhang
Anmerkungen
Abkürzungen
Personenregister
Bildnachweis
Der Autor
Prolog
Der Riesenwal Goliath oder Die Kunst des Verirrens
Ein neuer Doppelstockbus der BVG während der Probefahrt am Marx-Engels-Platz, im Hintergrund der Berliner Dom, Februar 1955
Allein in Berlin
Eine winzige Zeitungsnotiz ließ ein fast vergessenes Erlebnis aus dem Nebelmeer meiner Erinnerungen auftauchen. Das Auftauchen darf man in diesem Fall wörtlich nehmen, denn es geht um einen Wal – genauer gesagt, um den Riesenwal Goliath. Der präparierte Meeressäuger reiste damals als eine Art Jahrmarktsattraktion durch Europa. Weder das Jahr noch den genauen Ort seiner öffentlichen Schaustellung hätte ich benennen können, wohl nicht einmal den Namen Goliath, den die geschäftstüchtigen Eigentümer ihm verliehen hatten.
Doch die kleine Meldung aus dem Neuen Deutschland vom 17. November 1962 vermochte, Ort und Zeitpunkt zu präzisieren. Auf der Berlinseite des Zentralorgans der SED war in der Rubrik Kurznachrichten zu lesen: »RIESENWAL. Zur Besichtigung für die Hauptstädter gab Tierparkprofessor Dr. Dathe am Freitag auf dem Parkplatz Friedrich-, Ecke Reinhardtstraße einen 22 Meter langen Riesenwal Goliath frei. Goliath wurde 1954 gefangen und präpariert. Sein Lebendgewicht betrug 68 Tonnen. Bisher hat er schon viele Länder Europas besucht und kam direkt aus Sofija nach Berlin.«1
An den Berliner Litfaßsäulen hing damals sogar ein Plakat. Darauf war ein Wal zu sehen, der stolz einen Wasserstrahl in die Höhe spritzt. Dazu hieß es: »Die Attraktion Berlins – Riesenwal Goliath«. Es mag sein, dass dieses Plakat auch in unserem Vorort am östlichen Rand Berlins angeschlagen war. Jedenfalls beschloss die Gruppe »Junge Naturforscher«, sich die Sensation auf keinen Fall entgehen zu lassen. Mit unserem Biologielehrer verabredeten wir Tag und Stunde, um eine Exkursion ins Stadtzentrum zu starten. Aus irgendeinem Grund versäumte ich die gemeinsame Abfahrt, nahm eine S-Bahn später und erreichte nach etwa einstündiger Fahrt den Bahnhof Friedrichstraße. Dort stieg ich zwar in den richtigen Bus der Linie A 57, nahm aber die falsche Richtung. Schon als der Doppelstockbus an der damals noch unbebauten Kreuzung Friedrichstraße / Unter den Linden einbog und entlang der großen Bauwerke, der Universität, Staatsoper und der Alten Wache fuhr, wusste ich, dass ich falsch war. Das Zeughaus mit dem Museum für Deutsche Geschichte kannte ich, wohl auch das Opernhaus und das noch im Wiederaufbau befindliche Alte Museum mit den riesigen Säulen. Doch wie sollte ich von hier aus zurückfinden zur S-Bahn? Die Gegend wurde immer fremder, das Häusermeer der Großstadt machte Parks, Freiflächen und Fabriken Platz. Immer neue Fahrgäste stiegen ein und wieder aus. Alle hatten irgendein Ziel. Ich allein trieb wie ein Schiffbrüchiger durch das endlose Meer der Stadt. Ich kalkulierte zwar richtig, dass der Bus irgendwann zum Ausgangspunkt zurückkehren musste, doch es war schon dunkel, als ich wieder am Bahnhof Friedrichstraße anlangte. Per S-Bahn machte ich mich auf den Heimweg. Goliath habe ich einige Wochen später besucht und war etwas enttäuscht. Der graue Riese wirkte traurig und fremd in seinem Zirkuszelt auf dem Parkplatz inmitten der Stadt. Stärker im Gedächtnis geblieben ist mir die Irrfahrt durch Berlin.
Die Geheimschrift
Walter Benjamin spricht in Berliner Kindheit um neunzehnhundert von einer Kunst des Verirrens. Wer sich an den Stadtplan hält, wird immer nur die Dinge finden, die er schon kennt. Nur die Irrwege führen zu Entdeckungen. »Sich in einer Stadt nicht zurechtzufinden, heißt nicht viel«, beginnt Walter Benjamin seine Erinnerungen. »In einer Stadt sich aber zu verirren, wie man in einem Walde sich verirrt, braucht Schulung.«2 Die Rundfahrt auf der Linie A 57 war meine erste Lektion im Fach Verirrung. Zum ersten Mal entzifferte ich – natürlich noch unreflektiert – jene Geheimschrift, in welcher der Text der Stadt Berlin geschrieben ist. Es sei dahingestellt, was ich damals wahrnahm und was durch spätere Erfahrungen und Einsichten überlagert wurde. Jedenfalls hatte ich ein Spiel erfunden, das ich einige Male wiederholte: Ich stieg auf gut Glück in einen der großen gelben Doppelstockbusse des in Bautzen gefertigten Typs DO 56 mit der wie eine Schnauze hervorstehenden Motorhaube, bezahlte beim Schaffner zehn Pfennig und durchquerte unbekannte Stadtviertel. Der beste Platz war die vorderste Reihe auf dem Oberdeck. Vor der breiten Frontscheibe zogen Straßen und Plätze vorbei. Die Stadt war wie eine Wildnis, die umso geheimnisvoller wurde, je tiefer man vordrang. »Da müssen Straßennamen zu dem Irrenden so sprechen wie das Knacken trockener Reiser«, schrieb Walter Benjamin, »und kleine Straßen im Stadtinneren ihm die Tageszeiten so deutlich wie eine Bergmulde widerspiegeln.«3
Ost-Berlin ähnelte angesichts der Zerstörungen und politischen Umbrüche einem mittelalterlichen Palimpsest, einem mehrfach überschriebenen Pergamentblatt. Der neugierige Flaneur steht vor der Aufgabe, die ausgekratzten Schriften unter Infrarot wieder sichtbar zu machen. Er entziffert das Zeichensystem der Stadtlandschaft. Denkmale, Inschriften, Symbole, Straßennamen fielen durch Kriege und Stadtsanierungen der Zerstörung anheim. Oder sie wurden eilig weggewischt, wenn der politische Wind sich drehte. Dafür sind neue Texte geschrieben worden – in Form von Bauwerken, Verkehrs- und Versorgungseinrichtungen, Namen, Inschriften, Reklametafeln, Parolen und Symbolen. Doch die alten Zeichensysteme schlagen immer wieder durch und bilden mit den Überschreibungen einen Gesamttext.
Doch die Geheimschrift der Großstadt ist noch schwieriger zu entziffern als ein mehrfach überschriebenes Pergament. Seit Heraklit wissen wir, dass wir nicht zweimal in denselben Fluss steigen können, da alles fließt. Genauso wenig können wir zweimal durch dieselbe Stadt gehen oder zweimal denselben Text lesen. Wir befinden uns in einem Archiv, in dem jedes Aktenstück nach seiner Benutzung, genauer: durch die Benutzung, seinen Inhalt ändert. Das komplexe Zeichensystem der Stadt verändert sich nach jeder Entzifferung.
Viele Vergangenheiten
Der Krieg, die Zerstörungen und die Teilung der Stadt in Sektoren blieben in Ost-Berlin auf schmerzhafte Weise präsent. Die Stadt lebte seit 1945 in einer Nachkriegszeit, die nicht enden wollte.
»Einzig Vineta vielleicht versank derart gründlich in einer Sintflut (…)«, schrieb Günter Kunert in der literarischen Miniatur Berliner Gemäuer im Jahr 1964.4 »Doch wie der Wanderer Vinetas Glocken hört, wenn der Zufall es will, und Vinetas Turmspitzen, Dachfirste, Söller und einen Schimmer von Höfen, Gassen und Plätzen wahrnimmt, wenn der Einfallwinkel des Lichtes im Meer günstig ist, so auch spürt der Spaziergänger in Berlin manchmal einen Anhauch der gewesenen Stätte.«5 Das Gestein ist »ganz besonders redselig, »wahrscheinlich, weil es immer weniger wird und, ähnlich den Menschen einer schrumpfenden Generation, dadurch gedrängt, seine aussterbende Erfahrung weiterzugeben. Wer die mürben Mietshäuser betritt, den umfängt sogleich eine gänzlich andere Luft; die Luft der Vergangenheit, hängengeblieben, abgestanden, eine Mischung nicht mehr zu trennender Gerüche.«6
Die seltsame Topografie, aufgrund derer die Menschen ständig gegen Mauern liefen, wie auch die überall sichtbaren Kriegsschäden bildeten nur die äußerliche Folie für den Zustand des Vorübergehenden und Provisorischen. Andere Städte der Welt existieren aus sich selbst heraus, sosehr auch sie Symbole von Macht und Ideologie sein mögen: Jerusalem kann man besuchen und bewundern, ohne an den gekreuzigten Jesus oder an den dort in den Himmel aufgestiegenen Propheten Mohammed zu glauben. Roma aeterna, wie man die Stadt nicht zufällig nennt, wird es immer geben, unabhängig davon, welche Kaiser, Päpste oder Präsidenten dort regieren. Moskau ist trotz aller Abrisse und Neubauten unsterblich, egal ob auf den Kremltürmen rote Sterne leuchten. Ost-Berlin hingegen war ein Konstrukt des Kalten Krieges, im Grunde eher eine These als eine Stadt. Sie hob sich im Hegel’schen Sinne auf, als sie von der Geschichte widerlegt wurde. Nur noch Fragmente künden von der einstigen Halbstadt, die so gern eine Hauptstadt gewesen wäre.
Zeichen an der Wand
Die Wohnviertel der Innenstadt waren von Mietshäusern aus der Zeit um 1900 geprägt. Es fehlte nicht an Firmenschildern mit dem Zusatz Hoflieferant, aufgemalten Goldmedaillen mit Kronen und heraldischen Raubvögeln. An den Häusern hingen Emailleschilder mit dem roten Adler der brandenburgischen Feuersozietät und Ladenschilder mit der Aufschrift Kolonialwaren. Das ließ an Kokosnüsse oder Bananenstauden denken, auch an bunte Blechdosen für Kakao oder Zigarren, wie sie bei alten Leuten noch in der Küche standen. Doch wie ein Kommentar zu diesen längst verklungenen Zeiten der Monarchie und der Kolonialherrschaft waren die Fassaden von Splittereinschlägen und Gewehrkugeln zerfressen. In den einst besseren Gegenden bewachten Tritonen, Nereiden, Delphine, Zentauren und anderes mythologisches Getier den traurigen Verfall. Verrostete Eisengitter mit barocken Rundungen hielten leere Blumenkästen. Oft wurden die Balkone von steingrau gewordenen Karyatiden gestützt, um sie vor dem drohenden Absturz zu sichern. Oder sie ragten, ihrer Last ledig geworden, funktionslos ins Leere.
Auch Günter Kunert erzählt in seinen literarischen Spaziergängen durch Berlin von diesen »busenfreien Damen, die ihre Schamgegend hinter Zementfalten versteckten, den Blick voller Entsetzen in die Kunstgeschichte gerichtet, aus der sie extrahiert worden waren«.7 Nun zierten sie Ruinen und zerschossene Fassaden. Die großen Flügel der Eingangstore hingen schief in den Scharnieren, die Glasscheiben herausgeschlagen und die Verzierungen abgebrochen. Überlebt hatten Inschriften wie »Betteln und hausieren verboten« oder »Eingang nur für Herrschaften«. Die Schilder erwiesen sich als dauerhafter als die Gesellschaft, in der es noch Bettler, Hausierer und Herrschaften gab.
Wo sich die Gelegenheit bot, schlug man in den Jahrzehnten nach dem Krieg den Stuck von der Fassade, freute sich an dem modernen Anblick und strich die Außenmauern in hellen Ockerfarben. Doch meist waren die Häuser noch in jenem Einheitsgrau gefärbt, mit dem man sie während des Bombenkrieges übertüncht hatte, um den feindlichen Fliegern die Orientierung zu erschweren. Hier und da las man Inschriften wie LSR, die Abkürzung für Luftschutzraum. Aufgemalte Pfeile zeigten nach unten, um Verschüttete freischaufeln zu können. An anderen Stellen waren große weiße Kreise mit einem roten Kreuz zu finden, die auf Verbandsplätze oder Lazarette verwiesen. Zudem gab es russische Inschriften für Kommandostellen, Essenausgaben, Schneider- und Schusterwerkstätten der Roten Armee, doch sowjetische Soldaten waren außerhalb ihres Hauptquartiers in Karlshorst in Ost-Berlin selten anzutreffen.
Die Schuttberge und die meisten Ruinen waren 1962 bereits weggeräumt. Stattdessen erweckten riesige Freiflächen östlich und südlich des Alexanderplatzes den Eindruck einer Einöde. Dazwischen standen die wenigen Gebäude, die den Luftkrieg überstanden hatten. Die Ödnis verstärkte sich in Richtung Mauer. Wo einst das Berliner Zeitungsviertel war, dehnte sich Brachland aus, und nur das Denkmal des Freiherrn vom Stein stand einsam auf dem Dönhoffplatz, der lange schon kein Platz mehr war. Es bildete den vermessungstechnischen Mittelpunkt von Berlin. Von einer inzwischen verschwundenen Postsäule aus wurde seit 1730 die Entfernung zu anderen Städten gemessen. Nun lag der topografische Mittelpunkt der Stadt ganz am Rande der begehbaren Welt, etwa 500 Meter von der Mauer entfernt. Seltsamerweise hat diese Absurdität niemanden gestört, als 1979 eine Kopie des Obelisken in den Mittelpunkt der wiedererrichteten Spittelkolonnaden gesetzt wurde.
Heinz Knobloch berichtete in seinem erstmals 1982 im Ost-Berliner Verlag Der Morgen erschienenen Buch Stadtmitte umsteigen. Berliner Phantasien: »Wer (…) beim Verlassen des Bahnsteigs die Augen niederschlägt, kann an der Verfärbung des Fußbodens erkennen, daß ein etwa wohnzimmergroßes Quadrat sich abhebt von dem übrigen Untergrund. Es hat sich der Umgebung nicht anpassen können in all den Jahren. Das ist kein Anlaß zur Unruhe. Der Boden hält. Wir stehen auf festem Grund; wahrscheinlich ist der Beton gut.«8 Der Autor wundert sich in einer 20 Jahre später geschriebenen Anmerkung in der Neuauflage, dass er Anfang der achtziger Jahre die Hürden der Zensur überwunden hat. Denn unter der Betondecke befand sich jahrelang der Ausgang eines langen Ganges, der zum anderen Bahnsteig führte, an dem die Züge seit dem 13. August 1961 nicht mehr anhielten – einer jener halbdunklen Geisterbahnhöfe im Untergrund von Berlin. Die Züge fuhren vom Westen in den Westen und unterquerten mit einem einzigen Halt am Bahnhof Friedrichstraße den Osten. Nur dort konnte die West-Berliner aus- und umsteigen oder sich auf den Weg in den Ostteil der Stadt machen. Die anderen Bahnhofszugänge hatte man geschlossen, dann betoniert und mit Asphalt überzogen. Wenn es spätabends still wurde – und im Zentrum von Ost-Berlin war es nachts sehr still –, hörte man das geheimnisvolle Rumpeln der U- und S-Bahnen im Untergrund.
Am Rande der bewohnbaren Welt
Ost-Berlin war jahrzehntelang die wohl seltsamste Stadt der Welt. In vielen Richtungen endeten die Straßen an Sperren, Zäunen, Postenhäuschen, Warnschildern und Wachtürmen. Straßenbahnschienen führten ins Nirgendwo. Einige Endstationen der Linien von Stadtbahn wie Untergrundbahn lagen mitten im Zentrum. Wer hier ausstieg, erreichte nach wenigen Schritten den Stadtrand. Doch was hieß schon Stadtrand? Hier war die Welt mit Brettern vernagelt. Der zur schnoddrigen Untertreibung neigende Berliner sagte einfach Mauer. Die SED-Propaganda nannte das monströse Bauwerk »antifaschistischer Schutzwall«. Manche sagten, den Abkürzungsfimmel der SED-Sprache persiflierend, Antifa-Schuwa. Im Westen dagegen sprach man, wenn auch nicht amtlich, von der Schandmauer. Wenn es sachlich zugehen sollte, hieß es Sektorengrenze oder Demarkationslinie. Der Kalte Krieg teilte die Welt, Deutschland und Berlin, aber auch die Sprache. Hinter der Mauer war Feindesland oder Sehnsuchtsland – je nach Standpunkt. In jener zerrissenen Zeit gab es zu jeder Sache mindestens zwei gegensätzliche Ansichten und zwei Begriffe. Ständig mussten die Menschen darauf achten, wo und mit wem sie sprachen.
Am Rande des Brachlandes ragten wie zwei Schneidezähne im ansonsten zahnlosen Maul der zerrissenen Stadt das im Bau befindliche Axel-Springer-Hochhaus und der Stahlskelettbau der Gesellschaft für Straßen- und Wasserbau in die Höhe. Seit 1963 befand sich auf dem Dach ein Nachrichtenbalken, der weit in den Osten hineinstrahlte. Die fälschlicherweise oft dem Springer-Verlag zugeordnete Leuchtschrift war ein großes Ärgernis für die Staatsmacht der DDR. Wenn es in Ost-Berlin dunkel wurde, eilten die Leuchtbuchstaben wie kleine Ameisen über den Balken und verkündeten den wenigen Passanten, was diese längst wussten, denn auch in Ost-Berlin hatte fast jeder Haushalt ein Radiogerät und viele einen Fernseher. Dort konnte man sich einfacher und umfassender informieren als im kalten Wind des Brachlandes an der Mauer. Die Lufthoheit der Westsender war nahezu uneingeschränkt. So radikal die Mauer die Stadt teilte, so allgegenwärtig war der andere Teil der Stadt durch Rundfunk und Fernsehen präsent. In den fünfziger und beginnenden sechziger Jahren waren es vor allem der Rundfunk im amerikanischen Sektor (RIAS), der Sender Freies Berlin (SFB) und die Sendestationen der Westalliierten AFN und BBC.
Parallel begann der Siegeszug des Fernsehens, und allabendlich eroberte der Klassenfeind die Wohnzimmer Ost-Berlins. So hörten die DDR-Bürger morgens im Radio die West-Berliner Marktpreise für Radieschen und Gurken, mittags vom Stau auf der Avus und abends die Veranstaltungstipps der angesagten Diskos und Clubs. Dazu kamen Rezensionen von Büchern, die es im Osten weder im Buchladen noch in der Bibliothek gab, Kritiken über Filme, die sie nicht sehen konnten, und Ankündigungen zu Theaterabenden, zu denen sie nicht gehen konnten. Die Situation war im eigentlichen Wortsinn schizophren, was frei übersetzt nichts anderes heißt als gespaltene Wahrnehmung oder besser noch: gespaltene Seele.
Schwierigkeiten bei der Namensgebung
Die Namensgebung für den Ostteil Berlins war voller Geheimnisse. Zunächst wurde der Machtbereich der Roten Armee schlicht Sowjetischer Sektor von Groß-Berlin genannt. Groß-Berlin hieß seit dem 1. Oktober 1920 die aus sechs Städten, 59 Landgemeinden und 27 Gutsbezirken zusammengefügte Reichshauptstadt. Der Name überlebte den Krieg und die unmittelbare Nachkriegszeit. Am 24. Juni 1950 tauchte in der DDR-Presse erstmals der Name »demokratischer Sektor« auf. Das Adjektiv wurde gelegentlich großgeschrieben, was auf eine feststehende Bezeichnung hindeutete, öfter jedoch kleingeschrieben, sodass der Name als Zustandsbeschreibung interpretiert werden konnte. Gleichzeitig wurde die Bezeichnung Groß-Berlin in allen amtlichen Verlautbarungen verwendet. Dahinter stand der Anspruch der DDR auf ganz Berlin. Seit 1961 wurde die Bezeichnung »demokratischer Sektor« seltener und verschwand allmählich aus dem amtlichen Sprachgebrauch. Nun hieß es amtlich: Berlin – Hauptstadt der Deutschen Demokratischen Republik. Dennoch stand hier und da noch an Häuserwänden oder auf Schildern der alte Begriff Groß-Berlin, so an der Pfandleihe in der Wilhelm-Pieck-Straße.
Die Begriffe Sowjetsektor oder Ostsektor hingegen waren westliche Kampfbegriffe des Kalten Krieges, die Ende der sechziger Jahre aus dem Sprachgebrauch verschwanden. Landläufig sagten hüben wie drüben die Leute Ostberlin, wenn sie hervorheben wollten, dass ausschließlich der Ostteil der Stadt gemeint war. Spiegelverkehrt wurde der Begriff Westberlin gebraucht. Sagte man in Hamburg oder München Berlin, meinte man Westberlin. In Leipzig oder Rostock sagte man Berlin und meinte Ostberlin. Der Bindestrichstreit ist erst im Rückblick aufgekommen und eigentlich eine Analogie des Streites um die Bezeichnungen Westsektor, Westberlin, Besondere politische Einheit Westberlin, West-Berlin, Berlin (West). Damals ging es allerdings um hochpolitische Statusfragen. Von 1948 bis 1961 liebäugelte die DDR damit, ihre Herrschaft auf ganz Berlin auszudehnen, später sollten die Ost-Berliner möglichst vergessen, dass es hinter der Mauer noch eine Stadt gab.
Meyers Neues Lexikon vom Leipziger Bibliographischen Institut aus dem Jahr 1962 vermerkte unter dem Stichwort Berlin: »Groß-Berlin; größte deutsche Stadt und Hauptstadt der Deutschen Demokratischen Republik.« Dann erst wurde »Westberlin« genannt und entgegen den Regeln der deutschen Orthografie zusammengeschrieben, vermutlich, um zu suggerieren, es handele sich um eine eigenständige Landschaftsbezeichnung – etwa analog zu Westfalen oder zum Westernwald. Die Ausgabe des Lexikons von 1978 vaporisierte im Zeichen der Abgrenzungspolitik den Westteil der Stadt endgültig. Unter dem Stichwort Berlin ist zu lesen: »Hauptstadt und politisches, ökonomisches und wissenschaftlichkulturelles Zentrum der DDR«. Dann folgten geografische und topografische Angaben, die sich ausschließlich auf den Ostteil bezogen. Nicht einmal im Abschnitt Geschichte wurde auf die Existenz eines Westteils verwiesen. Allerdings findet man in einem anderen Band des Lexikons zwischen Westbengalen und Westböhmen das Stichwort Westberlin: eine Stadt mit »besonderem politischen Status«, die »inmitten der DDR« liegt. Immerhin werden der Zoo und das Olympiastadion erwähnt.
Nun sind Namensänderungen in politisch bewegten Zeiten nichts Ungewöhnliches. Irritierend aber war, dass keine der erwähnten Sprachregelungen formal beschlossen, irgendwo verkündet, geschweige denn erläutert oder gar diskutiert wurde. Dem aufmerksamen Zeitungsleser oblag es, selbständig die verborgenen Winke der Obrigkeit zu deuten.
Im Zeichen der Zukunft
In der sozialistischen Vorzeigestraße zwischen Strausberger Platz und Frankfurter Tor hatte 1962 die Zukunft schon begonnen: Für den Humanismus, den Fortschritt und den Weltfrieden stand bis 1956 und mit Einschränkungen bis 1961 der Name Stalins. Die Große Frankfurter Straße war am 21. Dezember 1949 zu Ehren seines 70. Geburtstages nach Josef Wissarionowitsch Stalin benannt worden. Zwölf Jahre später, am 14. November 1961, verschwand der Name über Nacht aus dem Stadtbild. Moskau hatte verfügt, dass der »größte Humanist aller Zeiten« ein größenwahnsinniger Verbrecher gewesen sei, und die SED-Führung schwenkte ohne zu murren auf die neue Linie ein.
In dieser Nacht wurden die Anwohner unsanft gestört. Im Licht von Flakscheinwerfern räumten Bautrupps der Nationalen Volksarmee das Stalin-Denkmal ab. Am Dienstag, dem 14. November 1961, erschien auf der Titelseite des Neuen Deutschland unter der Überschrift »Mitteilung des Magistrats von Groß-Berlin« folgender Text: »Nach Kenntnisnahme der Materialien des XXII. Parteitages der Kommunistischen Partei der Sowjetunion hat der Magistrat von Groß-Berlin in seiner Sitzung vom 13. November 1961 in Bezug auf die in der Periode des Personenkultes Stalins erfolgten Verletzungen der revolutionären Gesetzlichkeit und der daraus entstandenen schweren Folgen nachstehende Maßnahmen beschlossen: Der Teil der bisherigen Stalinallee vom Alexanderplatz bis zum Frankfurter Tor wird in Karl-Marx-Allee umbenannt; der Teil der Stalinallee vom Frankfurter Tor in östlicher Richtung erhält den Namen Frankfurter Allee; das Denkmal J. W. Stalins wird entfernt; der S-Bahnhof Stalinallee erhält die Bezeichnung: S-Bahnhof Frankfurter Allee. Dementsprechend wird auch der U-Bahnhof Stalinallee in U-Bahnhof Frankfurter Allee umbenannt.«9
Die Berliner vermissten Stalin nicht, und auch die SED-Propaganda hob die Freude am Einkauf und die kulturvolle Freizeitgestaltung der Werktätigen hervor, für die der Name Karl-Marx-Allee nun stand. »Tausende flanieren tagsüber zwischen dem Strausberger Platz und dem Bersarinplatz und haben bei einem Schaufensterbummel ihre Freude an dem reichhaltigen Warenangebot. Gegen Abend immer nimmt der Strom der Schaulustigen zu. Neugierde, Staunen. Freude und Stolz ist in den Gesichtern der Menschen. Die erste sozialistische Straße unserer Stadt ist auch ihre schönste geworden«, jubelte die Junge Welt.10 Über den Geschäften und Restaurants flimmerte bonbonfarbene Neonreklame. Hierher kam man, wenn man etwas Besonderes kaufen oder fein ausgehen wollte. Im »Café Warschau«, im »Restaurant Budapest« mit dem »Zigeunerkeller« und im »Restaurant Bukarest« durften die Berliner kulinarische Köstlichkeiten der Bruderstaaten genießen, dazu gab es Tanz und Folklore. Die »Karl-Marx-Buchhandlung« war die größte ihrer Art in der ganzen Republik und wurde bevorzugt mit stets raren Besonderheiten der Verlagsproduktionen beliefert. Im »Haus des Kindes« gab es nicht nur Kinderkleidung und Spielzeug zu kaufen, sondern auch ein Puppentheater und ein Kindercafé. Vor allem aber gab es Geschäfte für Kleidung, Schuhe, Elektrowaren und vieles andere. Die sozialistische Welt schien in dieser Straße in Ordnung zu sein. Die roten Banner der Arbeiterbewegung und die schwarz-rot-goldenen Fahnen mit dem DDR-Emblem flatterten vor der Kulisse der gekachelten Prachtbauten im Wind, und die Parolen in weißer Schrift auf rotem Grund kündeten vom kommenden Sieg des Sozialismus.
Die Stadt als Roman in zufälligen Makulaturblättern
Doch Ost- und West-Berlin kamen nicht voneinander los. Die Geschichte Ost-Berlins ist wie ein Roman, aus dem jedes zweite Kapitel herausgerissen wurde und die übrig gebliebenen Druckbögen mit einem fremden Manuskript vermengt wurden. So entstanden Paralleltexte, die auf den ersten Blick nichts miteinander zu tun haben. Doch auf den zweiten Blick erkennt man ein kunstvoll miteinander verwobenes Ganzes.
Die Dichter der Romantik liebten solche literarischen Verwirrspiele. E.T.A. Hoffmanns Kater Murr schrieb seine Lebensansichten auf die herausgerissenen »zufälligen Makulaturblätter« der Biografie des Kapellmeisters Johannes Kreisler. Der Setzer übernahm die Manuskriptseiten ungeprüft, so die literarische Fiktion, und gab sie zum Druck. Immer wieder bricht die Künstlerbiografie ab und wird durch die Lebensweisheiten des lese- und schreibkundigen Katers ergänzt. Aus der scheinbaren Unordnung wird ein Kunstwerk. Der Roman blieb Fragment, so wie auch der Doppelroman Berlins aus zwei Fragmenten besteht, die nur gemeinsam eine Romanhandlung bilden.
Wer auch immer der Schöpfer der Lebensgeschichte der Halbstadt Ost-Berlin gewesen sein mag, er hatte viel Sinn für jene romantische Doppelbödigkeit, die E.T.A. Hoffmann die Feder führte. Vor allem aber ist die Historie der Doppelstadt ein Musterbeispiel für die List der Vernunft, wie es Georg Wilhelm Friedrich Hegel nannte. Das Gegeneinander von West und Ost war immer auch ein Miteinander. Das eine existiert durch das andere, wie Hegel lehrt. In diesem Falle heißt das, Ost-Berlin existierte nur durch West-Berlin und umgekehrt. So hat Hegels Weltgeist in Berlin, dem Ort seiner akademischen Inauguration, ein Meisterstück der Dialektik geliefert.
Schlagen wir das von den Krallen des Katers Murr zerrupfte Romanfragment Ost-Berlin auf. Entziffern wir die geheimen Zeichensysteme der Großstadt und steigen in einen jener blassgelben Doppelstockbusse der BVG / BVB, die 1974 endgültig ausgemustert wurden. Fahren wir kreuz und quer durch die virtuelle Realität des alten Ost-Berlins, und verirren wir uns dabei ganz im Sinne von Walter Benjamin im Labyrinth von Zeit und Raum.
ERSTER TEIL
Der sowjetische Sektor von Berlin1945 bis 1949
Erstes KapitelKriegsende und Teilung
Blick über den Pariser Platz zum Brandenburger Tor, Juni 1945
Stalins ungewolltes Kind
Biografien beginnen üblicherweise mit der Geburt des Helden. Doch wann Ost-Berlin das Licht der Welt erblickte, ist einigermaßen unklar. War es in den Nachtstunden vom 8. zum 9. Mai 1945, als die deutsche Wehrmacht bedingungslos kapitulierte, oder in den Tagen vom 1. bis zum 4. Juli 1945, als die Westalliierten ihre Sektoren in Berlin übernahmen? In Frage kommt auch die Einführung der D-Mark in den Westsektoren am 23. Juni 1948, die den Anlass für die sowjetische Blockade bot, oder der 30. November 1948, als mit der staatsstreichartigen Bildung eines von der SED dominierten Magistrats und der Wahl Friedrich Eberts zum Ost-Berliner Oberbürgermeister faktisch jede verwaltungsmäßige Gemeinsamkeit mit den Westsektoren beendet wurde. Doch auch danach beschworen beide Seiten mit viel Pathos die Einheit Berlins, und im Alltagsleben der Stadtbewohner blieb sie bis zu einem gewissen Grad bis zum 13. August 1961 erhalten.
Ein eindeutiger Geburtstag des feindlichen Geschwisterpaares ist schwer auszumachen. Der Zeitpunkt der Zeugung hingegen lässt sich genau bestimmen. Auch der Kindsvater stand von Anfang an fest: Es war der sowjetische Diktator Stalin, der mit den eher widerstrebenden oder zumindest gleichgültigen Briten und Amerikanern den missratenen Wechselbalg zeugte. Wie es auch im Leben vorkommen mag, war sich diese Ménage-à-trois keineswegs der langfristigen Konsequenzen ihres Treibens bewusst. Die ungewollte Nachkommenschaft entwickelte sich zum weltpolitischen Problemfall und blieb es mehr als 40 Jahre lang.
Die Idee der Teilung Berlins entstand 1944. Während an allen Fronten noch der Krieg tobte, beschlossen die vom 19. bis zum 30. Oktober 1943 in Moskau tagenden Außenminister Großbritanniens, der USA und der Sowjetunion, die European Advisory Commission (EAC) einzurichten. Dort sollten Vertreter der drei Mächte – von Frankreich als Siegermacht war noch keine Rede – Vorschläge für eine europäische Nachkriegsordnung erarbeiten. Seit Dezember 1943 tagte die Kommission im Lancaster House in London. Für die UdSSR saß deren Londoner Botschafter Fjodor Gusew am Verhandlungstisch. Zu seiner Unterstützung richtete man in Moskau eine Kommission unter Marschall Kliment Woroschilow ein. Ihr gehörten Militärs und Fachleute für internationale Beziehungen an, einige hatten schon unter dem Zaren im diplomatischen Dienst gearbeitet. Die Woroschilow-Kommission griff eine wohl ursprünglich britische, vage formulierte Idee auf, analog zur Aufteilung Deutschlands auch Berlin zu teilen. In der ehemaligen Reichshauptstadt sollte ein gemeinsames Gremium der Alliierten seinen Sitz haben und die Entscheidungen der Siegermächte umsetzen. Am 17. April 1944 lag der Moskauer Kommission ein Entwurf vor, der erstmals Berlin in Sektoren teilte. Dabei ging man schlicht mit Zirkel und Lineal ans Werk. Man stach die Zirkelspitze in den Mittelpunkt von Berlin, schlug zwei Kreise mit einem Radius von 10 und 15 Kilometern und teilte den Doppelkreis mit dem Lineal in drei gleich große Tortenstücke. Das östliche Drittel war der Sowjetunion zugedacht, hatte aber einen anderen Zuschnitt als das spätere Ost-Berlin. Die westlichen Tortenstücke sollten Amerikaner und Briten bekommen. Der Vorschlag fand in der Kommission unter Marschall Woroschilow keine Zustimmung. Mehrere andere Varianten wurden durchgespielt, ohne dass eine Entscheidung fiel. In den Diskussionen ging es vor allem um die Standorte der Industrieanlagen, die man nach Kriegsende zu demontieren gedachte.
Schließlich einigte man sich in Moskau. Sicherlich nicht ohne Billigung Stalins brachte die sowjetische Delegation bei der EAC einen Vorschlag ein, der auch den Westmächten genehm war und im Ersten Londoner Protokoll vom 12. September 1944 seinen Niederschlag fand. Er legte den genauen Umfang des künftigen sowjetischen Sektors fest. Dieser sollte die acht Stadtbezirke Pankow, Prenzlauer Berg, Mitte, Weißensee, Friedrichshain, Lichtenberg, Treptow und Köpenick in den vom Amtsblatt der Reichshauptstadt Nr. 13 vom 27. März 1938 festgelegten Grenzen umfassen.1 Mit der sprichwörtlichen deutschen Gründlichkeit werden in dem Protokoll die einschlägigen Berliner Amtsblätter über die Grenzziehung zitiert. Die Aufteilung der Westsektoren unter Amerikanern und Briten blieb zunächst offen, sie erfolgte erst am 14. November 1944. Doch auch diese Vereinbarung war kurze Zeit später überholt. Während ihres Treffens in Jalta vom 4. bis zum 11. Februar 1945 beschlossen Stalin, Churchill und Roosevelt, Frankreich als vierte Siegermacht aufzunehmen und ihm Besatzungszonen in Deutschland und Österreich sowie Sektoren in Berlin und Wien zuzuteilen. Dies geschah in allen Fällen auf Kosten der britischen und amerikanischen Ansprüche.
Von Anfang an war es die Sowjetunion, die auf eine Sonderstellung Berlins als Sitz der Alliierten Kommandantur drängte, während die britische und die amerikanische Seite der Angelegenheit keine besondere Bedeutung beimaß. Man hielt die Besatzung wohl für ein Provisorium und kümmerte sich vorläufig nicht um die Garantie der Zufahrtswege auf Straßen, Schienen und in der Luft. Vier Jahre später sollten diese ungeklärten Fragen die ehemaligen Verbündeten an den Rand eines Atomkrieges bringen. Doch 1944 war zwar der Sieg über Hitler-Deutschland nicht mehr fraglich, unklar waren der genaue Zeitpunkt und der Frontverlauf am Ende des Krieges. Die Entscheidung über die Teilung Berlins war eine gegenseitige Versicherung gegen jeden Versuch, schon während des Krieges Positionen für künftige Konflikte zu sichern. Die Siegermächte sollten als gleichberechtigte Partner die Umsetzung der Nachkriegsregelungen garantieren und darüber wachen, dass Deutschland dauerhaft entmilitarisiert wird. Berlin als gemeinsamer Sitz der alliierten Kontrollbehörden war der Schlussstein dieser Konstruktion. Stalin ging es nicht um den Export des Sowjetsystems oder die Bildung eines ostdeutschen Satellitenstaates, sondern um eine dauerhafte Neutralisierung Deutschlands. Die Sowjetführung agierte also noch in den Denkmustern des zu Ende gehenden Krieges, nicht in den Kategorien des sich abzeichnenden Weltkonfliktes zwischen der Sowjetunion und dem Westen.
Die Kapitulation
Wie durch ein Wunder war die Pionierschule I der Wehrmacht in Berlin-Karlshorst von den Bombenangriffen und den schweren Bodenkämpfen der letzten Kriegstage verschont geblieben. Auch die Häuser in der Umgebung hatten den Krieg unbeschadet überstanden. Das Villenviertel Karlshorst war erst um 1900 entstanden und bot in den dreißiger Jahren noch genügend Bauland. Deshalb war hier 1938 die Pionierschule errichtet worden. Als die Rote Armee Ende April 1945 näher rückte, räumte das deutsche Militär entgegen den Befehlen das Gelände kampflos. Noch während der Schlacht um Berlin machte die sowjetische Stoßarmee unter Generaloberst Nikolai Bersarin den Gebäudekomplex zu ihrem Hauptquartier. Wohl erst im Laufe des 7. Mai 1945 fiel die Entscheidung, hier die Unterzeichnung der formellen Kapitulation Hitler-Deutschlands vorzubereiten.
Bereits am 2. Mai 1945 waren mit der Teilkapitulation der Reichshauptstadt die letzten größeren Kampfhandlungen auf deutschem Territorium zu Ende gegangen. Hitler hatte vor seinem kläglichen Abtritt einen seiner treuesten Anhänger, Großadmiral Karl Dönitz, zu seinem Nachfolger ernannt. Dieser versuchte von Flensburg aus, die letzte Trumpfkarte des Nazi-Reichs ins Spiel zu bringen: die vermeintlichen oder tatsächlichen Spannungen zwischen den Westmächten und der Sowjetunion. Dönitz schickte Generaladmiral Hans-Georg von Friedeburg und Generaloberst Alfred Jodl nach Frankreich, ins Hauptquartier des Oberkommandierenden der verbündeten Streitkräfte Dwight D. Eisenhower in Reims. Dort sollte dieser bei den Westmächten eine Teilkapitulation erwirken, damit die Truppen im Osten weiterkämpfen oder sich wenigstens in Richtung Westen absetzen könnten. Doch Eisenhower durchschaute das Spiel und bestand auf der mit der Sowjetunion vereinbarten bedingungslosen Kapitulation Deutschlands. So blieb den deutschen Abgesandten nichts anderes übrig, als zu unterschreiben. In Anwesenheit von Offizieren aller vier Siegermächte setzten Jodl und Friedeburg am 7. Mai 1945 um 2.41 Uhr ihre Unterschriften unter die Kapitulationsurkunde. Am 8. Mai 1945 um 24 Uhr sollte an allen Fronten Waffenstillstand herrschen.
Doch Stalin ging das zu schnell, und es war der falsche Ort. Er wollte auf eine feierliche Kapitulation in Berlin nicht verzichten. Die Westmächte waren bereit, der Sowjetunion in diesem Punkt entgegenzukommen. Allerdings nahm Eisenhower nicht persönlich an der Zeremonie teil, er schickte den britischen Luftmarschall Arthur W. Tedder und den US-General Carl Spaatz nach Berlin.
Am 8. Mai brachte eine britische »Douglas« eine deutsche, von Dönitz zusammengestellte Abordnung aus Frankfurt am Main nach Berlin-Tempelhof. Der frühere Chef des Oberkommandos der Wehrmacht Generalfeldmarschall Wilhelm Keitel vertrat das Heer, Generaloberst Hans-Jürgen Stumpff die Luftwaffe und Generaladmiral Hans-Georg von Friedeburg die Marine. Die mitreisenden Engländer wurden auf dem Flughafen Tempelhof von den Russen mit militärischen Ehren empfangen, während die deutsche Delegation im Flugzeug warten musste. Dann fuhr die Autokolonne quer durch die zerstörte Stadt nach Karlshorst.
Währenddessen wurde der Beginn der Zeremonie durch einen Streit um die Teilnahme des angereisten französischen Generals Jean de Lattre de Tassigny verzögert. Insbesondere die Sowjetunion unterstützte die Bestrebungen Frankreichs, in den Kreis der Siegermächte aufgenommen zu werden. So entschied man schließlich, dass der französische General an dem feierlichen Akt teilnehmen könne, aber als Letzter unterschreiben sollte. Eilig wurde eine Trikolore zusammengenäht und im Speisesaal des Offizierskasinos in Karlshorst aufgehängt.
Kurz nach Mitternacht begann endlich die offizielle Zeremonie. Als die deutschen Militärführer und ihre Adjutanten im vollen Schmuck ihrer Orden und Ehrenzeichen den Speisesaal betraten, herrschte eisiges Schweigen. Keiner der alliierten Offiziere erhob sich zu einer militärischen Grußerweisung. Nur die ausländischen Reporter drängten nach vorn und machten Fotos und Filmaufnahmen.
Der russische Schriftsteller Konstantin Simonow, der als Kriegskorrespondent an der Zeremonie teilnahm, hielt seine Eindrücke in seinem Tagebuch fest: »Keitel braucht nur drei Schritte zu machen, um an seinen Tisch zu gelangen. Er geht dorthin, bleibt hinter dem mittleren Sessel stehen, streckt die Hand mit dem kurzen Marschallstab aus, vollführt eine flinke Bewegung vorwärts und rückwärts, die mich an Hantelgymnastik erinnert. Er rückt den Sessel ab, setzt sich und legt den Marschallstab vor sich nieder.«2
Währenddessen unterzeichneten die Vertreter der Siegermächte die Kapitulationsurkunde: Georgi Schukow für die Sowjetunion, Arthur Tedder für das Vereinigte Königreich, Carl Spaatz für die USA und Jean de Lattre de Tassigny für Frankreich. »Während sie unterschrieben, veränderte sich Keitels Gesicht schrecklich. In Erwartung der Sekunde, da er an der Reihe ist, zur Feder zu greifen, sitzt er steif und starr da. Der große Ordonnanzoffizier, der in strammer Haltung, die Hände an der Hosennaht, hinter seinem Sessel steht, weint, ohne daß sich in seinem Gesicht ein Muskel regt. Keitel sitzt gerade da, dann streckt er die Hände aus und ballt sie auf dem Tisch zu Fäusten.«3
Schukow forderte die Deutschen auf, zur Unterzeichnung an den Tisch zu treten. »Als erster steht Keitel auf. Er tritt an die schmale Seite des Tisches, setzt sich in den dort stehenden Sessel und unterzeichnet mehrere Exemplare der Urkunde. Dann kehrt er an seinen Tisch zurück, setzt sich und nimmt die alte Pose ein. Zum Schreiben hat er einen Handschuh abgestreift. Jetzt zieht er ihn wieder an. Nach ihm gehen Stumpff und Friedeburg unterschreiben. Unterdessen sehe ich weiter zu Keitel hin. Er hat sich halb dem Tisch der Alliierten zugewandt, betrachtet sie und grübelt so angestrengt über etwas nach, daß er unbewußt die rechte behandschuhte Hand ans Gesicht führt. Stumpff erscheint absolut ruhig. Friedeburg ist erstarrt, aber hinter seiner Reglosigkeit verbirgt sich grenzenlose Niedergeschlagenheit.«4 »Die Deutschen erheben sich. Keitel vollführt mit dem Marschallstab die gleiche Bewegung, die er eingangs gemacht hat, als er eingetreten ist, dreht sich um und geht hinaus. Die anderen folgen ihm. Die Tür wird geschlossen. Und plötzlich weicht die gestaute Spannung aus dem Saal. Sie verfliegt, als hätten alle lange den Atem angehalten, der nun der Brust entströmt. Ein allgemeiner Seufzer der Erleichterung und Erschöpfung bricht sich Bahn. Die Kapitulation ist besiegelt, der Krieg zu Ende.«5
Die Berliner Erklärung
Die in Berlin-Karlshorst unterzeichnete Kapitulationsurkunde enthielt keine Bestimmungen über den künftigen Umgang mit dem besiegten Feind. Um dies nachzuholen, trafen sich die Oberkommandierenden der verbündeten Streitkräfte der Anti-Hitler-Koalition am 5. Juni 1945 erneut in Berlin.
Auf dem Flughafen Tempelhof waren der Stellvertretende Oberkommandierende der Gruppe der sowjetischen Besatzungstruppen in Deutschland Armeegeneral Wassili Sokolowski und der Stadtkommandant Generaloberst Nikolai Bersarin mit einer Ehrenformation der Roten Armee aufmarschiert. Um 10.45 Uhr landeten nacheinander 13 amerikanische Flugzeuge. Aus dem ersten Flugzeug stieg der Oberbefehlshaber der US-Streitkräfte in Europa Dwight D. Eisenhower. Der TASS-Korrespondent vermerkte stolz, Eisenhower habe gesagt: »Ich habe nie gesehen, daß eine Ehrenwache so schneidig die Macht ihrer Armee zum Ausdruck gebracht hätte.«6 Später wiederholte sich die Zeremonie zu Ehren des französischen Armeegenerals Jean de Lattre de Tassigny und des britischen Feldmarschalls Bernard L. Montgomery.
Um 17 Uhr trafen sich die Oberkommandierenden im Hauptquartier von Marschall Schukow in Wendenschloss, einem Vorort im Stadtbezirk Köpenick. Dort, in der Nibelungenstraße 20, unterzeichneten sie vier Erklärungen zur Übernahme der Regierungsgewalt in Deutschland durch die Alliierten. Anschließend erhielten Eisenhower und Montgomery den Siegesorden, die höchste Auszeichnung der Sowjetunion, Lattre de Tassigny den Suworow-Orden Erster Klasse.
In der vierten Erklärung mit dem Titel »Feststellung seitens der Alliierten über die Einteilung Deutschlands in Besatzungszonen« heißt es bezüglich der Aufteilung Berlins erstmals klar und deutlich: »Das Gebiet von Groß-Berlin wird von Truppen einer jeden der vier Mächte besetzt. Zwecks gemeinsamer Leitung der Verwaltung dieses Gebietes wird eine interalliierte Behörde (…) errichtet, welche aus vier von entsprechenden Oberbefehlshabern ernannten Kommandanten besteht.«7
Nun war der Weg frei für den Rückzug der britischen und amerikanischen Truppen hinter die vereinbarte Demarkationslinie zwischen den künftigen Besatzungszonen sowie für die Übernahme der drei Westsektoren Berlins durch Großbritannien, Frankreich und die USA. Neben der völkerrechtlichen Bedeutung dieser Vereinbarungen, die bis 1990 die Grundlage für alle Abkommen der Siegermächte bilden sollten, war es von großem Belang, dass die Berliner erstmals über ihr weiteres Schicksal informiert wurden.
Am Nachmittag des 1. Juli 1945 erreichte ein Vorauskommando der US Army den südwestlichen Stadtrand von Berlin. Am frühen Morgen hatte sich die Kolonne von Militärlastwagen und -jeeps – als Amerikaner deutlich zu erkennen durch den weißen Stern auf den olivgrünen Fahrzeugen – von Halle (Saale) auf den Weg nach Berlin gemacht. Sie überquerten auf einer Pontonbrücke bei Dessau die Elbe und verließen damit den Machtbereich der westlichen Streitkräfte. Dann rollte das Kommando auf der leeren Autobahn nach Berlin. Dort wurden sie vom sowjetischen Stadtkommandanten empfangen, und es wurden die Details der Übernahme der Westsektoren durch die Briten, Amerikaner und Franzosen vereinbart. Als Tag der Übergabe wurde der 4. Juli 1945 vereinbart.
»Neunundneunzig von hundert Berlinern freuten sich auf die Amerikaner wie Kinder auf den Weihnachtsmann«, berichtete der Journalist Curt Riess, ein deutscher Emigrant, der damals in amerikanischer Uniform mit den ersten US-Truppen in Berlin eintraf.8 »Und dann folgte die Enttäuschung. (…) Es lag für die Alliierten nicht der geringste Grund zu der Annahme vor, daß sie in eine ihnen befreundete Stadt kamen. Sie waren ins Herz des Feindes vorgestoßen. Und wenn auch die große Mehrzahl der breitschultrigen, schmalhüftigen Hünen der 82. Airborne, die eintrafen, keine besonderen Ressentiments hatten, so fühlten sie doch sicher auch keine besondere Sympathie für die Berliner.«9