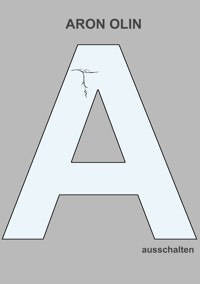Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: BoD - Books on Demand
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Serie: GABE
- Sprache: Deutsch
Rettung aus einer Notsituation hat nicht immer nur positive Folgen. Je nachdem, wie genau sich das eigene Verhalten während dieser Situation gestaltet hat. Manchmal kann man die Scherben aufsammeln und wieder zusammensetzen. Und manchmal ist zumindest letzteres nicht mehr ohne Weiteres möglich. Was für Geraldine und ihre Freunde weitreichende Veränderungen mit sich bringt.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 843
Veröffentlichungsjahr: 2024
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Inhaltsverzeichnis
Kapitel 1
Kapitel 2
Kapitel 3
Kapitel 4
Kapitel 5
Kapitel 6
Kapitel 7
Kapitel 8
Kapitel 9
Kapitel 10
Kapitel 11
Kapitel 12
Kapitel 13
Kapitel 14
Kapitel 15
Kapitel 16
Kapitel 17
Kapitel 18
Kapitel 19
Kapitel 20
Kapitel 21
Kapitel 22
Kapitel 23
Kapitel 24
Kapitel 25
Kapitel 26
Kapitel 27
Kapitel 28
Kapitel 29
Kapitel 30
Kapitel 31
Kapitel 32
Kapitel 33
Kapitel 34
Kapitel 35
Kapitel 36
Kapitel 37
Kapitel 38
Kapitel 39
Kapitel 40
Kapitel 41
Kapitel 42
Kapitel 43
Kapitel 44
Kapitel 45
Kapitel 46
Kapitel 47
Kapitel 48
Kapitel 49
Kapitel 50
Kapitel 51
Kapitel 52
Kapitel 53
Kapitel 54
Kapitel 55
Kapitel 56
Kapitel 57
Kapitel 58
Kapitel 59
Kapitel 60
Kapitel 61
Kapitel 62
Kapitel 63
Kapitel 64
Kapitel 65
Kapitel 66
Kapitel 67
Kapitel 68
Kapitel 69
Kapitel 70
Kapitel 71
Kapitel 72
Kapitel 73
Kapitel 74
Kapitel 75
Kapitel 76
Kapitel 77
Kapitel 78
Kapitel 79
Kapitel 80
Kapitel 81
Kapitel 82
Kapitel 83
Kapitel 84
Kapitel 85
Kapitel 86
Kapitel 87
Kapitel 88
Kapitel 89
Kapitel 90
Kapitel 91
Kapitel 92
Kapitel 93
Kapitel 94
Kapitel 95
Kapitel 96
Kapitel 97
Kapitel 98
Kapitel 99
Kapitel 100
Kapitel 101
Kapitel 102
Kapitel 103
Kapitel 104
Kapitel 105
Kapitel 106
Kapitel 107
Kapitel 108
Kapitel 109
Kapitel 110
Kapitel 111
Kapitel 112
Kapitel 113
Kapitel 114
Kapitel 115
Kapitel 116
Kapitel 117
Kapitel 118
Kapitel 119
Kapitel 120
Kapitel 121
Kapitel 122
Kapitel 123
Kapitel 124
Kapitel 125
Kapitel 126
Kapitel 127
1
„Becca?“ In Christopher drängten sich mehrere Emotionen nebeneinander: Überraschung ob ihres plötzlichen Auftauchens. Unsicherheit, ob er ihre Stimme wirklich erkannt hatte. Und natürlich das Entsetzen, sich einer Waffe gegenüber zu sehen. Zumindest in Punkt zwei durfte er sich allerdings recht schnell bestätigt sehen, denn obwohl sie seine Frage nicht bejahte, rief sie zurück:
„Christopher?“ was ihm als Antwort genügte.
„Ja.“ sagte er daher, „was meinst du mit ‚vorbei‘?“
„Du bist der Dämon.“ Rebecca klang wütend – was er ihr nicht verübeln konnte. Er bemühte sich daher um schnellstmögliche Klärung:
„Nein.“
Doch ihr als Polizistin reichte ein einfaches ‚Nein‘ natürlich nicht aus: „Wie heißt meine Mutter mit Mädchennamen?“
„Becca...“ Christopher hob die Hände, „ich habe keine Ahnung.“
„Gut. Blöde Frage. Wie heißt deine Mutter mit Mädchennamen?“
„Meine Mutter ist tot.“ entgegnete Christopher.
„Sie hatte doch wohl trotzdem einen Mädchennamen.“ beharrte Rebecca – inzwischen leicht gereizt.
„Schon. Ich weiß ihn auch. Und du?“
„Äh...“ machte sie und Christopher konnte sehen, wie sie die Waffe ein wenig sinken ließ.
„Was soll das werden?“ erkundigte er sich vorsichtig.
„Ich will sichergehen, dass du nicht der Dämon bist.“
„So kriegst du das aber nicht hin.“ erklärte er ihr, „er war in meinem Kopf.
Er wusste alles, was ich weiß.“
„Das ist sehr schlecht. Für uns beide.“ Die Waffe ging wieder nach oben und Christopher spürte den Schweiß auf seiner Stirn. Doch genau in diesem Moment kam ihm jemand zur Hilfe. Michelle hatte Rebeccas Einstiegsworte durch die offene Haustür gehört. Sie war schon fast oben gewesen und bei dem Versuch zu bremsen abgerutscht und unsanft auf den Stufen aufgeschlagen. Der Schmerz in ihren Schienbeinen hatte zunächst einmal alles andere verdrängt und es hatte eine Zeit gedauert, bis sie sich hatte aufrappeln können. Dann war sie nach unten gehumpelt. Und stand nun hinter Christopher in der Tür:
„Becca?“ fragte auch sie noch einmal.
„Michelle?“ kam erneut die Gegenfrage.
„Was machst du?“ überging sie diese.
„Sie versucht, meine Identität zu klären.“ kam die Antwort von Christopher.
„Deine...?“ Michelle brauchte einen Moment, um die Kurve zu kriegen, „der Dämon ist weg.“ rief sie dann aus.
Leider blieb die Waffe weiterhin, wo sie war: „Sicher?“
„Frag Z, frag Geraldine, frag... die beiden.“ führte Michelle den Satz ein wenig seltsam zu Ende. ‚Annie‘ hatte sie eigentlich sagen wollen, doch diese kannte die Geschichte schließlich auch nur vom Zuhören und war daher als Zeugin kaum geeignet. Zum Glück schien Rebecca ihren Versprecher entweder nicht bemerkt zu haben oder nicht beachten zu wollen:
„Wo sind die?“
„Z – zuhause. Oder bei Becka.“ fügte Michelle nachdenklich hinzu,
„Geraldine – spazieren. Sie kommt bestimmt bald wieder. Oder du rufst sie an.“
„Das werde ich. Aber vorher...“ wandte sich Rebecca wieder an Christopher, „verhafte ich dich.“
„Das trifft sich gut.“ stimmte dieser zu, „ich war sowieso gerade auf dem Weg zu dir.“
„Wir, besser gesagt.“ korrigierte Michelle.
Rebecca stutzte: „Das glaube ich euch nicht.“
„Ist aber die Wahrheit. Ich wollte dir nur nicht meine Neon-Leggins zumuten. Daher war ich noch kurz drin und...“
„Du hast Neon...?“ Rebecca brach ab, „ach... ihr verwirrt mich.“
„Muss nicht sein.“ erwiderte Christopher hastig, „nimm einfach die Waffe runter und...“
„Niemals.“
„Becca. Sieh her.“ Michelle schaltete die Außenbeleuchtung ein, was Rebecca ein leises „Uah…“ entlockte, von dem sie nicht wusste, ob es auf die Helligkeit oder die Hose bezogen war, und griff Christopher in die Tasche, „ich nehme dieses Handy. Und rufe Z an. Und dann gebe ich es dir.
Okay?“
Die Waffe wippte auf und ab, als Rebecca nickte: „Okay.“
Michelle hielt sich das Handy ans Ohr: „Mist – Mailbox.“
„Dann ist er wohl bei Becka.“ überlegte Christopher.
Sie konnten Rebecca schnauben hören: „Was ist das für eine Logik?“
„Sie hatte einen Todesfall auf der Arbeit.“ klärte Michelle sie auf.
„Ich war es nicht.“ warf Christopher ein und fing sich dafür von seiner Frau einen konsternierten Blick ein. Er hob entschuldigend die Hände und sie wedelte wieder mit dem Handy:
„Dann probiere ich es bei Geraldine. Keine Panik, okay?“
„Nach wie vor: Okay.“ gab Rebecca zurück.
„Geraldine?“ Michelle atmete tief aus, als sie die Stimme am anderen Ende vernahm, „Rebecca ist hier. Mit einer Waffe. Und wir bräuchten jemanden, der ihr versichert, dass Chris wieder Chris ist. Bevor sie glaubt, einen Dämon zu erledigen. Was mit einer Schusswaffe im Übrigen gar nicht geht.“
fügte sie laut hinzu, sodass Rebecca es auf keinen Fall überhörte.
Was sie nicht tat – wenn sie sich davon auch nicht beeindrucken ließ: „Ich werde sie nicht runternehmen.“
„Schon gut. Wann seid ihr...?“ Michelle lauschte kurz, „gut. Sehr gut. Ein paar Minuten.“ informierte sie Rebecca und steckte das Handy wieder in Christophers Tasche.
„Wird dir nicht der Arm schwer?“ fragte dieser mitfühlend.
Rebecca lachte humorlos: „Ich bin gut trainiert.“
2
Es dauerte wirklich nur wenige Minuten, bis Geraldine und Annie eintrafen und das allein reichte aus, um Rebecca zu überzeugen, dass Christopher wieder er selbst war.
„Mitnehmen muss ich dich trotzdem.“ erklärte sie bedrückt.
Christopher nickte ruhig: „Wie gesagt – ich wollte gerade zu dir.“
„Ehrlich?“ Annie zog die Brauen hoch, „nun also doch?“
„Ja, ich habe mich durchgesetzt.“ erwiderte er.
„Du? Dich?“ Annie und Geraldine sahen sich an.
„Überrascht?“ Christopher runzelte leicht pikiert die Stirn.
Annie nickte: „Ich hätte es eher andersrum erwartet.“
„Tja.“ schaltete sich Michelle ein, „so sind wir. Dürfte ich mich dann noch umziehen?“
Rebecca nickte und deutete Christopher, ebenfalls nach drinnen zu gehen:
„Warten wir dort, wo uns keiner sieht. Sonst stehen gleich alle Nachbarn an den Fenstern.“
„Du meinst, dass tun sie nicht schon längst?“ rief Michelle leicht spöttisch von oben – doch sie ignorierte dies und blieb ihm Türrahmen des Wohnzimmers stehen – die Waffe erhoben und Christopher fixierend, der sich vorsichtig auf einen Sessel gleiten ließ.
„Setz dich ruhig.“ forderte er sie auf, doch sie schüttelte den Kopf. Ließ den Blick flüchtig durchs Zimmer gleiten – so, als suche sie nach einer potenziellen Fluchtmöglichkeit – und blickte ihn dann weiter starr an.
Christopher senkte den Blick, während Geraldine und Annie, die in der Ecke standen, einen unsicheren wechselten. Zum Glück mussten sie nicht lange warten, dann erschien Michelle wieder am Fuße der Treppe:
„Können wir auf die Handschellen verzichten?“
„Das hoffe ich doch.“ Rebecca sah Christopher an, der nickte und sich erhob.
Rebecca ließ ihn passieren und auch Geraldine und Annie wollten sich an ihr vorbei durch die Tür quetschen, doch sie versperrte ihnen den Weg.
„Was soll das?“ fuhr Geraldine entrüstet auf und kramte ihren Autoschlüssel hervor, „wir kommen mit.“
Aber Rebecca schüttelte den Kopf: „Michelle... kann hinterherfahren.
Zivilisten nicht im Polizeiauto. Und Außenstehende nicht beim Verhör.“
„Aber wir...“ setzte Geraldine erneut an und wurde ein weiteres Mal ausgebremst:
„Ihr werdet zu gegebener Zeit Gelegenheit haben, euch zu äußern.“
Annie sah Rebecca vorwurfsvoll an: „Du bist aber nicht sehr freundlich.“
„Ich mache meinen Job.“ Rebecca seufzte, „ich würde auch viel lieber mit euch Kaffee trinken. Aber das ist ein Mordfall. Und er der Mörder.“
„Kannst du das beweisen?“ zischte Michelle scharf.
„Das...“ begann Rebecca, doch es war Christopher, der den Satz zu Ende brachte:
„...muss sie nicht.“
Michelle schlug sich auf die Stirn: „Christopher...“
„Ich gestehe alles. Auch schriftlich.“ fuhr er ungerührt fort.
„Nein, das tust du nicht.“ fauchte Michelle.
Rebecca tippte sich an die Lippen: „Ich denke...“
„Halt du dich da raus.“ fauchte Michelle nun in ihre Richtung.
„...dass Michelle Recht hat.“ vollendete Rebecca in Richtung Christopher.
„Was?“ entfuhr es diesem.
„Was?“ entfuhr es auch Michelle.
Rebecca tippte weiter: „Wenn du jetzt alles zugibst, dann ist das Ganze in Null-Komma-nichts durch.“
„Und?“ Christopher legte den Kopf schief, „ist doch gut?“
„Gibt aber deinem Anwalt keine Chance, eine Strategie zu entwickeln.“
entgegnete Rebecca.
„Strategie?“ wiederholte Christopher entgeistert.
Rebecca holte tief Luft: „Du hast ihn doch nicht einfach da runtergeschubst, weil du gerade Lust darauf hattest. Er war ein Auftragskiller. Der euch verfolgt hat. Und Leute dabei verletzt. Das sind Umstände, die es zu bedenken gilt. Aber das wird nur geschehen, wenn du den Personen um dich herum – den Profis – die Möglichkeit gibst, es richtig anzufangen. Sich Gedanken zu machen. Nachzuforschen.“
„Ich nehme es zurück.“ sagte Annie entschuldigend, „du bist doch nicht unfreundlich.“
„Vielen Dank.“ Rebecca lächelte schwach, „und nun sollten wir gehen.“ Sie deutete Christopher, mit ihr zu kommen, doch dieser blieb zunächst stehen:
„Und was sage ich nun?“
„Erstmal nur einen Satz.“ antwortete Rebecca, „und den wirklich gerne schriftlich.“
Michelle runzelte die Stirn: „Der da lautet?“
„Ich will einen Anwalt.“
3
Auf dem Revier war kaum etwas los um diese Zeit. Rebecca packte Christopher in einen der Verhörräume und wies Michelle einen Platz auf dem Flur zu.
„Müsste da nicht auch schon ein Anwalt dabei sein?“ fragte Michelle kritisch.
„Ich stelle ihm keine Fragen.“ entgegnete Rebecca, „ich erkläre ihm nur ein paar Sachen. Das hier...“ Sie deutete um sich, „...ist nur die offizielle Aufmachung.“
Michelle biss sich auf die Lippen: „Warum tust du das?“
„Ich bin in all den Jahren, die ich diesen Dienst nun schon tue, zwei Mal in tödlicher Gefahr gewesen. Das erste Mal durch den Mann, den Christopher wahrscheinlich umgebracht hat. Und das zweite Mal durch den Dämon, der Christopher in seiner Gewalt hatte.“
„Es ist gut, dass du das glaubst.“ Michelle atmete auf, stutzte dann allerdings, „aber – eigentlich sind das eher Gründe dagegen.“
„Wenn ich es als Polizistin betrachte, vielleicht.“ nickte Rebecca, „aber wenn ich es als Christin betrachte, dann zeigt es mir, wie wichtig das ist, was ihr tut. Und das werde ich unterstützen. Wenn das hier falsch läuft, kann alles kaputt gehen. Und dafür will ich keine Verantwortung übernehmen. Ich werde mich nicht außerhalb des gesetzlichen Rahmens bewegen. Aber den werde ich ausloten, wo ich nur kann.“
„Danke.“ Michelle ließ sich schwer auf einen Stuhl fallen und lächelte Rebecca an.
Diese jedoch blieb ernst: „Dieser Fall wird nicht lange in meiner Hand bleiben – ganz egal, was ich tue. Ich habe eine bestimmte Funktion im rechtlichen Ablauf. Diese Funktion ist fast erfüllt. Danach... sind mir die Hände gebunden.“
„Trotzdem – danke.“
Nun rang sich auch Rebecca ein Lächeln ab. Allerdings nur kurz: „Es wird nicht lange dauern...“ Mit diesen Worten betrat sie den Verhörraum und Christopher blickte sie müde an:
„Was passiert jetzt?“
„Ich rede – du hörst zu.“ klärte Rebecca ihn auf.
„Hm... ich bin verwirrt.“
„Weil?“
„Ich das andersrum erwartet hatte.“
„Tja. Normalerweise...“ Rebecca fuhr sich übers Kinn, „aber das hier ist nicht normal. Das wissen wir beide.“
Christopher legte den Kopf schief: „Und hilft uns das?“
„Ich stehe auf deiner Seite.“ erklärte sie, „darüber hinaus... nicht wirklich.“
„Das ist schade.“
„Ich werde tun, was ich kann. Ein Mord ist aber nun mal ein menschliches Vergehen und unterliegt daher auch menschlichen Regeln. Nicht alle um uns herum glauben, was wir glauben. Oder wissen, was wir wissen. Hinzu kommt, dass der Mord in einem anderen Land passiert ist. Das macht es zusätzlich kompliziert.“
„Politik?“ vermutete er und sie nickte genervt:
„Ganz richtig. Wir haben allerdings einen Vorteil auf unserer Seite: Weder euer Attentäter noch dein Dämon waren... nun... nennen wir es
‚unauffällig‘. Wir haben so einige Leute, die Zeugen von Ereignissen geworden sind, die sie sich nicht erklären können. Das können wir nutzen.“
Christopher kniff die Augen zusammen: „Wir werden nie beweisen, dass...“
„...ein Dämon in dir war? Vielleicht nicht, vielleicht doch.“ Rebecca zuckte die Achseln, „auf jeden Fall können wir es mit einbringen. Was es bewirkt
– keine Ahnung. Grundsätzlich denke ich aber, dass alles hilft, was schuldlindernd wirkt. Deswegen ist es auch so wichtig, dass du jetzt nicht einfach irgendwas rausplauderst, sondern dir sehr genau überlegst, wem du was sagst. Du brauchst einen Rechtsvertreter, dem du vertrauen kannst.
Und du brauchst plausible Erklärungen für alles, was passiert ist.“
„Die habe ich.“ erwiderte Christopher.
„Mag sein. Trotzdem solltest du vorsichtig damit umgehen. Und das beginnt damit, dass du mir überhaupt gar nichts davon erzählst.“
„Wirklich nicht? Ich dachte, das wäre nur die offizielle Variante vorhin gewesen.“
Rebecca schüttelte den Kopf: „Ich bin in erster Linie Polizistin. Alles, was du sagst, muss ich ins Protokoll aufnehmen. Momentan setzt sich mein Protokoll aus den Fakten zusammen, die ich habe – ohne deine Aussage.
Und dabei sollte es auch bleiben. Und... das sage ich dir – denn das, was ich sage, muss nicht mit ins Protokoll – überleg dir gut, wieviel Wahrheit sein muss.“
„Du meinst...“ begann er. Ohne zu wissen, wo er damit hinwollte. Weil er nicht wusste, wo sie damit hinwollte. Sie deutete sein Schweigen allerdings richtig und erklärte es ihm:
„Ich meine, es ist verständlich, dass du das mit dem Dämon für dich behalten willst. Weil es erstmal so aussieht, als würdest du dich damit nur lächerlich machen. Aber unterschätze nicht den Willen der Menschen, an das Böse zu glauben. Es kann dir nützlich sein, wenn du zugibst, dass der Dämon dich in seiner Gewalt hatte, als du den Attentäter...“
„Aber das...“ unterbrach er sie, doch sie übernahm sofort wieder:
„Ich wiederhole mich: Es kann dir nützlich sein, wenn du es zugibst.“
„Ich soll lügen?“ Christopher funkelte sie aufgebracht an.
„Das habe ich niemals gesagt.“ entgegnete sie, „ich sage nur: Überleg dir, was klug ist. Einem übernatürlichen Wesen die Schuld an allem außer dieser einen Sache zu geben, ist es meines Erachtens nach eher nicht. Zumal das der Hauptpunkt der Anklage sein wird. Es ist ein Risiko, damit zu arbeiten. Aber wenn du Erfolg hast, wäre es doch sinnlos, wenn dieser Erfolg das nicht miteinschließen würde.“
Christopher sagte nichts mehr dazu. Und Rebecca hatte nichts mehr zu sagen. Sie erhob sich und deutete Christopher, ihr zu folgen:
„Ich muss dich leider einsperren. Du giltst als fluchtgefährdet.“
Er seufzte: „Für wie lange?“
„Ich schreibe meinen Bericht. Den gebe ich dann meinem Vorgesetzten. Der entscheidet, ob es zur Staatsanwaltschaft geht. Was so gut wie sicher ist. Das wird innerhalb der nächsten 24 Stunden geschehen. So lange dürfen wir dich ohne Anklage festhalten. Und dann... gibt es entweder eine oder nicht.
Wenn nein: Auf Wiedersehen. Wenn ja, bleibst du hier bis zum Prozess.
Beziehungsweise: woanders. Hier haben wir die Kapazitäten nicht.“
„Kann ich...?“ Er deutete auf die Tür, „Michelle...?“
„Michelle ja. Ansonsten nur deinen Anwalt. Wenn du einen brauchst.“
Rebecca öffnete die Tür und ließ Christopher hinaus, „da ich davon ausgehe, dass ihr nicht den ‚großen Ausbruch‘ wagen werdet, lasse ich euch ein paar Minuten hier alleine, während ich den Papierkram fertig mache.
Nutzt die Zeit – ich bin mir sicher, ihr habt euch einiges zu sagen.“
Rebecca ging zu ihrem Schreibtisch und Michelle nahm Christophers Hand:
„Sie behalten dich hier?“
„Ja.“ nickte er, „muss.“
„Was soll ich tun?“
„Erstmal abwarten. Vielleicht bin ich morgen um die Zeit wieder draußen.“
Michelle fuhr sich durchs Haar: „Das glaubst du doch selber nicht.“
„Hm...“ machte Christopher nur.
„Du brauchst einen Anwalt.“ übernahm Michelle daher das Überlegen.
„Ja...“
„Wir kennen keinen Anwalt.“
Er lächelte sie aufmunternd an: „Du wirst schon einen finden.“
„Na danke.“ gab sie ohne jegliches Lächeln zurück, „und dann?“
„Keine Ahnung. Rebecca hat mir geraten, zu sagen, ich wäre schon besessen gewesen, als ich ihn umgebracht habe.“
Michelle sah ihn durchdringend an: „Und da tätest du gut dran.“
„Was?“ fuhr er auf, „du auch?“
„Christopher – wach auf. Dämon istgleich schlecht. Du – bist gut. Willst du das wirklich auf dich nehmen? Willst du dich aus dem Verkehr ziehen?
Wegen ihm?“
„Er hat damit nichts zu tun.“
„Und du bist der Einzige, der das wirklich weiß.“ erinnerte sie ihn, „mach jetzt bitte keinen Fehler.“
„Ich soll die Verantwortung einfach wegpusten?“ Er tippte sich auf die Brust, „das war ich – ich allein.“
Michelle griff nach seinem Finger und hielt ihn fest: „Und ich bin mir sicher, du wirst 1.000 verschiedene Wege finden, dafür Buße zu tun. Bei denen du leidest bis zum Abwinken. Aber hier geht es nicht nur um dich. Ich brauche dich. Valentina braucht dich.“
„Valentina?“ Christopher runzelte die Stirn, „was ist mit ihr?“
„Äh...“ Michelle ohrfeigte sich innerlich dafür, dass ihr das herausgerutscht war. Doch als Christopher ihr anklagend „Sie ist da – ich weiß. Aber sie hat nicht wirklich was gesagt außer ‚Hallo‘. Und du auch nicht.“
entgegenschleuderte, sah sie eine Möglichkeit, es doch noch positiv einzusetzen:
„Das ist eine sehr lange, sehr traurige Geschichte, die hier nicht her passt.
Und genau deswegen ist es so wichtig, dass du dich jetzt nicht stur stellst.
Nutze die Möglichkeiten, die sich dir bieten.“
„Ich habe ein Gewissen.“ brummte Christopher und brachte damit Michelles Geduldsfaden zum Reißen:
„Hättest du ein Gewissen – zumindest ein so starkes – dann wäre das gar nicht passiert.“ fauchte sie ihn an.
Christopher zuckte wie getroffen zusammen: „Michelle, das war gemein.“
„Na und?“ ließ sie sich davon nicht beeindrucken, „ich weiß, was du tust: Du drückst dich.“
„Eben gerade nicht.“ widersprach er.
„Der Attentäter ist tot. Ihm kannst du nichts mehr Gutes tun. Aber wir sind alle noch am Leben. Und uns hast du genauso verletzt wie ihn. Auf einer anderen Ebene, aber das ist nur bedingt besser. Und: Das sind die Wunden, um deren Heilung du dich kümmern musst.“
„Michelle...“ wollte er ansetzen, doch sie winkte ihn still:
„Becca kommt zurück. Versprich mir, dass du darüber nachdenkst.“
„Ich...“
„Versprich es mir.“ Sie bohrte ihren Finger in seinen Bauch und er nickte resignierend:
„Ich verspreche es dir.“
Michelle ließ Christopher stehen, nickte Rebecca zu und verließ das Revier.
„Das sah nicht gut aus.“ stellte Rebecca – ihr hinterherschauend – fest.
„Wir sind uns ein wenig... uneins.“ Er kratzte sich nachdenklich am Kinn.
Und wurde im nächsten Moment von ihr den Flur hinuntergeschoben:
„Das meinte ich. Christopher – nur für den Fall, dass du es noch nicht verstanden hast: Jetzt... brauchst du jeden Verbündeten, den du kriegen kannst.“
4
Von dem Moment an, wo Michelle den Haustürschlüssel ins Schloss steckte, bemühte sie sich, so leise wie möglich zu sein. Sie wollte mit den anderen nicht mehr reden, sondern einfach nur noch schlafen. Und sie schaffte es wirklich. Denn Geraldine und Annie hatten zwar versucht, wach zu bleiben, waren aber irgendwann von der Erschöpfung übermannt worden. Am nächsten Tag stellte sie sich dann ihren Fragen. Auch Z und Becka waren dazugekommen. Valentina ebenfalls. In knappen Worten fasste Michelle die Geschehnisse des Vorabends zusammen und fügte dann ernst hinzu:
„Christopher hat mir eine Botschaft für euch mitgegeben. Für euch alle.“
„Ja?“ Sämtliche Anwesenden sahen sie gespannt an.
„Die nächsten Wochen werden nicht leicht für ihn werden. Aber ihr habt alle eure eigenen Sorgen. Oder auch Freuden. Gerade Geraldine und Z haben in den letzten Wochen sehr viel erleiden müssen. Es wird Gelegenheit geben, sich damit auseinanderzusetzen. Sich zu vergeben. Aber jetzt müssen wir alle durch das durch, was akut vor uns liegt. Kümmert ihr euch um euer Leben. Damit es nicht auch noch aus den Fugen gerät.“
Geraldine klappte den Mund auf: „Das ist seine Botschaft?“
„Das ist eine dumme Botschaft.“ murmelte Annie.
„Ja – wir wollen ihm helfen.“ ereiferte sich auch Z.
Michelle blickte ihn skeptisch an: „Und wie sollte das gehen?“
„Na – wir waren doch dabei.“
„Wir können aussagen.“ stimmte Geraldine ihm zu.
„Okay.“ Michelle hob die Hand, „vielleicht habe ich die Botschaft nicht ganz richtig wiedergegeben. Natürlich werdet ihr aussagen und all das. Aber das sind Sachen, die gesetzlich sowieso sein müssen. Ihr seid Zeugen. Und wenn es zum Prozess kommt, führt gar kein Weg dran vorbei. Aber es geht ihm um das darüber hinaus. Ihr könnt für ihn beten, ihr könnt an ihn denken. Aber ihr sollt nicht nur rumsitzen und darauf warten, dass bei ihm was passiert. Hört nicht auf, selbst zu leben. Übernehmt nicht seinen Stillstand.“
„Hm...“ Annie kratzte sich missmutig am Kinn, „wie soll ich mich denn auf was anderes konzentrieren?“
„Ich habe es ausgerichtet.“ brummte Michelle, „das ist das, was er wollte.
Und ich denke, er hat recht. Wir werden ihn alle unterstützen, wo wir nur können. Aber das Leben gönnt uns keine Pause.“
Z seufzte: „Nun gut. Wenn er das so will...“
5
Den Tag über gelang das allerdings keinem von ihnen. Was in erster Linie daran lag, dass sie auf den Anruf von Rebecca warteten. Er kam um kurz vor 18 Uhr, als sie alle zusammen im Wohnzimmer saßen und als Michelle nach kurzem zuhören wortlos den Hörer sinken ließ, wussten sie genau, was sie ihnen gleich sagen würde. Sie hörten Rebecca laut „Hallo?“ rufen, daher schnappte sich Z das Telefon und dankte ihr für ihren Anruf. Als er aufgelegt hatte, sprach Michelle es dennoch aus:
„Sie werden Anklage erheben. Wegen Mordes. Der Staatsanwalt sagt, es würde die Beziehungen mit Frankreich belasten, wenn dieser Fall nicht reibungslos abgewickelt wird.“
„Und was heißt das?“ Annie sah Michelle entsetzt an.
Diese ließ den Kopf hängen: „Dass ich jetzt wirklich ganz dringend nach einem Anwalt suchen muss...“
6
Michelle tat jedoch erst einmal nichts dergleichen, sondern verzog sich ins Schlafzimmer, begleitet von Valentina, die – trotz ihrer eigenen Probleme – sehr gefasst wirkte. So übernahm Geraldine das Ruder:
„Wir kennen einen Anwalt.“ wandte sie sich an Annie, „deinen Anwalt.“
„Meinen...?“ Annie schrak zusammen, „äh... öh... üh... nein. Bloß nicht.“
„Das hat ja nichts mit dir zu tun.“ beharrte Geraldine.
„Trotzdem...“
„Ich rufe Steve und Katiana an.“
Annie versuchte noch, Geraldine davon abzuhalten, doch diese griff zum Telefon. Als sie kurz darauf auflegte, war ihre Miene düster, was Annies Miene deutlich erhellte:
„Klappt nicht.“
Geraldine schüttelte den Kopf.
„Aber... aus reiner Freundschaft.“ wandte Z ein – und übersah dabei Annie bösen Blick, „mit uns ihn gerettet... habend...“
„Keine Chance.“ winkte Geraldine ab, „Steve hat sich nicht näher dazu ausgelassen. Aber sein ‚Nein‘ klang sehr endgültig.“
„Prima.“ entfuhr es Annie und nun war es Z, der sie böse anschaute:
„Freut mich, dass du dich freust. Hast du eine andere Idee?“
„Ehrlich gesagt... ja.“
Z starrte sie an: „Ja?“
Auch Geraldine blinzelte verwundert – und gleich nochmal, als Annies Vorschlag kam:
„Sarah und Sebastian.“
„Die Pflegeeltern von Linda? Die sind nicht Anwalt. Äh... keine Anwälte.“
„Nein.“ stimmte Annie zu, „aber sie kennen einen. Den von Heike.“
„Oh.“ machte Geraldine überrascht, „aber...“
„Und der kennt uns.“ fuhr Annie über sie hinweg fort, „und soweit ich mich erinnere, war er zwar skeptisch aber durchaus offen für die... ‚besondere Würze‘ des damaligen Falles.“
„Hm...“ Z brummte nachdenklich, „das klingt wirklich nicht schlecht. Hast du die Nummer?“
„Kann ich raussuchen. Beziehungsweise: Michelle fragen.“
„Damit sollten wir aber lieber warten, bis...“
„Hier wird gar nichts gewartet.“ erklärte Geraldine schnell – und verbesserte sich noch schneller: „Gar nicht... gewartet.“
Annie grinste sie an: „Sehe ich auch so. Wir sollten das erledigen, bevor wir alle nicht mehr richtig sprechen können.“
„Haha.“
„Michelle wird uns dankbar sein, wenn wir ihr ein Ergebnis liefern können.“ schaltete sich Becka mit einem Mal mit ein, „sehr schnell.“
„Nun gut.“ Geraldine sah Annie an, „dann geh du hoch und frag.“
Annie nickte: „Mit Vergnügen. Okay... ohne Vergnügen. Aber... ach...“
„Geh einfach.“
7
Herr Bartesque, der Anwalt, der Heike vertreten hatte, war zwar unterwegs, aber über Handy zu erreichen. Und er wirkte nicht abgeneigt, als Geraldine ihm schilderte, worum es ging. Er konnte sich ohne Probleme an sie alle und den damaligen Fall erinnern und wie Annie schon richtig festgestellt hatte, war er ihnen durchaus wohlgesonnen. Wenn er auch zunächst vorsichtig blieb und sich das Recht vorbehielt, mit einer Entscheidung zu warten, bis er mit Christopher gesprochen hatte. Geraldine stimmte dem zu – auch wenn ihr bewusst war, dass Christopher erst einmal selbst zustimmen musste. Doch ein erstes Gespräch war bestimmt für beide Seiten gut. Herr Bartesque versprach, sich am nächsten Tag auf dem Revier zu melden und Geraldine stieg erneut nach oben, um Michelle diese Nachricht zu überbringen. Sie dankte ihr unter Tränen und bat dann darum, schlafen zu dürfen. Valentina kehrte mit Geraldine ins Wohnzimmer zurück. Sie wirkte angespannt und Annie sprach sie schließlich darauf an:
„Es macht dir zu schaffen, nicht wahr?“
„Ja, das tut es. Aber nicht nur das. Ich habe selbst eine Situation, um die ich mich kümmern muss.“
„Dann mach das.“ ermunterte Becka sie, „du hast Christopher doch...“
„Natürlich tue ich das.“ unterbrach Valentina unsanft, „aber... er hat euch.
Und ich? Ich bräuchte auch jemanden, der mir beisteht. Ich will euch nicht volljammern, aber... die Aussicht, dass Christopher und Michelle mir in dieser Zeit beistehen, was das Einzige, was mich am Leben erhalten hat.
Jetzt... müsste ich eigentlich ihm beistehen. Was ich nicht kann. Aber wie gesagt... er hat euch.“
„Wir können dir auch helfen.“ Geraldine sah in die Runde, „wir sind ja zu mehreren.“
„Ja.“ kicherte Annie, „zu einigen mehreren sogar.“
Valentina wiegte mit dem Kopf: „Das ist nett von euch, aber... ich brauche keine detektivische Hilfe. Ich brauche emotionale Hilfe. Und da nützen mir keine Fremden. Versteht das nicht falsch – ihr seid alle nette Menschen.
Aber...“
„Oh – wir haben das schon richtig verstanden.“ beruhigte Becka sie.
„Dann können wir dir aber auch wirklich nicht helfen.“ sinnierte Annie und Valentina nickte:
„Nein, das könnt ihr nicht. Und da ich es auf der einen Seite nun wirklich angehen muss – und hier auf der anderen Seite eher im Weg bin – werde ich mich morgen auf den Heimweg machen.“
„So überstürzt?“ Geraldine sah sie unsicher an.
Wieder nickte Valentina: „Es hat keinen Sinn, länger zu warten.“
8
Er stand an dem Berghang und blickte über das Land. Man konnte hier kilometerweit sehen. Doch das war für ihn nicht relevant. Das, was er sehen wollte, lag lediglich ein paar 100 Meter unter ihm. Ein großes Holzhaus, das von einem hohen Zaun umgeben war. Die Winterresidenz seines Opfers. Es war gar nicht mal schwer gewesen, sie ausfindig zu machen. Er hatte nur der Spur des Schiffes folgen müssen. Sein Opfer mochte ein Mensch sein, über den niemand gerne sprach. Seine Yacht dagegen war überall, wo sie anlegte, ein Gesprächsthema. So hatte er keine Mühe gehabt, im Hafen in der Nähe der Sommerresidenz ein Foto davon aufzutreiben, das einer der Ansässigen gemacht hatte. Mit diesem Foto hatte er sich auf die Suche gemacht. Die Informationen, die er zu seinem Opfer grundsätzlich hatte, hatten ihm dabei geholfen. Er mochte die Kälte nicht. Also hielt er sich in einer Gegend auf, in der es im Winter warm war. Ein Hafen mit Fischerbooten war unter seinem Niveau. Und auch, was seine Unterkunft anging, hatte sein Opfer gewisse Vorgaben, die erfüllt werden mussten. Das alles grenzte die Möglichkeiten ein und er hatte sich nicht beeilen müssen.
Sein Opfer würde sich fast vier Monate am selben Ort aufhalten. Den ersten davon hatte es ihn gekostet, den richtigen Hafen zu finden; das richtige Haus zwei weitere Wochen. So war er nun hier – mit dem Wissen, dass er noch mehr als zwei Monate hatte, um alles zu lernen, was er für eine erfolgreiche Ausführung benötigte. Die Probleme hier waren die gleichen wie bei seiner Sommerresidenz: Sein Opfer kam nicht nach draußen und er kam nicht nach drinnen. Dementsprechend war auch sein Angriffsplan derselbe. Und dieses Mal konnte er ihn umsetzen. Dieses Mal hatte er die Zeit genutzt. Nicht nur, um Informationen zu sammeln, sondern auch, um sich auf jede Option bestens vorzubereiten. Er hatte sich einen Platz gesucht, an den er den Raketenwerfer bringen konnte, ohne Aufsehen zu erregen.
Und von dem aus er eine ziemlich lange Zeitspanne hatte, den Wagen ins Visier zu nehmen. Denn auch hier stand seinem Opfer ein gepanzertes Fahrzeug zur Verfügung. Heute nun würde er zuschlagen. Am Tag der Abreise. Wenn der Kreislauf von vorne losging: Eine Zeit auf dem Meer und dann zurück an den Ort, wo sein Auftrag eigentlich hätte enden sollen. Aber dieses Mal war das Warten bis zum letzten Moment Teil des Plans. Und keine Improvisation. Das Garagentor öffnete sich und der Wagen kam heraus. Das Tor im Zaun schwang automatisch auf und der Wagen fuhr hindurch. Hier konnte er kein Gas geben, denn die Straße, die hinab ins Tal führte, war kurvig und steil. Erst fast ganz unten konnte man sorglos beschleunigen. Als der Wagen um die erste Kurve bog, setzte er sich in Bewegung. Er hatte sich ein Fahrrad gekauft, mit dem er den Berg querfeldein nach unten kam. Auch das hatte er geübt in den letzten Wochen und war inzwischen sehr sicher und ziemlich schnell. So kam er lange vor dem Wagen an der Stelle an, an der sein Auto stand. Er holte den Raketenwerfer aus dem Kofferraum und ging damit die letzten paar Meter zu Fuß. Er hatte sich eine kleine Mulde gegraben, in der er sich der Länge nach niederlassen konnte. Den Raketenwerfer positionierte er vor sich und klappte das Visier auf. Es konnte noch eine Weile dauern, bis der Wagen am Fuße des Berges um die Ecke bog, doch er war ganz entspannt. Und nutzte die Gelegenheit, noch einmal mit den Augen die Umgebung abzusuchen.
Weit und breit war niemand zu sehen. Hier standen keine weiteren Häuser und Spaziergänger benutzten nicht die Straße, sondern einen der Wanderwege. Der Wagen kam in Sicht und er legte den Finger auf den Abzug. Das eine Auge fest ans Visier gepresst, nahm er die letzten Justierungen vor. Der Wagen kam direkt auf ihn zu, was es ihm leicht machte, präzise zu sein. Dann drückte er ab. Die Rakete schoss mit lautem Heulen davon und schlug nur eine Sekunde später ein. Der Wagen explodierte mit einem lauten Schlag. Metall und Glas wurden in die Luft geschleudert und regneten direkt wieder auf den Boden herab. Flammen hüllten das Auto ein und verwandelten es in ein schwarzes Gerippe. Er stand auf, packte den Raketenwerfer ein und ging zurück zu seinem Auto.
Jetzt im Nachhinein stellte dieser ein Problem dar, um das er sich kümmern musste, bevor er verschwand. Mitnehmen konnte er ihn nicht, denn je nachdem, wie schnell die Polizei reagierte, wurde er vielleicht angehalten.
Einfach dalassen konnte er ihn aber auch nicht. Denn sonst geriet er am Ende in falsche Hände. Entweder auch die der Polizei, die damit unter Umständen so einiges anfangen konnte. Oder in die Hände eines Dritten, der damit höchstwahrscheinlich rein gar nichts anfangen konnte. Beides war gefährlich – das eine für ihn, das andere für den Rest der Bevölkerung.
Also musste er ihn loswerden. Aber auch dafür hatte er vorgesorgt: Im Kofferraum lag noch eine zweite Rakete. Daneben ein Kanister mit Benzin.
Den er nun aufschraubte und umkippte. Das Benzin ergoss sich auf die Verkleidung des Kofferraums. Er holte ein Schachtel Zigaretten aus der Tasche. Er rauchte nicht, doch für solche Fälle waren sie immer gut zu gebrauchen. Er zündete eine Zigarette an, ließ sie dann in den Kofferraum fallen und schlug den Deckel zu. Dann sprang er auf sein Fahrrad und fuhr so schnell er konnte davon. In der Ferne konnte er schon Sirenen hören.
Dann gab es einen weiteren lauten Knall. Sein Auto war explodiert. Jetzt war alles geschafft. Er erreichte einen kleinen Fluss, an dessen Ufer hohes Gras wuchs. Hier stieg er ab und ließ das Fahrrad hineinfallen. Auch das wollte er lieber zurücklassen. Als Fußgänger war er in dieser Entfernung zum Unglücksort unauffälliger. Weil ihm niemand unterstellen würde, kurz zuvor noch dort gewesen zu sein. Mit einem letzten Blick in die Richtung, aus der die beiden Rauchsäulen aufstiegen, ging er davon.
9
Christopher hatte schlecht geschlafen und das Essen ließ auch zu wünschen übrig. Doch er beschwerte sich nicht. Das gehört für ihn dazu. Er war nun im Bußmodus. Die Zellentür ging auf und er nickte in Richtung des halbleeren Tabletts. Rebecca rollte mit den Augen:
„Da wirst du dich dran gewöhnen müssen.“
„Ob das jemals passiert...“ murmelte Christopher.
„Ich habe mir sagen lassen, es dauert ein paar Jahre.“
Er sah auf: „Jahre?“
„Entschuldigung.“ gab sie trocken zurück, „ich sehe einfach ein bisschen schwarz für dich, wenn du bei deiner Einstellung bleibst. Aber vielleicht kann dein Anwalt dich überzeugen.“
Jetzt war Christopher komplett verdutzt: „Anwalt?“
„Er ist draußen.“
„Anwalt?“ wiederholte er nur.
„Ich schicke ihn mal rein.“ Rebecca verließ die Zelle und kurz darauf trat Herr Bartesque ein:
„Guten Morgen. Und...“ Er wandte sich noch einmal zu Rebecca um,
„könnten wir einen netteren Raum zum Sprechen haben?“
„Natürlich.“
Christopher folgte Rebecca und dem Anwalt von der Zelle in den Verhörraum. Er versuchte krampfhaft, das Gesicht des Mannes einzuordnen. Schließlich gelang es ihm und als sie auf beiden Seiten des Tisches Platz genommen hatten und sich die Tür nach draußen schloss, sagte er:
„Sie waren Heikes Anwalt.“
„Das ist richtig.“ nickte Herr Bartesque.
„Und jetzt kommen Sie zu mir?“
„Oh, ich wurde beauftragt.“
Christopher ließ den Kopf hängen: „Von meiner Frau.“
„So ist es.“ bestätigte Herr Bartesque.
„Und Sie denken, dass das eine gute Idee ist.“
„Haben Sie eine bessere?“
„Nicht wirklich.“ gestand Christopher.
Herr Bartesque lächelte gewinnend: „Dann ist es eine gute Idee.“
„Die einzige Idee ist nicht immer...“
„Ich sage Ihnen mal, wie das läuft.“ unterbrach der Anwalt ihn unsanft,
„reiche Leute geben viel Geld für teure Anwälte aus. Die sind vielleicht nicht besser ausgebildet, aber sie können ihrerseits viel Geld ausgeben. Für Detektive, Assistenten, Untersuchungen, Untersuchungsergebnisse, Zeugen... und alles, was sie sonst noch brauchen. Ich kann das nicht. Denn ich bin kein teurer Anwalt. Und sie sind kein reicher Leut.“
Christopher blinzelte verdutzt: „Ein was?“
„Einzahl von Leute. Aber ich kann Sie auch Klient nennen. Das ist der offizielle Begriff für Ihren Status mir gegenüber. Der Punkt ist: Sie gehören nicht zu den Personen, um die sich ein Anwalt reißt. Dafür leben hier in der Gegend genug Bänker oder ähnliches, an denen man sich eine goldene Nase verdienen kann. Mit Scheidungsrecht oder Arbeitsrecht. Da ist viel zu holen. Ein Mordfall dagegen... Nun – wir sind alle froh, dass es davon recht wenige gibt, nicht wahr? Und ich bin froh, dass Sie nicht drogen- oder alkoholsüchtig sind. Auch wenn das, was mir bisher berichtet wurde, durchaus in diese Richtung interpretiert werden kann.“
„Ich bin nicht...“ setzte Christopher empört an und der Anwalt winkte ab:
„Ich weiß. Das ist ja der große Vorteil: Ich weiß. Eben gerade weil wir uns schonmal unter ähnlichen Umständen begegnet sind. Sie können meine Einstellung damals und auch heute als schädigend oder hinderlich betrachten. Das ist mir egal. Fakt ist, dass ich einen Vorsprung habe vor allen anderen, die sonst durch diese Tür kommen könnten.“
„Aber sind Sie denn auch offen? Für das, was ich zu berichten habe?“
„Nun...“ Herr Bartesque tippte sich ans Kinn, „wir haben damals gewonnen, oder nicht?“
„Gewonnen?“ fuhr Christopher auf, „Heike wurde weggesperrt.“
„Das war zu keinem Zeitpunkt zu vermeiden. Schließlich ist es immer noch ein Rechtssystem, das für ein Vergehen eine Strafe vorsieht. Aber sie hat das Beste bekommen, was sie bekommen konnte. Und Sie und Ihre Leute hatten einen nicht unerheblichen Anteil daran. Das macht Sie in meinen Augen schonmal zu einem guten Menschen.“
„Wie schön. Hat aber nichts mit meiner Frage zu tun. Und ewig weggesperrt werden...“
„Hm...“ ging der Anwalt wieder dazwischen, „irgendwie... bin ich gerade ein bisschen verwirrt. Aber entwirren wir es mal: Erstens: ewig? Nein.
Heike ist frei und genauso...“
„Frei?“ entfuhr es Christopher.
„Ja. Nicht gewusst?“
„Nein.“
„Naja – Sie hatten wahrscheinlich...“ Herr Bartesque legte den Kopf schief,
„anderes zu tun. Wie dem auch sei: Auch bei Ihnen besteht kaum Gefahr, dass es auf eine lange Strafe hinausläuft. Zumindest dann nicht, wenn wir es clever angehen. Und genau da ist der Punkt, an dem ich verwirrt bin.
Wenn ich das richtig verstehe, sind Sie derjenige, der darauf pocht, den einen großen Vorteil, den wir haben, nicht zu nutzen. Auf der anderen Seite stehen Sie mir feindselig gegenüber, weil ich nicht daran glaube. Was ist es denn nun?“
„Das sind für mich zwei unterschiedliche Sachen.“ brummte Christopher, ohne den Anwalt anzusehen.
„Klären Sie mich auf.“ bat dieser.
„Ich brauche einen Anwalt, der meine Geschichte glaubt. Das ist das eine.“
„Das wird schwer zu kriegen sein. Praktisch unmöglich. Denn... nach unserem letzten Aufeinandertreffen habe ich mich ein wenig umgehört. Bei den Kollegen, von denen ich weiß, dass sie kirchennah sind. Das, was Sie glauben, glaubt so gut wie kein anderer. Sie gehören zu einer Randgruppe.
Was nicht heißt, dass Sie automatisch unrecht haben, aber... meine Offenheit
– die ich Ihnen bis zu einem gewissen Grad zusichern kann aufgrund meiner vergangenen Erfahrungen – ist das Beste, was Sie kriegen. Sie können es natürlich woanders probieren. Ich gebe Ihnen gerne Kontaktdaten. Ernsthaft. Aber... wenn mir die Kollegen, die Sonntag für Sonntag ihren Vormittag im Gottesdienst verbringen, schon sagen, dass das alles ziemlich unwahrscheinlich klingt, dann...“
„...sind sie immer noch leichter zu überzeugen.“ schloss Christopher den Satz auf seine Weise.
Herr Bartesque hob die Brauen: „Glauben Sie? Glauben Sie, dass jemand, der fest an etwas glaubt, eher davon zu überzeugen ist, dass er das Falsche glaubt, als jemand, der an gar nichts glaubt, davon zu überzeugen ist, dass es etwas gibt, woran er glauben sollte?“
„Jetzt wird es philosophisch.“
„Mag sein. Aber es geht hier um eine grundsätzliche Entscheidung. Wollen Sie meine Hilfe – auch wenn ich nicht wie ein staunendes Kind vor Ihnen sitzen und die Worte von den Lippen ablesen werde?“
Christopher verzog das Gesicht: „Diese Offenheit...“
„...garantiere ich Ihnen. Ich werde Sie nicht auslachen und nicht abtun. Ich werde jeder Spur nachgehen... lassen..., die Sie mir nennen. Aber ich werde eben auch alle Ergebnisse dieser Spuren nehmen und damit arbeiten.“
„Im Notfall auch auf unsaubere Art und Weise?“
„Wie meinen Sie das?“ fragte der Anwalt unsicher.
„Sie wollen, dass ich die Unwahrheit sage.“
„Jetzt drehen Sie es um.“ Der Anwalt lächelte, „clever. Sie hätten Anwalt werden sollen.“
„Bloß nicht.“ wehrte Christopher ab.
„Wahrscheinlich nicht.“ stimmte Herr Bartesque – immer noch lächelnd – zu, „aber zur Antwort auf ihre Frage: Gibt es eine Spur, die ich verfolgen kann, die mich zu einem eindeutigen Beweis führt, dass Sie besessen waren?“
„Wohl eher nicht.“
„Gut. Geklärt. Womit sich die Frage, ob es eine weitere Spur gibt, die mir den Startpunkt dieser Besessenheit aufzeigen kann, komplett erledigt hat.
Wir haben Ihr Wort.“
„Und das meiner Zeugen.“ ergänzte Christopher. Doch das schien dem Anwalt nicht sonderlich viel zu bedeuten:
„Ja, gut. Auch nur Worte. Verstehen Sie? Gericht – Beweise. Worte – können wahr sein, können Lügen sein, können... nun... irgendetwas sein. Fälle mit Religion sind immer schwierig. Weil man sich so viel zurechtlegen und zurechtdenken kann. Sie mögen der Meinung sein, das stimmt alles so. Und ihre Leute auch. Aber... Beweise? Keine. Nur Gefühle. Und... Glaube. Und...
glauben Sie mir das: Glaube kommt vor Gericht gar nicht gut an. Weil man mit Glauben alles rechtfertigen kann, was es auf der Welt gibt.
Hexenverbrennung? Hat Gott uns gesagt. Kreuzzüge? Hat Gott uns gesagt.
11. September? Hat Gott uns gesagt.“
„Das war nicht Gott.“ brüskierte sich Christopher.
„Nicht unserer.“ stimmte Herr Bartesque zu, „aber denen ihrer. Oder wie auch immer. Geht auch nicht darum, das jetzt zu diskutieren. Geht um die Leute, vor denen sie auftreten müssen: Sie können mit ihrem Glauben argumentieren. Und werden damit genau so...“ Er hielt Daumen und Zeigefinger knapp übereinander in die Luft, „...weit kommen. Weil Glaube da drinnen nichts bedeutet. Fakten, Beweise, Argumente. Ärztliche Gutachten, Expertenmeinungen. Wenn Sie diesen Priester wieder dabeihätten, das wäre...“
Christophers Miene hellte sich ein klein wenig auf: „Der ist schon da.“
„Oh.“ machte der Anwalt erstaunt, „sehr gut. Er gilt als Experte. Das haben wir ja schon letztes Mal gesehen. Er ist in diesem Bereich ihre einzige Karte.
Weil man vor den ‚hohen Vertretern der alten Kirche‘ zumindest Respekt hat. Aber sonst... Wir brauchen etwas zum Anfassen, zum Vorführen, zum Zeigen.“
„Schön und gut. Aber was hat das mit meiner Aussage zu tun?“
„Strategie.“ erklärte Herr Bartesque, „Ihre Aussage ist im Grunde erstmal nichts wert. Weil dieser ganze Bereich, worauf Sie Ihre Aussage aufbauen, nichts wert ist. Das kann nicht geprüft werden. Und fällt deswegen durchs Raster. Jedoch... Ihre Aussage bestimmt unsere Strategie. Es gibt zwei Möglichkeiten: Unzurechnungsfähigkeit oder Notwehr. Alles andere fällt grundsätzlich raus. Unfall ginge vielleicht noch. Aber ohne jegliche Zeugen ist das am schwersten. Vor allem, wenn man die Umstände bedenkt.“
„Die da wären?“ hakte Christopher stirnrunzelnd nach.
„Dass Sie ihm mehrere 100 Kilometer hinterher gefahren sind. Da wird automatisch Absicht unterstellt. Da geht Unfall kaum durch. Wir müssen uns also darauf konzentrieren, diese Absicht als ‚nicht böse‘ zu beweisen.
Und das geht entweder, indem wir ihren Geisteszustand in Frage stellen oder, indem wir ihn als den Überbösewicht und Sie als das ängstliche Opfer präsentieren.“
„Und ersteres ist besser, weil...?“
„Es einfacher geht. Und schneller.“ Herr Bartesque wedelte mit den Händen herum, „ich führe Sie vor, Sie sagen Ihren Spruch, der Richter zuckt kurz und entscheidet dann, dass ein Pfarrer, der sich tagtäglich mit solchen Sachen rumplagen muss, in einer derartigen Extremsituation schonmal austicken kann. Nehmen wir die Anschläge von davor hinzu, dann sieht das für uns gut aus. Aber das andere...“
„...klingt auch nicht unmöglich.“ entgegnete Christopher.
„Bedeutet aber, dass wir ihr Opfer konkret vorführen müssen. Die Anschläge sind ein guter Anfang. Aber dafür kann er was weiß ich was für Gründe gehabt haben. Im schlimmsten Fall sagt der Staatsanwalt, Sie hätten ihn provoziert. Und schon... schauen wir in die Röhre. Denn er ist tot und wir haben keinen Beweis, dass das nicht stimmt.“
Christopher sah den Anwalt böse an: „Wir kannten ihn gar nicht.“
„Er hatte Sprachunterricht bei einer Frau, die bei Ihnen im Haus wohnt.“
konterte dieser.
Der Ärger wandelte sich in Erstaunen: „Sie wissen eine ganze Menge.“
„Nicht wirklich. Nur ein paar Einzelheiten, bisher. Was sich ganz dringend ändern muss...“ Herr Bartesque blickte einen Moment nachdenklich in die Ferne. Und zuckte zusammen, als er merkte, dass Christopher bereits weitersprach:
„Dann sollten wir alle gemeinsam dafür sorgen, dass es sich ändert. Ich ändere auf jeden Fall nichts an meiner Meinung: Ich werde die Schuld nicht von mir abwälzen. Wenn wir in den Prozess gehen mit der ganzen Geschichte – auch den Sachen, die laut Ihnen keiner glaubt – dann machen wir das mit der Wahrheit. Denn Lügen fliegen einem um die Ohren.“
Der Anwalt breitete die Hände aus: „Sie sind der Einzige, der es wirklich weiß.“
„Und selbst meine Frau sieht es mir an der Nasenspitze an, wenn ich lüge.“
„Nun gut. Ihre Entscheidung.“
„Das heißt, Sie machen das?“ Christopher konnte seine Überraschung kaum verbergen.
„Das müssen Sie mir sagen.“ erwiderte der Anwalt.
„Ich denke, ich habe keine Wahl.“
„Die haben Sie immer. Sie können es woanders probieren. Ich sage nur, wie die Chancen stehen dürften.“
„Nein, nein.“ wehrte Christopher ab, „Sie sind schon okay.“
„Vielen Dank.“ schnaubte Herr Bartesque.
„Und was die Offenheit angeht...“ brachte Christopher diesen Punkt erneut auf.
„...bleibt es auch unter diesen Umständen dabei.“ stellte Herr Bartesque klar, „ich sehe es als meine Aufgabe, Ihnen alle Möglichkeiten aufzuzeigen.
Und Ihren zu sagen, welche die einfachste und sinnvollste ist. Wenn Sie sich dafür nicht entscheiden, ändert das einiges – meine Bereitschaft für den Job gehört nicht dazu.“
„Was denn dann?“
„Ihre Erfolgschancen. Das Strafmaß. Die andere Lösung hätte wie bei Heike funktionieren können: Krankenhaus und Rehabilitation statt Gefängnis.
Nun wird es Gefängnis – die Frage ist nur, wie lange. Und dann der Prozess: länger, teurer, aufwändiger. Und Sie brauchen noch mindestens eine Person über mich hinaus.“
Christopher kratzte sich am Kopf: „Nämlich?“
„Einen, der Ihnen Beweise liefert.“
„Das ist nicht Ihre Aufgabe?“
Herr Bartesque schüttelte den Kopf: „Ich bin Anwalt. Ich gehe mit Ihnen vor Gericht und vertrete Sie. Ich leiste Überzeugungsarbeit auf Basis dessen, was ich habe. Aber bisher habe ich nichts. Oder sagen wir: so gut wie nichts.
Und das sollte sich ändern. Je mehr ich habe, desto besser kann ich arbeiten.“
„Und die Polizei...?“ Christopher deutete auf die Tür.
„...wird nicht auf mein Kommando hören.“ Herr Bartesque zuckte mit den Schultern, „für die ist der Fall soweit klar. Die haben alles, was sie brauchen.
Das Opfer, den Täter. Der Rest ist unsere Sache.“
„Das klingt irgendwie seltsam.“
„Sie vergessen etwas: Keiner von denen da draußen – von den Offiziellen, meine ich – ist daran interessiert, dass Sie hier möglichst gut bei wegkommen. Die wollen einfach nur Aufklärung.“
„Nun... die Kollegin, die...“ begann Christopher zögernd.
Der Anwalt nickte: „Ihre Freundin? Oder Bekannte? Ja... habe ich gemerkt.
Mag sein, dass sie sich für Sie einsetzen würde. Aber das hier ist kein ‚Ich-mache-was-ich-will‘-Ding. Auch sie hat Anweisungen. Und die kriegt sie nicht von mir. Wenn ich ihr eine Spur liefere – dann kann sie ihr nachgehen.
Aber das muss dann schon etwas sehr Handfestes sein. Ansonsten... werden wir sie vielleicht ab und zu um einen Gefallen bitten können. Aber auch das geht nur bis zu einem gewissen Punkt. Von daher... benötigen Sie – wir – jemanden, der in der Lage ist, uns genau das zu liefern, was wir nun brauchen für unsere enorm komplizierte Strategie.“
„Beweise, dass unser Attentäter, der im übrigen Sven heißt...“
Herr Bartesque klappte den Mund auf: „Das wissen Sie?“
„Der Dämon wusste es.“ erklärte Christopher.
„Hm...“ Der Anwalt strich sich langsam übers Kinn, „das sollten Sie erstmal keinem erzählen. Bis ich drüber nachgedacht habe, ob uns das einen Vorteil oder einen Nachteil bringt.“
„Einen Vorteil, oder? Woher sollte ich das sonst wissen?“
„Daher, dass Sie ihn doch persönlich kannten.“ antwortete der Anwalt,
„und das nur verschwiegen haben.“
„Oh.“ Christopher biss sich auf die Lippen und schwieg.
„Genau – oh. Von daher: Hören Sie auf Ihren Anwalt. Zumindest ab und zu. Ich mache das auch nicht zum ersten Mal. Noch nicht einmal das hier...“
Er deutete auf Christopher, „mache ich zum ersten Mal. Aber zurück zum...“
„Wir brauchen einen Detektiv.“
„So was in der Art, ja.“
Christopher klatschte in die Hände: „Sehr schön.“
„Sehr schön?“ wiederholte Herr Bartesque unsicher.
„Ja. Denn genau sowas in der Art kennen wir.“
10
Emily stellte ihr Fahrrad ab und versuchte, das Schloss zu öffnen, um es fest zu ketten. Doch sie konnte sich nicht mehr an die Kombination erinnern.
Das war eine Katastrophe, denn nur sie wusste sie. Und wenn sie ihr nun nicht mehr einfiel, würde sie nicht nur Fahrrad nicht anschließen können – ihre Brüder würden sie als kleines Mädchen verspotten und ihr Vater sie mit diesem strengen Blick ansehen, den er immer aufsetzte, wenn er enttäuscht von ihr war. Und dann würde sie bestimmt nie mehr wieder ihre eigene Kombination wählen dürfen. Weil auch er sie nicht mehr für fähig hielt. Tränen schossen ihr in die Augen, während sie krampfhaft versuchte, gleichzeitig so zu tun, als würde sie mit dem Schloss hantieren und sich an die Zahlen zu erinnern.
„Kommst du, Emily?“ rief ihr Vater.
„Nicht träumen, kleines Mädchen.“ fügte ihr ältester Bruder hinzu.
Nun brach sie vollends in Tränen aus und es dauerte nur einen Augenblick, da hatten sich alle vier um sie versammelt.
„Du hast die Kombination vergessen.“ sagte ihr Vater.
Ihre Brüder brachen in Gekicher aus, das allerdings sofort wieder verstummte. Sie drehte sich um und sah den Ausdruck auf dem Gesicht ihres Vaters, vor dem sie sich so gefürchtet hatte. Doch er galt nicht ihr, sondern ihren Brüdern, denn als er sich ihr zuwandte, wurde sein Gesicht weich und er ging in die Knie, um ihr direkt in die Augen schauen zu können:
„Geheimnisse sind eine anstrengende Sache, nicht wahr?“
Sie nickte, obwohl sie nicht ganz verstand, was er meinte.
„Wenn man etwas hat, das man niemandem erzählen will, kann es ganz schnell verloren gehen. Deswegen ist es so wichtig, jemanden zu haben, dem wir alles erzählen können. Auch die Kombination zu unserem Fahrradschloss.“ Ihr Vater lächelte sie an. Und die Tränen versiegten:
„Ich habe sie Mister Happy erzählt.“ erklärte sie stolz.
Wieder folgte Gekicher und ihr Vater schaute zu den drei Jungs hoch: „Geht doch schonmal vor und stellt euch an. Die Schlange ist bestimmt lang.“
Ihre Brüder verschwanden und ihr Vater widmete seine Aufmerksamkeit wieder ihr: „Aber Mister Happy kann dir jetzt nicht helfen.“
Sie biss sich auf die Lippen: „Weil er nicht sprechen kann.“
„Weil er nicht hier ist.“
„Oh. Das stimmt.“
Ihr Vater strich ihr über den Kopf.
„Und was machen wir jetzt?“ fragte sie ängstlich, den Tränen wieder gefährlich nahe, „muss ich nach Hause fahren?“
„Aber nein. Stell dein Fahrrad neben meines – dann schließe ich es mit fest.“
„Das ist alles?“
„Naja...“ Ihr Vater fuhr sich über den haarlosen Kopf, „heute Abend werden wir leider deine Fernsehzeit damit verplempern müssen, die Kombination herauszufinden. Durch ausprobieren.“
„Geht das nicht beides gleichzeitig?“ schlug sie vorsichtig vor.
„Hm... ich denke, da lässt sich was einrichten.“
Emily kicherte. Tränen kamen keine mehr. Zwei Minuten später war ihr Fahrrad angekettet und sie machten sich auf den Weg zum Eingang. Ihre Brüder waren schon recht weit vorne angekommen. So würden sie nicht mehr lange warten müssen.
„Hast du denn etwas gelernt?“ hakte ihr Vater leise nach, als sie sich einreihten.
Sie nickte vehement: „Es immer jemandem sagen, der mit dabei ist.“
„Das klingt gut.“
„Und der sprechen kann.“ fügte sie zwinkernd hinzu.
Ihr Vater zwinkerte zurück: „Das ebenfalls.“
Der restliche Tag war einfach nur wundervoll. Ihre Brüder tobten sich irgendwo aus und ihr Vater lag faul im seichten Wasser des Nichtschwimmerbeckens, während Emily um ihn herumplantschte. Es kam nicht oft vor, dass er so viel Zeit für sie hatte. Weil seine Arbeit ihn einfach viel zu sehr in Anspruch nahm. Schließlich kosteten sechs Personen eine ganze Menge Geld. Doch heute hatte er frei. Warum – das wusste Emily nicht. Und es war ihr auch egal. Sie genoss es und war keine Minute traurig darüber, dass ihre Mutter nicht mitgekommen war. Womit sie schon fest gerechnet hatte, bevor ihr ältester Bruder es beim Frühstück verkündet hatte. Ihre Mutter musste ihrer Oma helfen, die mit irgendeiner komplizierten Krankheit, die Emily nicht verstand, im Krankenhaus war.
Normalerweise bedeutete das, dass Emily zu kurz kam. Dass sie den vier Männern hinterherlief, die taten, was sie wollten und sie nur als Ballast ansahen. Heute war das nicht so. Heute stand sie im Mittelpunkt.
Zumindest für ihren Vater. Das Wetter war herrlich, das Mittagessen schmeckte wunderbar, obwohl es kalt und matschig war, und Emily musste lange überlegen, um einen Tag in ihrem Gedächtnis zu finden, an dem sie sich genauso glücklich gefühlt hatte. Es störte sie noch nicht einmal, dass ihre Brüder im Laufe des Nachmittags entdeckten, dass man auch als Schwimmer im Nichtschwimmerbecken Spaß haben konnte und ihre Tobereien dort fortsetzten. Das Größte aber war, als ihr Vater ganz plötzlich etwas aus der Tasche holte, was sie noch nie zuvor gesehen hatte und anfing, Luft hinein zu blasen. Zuerst dachte sie, es wäre ein Ball, doch dann erkannte sie, dass es ein Ring war. Ein Schwimmring. Und da ihre Brüder so etwas nicht mehr brauchten, konnte das nur eines bedeuten: „Ich finde, es ist Zeit, dass wir mal ins große Becken rüber wandern – was denkst du?“
Emily antwortete gar nicht richtig – sie jauchzte einfach nur laut und ihr Vater lachte ebenso laut. Dann hielt er ihr den Ring hin, den sie sich überglücklich über den Kopf zog. Ihre Brüder waren ebenfalls im großen Becken und während sie sonst oft keine Scheu hatten, sich auf Emilys Kosten Scherze zu erlauben, war dies einer der Momente, in denen in ihnen der Beschützerinstinkt durchkam. Sie kam sich fast vor wie eine Prinzessin mit Bodyguards, als sie – umgeben von ihrem Vater und ihren Brüdern – ihre ersten vorsichtigen Versuche unternahm, sich über Wasser zu halten ohne, dass ihre Füße den Boden berührten. Und es gab kein Gekicher und keine dummen Bemerkungen, sondern jede Menge Anfeuerungsrufe. Sie waren ziemlich genau in der Mitte des Beckens, als es plötzlich dunkel wurde. Nicht stockfinster, aber wie zur Abenddämmerung. Eine große Wolke hatte sich vor die Sonne geschoben. Keine weiße Sommerwolke, sondern eine dunkelgraue Regenwolke. Die nicht nur Regen mit sich brachte, sondern ein richtiges Gewitter. Binnen kürzester Zeit blies der Wind den Wolkenbruch über das Freibad und überall fingen die Leute an zu kreischen. Das fand Emily komisch. Schließlich war das auch nur Wasser. Doch als es zum ersten Mal donnerte, fühlte auch sie sich nicht mehr wohl. „Können wir raus?“ murmelte sie leise. Wie um sie zu bestätigen, hallte in diesem Moment eine Durchsage aus dem Lautsprecher, der auf einem – bereits stark schwankenden – Mast neben dem Becken befestigt war: „Aufgrund eines aufziehenden Gewitters bitte ich alle Badegäste, die Becken zu verlassen.“ Die meisten Leute waren bereits draußen und auch ihre Brüder machten sich flink auf den Weg zum Rand.
Emily versuchte, schneller zu paddeln, doch sie kam nicht voran. „Papa?“
rief sie verzweifelt.
„Ich bin da.“ hörte sie seine Stimme direkt neben sich. Er legte ihr einen Arm um den Rücken, zog sie an sich und schwamm dann mit dem anderen Arm auf den Beckenrand zu. Der Wind wurde immer stärker und über sich konnte sie den Bademeister seine Anweisung wiederholen hören.
Zumindest zwei Mal. Dann gab es ein lautes Krachen und praktisch direkt danach ein lautes Platschen. Emily fuhr beide Male zusammen und ihr Vater schwamm noch schneller.
„Was war das?“ stieß sie hervor.
Ihr Vater schüttelte außer Atem den Kopf: „Egal.“
Doch egal war es nicht. Es war sogar sehr wesentlich. Denn beide Geräusche waren durch den Mast erzeugt worden, der mit seinem morschen Holz dem Wind nicht mehr hatte standhalten können. Er war umgeknickt und in das Becken gefallen. Das allein war natürlich noch nicht tragisch. Tragisch wurde es erst durch das, was folgte. Ein Blitz zuckte grell durch den Himmel, der Donner grollte ohne jegliche Verzögerung. Und keine Sekunde später war die Luft um Emily herum erfüllt mit Funken. Der Blitz hatte in den Mast eingeschlagen – der zwar nun auf der Seite lag, durch das dicke Kabel des Lautsprechers aber nach wie vor mit dem Stromnetz verbunden war. Mehrere 1.000 Volt entluden sich in das Becken sowie in die vielen kleinen Pfützen um es herum. Emily schrie laut auf, doch der Schrei währte nicht lange. Der Stromschlag stoppte ihr Herz und sie sackte tot in den Armen ihres Vaters zusammen. Der nicht mehr um sie trauern konnte, denn im selben Moment starb auch er. Die Rettungskräfte machten hinterher den Betreiber des Freibads verantwortlich. Bereits bei mehreren Sicherheitsüberprüfungen war darauf hingewiesen worden, dass ein über die normale Stromleitung betriebener Lautsprecher nichts in der Nähe eines Wasserbeckens zu suchen hatte. Zumindest nicht, wenn er auf einem so labilen Mast befestigt war. Das Freibad wurde geschlossen und erst nach einer gründlichen Sanierung wieder geöffnet. Die Betreiber zahlten den Angehörigen der Opfer große Entschädigungssummen. Was Emilys Mutter kein Trost war. Sie hatte auf einen Schlag ihren Mann und ihre vier Kinder verloren. Da war ihr alles Geld der Welt egal. So wie ihr ging es auch den meisten anderen Angehörigen der insgesamt 37 Todesopfer.
11
Sie saßen alle zusammen im Wohnzimmer: Michelle, Geraldine, Annie, Z und Herr Bartesque. Er hatte eigentlich nur mit Michelle alleine reden wollen. Doch sie hatte darauf bestanden, dass die drei Freunde dabei waren.
„Wir kennen uns ja nun auch schon. Und ich bin immer froh, wenn es viele Leute im Umkreis eines meiner Mandanten gibt, die helfen wollen.“ nahm der Anwalt dies mit einer gewissen Zurückhaltung zur Kenntnis. Was Geraldine nicht entging:
„Aber?“
„Aber ich bin der Meinung, dass es Dinge gibt, die nur meinen Mandanten und seine Frau etwas angehen.“ fuhr er ungerührt fort.
„Und seine Frau ist der Meinung, dass es uns auch angeht.“ blieb Geraldine genauso ungerührt.
Herr Bartesque sah Michelle prüfend an, die keine Miene verzog: „Nun gut.
In diesem Fall halte ich mich natürlich daran. Ich wäre trotzdem dankbar, wenn wir zuvor Ihr aller Verhältnis zu Herrn Weizmann abklären könnten.“
Annie blinzelte verdutzt: „Wer?“
„Er meint Christopher.“ flüsterte Geraldine ihr zu.
„Oh. Klar.“
„Sie wussten nicht einmal, dass er so heißt?“ Der Anwalt runzelte die Stirn.
„Doch, natürlich.“ versuchte Annie schnell, ihn zu beruhigen, „ich habe ihn nur noch nie so genannt... ich habe auch noch nie gehört, dass ihn jemand so nennt. Immer nur Christopher oder Herr Pfarrer.“
„Ja, nun. Ich bin sein Anwalt, nicht sein Freund. Von daher bleiben wir da bitte auf einer förmlichen Ebene.“
„Sie können so förmlich sein, wie sie wollen.“ Annie zwinkerte ihm zu, „ich werde ihn trotzdem Christopher nennen.“
„Und ich werde wissen, von wem Sie reden.“ erwiderte Herr Bartesque mit einem leichten Lächeln.
„Wunderbar.“
So schnell wie es gekommen war, war das Lächeln wieder verschwunden:
„Nun?“
„Nun: Wir arbeiten zusammen.“ erklärte Geraldine, „so wie wir das schon damals getan haben.“
„Gut. Und was genau haben Sie mit dem vorliegenden Fall zu tun?“
„Wir waren die Opfer.“ antwortete Annie und rief damit ein verdutztes Kopfschütteln hervor:
„Bitte?“
„Des Attentäters.“ fügte Geraldine schnell hinzu.
„Es hat nicht geklappt.“ ergänzte Annie noch und zum zweiten Mal bekam sie von Herrn Bartesque ein schwaches Lächeln zurück:
„Das sehe ich.“
„Ja, logisch.“ nickte sie.
„Wie dem auch sei.“ ergriff Geraldine wieder das Wort, „wir waren die, auf die er es abgesehen hatte. Und Christopher hat uns geholfen.“
„Er selbst war also gar nicht betroffen.“ folgerte Herr Bartesque.
„Hm... am Anfang nicht. Am Ende schon.“
„Gut.“
„Äh...“ machte Annie, „da kann man geteilter Meinung sein.“
„Meine Meinung ist in diesem Fall rein rechtlicher Natur.“ klärte der Anwalt sie auf, „wenn Herr Weizmann den Herrn namens Sven nur...“
„Sven?“ ging Annie unsanft dazwischen, „so hieß er?“
„Ja.“ meldete sich Z zum ersten Mal zu Wort, „wusstest du nicht?“
„Woher denn?“
Z sah Geraldine an. „Na... weil...“ begann diese, brach dann aber ab, als sie Annies Gesicht sah:
„Ihr wisst das? Alle?“
„Christopher hat es uns erzählt.“ murmelte Geraldine, „als wir...“
„Okay.“ winkte Annie ab, „schon verstanden.“
Z wandte sich dem Anwalt zu: „Sie wollten etwas sagen.“
„Das wollte ich, ja. Aber wir können hier gleich einhaken, anschließend.
Zunächst: Es ist ein Unterschied, ob jemand eine Tat begeht, um sich selbst zu helfen oder zu schützen, oder um anderen zu helfen oder zu schützen.“
Annie legte den Kopf schief: „Wirklich?“
„Ja. Es gibt da natürlich Abstufungen. Aber wir müssen ja – leider – mit Notwehr als Bekenntnis arbeiten. Und das greift natürlich ganz anders, wenn Herr Weizmann um sein eigenes Leben gefürchtet hat. Im Gegensatz zu nur Ihrem Leben.“
„Nicht sehr nett.“ Annie brummte beleidigt und Geraldine warf ihr einen warnenden Blick zu:
„Aber nachvollziehbar.“
„Und nicht änderbar.“ sagte der Anwalt trocken.
„Also – am Ende war er mit betroffen.“ Annie tippte sich an die Wange, „bei der Geschichte mit dem Feuer war auch er mit auf der Liste.“
„Und wer erst einmal auf so einer Liste steht, kommt da eigentlich auch nicht mehr runter.“ sinnierte Z.
„Davon könnte man ausgehen, ja.“ stimmte Annie zu.
Herr Bartesque nickte: „Das tun wir in diesem Fall. Das hilft.“
Michelle, die die ganze Zeit über schweigend dagesessen hatte, räusperte sich nun: „Sie sagten ‚leider‘.“
Ein weiteres Nicken: „Ich hatte eine andere Vorgehensweise vorgeschlagen.
Aber die...“
„Nämlich?“
„Ich wollte, dass er seine Geschichte mit dem Dämon auf den Mord ausweitet.“
„Ja, das wollte ich auch.“ Michelle seufzte tief.