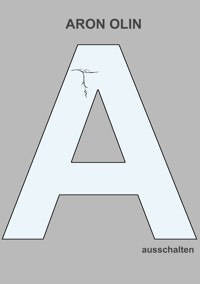Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Books on Demand
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Serie: GABE
- Sprache: Deutsch
Geraldine hat eine Gabe: Sie kann Dämonen sehen. Gott hat ihr dies gegeben. Und damit verbunden einen Auftrag: Menschen zu helfen, die besessen sind. Alleine jedoch schafft sie das nicht. Also macht sie sich auf die Suche nach Mitstreitern und stellt dabei fest, dass es noch andere Menschen mit anderen Gaben gibt. Gemeinsam stellen sie sich der Herausforderung. Und erkennen, dass es selbst mit Gottes Hilfe nicht immer einfach ist, das Richtige zu tun.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 674
Veröffentlichungsjahr: 2024
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Inhaltsverzeichnis
Kapitel 1
Kapitel 2
Kapitel 3
Kapitel 4
Kapitel 5
Kapitel 6
Kapitel 7
Kapitel 8
Kapitel 9
Kapitel 10
Kapitel 11
Kapitel 12
Kapitel 13
Kapitel 14
Kapitel 15
Kapitel 16
Kapitel 17
Kapitel 18
Kapitel 19
Kapitel 20
Kapitel 21
Kapitel 22
Kapitel 23
Kapitel 24
Kapitel 25
Kapitel 26
Kapitel 27
Kapitel 28
Kapitel 29
Kapitel 30
Kapitel 31
Kapitel 32
Kapitel 33
Kapitel 34
Kapitel 35
Kapitel 36
Kapitel 37
Kapitel 38
Kapitel 39
Kapitel 40
Kapitel 41
Kapitel 42
Kapitel 43
Kapitel 44
Kapitel 45
Kapitel 46
Kapitel 47
Kapitel 48
Kapitel 49
Kapitel 50
Kapitel 51
Kapitel 52
Kapitel 53
Kapitel 54
Kapitel 55
Kapitel 56
Kapitel 57
Kapitel 58
Kapitel 59
Kapitel 60
Kapitel 61
Kapitel 62
Kapitel 63
Kapitel 64
Kapitel 65
Kapitel 66
Kapitel 67
Kapitel 68
Kapitel 69
Kapitel 70
Kapitel 71
Kapitel 72
Kapitel 73
Kapitel 74
Kapitel 75
Kapitel 76
Kapitel 77
Kapitel 78
Kapitel 79
Kapitel 80
Kapitel 81
Kapitel 82
Kapitel 83
Kapitel 84
Kapitel 85
Kapitel 86
Kapitel 87
Kapitel 88
Kapitel 89
Kapitel 90
Kapitel 91
Kapitel 92
Kapitel 93
Kapitel 94
Kapitel 95
Kapitel 96
Kapitel 97
Kapitel 98
Kapitel 99
Kapitel 100
Kapitel 101
Kapitel 102
Kapitel 103
Kapitel 104
1
„Am Anfang schuf Gott Himmel und Erde. Und viele 1.000 Jahre später schuf er mich...“
Geraldine machte eine kurze Pause, um diese Worte wirken zu lassen, doch die Reaktion fiel nicht so aus, wie sie das gehofft hatte:
„Wow... sehr krass! Das ist doch mal ein Anfang. Nicht so wie dieser total missglückte erste Versuch.“
Sie rollte mit den Augen: „Freut mich, dass es dir besser gefällt.“
„Nicht so genervt.“ erwiderte Z, „ich wollte dir lediglich meine Anerkennung ausdrücken.“
„Weißt du, wie du sie mir am besten ausdrücken kannst? Indem du mich nicht ständig unterbrichst.“
„Okay, okay, okay...“ Z hob abwehrend die Hände und legte sich eine dann auf den Mund.
„Und außerdem...“ mischte sich Annie ein, gerade als Geraldine fortfahren wollte, „...was war denn so falsch an ihrem ursprünglichen Anfang?“
Die Hand von Zs Mund verschwand. „Das fragst du wirklich? Willst du ihn nochmal hören?“
„Hören?“ wiederholte Annie verständnislos, „was meinst du mit ‚hören‘?“
„Na...“ Z nahm sein Handy, das bisher – von den anderen unbeachtet – vor ihm auf dem Boden gelegen hatte, und drückte ein paar Knöpfe. Geraldines Stimme erklang:
„Es war einmal vor vielen, vielen Jahren, da lebte...“
„Halt!“ hörte man Z, wie er sie zum ersten Mal unterbrach.
„Hm...!?“ machte Geraldine, „was denn?“
„So kannst du doch nicht beginnen!“ gab Z zurück, „deine Geschichte braucht noch eine Überschrift.“
„Was denn für eine Überschrift? Warum denn eine Überschrift?“
„Na... jede gute Geschichte hat doch eine Überschrift.“
Geraldine seufzte laut. „Okay... dann... also: Episode 1: W…”
“Was?“ unterbrach Z sie schon wieder, dieses Mal noch vehementer, „Episode 1? Bloß nicht! Die war einfach grottenlangweilig! Was meinst du, was das in den Zuhörern für Assoziationen weckt?“
Einen Moment lang herrschte Stille, dann fragte Geraldine langsam: “Weißt du, was das jetzt bei mir für Assoziationen weckt?“
„Nein, welche denn?“ fragte Z zurück.
„Gar keine! Ich habe keinen blassen Schimmer, wovon du redest.“
Auch hier mischte sich Annie mit ein: „Ich glaube, er redet von diesem... Star... Dings.“ Sie brach ab.
„Star Dings.“ wiederholte Z sichtlich entgeistert, „Star Dings.“ Jetzt war er mit Seufzen dran. „Auf jeden Fall brauchst du eine anständige Überschrift.“ Geraldine schnaufte spöttisch. „Na... gut. Dann: Wie alles begann.“
Weiter kam sie auch diesmal nicht. Und wieder war es Z: „Das ist ja noch viel schlimmer. Ich denke, wir sollten...“
„Hey, was machst du?“ rief Z, nachdem seine Stimme vom Band so abrupt verstummt war. Annie hatte sich das Handy geschnappt und augenscheinlich auf den Stoppknopf gedrückt.
„Diese Unterhaltung ist fünf Minuten her.“ erklärte Geraldine stattdessen Annies Aktion, „und wir waren alle dabei. Soll ich nun erzählen, oder nicht?“
Z nickte. „Ja...“ Er nahm Annie das Handy aus der Hand und drückte erneut auf den Aufnahmeknopf. „...jetzt.“
Doch diesmal kam Geraldine gar nicht zu Wort – Annie war schneller: „Was soll das eigentlich? Glaubst du, wir beide können uns das nicht merken, was Geraldine erzählt?“
„Das ist nicht für uns, das ist für die Nachwelt.“ klärte Z sie auf.
„Die Nachwelt...“ Annie sah ihn zweifelnd an.
„Na, irgendwann, wenn hier auf der Erde alles ruhig und friedlich ist, werden Kinder ihre Eltern fragen ‚Wie habt ihr das geschafft?‘ und die Eltern werden antworten ‚Wir haben das nicht geschafft.‘ und dann werden die Kinder fragen ‚Wer hat es dann geschafft?‘ und die Eltern werden antworten ‚Da gab es eine Gruppe von Leuten, die... aber hört es euch am besten selbst an.‘ Und dann werden sie die große Box aus dem Schrank holen, die die CDs mit allen unseren Aufnahmen enthält. Und die werden sie einlegen und die Kinder werden sie sich anhören. Eine nach der anderen. Genau wie ihre Eltern vor ihnen und ihre eigenen Kinder nach ihnen.“
Annie lachte: „Du hast echt eine blühende Phantasie.“
Z zuckte lächelnd mit den Schultern: „Zumindest.“
„Zu ist ein gutes Stichwort.“ war es nun Geraldine, die sich einmischte, „im Sinne von Zu-rück. Zu-m Thema. Zu-m Beispiel.“
„Ja, du hast Recht.“ stimmten Annie und Z gleichzeitig zu, „erzähl!“
„Gut.“ Geraldine holte Luft, wartete allerdings einen Augenblick, ob die anderen auch wirklich still blieben. Dem war so und so begann sie: „Also. Es war einmal. Vor vielen... ach nein, das andere: Am Anf... ach, wisst ihr was: egal! Ich fang jetzt einfach so an: Es lebte in einer kleinen Stadt ein junges Mädchen. Das war zumindest die allgemeine Meinung. Sie selbst betrachtete sich nicht als jung. Alle anderen taten das. Und für sie war das ein großes Problem. Denn es war nervig. Allerdings... nun: es kommt auf den Blickwinkel an, nicht wahr? Alle anderen betrachteten sie von sich aus – ihre Eltern, ihre Großeltern, die ganzen Nachbarn und Freunde der Familie. Die waren natürlich auch alle älter und so war sie ‚das junge Mädchen‘ und würde dies sicherlich in 30 Jahren auch immer noch sein. Denn dann waren auch die anderen alle 30 Jahre älter und sie dagegen immer noch jung. Sie selbst betrachtete sich so natürlich nicht, denn ihr eigener Blickwinkel zeigte ja ihr eigenes Leben. Die frühesten Erinnerungen, die sie hatte, waren an den Kindergarten. Da war sie drei gewesen. Jetzt war sie schon 12. Und hatte sehr viel erlebt in den Jahren danach. Also war sie schon alt – im Vergleich zu vorher mit sich selbst. Allerdings noch nicht alt genug, diese Blickwinkelverzwickungen derart zu durchschauen, dass sie ihr nicht mehr auf die Nerven gingen. Viel mehr noch als ‚Du bist aber groß geworden‘ und ‚In dem rosanen Kleidchen sahst du immer so süß aus‘. Dabei hatte sie das rosane Kleid immer nur getragen, weil ihre Großmutter das schön fand und ihre Mutter es schön fand, wenn ihre Großmutter es schön fand. Aber ich schweife ab...“
„...und ich unterbreche...“ war es dieses Mal Annie, die ihr ins Wort fiel.
„Weil?“ fragte Geraldine so geduldig wie sie nur konnte.
„Nun... das Mädchen, von dem du da redest, das bist doch du, oder?“
„Ja...“
„Dann... warum redest du dann von ‚sie‘ und nicht von ‚ich‘?“
„Du meinst, warum rede ich von ‚ihr‘ und nicht von ‚mir‘.“ verbesserte Geraldine.
„Äh... ja, genau.“
„Nun, wenn das alles für den Rest der Welt aufgezeichnet wird, dann ist es dramatisch doch viel sinnvoller, in der dritten Person zu sprechen.“
Ein Blitzen erschien in Annies Augen: „Du meinst dramaturgisch.“
Geraldine musste unwillkürlich lachen. Dann blickte sie um sich: „Soll ich fortfahren?“
Die beiden anderen nickten und Geraldine setzte wieder an:
„Das, was sie jedoch am meisten nervte, das war, wenn sie am Wochenende zu ihrer Großmutter musste, weil ihre Eltern beruflich unterwegs waren. Denn dann musste sie mit in die Kirche. Und zwar wirklich im Sinne von ‚Kirche‘. Ein altes, riesengroßes Gebäude aus Stein mit einer kleinen Tür aus Holz, in dem es immer kalt und vor allem immer zugig war, was sehr seltsam war, wenn man bedachte, dass sich keines der vielen bunten Fenster öffnen ließ und das Einzige, was offen stand die Tür war, durch die von innen gesehen aber immer die Sonne hereinschien. Draußen war auch kein Wind zu spüren, drinnen dagegen schon. Irgendjemand hatte auf ihre schüchterne Frage hin mal unwirsch gemurmelt, dass das der ‚Heilige Geist‘ sei, doch das konnte sie sich nicht vorstellen, denn wenn der wirklich von Gott kam, so wie ihre Großmutter das immer behauptete, dann war ihm sicherlich daran gelegen, dass es ihr durch ihn besser ging und er würde nicht versuchen, ihr bei jedem Besuch eine Erkältung unterzujubeln. Das machte keinen Sinn. Doch darüber hatte sie noch nie mit jemandem gesprochen und daran sollte sich auch nichts ändern. Das war sowieso eine komische Sache, dass der Gedanke, sie sei zu jung, in Momenten wie diesen von ganz alleine kam – ohne, dass es jemand laut aussprach. Doch da musste sie wahrscheinlich durch. Zumal sie ihn sich unter all den anderen Anwesenden auch nicht guten Gewissens verbieten konnte. Schließlich war sie nicht nur die Einzige, die noch keinen Führerschein und keine eigenen Kinder oder Enkel hatte, sondern sogar die Einzige, die zum Sehen und Hören keine Hilfsmittel benötigte und ihre Zähne nicht abends in ein Glas mit Reinigungstablette legte. Hätte ihre Großmutter nicht alleine in einem eigenen Haus gewohnt – ihr Mann, des Mädchens Großvater, war bereits einige Jahre zuvor verstorben – so hätte sie sich gefragt, ob es sich bei der allsonntäglichen Versammlung nicht um einen Ausflug des Altersheims in der letzten Seitenstraße vor dem Ortsausgang handelte. Oder auch nicht. Denn ‚sich etwas fragen‘ oder ‚darüber nachdenken‘ war an diesem Ort nicht gerne gesehen – vor allem nicht laut. Denn dann hätten die anderen antworten müssen und das taten sie nicht gerne. Das hatte sie bereits einige Jahre vorher herausgefunden. Wahrscheinlich, weil sie keine Antworten hatten. Oder welche hatten, die sie nicht verstanden. Stattdessen hatten sie sich alle darauf versteift, ihr über das Haar zu streicheln und sie in die Wange zu kneifen und alle diese Sätze von sich zu geben, die sie so sehr hasste. Und sie hatte sich darauf versteift, es einfach über sich ergehen zu lassen – in dem Wissen, oder besser: der Hoffnung – dass all das irgendwann ein Ende haben würde. Weil alte Leute auch irgendwann mal starben. Und wenn das nicht half, würde zumindest sie ja irgendwann alt genug sein, sich endlich aus dem Staub machen zu können. Alt. Da war es wieder. Das Gegenteil von jung. Sie fühlte sich alt. Aber sie war jung. Nervig war das! Aber das hatten wir schon... und wir wollen auch nicht vorweggreifen. Auf jeden Fall... pünktlich um 10 Uhr begann die Orgel zu dröhnen – in einer Lautstärke und auf einer Frequenz, bei der sogar ihre Zähne zu klappern begannen. Und sie fragte sich sehr regelmäßig – leise natürlich – warum den ganzen alten Leuten ihr Gebiss nicht einfach herausfiel. Gerade wenn sie sangen. Da gab es Momente, da wünschte sie sich fast, den Leuten würden die Zähne ausfallen. Nur, damit sie aufhörten. Der Gesang war unerträglich. Die Orgel mochte laut und schrill sein – zumindest war sie gerade. Die Leute dagegen... jedes Mal schien es mehr Stimmen zu geben als Personen anwesend waren und keine davon schien zu dem zu passen, was der Mann an der Orgel spielte. Sie mochte jung sein, aber sie hatte ein sehr ausgebildetes Gehör. Das hatte sie von ihrer Mutter – genau wie ihre Vorliebe für Musik. Gute Musik. Schöne Musik. Solche Musik dagegen... nun ja. Irgendwann waren Spiel und Gesang vorbei und der lustlose Mann in dem langen schwarzen Umhang schlurfte hoch auf die Kanzel und nuschelte gefühlte Stunden etwas in das nicht verstärkte oder vielleicht noch nicht einmal angeschlossene Mikrophon. Und sie war sich sicher, dass wenn sie es mit ihren jungen, gesunden Ohren schon nicht verstand, es von den schwerhörigen Alten erst recht keiner verstand. Wobei... sie war sich trotz mangelnder Erfahrung relativ sicher, dass... hätte man ihn gehört, wäre es auch nicht besser gewesen. Denn wenn man nach seinem Gesichtsausdruck und seiner Körperhaltung ging, war das, was er zu verkünden hatte, für die Leute wahrscheinlich genauso interessant und hilfreich wie das Vorlesen des Telefonbuchs. Ja, das war sie – die erste Erfahrung mit der Kirche. Natürlich war sie schon in den Jahren davor sehr regelmäßig dort gewesen, doch es war dieser eine Sonntag – mit 12 – an dem sie die entscheidende Entscheidung traf: sobald es irgend ging, würde sie aufhören, hierher zu kommen. Ein für alle Mal! Denn das war der Sonntag, an dem man den Mann auf der Kanzel wirklich mal ein wenig verstand und an dem er davon erzählte, dass man werden sollte, wie die Kinder. Und die ganzen Leute, die alle auf die 100 zugingen, die Lieder sangen, die auf die 500 zugingen und in einem Gebäude saßen, dass auf die 800 zuging, die saßen da und nickten und verstanden zwar vielleicht mal das, was er sagte, aber nicht das, was er meinte. Was sie im Anschluss an den Gottesdienst nur zu deutlich zu spüren bekam, als sie sich wagte, auf einem Bein den Mittelgang entlangzuhüpfen, und von 20 Anwesenden wütende Blicke erntete, bevor der 21ste Anwesende sie schroff am Arm packte und mit brummelnder Stimme nicht etwa bat, sondern aufforderte, damit aufzuhören, schließlich sei das ein Haus Gottes und der mochte so etwas nicht. So kam ich an diesem Tag nach draußen – aus dem kalten Gebäude in die warme Sonne. Auf beiden Beinen und mit einem schmerzenden Arm. Und dem fest gefassten Entschluss, nie wieder eine Kirche zu betreten – es sei denn, ich hatte keine andere Wahl. Zwei weitere Jahre lang hatte ich keine andere Wahl. Dann war ich in den Augen meiner Eltern endlich alt genug, die Wochenenden, die sie nicht da waren, alleine zuhause zu verbringen. Und von einem Tag auf den anderen hörten die Besuche bei meiner Großmutter auf. Und die Gänge in die Kirche auch.“
Sie machte eine Pause und die anderen schauten sie an.
„Was ist?“ fragte Annie.
„Ich mache eine dramati...turgische Pause.“ erwiderte Geraldine, „denn jetzt kommt Episode 2.“
„Du mit deinen Episoden.“ brummte Z.
„Du bist derjenige, der daraus so ein Ding gemacht hat.“ gab Geraldine zurück.
„Ein Dings meinst du wohl.“ kicherte Z, verstummte aber sofort wieder, als er sich Annies Blick bewusstwurde, und fuhr dann ernst fort: „Ich wäre ja dafür, dass wir nicht nur eine turgische Pause machen, sondern eine richtige.“
Geraldine nickte. „Das ist eine gute Idee.“ Sie lehnte sich auf der Couch zurück und legte die Füße hoch.
„He!“ machte Z, der dort saß, „ich bin nicht deine Ablage.“
„Hm... doch... jetzt gerade schon.“ grinste Geraldine.
Z schaute sie böse an. Oder versuchte es zumindest. Es gelang ihm nicht sonderlich gut, denn Geraldine begann nun vollends zu lachen:
„Ach...“ brachte sie zwischen den einzelnen Lachern hervor, „...ich bin schon froh, dass ich dich habe. Euch habe.“ verbesserte sie sich schnell in Richtung Annie, doch die zuckte nur mit den Schultern: „Ich hätte nichts gesagt.“
„Ich schon.“ Geraldines Lachen war verstummt und sie blickte nachdenklich zwischen den beiden anderen hin und her. „Ihr mögt nicht die sein, die ich gesucht habe, aber ich bin überglücklich, dass ich euch gefunden habe.“
Eine Zeitlang sagte niemand etwas. Dann gab sich Z einen Ruck und stand auf. Was zur Folge hatte, dass Geraldines Füße von seinem Schoss auf den Boden purzelten. Und der Rest ihres Körpers ihnen folgte. Sie hatte nicht damit gerechnet und war daher hilflos der Schwerkraft ausgeliefert.
„Ups.“ murmelte Z.
„Die bringen mir jetzt auch nichts mehr.“ brummte Geraldine vom Boden herauf, was Annie wieder zum Lachen brachte. Geraldine sah sie fragend an.
„Das war ein schönes Wortspiel.“ kicherte sie.
Geraldine und Z warfen sich einen verständnislosen Blick zu, doch dann dämmerte es ihnen beiden praktisch im selben Moment.
„Der Knaller!“ murmelte Z.
„War auch gar keine Absicht.“ ergänzte Geraldine, während sie sich aufrappelte, „war einfach nur grammatikalisch falsch.“
„Grammatisch.“ verbesserte Annie triumphierend.
„Grammatikalisch.“ widersprach Geraldine.
„Grammatisch.“ beharrte Annie.
Einige Augenblicke lang sahen sich die beiden Frauen gegenseitig herausfordernd an, dann wandten sie die Köpfe langsam in Richtung Z.
Doch dieser zuckte nur mit den Schultern. „Ich glaube, es geht beides.“ erklärte er und erntete dafür aus beiden Richtungen ein Augenrollen.
„Läuft eigentlich deine Aufnahme noch?“ versuchte Geraldine, das Thema zu wechseln.
„Ja.“ bestätigte er.
„Na, dann haben wir jetzt sogar für die ganze Welt Schleichwerbung gemacht.“ brachte Annie sie gleich wieder zum alten Thema zurück.
„Ich mach es mal lieber aus.“ Z bewegte sich in Richtung Handy, doch Geraldine hielt ihn zurück: „Nein. Es ist schon spät. Und zumindest einen Teil möchte ich euch heute noch erzählen.“
Z nickte, setzte sich wieder hin und sah Geraldine erwartungsvoll an. Annie tat es ihm gleich.
„Schön. Dann geht es jetzt weiter: Nie wieder Kirche! Und das... ist die Überschrift! Genau. Meine Großmutter war sehr traurig, als ich ihr erzählte, dass ich nicht mehr mit in die Kirche kommen würde. Natürlich bot ich ihr an, sie trotzdem zu besuchen, doch jedes Mal begann sie, mich deswegen anzugehen und da ich hart blieb – oder: stur, wie sie es nannte – kam irgendwann der Punkt, an dem ich sie gar nicht mehr besuchen wollte. Was ich dann auch nicht mehr tat. Und so war meine Zeit mit der Kirche erst einmal vorbei. Und die Zeit, in der ich über Gott nachdachte, auch. Denn das hatte ich in all den Jahren schon des Öfteren mal getan. Doch die Ergebnisse waren – auch beeinflusst durch die Leute um mich herum – immer negativ gewesen und in meiner mangelnden Weisheit machte ich einen Fehler, den viele Leute machen: ich setze Gott mit den Menschen gleich, die für ihn standen und...“
Geraldine versuchte, ein Gähnen zu unterdrücken. Es gelang ihr nicht und binnen weniger Sekunden hatte sie die anderen beiden angesteckt.
„Vielleicht sollten wir doch erstmal schlafen gehen...“ murmelte Z und erwartete dafür eigentlich einen Sturm der Entrüstung. Stattdessen erntete er Zustimmung und so taten sie genau das.
2
Am nächsten Morgen wurde Geraldine von der Sonne geweckt. Sie spürte die Wärme auf ihrem Gesicht und öffnete mit verschlafenem Lächeln die Augen – nur, um sie den Bruchteil einer Sekunde später schon wieder zuzukneifen. Sie hatte vergessen, die Vorhänge zuzuziehen und die Sonne schien ihr direkt ins Gesicht. Einen Moment lang sah sie bunte Sternchen innen an ihren Augenlidern tanzen, dann war es vorbei und sie setzte sich – immer noch verschlafen – auf. Aus dem Nachbarraum hörte sie Annies gleichmäßiges Atmen. Sie schlief also noch. Böser Fehler! So leise wie sie konnte stieg Geraldine aus dem Bett und tappte auf Zehenspitzen über den dicken Teppich, der zum Glück jegliches Geräusch verschluckte. Die Tür zwischen den beiden Zimmern stand offen. Ein weiterer Fehler! Denn sie quietschte bei jeder Bewerbung und hätte es Geraldine dementsprechend unmöglich gemacht, unbemerkt von einem Raum in den anderen zu gelangen. So jedoch war das kein Problem und nur wenige Augenblicke später stand sie vor Annies Bett und...
„Buh!“
...machte Annie laut, fuhr ruckartig aus dem Bett hoch und riss dabei die Augen auf. Geraldine stieß einen spitzen Schrei aus und taumelte zwei Schritte nach hinten und dabei mit einem Fuß über den anderen, sodass sie sich unsanft auf den Hintern setzte. Ein weiterer Grund, für den dicken Teppich dankbar zu sein, der auch hier lag – so wie eigentlich fast in jedem Zimmer. Sie atmete schwer ein und aus und starrte unfokussiert vor sich hin, während Annie sich lachend aus ihrer Bettdecke schälte, die sie sich wie einen Schlafsack um die Beine gewickelt hatte.
„Das war gemein!“ stieß Geraldine – immer noch keuchend – hervor.
„Und genau das gleiche, was du auch vorhattest.“ konterte Annie.
Geraldine zog eine Schnute: „Ja... ja... okay... okay...“ Dann musste auch sie lachen und Annie stimmte erneut mit ein. Geraldine rappelte sich auf und Annie stieg aus dem Bett.
„Wo ist der Mann, der uns das Frühstück bringt?“ fragte Annie gähnend und reckte die Nase schnuppernd in die Luft, so als erwartete sie wirklich, Essensduft zu riechen.
„Hm... noch nicht erfunden?“ erwiderte Geraldine achselzuckend.
„Dann sollten wir das schleunigst nachholen.“ sagte Annie mit bestimmtem Nicken und stemmte die Hände in die Hüften. Es klopfte – an der Tür, die zum Flur führte. „Siehst du... hat schon geklappt.“
Geraldine hatte da so ihre Zweifel. Zwar war die Chance ziemlich groß, dass die Person, die geklopft hatte, wirklich ein Mann war – schließlich war Z der Einzige, der sich außer ihnen hier aufhielt – doch dass er ihnen Frühstück bringen würde, wagte sie doch arg zu bezweifeln. Da sie beide nicht laut auf das Klopfen reagiert hatten, öffnete Z langsam die Tür und steckte vorsichtig den Kopf hindurch, eine Hand vor die – wie man deutlich sehen konnte – fest zusammengekniffenen Augen haltend.
„Kann ich reinkommen?“ fragte er.
Annie nickte, was ihm natürlich rein gar nichts brachte, daher sagte Geraldine: „Ja.“
Z schob sich durch den Türspalt. „Kann ich die Hand wegmachen?“
Wieder nickte Annie und Geraldine musste lachen. „Ja.“ brachte sie schließlich hervor.
Z ließ die Hand sinken, mehr allerdings nicht. „Kann ich die Augen aufmachen?“ fragte er stattdessen.
Geraldine sah Annie an. „Wehe du nickst wieder...“ zischte sie leise und Annie erwiderte ihren Blick mit einem Ausdruck purer Verständnislosigkeit. Dann nahm ihr Hirn die letzte Kurve und sie sagte laut: „Ja.“
Z stieß laut hörbar die Luft aus. „Puh, das war ganz schön anstrengend.“
„Äh...“ machte Annie, „...du hattest die Augen zu, nicht den Mund.“
„Aber woher weiß ich denn, was ihr macht, während ich nichts sehe.“
entgegnete Z.
Geraldine schlug sich mit der Hand auf die Stirn und schüttelte resigniert den Kopf.
Annie dagegen blieb ernst: „Das ist eigentlich ein guter Punkt. Oder besser gesagt: eine gute Idee. Vielen Dank dafür. Werde ich gleich morgen früh...“
Weiter kam sie nicht, denn Geraldines Magen meldete lautstark Befüllungsbedürfnisse an.
„Ja.“ wandte sich Z an Geraldine, „ich weiß genau, was du meinst. Und ich denke, du hast Recht.“
Geraldine schüttelte erneut den Kopf – diesmal aus Ratlosigkeit.
„Er meint, wir sollten was essen.“ klärte Annie sie auf.
„Ah... jetzt... ja.“
3
Es war ihr erstes Frühstück in diesem Haus, daher dauerte es eine Weile, bis sie alles gefunden hatten, was sie brauchten.
„Schon komisch, dass alle Leute unterschiedlicher Meinung sind, wo was hingehört.“ merkte Annie an, während sie einen Schrank nach dem anderen öffnete, um die Marmelade zu finden die – wie sie feststellte, als sie sich nach dem letzten Schrank verärgert zum Tisch drehte – bereits auf selbigem stand und sich – wie Geraldine auf ihren fragenden Blick hin erklärte – im Kühlschrank befunden hatte. Da Annie damit voll versorgt war, setzte sie sich an den Tisch, während Geraldine und Z noch weitersuchten, bis sie das Brotmesser und die Eierbecher gefunden hatten. Als sie alle saßen, sprach Z ein sehr kurzes Dankgebet und hatte bereits das Messer in einer und ein Brötchen in der anderen Hand, da öffneten die beiden Frauen gerade erst die Augen.
„Hunger?“ fragte Geraldine unschuldig.
„Bisschen.“ antwortete Z ebenso unschuldig.
Die nächsten Minuten waren erst einmal alle beschäftigt, dann nahm Annie den Faden ihres vorherigen Gedankens wieder auf: „Es ist überhaupt seltsam, in einem Haus zu wohnen, das jemand anders gehört. Da traut man sich gar nicht, an die Schränke und Schubladen zu gehen.“
„Äh...“ machte Z, „...du sollst auch gar nicht an die Schränke und Schubladen gehen.“
„Außer hier in der Küche.“ ergänzte Geraldine.
„Ja, außer in der Küche.“ stimmte Z zu, „aber ansonsten wären der Pfarrer und seine Frau dir bestimmt sehr dankbar, wenn du ihre Sachen dalassen würdest, wo sie sind. Schließlich lassen sie uns aus reiner Freundlichkeit hier übernachten. Das sollten wir uns nicht verscherzen.“
„Das hatte ich auch nicht vor.“ verteidigte sich Annie, „und ich meinte auch gar nicht die Schränke im Rest des Hauses. Da würde ich nie rangehen. Da ist auch gar nichts Interessantes drin.“
Geraldine verschluckte sich und fing an zu husten, Z blickte Annie abschätzend an: „Das war ein Scherz, oder?“
Annie grinste und Z grinste zurück.
Geraldine hustete immer noch. „Ich denke, nach dem Frühstück sollten wir mal überlegen, wie wir weitermachen.“ brachte sie schließlich hervor, als sich ihre Atmung wieder einigermaßen beruhigt hatte. Die anderen stimmten ihr zu und den Rest des Frühstücks verbrachten sie mit Schweigen.
4
Anschließend begaben sie sich ins Wohnzimmer, wo sich alle dort niederließen, wo sie schon am Abend zuvor gesessen hatten. „Und wehe, es klaut einer meinen Sessel.“ hatte Annie noch gerufen, als sie sich gewahr wurde, dass sich die anderen bereits auf dem Weg dorthin befanden, während sie selbst noch mit dem störrischen Besteckfach in der Spülmaschine kämpfte. Doch sie hätte sich keine Sorgen machen brauchen.
Die beiden visierten direkt die Couch an und nachdem sie sich ebenfalls niedergelassen hatte, nahm Geraldine das Heft sofort in die Hand: „Gut.
Was als erstes? Hm... ich denke, wir sollten zunächst mal klären, wieviel Zeit wir eigentlich haben.“
„Zeit?“ fragte Annie.
„Na, ich müsste morgen eigentlich wieder zur Uni. Nicht zwangsläufig, aber es wäre besser.“
Annie nickte: „Ach so, ja. Ich muss auch morgen arbeiten.“
„Ich muss auch zur Uni.“ schloss Z sich an.
„Gut. Also haben wir bis abends Zeit. Das ist nicht viel, aber es lässt sich trotzdem sicher was machen. Nächster Punkt: was genau haben wir eigentlich vor?“
„Das musst du wissen. Das war doch deine Idee.“ erwiderte Z.
„Soll ich einfach sagen? Okay. Also... ich habe eine Gabe, wie ihr wisst. Und diese Gabe will ich einsetzen. Doch dazu brauche ich jemanden, der mir hilft. Diesen jemand habe ich jetzt – auch wenn er leider nicht hier ist. Wozu ich gleich noch komme. Und ich habe euch beide. Wie ich schon gestern sagte, bin ich da sehr froh drum. Und ich denke, dass wir ein gutes Team sein können, wenn wir das wollen.“
„Das denke ich auch.“ stimmte Annie zu.
„Schön,“ fuhr Geraldine fort, „dann jetzt zu Yannik. Ich denke, dass es wenig Sinn macht, tiefer in die Planung einzusteigen, solange er nicht da ist.
Daher drei Fragen: Warum ist er nicht da? Wo ist er gerade? Und wie kriegen wir ihn hierher?“
Sie sah Z direkt an, doch dieser wusste auch so, dass diese Fragen ihm galten: „Nun... er ist nicht hier, weil er kein Christ ist und trotz des positiven Einflusses, den ich unser ganzes Leben lang versucht habe, auf ihn auszuüben, nach wie vor alles befremdlich findet, was mit Gemeinde zu tun hat. Und das hier ist ja auch für alteingesessene Gemeindemenschen ein Extremfall. Von daher wird er eine Weile brauchen, bis er sich da eingefunden hat. Er weiß nicht wirklich, was mit ihm gerade passiert und er wusste nicht, was mit uns hier passiert. Daher habe ich ja auch gesagt, ich bleibe mit dabei. Und spreche mit euch erstmal alleine. Aber das ist jetzt durch und ich denke, hier passiert nichts, was er nicht verkraftet. Wenn ich ihn anrufe, ist er in zehn Minuten hier.“
„Okay. Dann mach das mal.“ bat Geraldine und Z zog sein Handy aus der Tasche. Das Gespräch ging schnell:
„Er ist auch gerade erst aufgestanden. Halbe Stunde, sagt er.“
„Na, dann kann Geraldine ja in der Zwischenzeit ihre Geschichte weitererzählen.“ freute sich Annie.
„Dann verpasst er sie doch.“ gab Z zu bedenken.
„Aber er hat doch deine Aufnahme.“ grinste Annie ihn an.
Z ließ den Kopf hängen und Geraldine fing laut an zu lachen.
5
„Ich denke, es ist am sinnvollsten, wenn ich euch zunächst erzähle, wie das mit meiner Gabe passiert ist.“ sagte sie ein paar Minuten später, als sie sich alle etwas zu trinken geholt und ihre Plätze wieder eingenommen hatten.
„Und vielleicht klappt es diesmal ja ohne Unterbrechung – auch wenn ich mir keine Überschrift ausdenke.“ Die anderen beiden zogen Grimassen, doch Geraldine störte sich nicht daran, sondern nahm es als Zustimmung:
„Ich mache einen großen Sprung von gestern Abend zu jetzt. Inzwischen bin ich 18. Genau 18, um genau zu sein. Es ist zwei Tage nach meinem Geburtstag – die Nacht meiner Geburtstagsparty. Den Teil der Geschichte, der uns an den Punkt führt, an dem ich jetzt anfange, spare ich mir jetzt. Er ist erst einmal nicht wichtig und ich weiß ehrlich gesagt noch gar nicht, ob ich euch den überhaupt erzählen will. Fakt ist, dass ich von meiner eigenen Party abgehauen bin – in einem nicht unbedingt als positiv zu bezeichnenden Gemütszustand. Es war dunkel und ich verwirrt und erschöpft, weswegen ich mich schließlich auf einer Wiese niederließ. Ich brauchte eine ganze Weile, bis ich mir gewahr wurde, wo genau ich mich befand. Ich meine... den direkten Ort. Wo ich mich in Relation zu meinem Zuhause befand, wusste ich beim besten Willen nicht. Aber irgendwann schaute ich auf und blickte mich um und stellte zu meiner Überraschung fest, dass die Wiese vor einer großen Kirche lag. Das war auch gut, denn genau in diesem Moment hatte ich den Eindruck, Schritte zu hören und so sprang ich auf und lief zu der großen Eingangstür, die – genau wie ich gehofft hatte – nicht verschlossen war. Ich stürmte hinein, sah mich panisch nach einem Versteck um und fand es relativ schnell: eine schmale Holztreppe auf der rechten Seite ganz an der Wand, die nach oben führte.
Zunächst dachte ich an den engen Spalt unter der Treppe, doch in diesen passte ich nicht hinein. So eilte ich die Treppe hinauf und landete auf einer kleinen Empore, auf der sich außer ein paar Holzbänken nichts befand. Dort rollte ich mich auf dem Boden zusammen und... schlief ein.“
„Äh... nur kurz...“ schaltete sich Z ein, „... vollkommen okay, wenn du das Davor nicht erzählen willst, aber... sehe ich das richtig, dass du vor jemandem weggelaufen bist? Keine Details – nur ein ‚ja‘ oder ‚nein‘, so zum besseren Verständnis.“
Geraldine nickte und fuhr dann fort: „Natürlich hatte ich das nicht vor – mit dem Einschlafen, meine ich – und zunächst war es mir auch gar nicht bewusst, denn der Traum, den ich in dieser Nacht hatte, war im extremsten Ausmaß real: ich lag auf dem Boden der Empore und hörte, wie unten die Tür geöffnet wurde. Die Schritte von mehreren Personen hallten über den Steinfußboden und eine Stimme rief leise: ‚Verteilt euch. Irgendwo muss sie schließlich sein.‘ Ich hörte, wie die Schritte in alle Richtungen ausschwärmten und wurde mir mit einem Schlag einer ganz unschönen Tatsache bewusst: von der Empore gab es keinen anderen Weg als die Treppe, die ich hinaufgekommen war. Es war einfach nur eine zwischen den Wänden eingelassene Bühne, die keinen weiteren Zweck erfüllte, als dass man darauf saß. Und ich war hier oben zwar versteckt, aber gleichzeitig auch gefangen. Wenn jemand die Treppe hinaufkam, hatte ich keine Chance mehr. Dieser Gedanke brachte mich in Bewegung und so leise ich konnte schlich ich zur Treppe und diese dann hinunter. Ich war auf der letzten Stufe, als vor mir ein Schatten auftauchte und eine andere Stimme rief: ‚Hier! Hier ist sie!‘ Ich versuchte noch, davon zu laufen, doch meine Beine trugen mich nicht mehr und auch meine Versuche, wild um mich zu schlagen, wurden im Keim erstickt. Ich schrie laut, doch die, die mich hörten, halfen mir nicht und die, die mir geholfen hätten, hörten mich nicht.
Unsanft wurde ich gepackt und hinter der letzten Bank auf den Boden geworfen. Es waren mindestens drei Personen, von denen eine meine Arme auf den Boden drückte, während eine andere meine Hose nach unten zog.
Ich zappelte so sehr ich konnte, doch es half nichts. Ich hörte das unverkennbare Geräusch eines sich öffnenden Reißverschlusses, meine Beine wurden auseinandergedrückt, ich spürte etwas Fremdes zwischen ihnen und dann... drang ein ohrenbetäubendes Gedröhn an meine Ohren.
Im ersten Moment dachte ich, die Gestalten hätten Musik angemacht, im zweiten Moment dachte ich, das wäre eine Schutzreaktion meines Gehirns.
Dann kam der dritte Moment – der Moment der Klarheit: das Geräusch kam von außen – von außerhalb der Szene, die ich gerade erlebte. Und ein befreiendes Gefühl bemächtigte sich meiner: du musst nur die Augen öffnen, dann ist alles vorbei. Wie oft hatte ich das in meinem Leben schon gedacht in Momenten, die mir nicht behagten, doch diesmal stimmte es wirklich: ich öffnete die Augen und fand mich genau dort wieder, wo ich mich in der Nacht hingelegt hatte. Um mich herum war es taghell und das Gedröhn waren die Glocken, die zum Gottesdienst einluden. Vorsichtig stand ich auf und blickte über die Brüstung. Unten war alles leer. Ich wollte so schnell wie möglich hier weg und so schlich ich mich zur Treppe hinüber.
Doch diesmal kam ich nicht mal bis zur ersten Stufe, als die Tür unten aufging und Schritte hereinkamen. Es waren keine bösen Männer und sie waren auch nicht wegen mir hier. Doch es waren andere Menschen und in diesem Moment wollte ich keinen Kontakt zu anderen Menschen. Vor allem keinen, bei dem ich meine Situation ausführlich würde erklären müssen. So verkroch ich mich wieder auf der Empore und lauschte von dort, wie die Personen, die hereingekommen waren, den Gottesdienst vorbereiteten. Ich hoffte, dass ich zwischen dem Ende der Vorbereitungen und dem Beginn des Gottesdienstes Gelegenheit haben würde, unbemerkt zu entkommen.
Doch das war leider nicht der Fall, denn anstatt dass die Personen unten verschwanden, gesellten sich immer mehr Leute dazu und irgendwann wusste ich, dass ich würde ausharren müssen. So war mein einziger verbleibender Gedanke ‚Bitte lass niemand hier hochkommen.‘ Er war an niemand Bestimmtes gerichtet, aber ich denke mal, dass Gott sich trotzdem angesprochen fühlte, denn er tat mir den Gefallen: ich blieb unbemerkt. Der Gottesdienst verlief genauso, wie ich ihn von früher in Erinnerung hatte, wenn ich auch bei weitem nicht so bei der Sache war, wie damals. Die Geschehnisse des vorigen Abends und der anschließende Traum gingen mir nah und jetzt, wo ich keine Wahl hatte, als abzuwarten, nahm sich mein Gehirn die Zeit, mit der Verarbeitung zu beginnen. Es fühlte sich sehr unschön an, die einzelnen Passagen der realen wie nicht realen Ereignisse wieder und wieder durchleben zu müssen und ich war schon kurz davor, laut aufzuschreien, als etwas passierte, das meine Aufmerksamkeit ablenkte: eine Frau ging nach vorne auf die Bühne – für alle unten Anwesenden inklusive des Pfarrers komplett unerwartet – und teilte der Gemeinde mit, dass heute eine Person anwesend war, die dazu bestimmt war, von Gott eine wundervolle Gabe zu erhalten. Eine Gabe, mit der sie sehr viel Gutes würde tun können. Und in genau diesem Moment kam eine Wärme über mich. So als hätte mich jemand in eine dicke Decke aus warmer Luft eingewickelt. Ich musste mich unwillkürlich schütteln, doch ebenso schnell wie es gekommen war, verschwand das Gefühl auch wieder. Etwas jedoch blieb zurück: eine innere Ruhe, die ich vorher nicht gehabt hatte und in der dortigen Situation auch von alleine nicht hätte produzieren können.
Ich ließ sie dankbar auf mich einwirken und bemerkte daher kaum, dass der Gottesdienst zu Ende ging. Schließlich jedoch wurde mir bewusst, was das eifrige Getrappel unten zu bedeuten hatte und so lugte ich erneut über die Brüstung. Ich sah, dass die Leute unten dabei waren, ihre Sachen zusammenzupacken und das Gebäude zu verlassen. Einige unterhielten sich, andere verschwanden einfach so. Doch ich sah noch etwas anderes, etwas, das mich erschaudern ließ: ganz links stand neben der Bank eine alte Frau. Und auf ihr lag ein schwarzer Schatten. Wobei es ‚lag‘ nicht wirklich trifft. Er schien sich vielmehr in ihr zu befinden. Ich blinzelte ein paar Mal, doch der Schatten verschwand nicht. Die Leute um die Frau herum jedoch verhielten sich ganz normal und es dauerte nicht lange, bis ich verstand, was das zu bedeuten hatte: ich war die Einzige, die den Schatten sehen konnte. Nun vergaß ich alles: was passiert war, warum ich hier war, wie spät es inzwischen sein musste. Ich hatte nur noch einen Gedanken: ich muss dieser Frau folgen und herausfinden, was mit ihr ist. Doch so weit kam es nicht, denn obwohl die Frau die letzte war, die die Kirche verließ und mich daher keine anderen Besucher sahen, gab es da noch jemanden, der immer bis zum Schluss blieb und den ich vor lauter Gedanken nicht mit einkalkuliert hatte: den Pfarrer. Er fing mich an der Tür ab und sprach mich freundlich an: ‚Dich habe ich hier ja noch nie gesehen.‘
‚Ich...‘ begann ich, ‚ich bin...‘
‚Ich weiß, wer du bist.‘ unterbrach er mich lächelnd, ‚ich meinte nur, dass ich dich hier noch nie gesehen habe.‘
‚Ja...‘ stotterte ich – verwirrt über den ersten Teil seiner Aussage, ‚mir war einfach danach.‘
‚Das freut mich. So soll es sein.‘ Sein Lächeln blieb noch einen Moment, dann wurde sein Blick ernst: ‚Allerdings würde es deine Eltern noch viel mehr freuen, wenn du ihnen vorher Bescheid sagen würdest.‘
Ich riss erschrocken die Augen auf: ‚Meine... meine Eltern?‘
‚Ja. Ich kenne deine Eltern schon lange. Sie haben mir geholfen, als ich meine Ernährung umstellen musste. Heute Morgen haben sie mich angerufen, dass du nicht von deiner Feier zurückgekommen bist. Die ja hier ganz in der Nähe stattgefunden hat. Ich konnte ihnen nicht helfen. Bis jetzt. Und...
vielleicht kann ich vorher dir helfen...‘
‚Mir... vorher...‘ Ich verstand ihn nicht.
‚Ich werde sie anrufen, dass du wohlauf bist. Und dann mit dir hier warten, bis sie dich abholen. Aber vielleicht gibt es ja etwas, worüber du reden willst.‘
‚Ich... nein... ja.‘
‚Nein? Ja?‘ Er blickte mich fragend an.
‚Nicht bei mir.‘ erklärte ich schnell, ‚nein. Ich hatte lediglich ein wenig Stress mit einem Menschen, der nicht ganz so weit entwickelt ist, wie ich das gerne hätte. Und brauchte einen Ort, wo ich davon Anstand nehmen konnte.‘
‚Aha.‘ Der Blick des Pfarrers wandelte sich von fragend zu zweifelnd, doch ich ließ mich nicht darauf ein:
‚Aber es gibt etwas Anderes: die Frau, die direkt vor mir hinausgegangen ist. Was ist mit ihr?‘
Jetzt war er wieder bei fragend: ‚Wie meinst du das, was ist mit ihr?‘
‚Ich... nun... ich... ich habe einen Schatten gesehen.‘
‚Du hast... das ist...‘ Er machte eine lange Pause, dann sagte er: ‚Sie hat Krebs.‘
In mir wurde alles kalt. ‚Was bedeutet das?‘ fragte ich ängstlich und in genau diesem Moment sah ich etwas in seinen Augen, was ich zunächst nicht deuten konnte. Es war Erkenntnis:
‚Du bist es! Du hast von Gott eine Gabe bekommen!‘
‚Was?‘ machte ich, ‚Ich? Ich...‘
‚Ich bin seit 22 Jahren Pfarrer in dieser Gemeinde und noch nie ist eines meiner Mitglieder nach vorne gekommen und hat etwas verkündet, so wie es heute geschehen ist. Und nun stehst du hier und... das ist kein Zufall!‘
‚Aber...‘ begann ich, doch der Pfarrer unterbracht mich sogleich wieder:
‚Ich werde mich nicht darüber unterhalten. Mich nicht näher damit befassen. Gott hat mir eine treue Gemeinde gegeben, in der es keine Vorfälle dieser Art gibt. Und das soll auch so bleiben. So etwas können wir hier nicht gebrauchen. Weswegen ich sehr froh bin, dass du nicht zu uns gehörst.‘
Ich wollte etwas sagen, doch ich kam nicht dazwischen.
‚Ich werde jetzt deine Eltern anrufen. Und dann hier warten, bis sie dich holen. Und dann... habe ich nur eine Bitte an dich: komm nie wieder hierher!‘
Es war dieser letzte Satz, der mir jegliche weiteren Einwände raubte. Er zog ein Handy aus der Tasche und wählte. Nach einem kurzen Gespräch, bei dem ich meine Mutter am anderen Ende fast genauso laut hören konnte wie ihn direkt neben mir, steckte er es wieder weg. Dann warteten wir schweigend, bis meine Eltern kamen. Sie waren nicht sauer, sie waren nur erleichtert und auch meine sehr stark zensierte Version der Geschehnisse der letzten Nacht lösten in ihnen keine negativen Gefühle aus. Meine Mutter nahm mich einfach in den Arm und nach ein paar Minuten war alles wieder in Ordnung. Zumindest, was dieses Thema anbelangte. Das andere Thema blieb – auch wenn ich meinen Eltern davon nichts erzählte. Stattdessen fuhr ich am Nachmittag zurück zur Kirche. Es war meine erste eigene Fahrt mit dem Auto, doch diese Tatsache ging mir in diesem Moment vollkommen abhanden. Ich traf den Pfarrer wirklich an und stellte meine Frage. Er beantwortete sie widerwillig und nur wenige Minuten später stand ich vor dem Haus, das er mir genannt hatte. Doch ich traute mich nicht, zu klingeln. Auch nicht am nächsten Tag und auch nicht am Tag danach. Erst am Freitag wagte ich es endlich, doch da war es schon zu spät. Die junge Frau, die mir mit tränenverschmierten Augen die Tür öffnete, teilte mir mit, dass ihre Großmutter ins Krankenhaus eingeliefert worden und dort in ein Koma gefallen war. Auf ihre Frage, warum ich fragte, antwortete ich, dass ich zur selben Kirche gehörte. Das war eine Lüge, dessen war ich mir vollauf bewusst. Doch ich entschied, dass sie notwendig war. Und ich entschied noch etwas anderes: wenn ich ab jetzt wieder in den Gottesdienst ging, würde ich diese Lüge im Nachhinein entkräften können.“
Es klingelte und Geraldine unterbrach ihre Ausführungen. Z stand auf und eilte hinaus, um die Tür zu öffnen.
Annie sah Geraldine bewundernd an: „So lange könnte ich nicht am Stück reden.“
„Och...“ machte Geraldine, „...doch, das glaube ich schon.“
Annie lachte. Z kam wieder herein, gefolgt von Yannik, der sich mit einem „Die Damen“ leicht verbeugte und dann in den anderen, freien Sessel fallen ließ.
„Geraldine erzählt gerade aus ihrem Leben.“ erklärte Annie.
„Na, dann mach mal weiter. Lass dich von mir nicht stören.“ Yannik lächelte Geraldine fröhlich an. Wenn er sich wirklich so unwohl fühlte, wie Z das erzählt hatte, ließ er es sich nicht anmerken.
„Soll ich nochmal von vorne...?“ begann Geraldine, doch Yannik winkte ab:
„Ich bin mir sicher, dass Z wieder sein Handy mitlaufen lässt.“
Z funkelte ihn böse an, während die beiden Frauen leise vor sich hin kicherten. Dann fuhr Geraldine fort:
„Am nächsten Tag besuchte ich die alte Frau – Hannelore hieß sie. Ich saß eine Weile an ihrem Bett und betrachtete sie, wie sie friedlich dalag. Der Schatten war auch da, lag auf… in ihr so ruhig und friedlich, dass es fast gemütlich hätte wirken können. Doch ich wusste, dass er böse war, dass er der Grund war, weswegen diese Frau hier lag. Und das auch nicht immer so friedlich, wie mir eine Schwester einmal erzählte. Sie warf sich oft hin und her. Wahrscheinlich, weil sie schlecht träumte. Und ich – ich saß daneben und konnte nichts tun. Auch der Pfarrer, den ich am nächsten Tag nach dem Gottesdienst entgegen seiner Bitte nochmals aufsuchte, war mir keine Hilfe. Im Gegenteil: mit überaus deutlichen Worten machte er mir klar, wie ernst ihm seine Aufforderung am Sonntag zuvor gewesen war. Er wolle seine Schafe nicht solch angsteinflößenden Einflüssen aussetzen, erklärte er mir, bevor er die Tür zum Pfarrhaus vor meiner Nase schloss. So blieb ich mit meinen Fragen allein und beging einen Fehler, wie ich ihn schon als 12-jähriges Mädchen begangen hatte: ich schloss von einem Mann Gottes auf alle und verlor jegliche Hoffnung, durch die Vertreter der Kirche Antworten zu finden. Stattdessen besuchte ich Hannelore, so oft ich konnte.
Saß an ihrem Bett und suchte verzweifelt in mir selbst nach einer Lösung, die ich nicht finden konnte, da nichts da war, was sie hätte erzeugen können. Eines Tages, als ich mich an ihr Bett setzte, traute ich meinen Augen nicht: der Schatten war verschwunden. Ich konnte es kaum glauben. Doch die Freude war nur von kurzer Dauer. Sehr kurzer. Wenige Minuten später starb sie. Atmete ein letztes Mal. Und dann nicht mehr. Ärzte und Schwestern kamen herein. Weil die Maschinen piepten. Sie scheuchten mich nach draußen. Ich sah sie ein letztes Mal – bei ihrer Beerdigung. Ruhig und friedlich lag sie in ihm Sarg. Genauso ruhig und friedlich wie die ganze Zeit über im Krankenhaus.“
6
Es war zwar immer noch früh am Vormittag, aber man Geraldine sah deutlich an, dass sie eine Pause brauchte. Also gönnten sie sie ihr. Zumal Yannik dadurch die Möglichkeit bekam, den Anfang ihrer Geschichte zu hören, was sehr gut war, denn er hatte von dem, was sie zuvor erzählt hatte, nicht das Geringste verstanden.
Annie und Geraldine nutzten die Gelegenheit, Z noch einmal auf ihn anzusprechen: „Du erzählst die ganze Zeit, er wäre so schüchtern. Aber irgendwie...“
„Ja, ich glaube, ich habe mich da ein wenig unklar ausgedrückt: ich meinte einfach, er ist das nicht gewöhnt, wie wir Christen uns benehmen, wenn wir untereinander sind. Das ist ja schon besonders – die Themen, die Sprache, und so weiter. Das findet er schon bei mir und meiner Familie befremdlich und uns kennt er seit Jahren. Bei Fremden ist das halt nochmal anders.
Daher habe ich gesagt, ich checke erstmal ab, wie ihr so drauf seid. Das war auch meine Idee, nicht seine. Und er ist insgesamt sowieso ein lockerer Typ.
In dem Moment, wo ich ihn angerufen habe, dass er herkommen soll, wusste er, dass alles in Ordnung ist. Denn so viel Vertrauen hat er in mich, dass ich das dann wirklich ernst nehme, wenn ich sowas verspreche. Also macht er sich jetzt keinen Stress mehr. Ihr werdet es bestimmt trotzdem an der einen oder anderen Stelle merken, dass ihr keinen ‚Eingeweihten‘ vor euch habt. Und dann wäre es nett, wenn ihr ihn das nicht zu doll spüren lasst.“
„Ich wäre eigentlich sogar für gar nicht.“ überlegte Geraldine laut.
Z lächelte: „Ja, das ist natürlich auch eine Möglichkeit.“
Anschließend versank jeder in seine Gedanken, bis Yannik schließlich ins Wohnzimmer zurückkehrte.
„Okay...“ machte er und warf Z das Handy zu, „...das ist abgefahren. Was genau passiert denn jetzt?“
„Ja...“ seufzte Geraldine, „...das ist die entscheidende Frage.“
„Und du bist diejenige mit der Antwort.“ erinnerte Annie sie.
„Einer Antwort.“ verbesserte Geraldine, „nicht der Antwort. Einer möglichen Antwort.“
„Nun gut. Aber wir wollen sie trotzdem gerne hören.“
Geraldine atmete tief ein: „Ich kann Dämonen erkennen. Denn das ist es, was der Schatten war. Ein Wesen aus der Hölle – früher mal ein Engel Gottes, jetzt ein... naja – Dämon halt. Ein Handlanger Satans.“
„Und woher weißt du das so genau? Dass es ein Dämon war?“ hakte Yannik nach.
„Ich wüsste nicht, was es sonst sein könnte. Und es passt auch ins Bild: das ist eine Gabe von Gott. Steht so in der Bibel. Und wenn Gott eine Gabe gibt, dann will er, dass sie eingesetzt wird. Also habe ich zusätzlich auch eine Auf-Gabe.“
„Die Königin des Wortspiels hat wieder zugeschlagen.“ kicherte Z.
„Des unabsichtlichen Wortspiels.“ ergänzte Annie.
„Erzähl weiter.“ forderte Yannik Geraldine auf und Z und Annie gaben einige undefinierbare, allerdings ganz eindeutig spöttische Laute von sich.
Geraldine ließ sich davon nicht beirren: „Ich kann mit meiner Gabe alleine nichts anfangen. Nur sehen bringt niemanden weiter. Diese Erfahrung habe ich bereits gemacht. Daher habe ich ja auch gesucht. Nach jemandem, der die Dämonen dann auch austreiben kann. Und das bist du, Yannik. Daher sind wir hier. Also... zunächst mal nur du und ich. Allerdings denke ich, dass die beiden Schnabeltiere da uns durchaus auch nützlich sein können.“
Sie nickte mit dem Kopf in keine bestimmte Richtung, doch es war eindeutig, wer sich angesprochen fühlen sollte.
„Also sind wir beide die Batmans und sie sind die Robins.“ vermutete Yannik.
Geraldine musste lachen: „Ja, so kann man das sagen.“
„Nein!“ brummte Z, „so kann man das überhaupt nicht sagen. Ich bin nicht Robin. Ich bin doch nicht bescheuert!“
„Du sähst auch bescheuert aus in dem Kostüm.“ Yannik sah ihn belustigt an, „vor allem mit den Beulen für die Brustwarzen.“
Z streckte ihm die Zunge raus: „Das wäre dann eher was für...“
„Sag es nicht!“ unterbrach ihn Annie sofort, „Um deiner eigenen Gesundheit willen, sag es nicht!“
Geraldine räusperte sich laut. „Ich sehe schon, das wird enorm anstrengend mit euch. Daher mache ich jetzt eine Regel: Wer stört, muss fünf Minuten nach draußen auf die ‚stille Treppe‘.“
Die drei anderen sahen sie an. 10 Sekunden, 20 Sekunden, 30 Sekunden.
Dann brachen sie alle in schallendes Gelächter aus, das erst nach einigen Minuten einigermaßen abebbte.
„Du bist echt der Kracher!“ keuchte Z.
Das war ganz und gar nicht die Reaktion, die Geraldine sich erhofft hatte.
Sie hatte Ruhe in die Situation bringen wollen. Aber... warum eigentlich?
Hatten sie es eilig? Stand irgendetwas auf dem Spiel? ‚Nein‘ lautete die eindeutige Antwort. Also konnte sie sich auch locker machen. Und genau das tat sie:
„Okay, okay. Ich sehe schon – mit meiner Autorität ist es nicht weit her.
Wollt ihr trotzdem hören, was ich denke?“
Das Lachen war inzwischen verstummt. Die anderen nickten ernst.
„Gut. Das heißt... mehr habe ich eigentlich gar nicht.“
Dafür erntete sie kein Lachen, sondern ein Kopfschütteln.
„Wie meinst du das, du hast nichts mehr?“ fragte Annie entgeistert.
„Du hast uns doch alle hergeholt.“ ergänzte Z.
„Ja, aber ich bin doch auch nicht die Mutter aller Antworten.“ verteidigte sich Geraldine, „ich habe euch in erster Linie hergeholt, weil... ich habe euch überhaupt nicht hergeholt. Das war eine gemeinsame Entscheidung.“
„Die darauf beruhte, dass du...“ begann Z, doch Geralinde würgte ihn sofort wieder ab:
„Ich habe es in Gang gebracht, okay. Aber jetzt sind wir alle mit dabei und das war doch von Anfang an der Sinn der Sache. Mitstreiter finden. Und Yanniks Batman-Vergleich bezieht sich ja auch nur auf die Arbeit. Aber ansonsten gibt es hier keinen Chef – erst recht nicht mich. Ich denke, wir sollten gemeinsam überlegen, was wir tun.“
„Ja, das sehe ich genauso.“ stimmte Yannik zu, „ganz gleich, wie gerne ich Z in einem...“
Er brach ab, um Zs Händen zu entgehen, die nach seinem Hals schnappten.
„...egal. Vergesst das. Aber: zuallererst sollten wir zusehen, dass alle auf dem gleichen Stand sind. Geraldines Geschichte habe ich nun komplett gehört. Das passt schonmal – mit einer kurzen Verständnisfrage: warum erzählst du eigentlich so vage? ‚Der Pfarrer‘, ‚die Frau‘, ‚die Stadt‘ – das kann ich gar nicht richtig einordnen, irgendwie.“
Geraldine runzelte die Stirn: „Ja, das weißt du nicht, das stimmt. Als wir darüber gesprochen haben, dass wir alle ein bisschen was von uns erzählen, haben wir uns darauf geeinigt, Personen, Orte und ähnliches, was nicht wichtig für die anderen ist, anonym zu lassen. Einfach aus Schutzgründen.
Denn wenn ich schlechte Dinge über jemanden erzähle, mögen die meines Erachtens nach wahr sein, aber im Grunde ist es ja Lästerei und das will keiner von uns. Ohne die Namen geht es nur noch um die Situation, nicht mehr um die Person. Oder um die Gemeinde – zum Beispiel. Wenn ich irgendwo unglücklich war, muss das ja nicht allen anderen automatisch auch so gehen. Siehe meine Großmutter in ihrer Kirche. Daher...“
Yannik winkte ab: „Okay, verstanden. Machen wir dann alle so. Ist gut. Ja...
ich denke, ich werde ja auch noch drankommen, oder? Aber jetzt doch erstmal ihr. Denn: ihr wisst ja trotzdem immer noch mehr als ich.“
„Zum Beispiel?“ fragte Geraldine.
„Na... wie seid ihr aneinandergeraten? Wie kommt ihr in dieses Haus? Wo ist der Pfarrer, der eigentlich hier wohnt? Wie ich sehr wohl weiß, auch wenn ich nicht in die Kirche gehe. Habt ihr ihn im Keller begraben?
Zusammen mit seiner Frau? Hat sie vorher zumindest noch etwas gekocht?
Seht ihr – das weiß ich: dass seine Frau gut kochen kann. Nur bringt mir diese Info momentan nichts. Andere Infos würden mir schon etwas bringen.“
„Schon klar.“ sagte Annie, „und kein Problem. Fangen wir mit den einfachen Sachen an: Der Pfarrer liegt nicht im Keller...“
„...sondern im Garten...“ fuhr Z dazwischen. Keiner lachte. Annie ignorierte ihn:
„...und seine Frau auch nicht. Sie sind wohlauf und sehr weit weg. Gekocht hat sie vorher leider nichts mehr.“
„Und wieso seid ihr hier, wenn sie weg sind?“
„Also...“ setzte Z an und hob dann auf Annies Blick hin abwehrend die Hände, „Ich wollte wirklich etwas Normales sagen.“ Sie nickte und er fuhr fort: „Als klar war, dass wir uns mal länger und unter Umständen auch öfter zusammensetzen müssten, haben wir lange überlegt, wo das am besten geht. Praktischerweise wohnen wir ja alle recht dicht beisammen, auch wenn Geraldine theoretisch aus dem Ausland kommt.“
„Rheinland-Pfalz ist kein Ausland!“ zischte Geraldine.
„Und Mainz ist eine schöne Stadt.“ schloss sich Annie an.
Z seufzte. „Das war ja klar, dass du wieder... naja, egal.“
Doch Geraldine war noch nicht bei ‚egal‘ angekommen: „Außerdem habe ich meine Kindheit in Hessen verbracht.“
„So?“ fragte Z neugierig, „wo denn genau?“
„In Mainz-Kastel.“ erwiderte Geraldine triumphierend, erntete dafür allerdings lediglich einen verwirrten Blick:
„Das soll in Hessen sein?“
„Es ist ein Vorort von Wiesbaden.“ kam ihr Annie zuvor.
„Macht das Sinn?“ Z kratze sich am Kopf.
„Lange Geschichte. In jedem Geschichtsbuch nachzulesen.“
„Und du weißt das, weil...“
„Ich dort auch mal gewohnt habe. Ein paar Jahre zumindest.“
Z lächelte spöttisch: „Scheint ja ein richtiger Knotenpunkt gewesen zu sein.“
„Es...“ begann Geraldine, besann sich dann aber eines Besseren, „...warum rechtfertige ich mich eigentlich dafür?“
„Gute Frage.“ stimmte Annie zu, „trotzdem aber lustig. Meinst du, wir sind uns mal begegnet?“
„Tja... wer weiß...“
„Die Chancen stehen gut, würde ich sagen.“ Zs Lächeln war noch nicht verschwunden, „viel mehr als ihr beide haben da sicher nicht gewohnt.“
Er erntete zwei giftige Blicke und entschied sich, doch wieder zum eigentlichen Thema zurückzuschwenken:
„Auf jeden Fall waren wir uns schnell einig, dass keiner von uns das bei sich zuhause machen wollte. Ich kann auch nicht genau sagen, warum... das war so eine Gefühlssache.“
„Es gibt Sachen, die bringt man nicht mit nach Hause.“ erklärte Geraldine, „nicht euch als Personen, aber das Thema, um das es mit euch geht. Dafür ist ein neutraler Ort einfach besser.“
„Okay. Das war durchaus eine Erklärung. Wir dachten jedenfalls, dass du das genauso siehst, und so ist es darauf hinausgelaufen, dass ich meine Eltern gefragt habe, ob sie nicht etwas wüssten. Sie wollten uns zunächst bei sich im Haus unterbringen, aber das fand ich dann wieder nicht so toll.
Sie sind lieb und nett, aber sie wären halt immer dabei. Letztendlich kam also die Idee auf, jemand aus der Gemeinde zu suchen. Aber das ist genauso wie mit meinen Eltern. Alle Leute in der Gemeinde sind lieb und nett. Und hilfsbereit und zuvorkommend. Aber wir brauchen hier unsere Ruhe und ich habe die Befürchtung, dass wir die bei Leuten, die zumindest mich und eventuell auch dich kennen – von meinen Eltern ganz abgesehen – nicht bekommen hätten. Außerdem sind wir noch nicht an dem Punkt, wo wir diese Sache an die große Glocke hängen sollten. Wofür meine Eltern zum Glück Verständnis hatten – auch wenn sie gar nicht wissen, worum es geht.
Also haben wir nach Leuten gesucht außerhalb der Gemeinde und da kam mein Vater auf die Idee, Christopher zu fragen – den Pfarrer, denn er hat auch einen Namen, genau wie seine Frau, die Michaela...“
„Michelle.“ korrigierte Annie.
„...heißt – und so hat er Annie, Geraldine und mich kurzerhand ins Auto gepackt und uns hier vor der Haustür aufgestellt. Wir haben alle unser bestes Lächeln aufgesetzt und ein paar Minuten später hatte ich den Hausschlüssel in der Hand. Denn praktischerweise hatten die beiden eine Reise nach Afrika geplant und mein Vater hat sie als Gegenleistung am Freitag zum Flughafen gefahren. So waren alle glücklich und wir haben das Haus für den nächste Monat für uns.“
„Wobei wir natürlich alle auch noch ein normales Leben haben und daher so wie es aussieht nur am Wochenende oder mal abends da sein werden.“
ergänze Annie.
Yannik nickte. „Okay, das ist gut. Denn das geht mir genauso. Aber von wo kommt ihr denn eigentlich... beziehungsweise...“ er sah Annie an, „...eigentlich muss ich nur noch dich fragen.“
„Aus Wiesbaden.“
„Na, das ist ja wirklich alles direkt um die Ecke. Wenn das mal kein toller Zufall ist.“
„Wir nennen es ‚Wirken Gottes‘.“ erklärte Geraldine.
Yannik lächelte. „Ja, tut das mal.“
Geraldine lächelte zurück, ging aber nicht darauf ein. Stattdessen sah sie Z an: „Interessant, dass er so wenig Informationen von dir hatte.“
„Oh. Ah.“ Z lief rot an, „das…“
„…hat sich auf die Schnelle nicht so ergeben.“ führte Yannik es für ihn aus, worauf Geraldine nur nickte. Es entstand eine kurze Pause, die Annie nicht behagte. Daher suchte sie schnell nach einem Thema und fand schließlich eines:
„Du kannst im Übrigen auch hier übernachten, wenn du willst. Frankfurt ist ja nicht so unbedingt die autofahrerfreundlichste Stadt. Von daher sparst du dir sicher eine Menge Stress, wenn du...“
„Das brauchst du mir gar nicht zu sagen. Die Sachen sind alle draußen im Auto.“
„Okay. Und warum nicht drinnen im Haus?“
„Weil ich mir bei aller Liebe zur positiven Meinung meines besten Freundes durchaus das Recht vorbehalte, eine eigene Meinung zur Situation und den beteiligten Personen zu bilden.“
„Oh... heißt das, wir müssen uns gut benehmen?“ Annie blickte fragend drein.
Und Z unglücklich: „Zu spät, oder?“
„Ja... irgendwie...“
Yannik schüttelte den Kopf. „Ihr seid schon alle ziemlich durchgeknallt.
Aber auf die richtige Art und Weise.“
„Na, herzlichen Dank!“ Geraldine sah nicht wirklich so aus, als meinte sie das ernst, was Yannik allerdings überging:
„Aber immer doch.“
„Vielleicht sollten wir doch nochmal umschwenken in Richtung Planung der...“ begann Geraldine daraufhin, doch Annie unterbrach sie sofort wieder:
„Nein – ich denke eigentlich, dass wir das gar nicht tun sollten.“
Alle sahen Annie an, die leicht errötete.
„Was ich meine: auch ohne weitere Informationen wissen wir alle, worauf es hinausläuft: Wir kämpfen gegen die dunklen Mächte. Das ist – wenn ich das mal so sagen darf – eine lebensverändernde Sache. Und dem voran steht dementsprechend die Entscheidung, ob man sich auf diese lebensverändernde Sache überhaupt einlassen will. Und das wiederum ist eine Entscheidung, die ich persönlich a) nicht einfach so zwischen Tür und Angel treffen will und für die ich b) auch alleine sein möchte. Zumindest nicht mit euch zusammen. Denn ihr seid nun mal die, die mit dran beteiligt wären und das macht mir Druck. Sorry, aber ist so.“
„Nein, da hast du eigentlich schon Recht.“ stimmte Z zu, „was schlägst du denn vor?“
„Ich schlage vor... dass wir den Tag heute nutzen, um einfach ein bisschen...
nun, die Chemie auszuloten und vielleicht noch ein wenig mehr aus unserem Leben erzählen. Entweder erzählt Geraldine weiter oder jemand anders fängt an. Und dann gehen wir alle nach Haus, zurück in den Alltag, und tragen das alles mit uns herum und nächstes Wochenende treffen wir uns alle wieder hier und dann sagt jeder, was er denkt, wie er dazu steht und ob er dabei ist oder nicht. Und dann... dann machen wir Pläne.“
Geraldine nickte: „Das ist auch ein Plan. Und zwar ein ziemlich guter.“
„Oh. Okay.“
„Dann nehmen wir diesen Plan mal an, würde ich sagen.“ stimmte Yannik zu.
Z nickte ebenfalls: „Sehe ich auch so. Und anschließend machen wir Mittagessen.“
Annie grinste. „Das ist ebenfalls ein guter Plan.“
7
Nach dem Mittagessen gönnten sie sich zunächst eine Zeit der Ruhe. Yannik holte seine Sachen aus dem Auto und bezog das letzte noch freie Zimmer im Obergeschoss. Er fragte sich, wie es kam, dass ein Ehepaar ohne Kinder ein so großes Haus hatte und beschloss, diese Frage bei nächster Gelegenheit an Z weiterzugeben, denn er war sich sicher, dass Zs Eltern das wussten. Und dann wusste es Z entweder auch oder konnte es zumindest in Erfahrung bringen. Gegen 14 Uhr trafen sie sich wieder im Wohnzimmer.