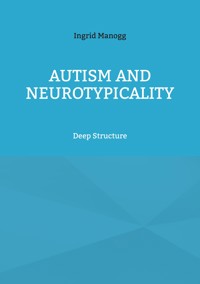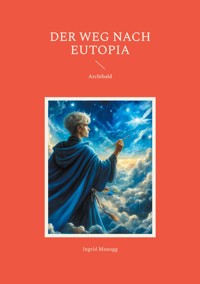Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: BoD - Books on Demand
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Deutsch
Wie gehen wir in Verbindung? Welche Rolle spielen dabei innere Bilder und Emotionen? Welche Sinnessysteme nutzen wir, sind wir denkfeindlich? Was erscheint uns schön, was empfinden wir als Belohnung? Was sind Lieblingskinder, welche Bedeutung haben Gefühle wie Neid, welche Funktionen haben Stolz und Scham? Welche Unterschiede gibt es hierbei zwischen Autisten und Neurotypen und wodurch entstehen sie? Wie hängen Gesellschaftssystem und Neurotypismus zusammen? Eine psycho-logische Analyse mit neuen Denkansätzen
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 433
Veröffentlichungsjahr: 2024
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Zu diesem Buch
Als Menschen gehen wir in Verbindung. Wie stellen wir uns diese vor? Welche Rolle spielen dabei innere Bilder und Emotionen? Welche Sinnessysteme nutzen wir, sind wir denkfeindlich? Was erscheint uns schön? Was empfinden wir als Belohnung – ist das für alle Menschen gleich? Was sind Lieblingskinder, welche Bedeutung haben Gefühle wie Neid, wofür stehen die Ahnen, welche Funktionen haben Stolz und Scham? Worin bestehen bei alledem die Unterschiede zwischen Neurotypen und Autisten?
Autismus ist nicht einfach ein angeborenes Cluster von Defiziten. Wir analysieren tieferliegende Strukturen und mögliche Entstehungsbedingungen. Neurotypismus dient dabei nicht als Maßstab für das ‚Normale‘, wir nehmen ihn nicht als etwas Selbstverständliches hin. Wir fragen auch hier nach Tiefenstrukturen und Entstehungsbedingungen und betrachten, auf welche Weise die neurotypischen Muster mit unserem Gesellschaftssystem zusammenspielen.
Zur Autorin Ingrid Manogg, geb. 1962 in Freiburg i.Br., Dipl.-Psychologin
Inhaltsverzeichnis
Einführung
Verbindung – die Basis gefühlten Seins
Verbindung nach innen und außen
Rhythmisch und dynamisch
Verbindungen loslassen
Innere Bilder, Personenkonstanz, Schrödingers Katze
Belohnung
Sinn und Sinne
Primäre, sekundäre und tertiäre Systeme
Der Denksinn ist ein Mediator
Denkfeindlichkeit
Wie wir Sinneseindrücke bewerten
Die verachteten Füße
Schönheit, Hingezogen-Sein und Identifikation
Basis für Schönheitsvorstellungen
Differenzierung von Schönheitskriterien bei Kindern
Basis-Schönheitskriterien bei Frauen und Männern
Freunde, Ähnlichkeit und Geruch
Neurodiversität / Autistisches Spektrum
Diagnose – Neuerungen, Fragebögen
Diagnose / Differentialdiagnose – Kommentar
Warum Therapien nicht funktionieren
Falschbehauptungen
Mimik lesen: ‚Dies ist keine Pfeife‘
Interpretationen – Edelgas und Kohlenstoff
Empathie
Spiegelneuronen
Interozeption – Embodiment
Entstehung von Autismus
Mitschwingen, Inkompatibilität, Abkoppeln, Unabhängigkeit:
Die MIAU-Theorie
Nach der Geburt
Trauma und Übergriffigkeit
Neurotypische Vorstellung von Verbindung
Neurotypismus und die Entstehung der Lüge
Mangel und Halblösungen
Sehnsucht und Streben
Falscher Rhythmus und unpassende Pädagogik
Spieluhr
Gespensterangst
Emotionale Erpressung – Beispiel Essen
Small Talk, ‚Erarbeiten‘ und Rituale bei Erwachsenen
In Besitz nehmen
Manipulation mit Metaphern
Verletzte Gefühle
Paradies, Urangst und Urschrei
Die Geschwisterneid-Lüge
Die Lieblingskind-Lüge
Die Rolle der Ahnen
Scham und Stolz
Neurotypismus und Autismus im Überblick
Neurotypische Muster
Autistische Muster
Neurotypismus und Kapitalismus
Beeren, Bären und Mangel
Der Prozess der Zivilisation
Basis für kapitalistisches Denken
Nachwort I
Nachwort II: Eutopia
Literatur / Quellen
Einführung
Dieses Buch ist ein Versuch, menschliches Erleben und Verhalten auf einer tieferen Ebene zu verstehen. Die meisten psychologischen Autoren beschränken sich auf eine oberflächliche Darstellung von neurotypischem Erleben und Verhalten; und Autoren, die Autismus bzw. Neurodiversität beschreiben, verbleiben gerne auf der Symptom-Ebene. Neurotypische Maßstäbe und die dazugehörende gesellschaftliche Organisation werden kaum hinterfragt. Dabei sind Menschen schon in Bezug auf ihre Basisbedürfnisse nach Verbindung, Belohnung und Schönheit individuell verschieden – nicht nur Autismus, auch Neurotypismus ist ein Spektrum.
In den ersten Kapiteln des Buches stehen die Unterschiede zwischen Neurotypischen und Autisten noch nicht im Vordergrund. Es geht um die allgemeinere Bedeutung von Verbindungsgefühlen, um das Verstehen von der sogenannten Objektkonstanz, um Belohnungen und um unsere Sinnessysteme. Zu den Sinnessystemen zähle ich auch das Denksystem. Erst danach geht es um die tieferliegenden Unterschiede und um die jeweils spezifische Entstehung und Musterbildung von Autismus und von Neurotypismus.
Einige meiner Thesen und Gedankengänge sind neu, sofern etwas neu sein kann; andere Thesen sind aus schon bekannten Thesen neu kombiniert oder wurden ergänzt. Meine Herangehensweise folgt der Psycho-Logik, nicht der sogenannten Psycho-Logie, und soll auch für Laien verständlich sein. Natürlich kann auch die beste Psycho-Logik nicht alles erfassen; jede Logik kann zu falschen Schlüssen führen. Es gibt verschiedene Arten von Logik und keine Logik stimmt für alles. Wie in der Physik gelten Annahmen immer nur in bestimmten Kontexten und unter bestimmten Bedingungen: Schwerkraft gibt es zwar sowohl auf der Erde als auch auf dem Mond, aber dennoch würde ein Apfel auf dem Mond nicht auf den Boden fallen.
Wer sich nur für bestimmte Themen interessiert, also ‚springen‘ will, dem empfehle ich, vorab die Kapitel ‚Innere Bilder, Personenkonstanz, Schrödingerkatze‘ sowie die ‚MIAU-Theorie‘ zu lesen.
Zum Sprachgebrauch: Der Einfachheit halber gendere ich nicht. Ich beschreibe Prototypen, die jegliches Geschlecht haben können. Die Einstellung, die hinter den Begriffen steht, halte ich für wichtiger als die ‚richtige‘ Etikettierung.
Ziel dieses Buches ist ein Mitdenken und Weiterdenken des Lesers, vor allem aber ein größeres Verständnis für das unterschiedliche Erleben und Verhalten von Menschen – ob ‚typisch‘ oder ‚divers‘. Mögen sich dadurch individuelle und gesellschaftliche Denk- und Freiräume weiten, sodass in ihren Nischen gute Visionen gedeihen und sich eines Tages vereinen können.
Verbindung – die Basis gefühlten Seins
Wir sind ‚Planet Man‘ – wir bestehen aus verschiedenen Organen und aus Milliarden von Kleinstlebewesen. Daher haben wir ein Bedürfnis nach gefühlter Einheit und nach einer übergeordneten ‚Verwaltungsinstanz‘. Es gibt verschiedene Möglichkeiten, Verbindungen einzugehen und Verbindungen zu lösen. In diesem Kapitel beschreiben wir Grundmerkmale von Verbindung und das Wirkprinzip der Spiegeltherapie. Wir streifen die ‚wahre‘ Geschichte von Narziss und erkunden unser Schmerzzentrum.
Verbindung nach innen und außen
Wir sind imstande, auch Unbelebtes oder Belebtes, das nicht zu unserem Körper gehört, als zugehörig zu empfinden. Blinde fühlen mit ihrem Blindenstock, als wäre er ein verlängerter Arm oder Finger. Und jeder Mensch kann lernen, einen Gummi-Arm so zu spüren, als wäre er sein eigener. Dies wurde in Experimenten hinreichend getestet:
Wir legen einen Arm auf einen Tisch. Der Arm wird sanft von jemand anderem gestreichelt. Dann wird ein Gummi-Arm dicht neben unseren echten Arm gelegt. Er wird gleichzeitig auf die gleiche Weise gestreichelt wie unser echter Arm. Nach einer Weile wird unser echter Arm abgedeckt – wir können ihn nicht mehr sehen. Wird nun der Gummi-Arm gestreichelt, reagieren wir darauf genauso wie vorher auf das Streicheln unseres echten Armes. Wir fühlen uns mit dem Gummi-Arm verbunden.
Auch mit geistig vorgestellten Körperteilen können wir in Verbindung gehen. Es gibt eine uralte Übung, in der wir zusätzlich zu unserem echten Arm einen geistigen Arm visualisieren und spüren lernen:
Lege deinen Arm auf einen Tisch oder auf deinen Oberschenkel. Die Handfläche ist offen und zeigt nach oben. Dann hebe den Arm langsam an, Zentimeter für Zentimeter, winkele ihn an unter ständigem Spüren und Beobachten, bis du mit der Hand die gleichseitige Schulter berührst. Dann führst du den Arm genauso langsam wieder in die Ausgangsposition zurück. Nach einigen Durchgängen stellst du dir einen geistigen Arm vor, der sich aus deinem echten Arm erhebt und die gleichen Bewegungen vollzieht, während dein echter Arm auf deinem Oberschenkel oder dem Tisch liegenbleibt. Als letztes bewegst du den geistigen und den realen Arm gleichzeitig in einer gegenläufigen Bewegung, der reale Arm hebt sich, der geistige Arm senkt sich. In dem Moment, wo sich die Arme begegnen, durch einander durchgehen, gibt es eine Art Flash, eine Trance. Zum Abschluss lässt du deinen geistigen Arm wieder in den realen Arm sinken.
Wenn du dich gut konzentrieren konntest, hattest du für einen Moment zwei Arme an einer Schulter.
Schon bevor wir eine Bindung zu Menschen eingehen und uns ihnen zugehörig fühlen, sucht unser Gehirn nach Verbindungen. Wir alle haben es als Embryonen erlebt, dass eines aus dem anderen herauswächst und sich gleichzeitig mit unserem Ich- und Körper-Empfinden entfaltet. Wir gingen auf vielfältige Weise in Verbindung mit allem, was uns an Reizen aus unserem Inneren und aus der Umgebung, dem Mutterbauch, begegnete.
Wir ‚wissen‘, dass wir selbst eine aus vielen Teilen zusammengesetzte ‚Einheit‘ sind. Wir sind ‚Planet Man‘. Wir bestehen nicht nur aus Abermilliarden Kleinstlebewesen, zum Beispiel Bakterien, sondern auch aus mehr oder weniger autonom arbeitenden Organen, Sinnessystemen, Faszien und anderem. Wir bestehen auch aus verschiedenen Selbst-Vorstellungen, die sich überlagern und sich aufeinander aufbauend miteinander entwickeln. Wissenschaftler behaupten, das Leben auf der Erde hätte sich in unterseeischen schwarzen Vulkankaminen aus schwefelfressenden, hitzebeständigen einzelligen Bakterien entwickelt. Diese Einzeller begannen sich auch voneinander zu ernähren, sie nahmen sich gegenseitig auf. Dadurch wurden sie komplexer, differenzierten sich aus, und es entstanden neue Kombinationen. Auch die neuen, komplexeren Wesen reagierten und agierten dann jeweils als Ganzes, als Einheit.
Auch unser Gehirn ist zusammengesetzt. Am Anfang gab es nur den Hirnstamm, dann wuchs er, neue Teile differenzierten sich aus, bis hin zum Präfrontalkortex.
Wir sind also ein Verbund und funktionieren mit allen unseren Teilen und Teilchen gemeinsam. Was unseren Kern oder unsere Seele ausmacht, ist umstritten. Unzweifelhaft ist, dass wir nach einem verbindenden Prinzip suchen, nach einer einheitlichen Definition für ‚uns und unsere Teilchen‘, nach einer übergeordneten Instanz, nach etwas, was Regie führt.
Auf welche Weise wir uns als Einheit definieren, wie unsere individuellen Vorstellungen aussehen von unserer Verkörperlichung, unserer Verhirnlichung und der Hierarchie unserer Systeme, wird natürlich mitgeformt oder überformt von unserer Sozialisation, den Lernsystemen wie Schule und Medien, und von den Narrativen, die zu den jeweils herrschenden Ideologien gehören.
Unabhängig davon brauchen wir es als Individuen, uns als Einheit zu definieren. Es wäre für unser Überleben nicht sinnvoll, würden wir Sinnessysteme wie Augen und Ohren oder unsere Arme, Beine und Hände längerfristig nicht als zugehörig ‚begreifen‘ oder wahllos in Verbindung gehen zu körperfremden Objekten. Könnten wir keine oder nur falsche Rückmeldungen von unserem Körper oder Geist empfangen, bliebe sehr schnell nichts von uns übrig. Physiologisch und kulturell geprägt, haben wir zu unseren Körperteilen und Sinnessystemen einen unterschiedlichen Bezug. Hände sind uns näher als Füße, Augen erscheinen den meisten wichtiger als Nasen oder Ohren.
Als gefühlte Ganzheit wollen wir uns in eine Einheit mit anderen Einheiten fügen, an anderen andocken oder uns teilweise vermischen. Wir suchen nach Passungen, so wie es auch Bakterien und Viren tun. Passt etwas, belohnt es uns.
Unsere ersten Verbindungen zwischen unserem Innen und dem Außen finden in einem geschlossenen Raum statt, im Mutterbauch, noch ohne Blickkontakt mit Menschen oder menschlichen Berührungen. Wir bauen Verbindungsempfindungen auf über Reize wie Darmgeräusche, Herzschlag, Nabelschnur, Plazentageschmack und -geruch; später auch über auditive Reize wie die Stimme der Mutter, über Berührungen auf oder Druck in ihrem Bauch, und über das Schaukeln, wenn sie sich bewegt oder geht. Unser visuelles System wird erst zu einem späteren Zeitpunkt dominant, dann aber wird es für die meisten Menschen zur wichtigsten Grundlage von Verbindungen. Die sogenannte Spiegeltherapie nutzt dies.
Manche Menschen, die eine Gliedmaße verloren haben, zum Beispiel einen Arm, leiden an Phantomschmerz: Der Arm, der nicht mehr da ist, tut weh. Das Gehirn kann offensichtlich den Verlust des Armes nicht nachvollziehen, vielleicht geschah er zu plötzlich. Das Gehirn sucht über die gekappten Nervenenden die Verbindung wiederherzustellen zu etwas, was in der Körpervorstellung da sein müsste, in dem jedoch zuletzt ein akuter Schmerz abgespeichert wurde. Das Nichtgelingen ist ambivalent, einerseits will das Gehirn das Wiedererleben der letzten Schmerzen vermeiden, andererseits quält das chronische ‚unfinished business‘, es absorbiert alle anderen Empfindungen. Richard Bandler riet Ärzten schon in den 70er-Jahren dazu, bei Phantomschmerz die Schmerzmittel nicht in den realen Arm zu spritzen, sondern in den fehlenden Arm, denn es ist der fehlende Arm, der schmerzt. Aber selbst, wenn das Schmerzmittel, in den fehlenden Arm gespritzt, in der Vorstellung des Menschen den ehemaligen Arm wiederbelebt, bleibt die geistige Verbindungsvorstellung nicht unbedingt bestehen.
In der Spiegeltherapie wird versucht, die Verbindung des Gehirns zu dem verlorenen Arm über Visualisierung wieder herzustellen. Der Patient sitzt entspannt an einem Tisch, auf dem ein Spiegel steht. Sein vorhandener Arm liegt auf der Tischplatte und wird vom Spiegel erfasst. Die andere Körperhälfte und der Armansatz des fehlenden Arms sind verdeckt. Im Spiegel sieht sich der Patient spiegelverkehrt, er sieht sich also selbst, nun mit seinem nichtvorhandenen Arm dran. Dem Gehirn ist das Bild vertraut, es erinnert sich. Es nimmt den verlorenen Arm für real, ohne Schmerzen, und reaktiviert die ursprüngliche Verbindung (zur Unterstützung braucht es entsprechende Suggestionen). Allmählich, in mehreren Durchgängen, kann das Gehirn den ‚falschen‘ Arm wieder loslassen, die Trennung nachvollziehen und akzeptieren, dass dieser Arm nicht mehr am Körper ist. Die körperlichen Schmerzen bleiben weg, das Business ist ‚finished‘. Für die seelischen Schmerzen, den seelischen Bruch, braucht es dennoch eine ergänzende Psychotherapie.
Wir können also auf verschiedene Weise in Verbindung gehen. Wir können unser Körperbild erweitern und verändern, wir können mit anderen oder anderem vorübergehend oder dauerhafter in unserer Vorstellung ‚verschmelzen‘. Jedoch hat auch die Spiegeltherapie nur eine Erfolgsquote von bis zu 70%. Das heißt: bei 30% funktioniert sie nicht.
Viele Autisten oder auch Neurotypische, die durch Menschen traumatisiert wurden, können nicht oder nicht gut in ein Spiegelbild hineingehen, in eine Vorstellung von sich selbst, in einen Film oder in ein Foto. Das Bild bleibt außerhalb von ihnen. Zum einen kann es sie stören, dass Fremdes ins Bild hineingemischt ist über die Spiegelverkehrtheit, den mitgespiegelten Hintergrund oder einen einschränkenden Spiegelrahmen. Zum anderen kann ihnen die Nähe zu anderen Lebewesen oder Menschen unangenehm sein, nämlich wenn sie Nähe mit Übergriffigkeit assoziieren. Dann wird selbst das eigene Spiegelbild nicht gerne als körperlich substantiell wahrgenommen (was es ja auch nicht ist). Es triggert in seiner Frontalheit und durch das eingefangene Hintergrundbild die Vorstellung von anderen Menschen, von Fremdblicken.
Wie können wir gleichzeitig wir selbst sein und ein anderer? Ein Spiegelbild, eine Filmfigur oder ein Avatar wird, wenn er lebendig erscheinen soll, verkörperlicht. Er wird mit fiktiver Körperwärme und Emotion gefüllt. Neurotypische gehen in ein Spiegelbild, in eine Filmfigur, eine Spielfigur oder einen Avatar hinein wie in einen Mantel, in den sie sich einhüllen. Ihnen reicht die Außenfassade, um sich als jemand anderer zu fühlen, sie fühlen vorwiegend von außen nach innen. Autisten, bestimmte Traumatisierte und auch einige Neurotypische müssen in solch einer Situation das Außenbild jedoch abwehren, denn sie nehmen eher von innen nach außen wahr. Sollen sie etwas von außen in sich hineinnehmen, wird die erzwungene ‚Nähe‘ als Übergriff oder als Überwältigung erlebt.
Menschen, die sich selbst im Spiegelbild suchen, werden nach der altgriechischen Legende als Narzissten bezeichnet. Aber niemand sucht nur sich selbst im Spiegel. Schauen wir uns im Spiegel an, schaut immer noch jemand anderes mit. Wir erinnern uns an frühe Fremdblicke, und immer sind wir im Spiegel falsch gespiegelt, mindestens seitenverkehrt. Unser Spiegelbild passt nicht wirklich zum Körper-Selbstgefühl, es ist außerhalb von uns.
Narziss war ein schöner Jüngling, vielleicht auch nur einfach der einzige Jüngling, der an einem bestimmten Flussufer mit seiner Nymphen-Mutter lebte. Er war ein Hahn im Korb. Viele junge Nymphen umwarben ihn, wollten von ihm wahrgenommen und angesehen werden. Sie begannen ihn zu hassen, weil er keine Notiz von ihnen nahm, sondern stattdessen in den Fluss blickte, tagein, tagaus. Schauten sie, was Narziss anschaute, sahen sie das Spiegelbild von Narziss und meinten, er sei in seinen eigenen Anblick versunken. Als er in den Fluss sprang, untertauchte und verschwand, glaubten sie, er hätte vor lauter Verliebtheit in sich selbst sein Spiegelbild ergreifen wollen. Aber Narziss suchte nach etwas anderem. Er kannte seinen Vater nicht, er wusste nur, dass er ein Flussgott war und seine Mutter vergewaltigt hatte, sodass sie nie über ihn sprach.
Spätestens in der Pubertät wird die Frage nach der Herkunft, nach dem Wesen der Erzeuger, nach der Zugehörigkeit wichtig. Sie kann wichtiger werden als alles andere. Wird sie nicht beantwortet, ist kein Raum frei für Verbindungen anderer Art, denn wir fühlen uns nicht als vollständiges Ich. Erst muss die Leerstelle gefüllt, der Phantomschmerz besänftigt werden. So spiegeln viele Neurotypische ihre eigene Leerstelle und hoffen, ein anderes Gesicht möge dazukommen, ihr eigenes Gesicht wohlwollend wahrnehmen, und somit ihr Sein und So-Sein bejahen.
Die existentiellen Grundbedürfnisse wie Nahrung, Wasser, Luft, Wärme, ein sicherer Ort etc. stehen schon am Anfang unseres Lebens in Wechselwirkung mit den Grundbedürfnissen Verbindung und Zugehörigkeit. Nur in Extremsituationen können diese existentiellen Grundbedürfnisse wichtiger werden als gefühlte Verbindung und / oder Zugehörigkeit. Setzen Erwachsene ein kleines Kind aus, kann es nicht überleben. Der Ausschluss aus der Gruppe bedeutete also zumindest in früheren Zeiten den sicheren Tod. Diese Grenzerfahrung sitzt tief in uns. Daher wirkt Mobbing so verheerend, daher können auch erwachsene Menschen sterben, wenn sie über Voodoo-Rituale aus ihrer Gruppe verbannt und mit einem Todesfluch belegt werden.
Das Gefühl der Zugehörigkeit entsteht aus beidseitig wahrgenommener, manchmal auch aus einseitig fantasierter Verbindung. Es entsteht über die sogenannte Bindung, die kleine Kinder zu ihren Bezugspersonen aufbauen. Auf welche Weise wir Bindungen eingehen, hängt von der Art ab, wie wir Verbindungen zu uns selbst und unserer Umwelt aufgebaut haben. Dies ist bei Autisten von Anfang anders als bei Neurotypischen (dazu später).
Ein Baby fügt seine verschiedenen Sinnesempfindungen zusammen durch Gleichzeitigkeit. Es studiert das Bild, das Gesicht einer Bezugsperson, dann greift es danach und ‚begreift‘ es nun über zwei Sinnessysteme. Hört es dazu noch die Stimme der Bezugsperson, wird auch das auditive System mitverknüpft. So wird die Bezugsperson zu einer Gesamtgestalt, zu der das Baby eine Beziehung aufbaut.
Haben wir als kleine Kinder erste Bindungen aufgebaut, sichere oder unsichere, lernen wir anhand dieses Grundmusters Verbindungen auch zu anderen Lebewesen einzugehen. In einer guten, sicheren Verbindung fühlen wir uns wahrgenommen, beachtet und erkannt in unseren Bedürfnissen. Idealerweise sind wir auch in Verbindung mit uns selbst, sodass wir auch andere wahrnehmen können, ohne diesen ihren Raum zu nehmen oder selbst unseren Raum zu verlieren.
Obwohl wir nicht festgebunden, nicht in Besitz genommen werden oder falsch verbunden sein wollen, geschieht genau das immer wieder. Denn viele haben schon als Kinder gelernt, unter Zugehörigkeit nicht Einander-Zuhören zu verstehen, sondern Einander-Gehören oder gar Hören und Folgen. Dann müssen die Betroffenen nach immer mehr Beweisen suchen für ihre Zugehörigkeit, denn die Verbindung ist nicht wirklich stimmig und kann daher nicht gefühlt werden.
Viele Menschen mit unsicherer Bindung glauben, eine Verbindung zu verlieren, wenn sie das betreffende Wesen oder Objekt nicht ständig spüren, sehen, hören oder daran denken. Sie suchen nach einer statischen Verbindung, nach absoluter Sicherheit und Zugehörigkeit. Eine statische Sicherheit muss für sie greifbar sein, wie für ein Baby der Körperkontakt mit der Mutter. Nur klammert kein Baby konstant an der primären Bezugsperson, sondern lernt Hinzu- und Weg-von-Bewegungen in Interaktion mit der Bezugsperson. Würden Menschen eine statische Sicherheit finden, müssten sie sofort wieder aus ihr ausbrechen, denn wir sind wie alles Lebendige dynamisch. Was sich nicht bewegt, halten wir für tot.
Auch wenn wir nicht in Verbindung zu anderen Menschen gehen, arbeiten unsere Gehirne und Körper ständig daran, Dinge in Verbindung zu bringen. Was hat der eine Sinnesreiz mit einem anderen Sinnesreiz zu tun? Was war vorher, was nachher? Wie hängt das eine mit dem anderen zusammen, gibt es Kausalitäten? Gibt es etwas Neues im Vertrauten, oder gibt es Abweichungen? Unser Gehirn versucht sowohl im Wach- als auch im Schlafzustand, alles raumzeitlich in das ursprüngliche Ablagesystem einzuordnen und es dort zu komprimieren, um Platz für neue Erfahrungen zu schaffen. Auf diese Weise sind wir immer wieder frei, zu lernen. Auch unser Ablagesystem kann sich erweitern und Spielraum bieten für neue Kategorien oder erweiterte Perspektiven.
Rhythmisch und dynamisch
Alle Verbindungsoptionen haben eines gemeinsam: Sie sind rhythmisch oder zumindest dynamisch. Sie sind niemals statisch, auch wenn Menschen für ihr Sicherheitsgefühl Statik anstreben und darüber die Verbindung wieder verlieren. Lücken oder Synkopen prägen uns genauso wie anwesende Sinnesreize. Nur in der Pause können wir wahrnehmen. Ein Dauerton, ein Dauergrundrauschen muss ausgeblendet werden, sonst haben wir Mühe, andere Reize aufzunehmen, sie einzuordnen oder zu verarbeiten. Daher gewöhnen wir uns an Dauerreize und reagieren nicht mehr auf sie. Man nennt das Habituation.
Unser Gehirn reagiert also nur auf Abweichungen des Gewohnten. Durch Ablenkung, durch das Umschwenken auf andere Sinnessysteme, können wir Dauersignale kurzfristig ausblenden, aber das funktioniert nur begrenzt. Hört ein Dauerton nicht auf zu tönen, wird er von der Wahrnehmung abgekoppelt. Zu laut dauerbeschallte Embryonen können für die entsprechende Frequenz taub werden, körperwarmes Badewasser wird nicht gefühlt. Ein zu regelmäßiger Herzschlag der Mutter, ohne Synkopen, würde das mitschwingende Herz des Ungeborenen nur unzureichend auf die Anpassung an verschiedene Erregungszustände vorbereiten.
Unsere Sinnessysteme takten ebenso wie unsere Organe in unterschiedlichen Rhythmen. Unser Geruchssinn schaltet den Empfang eines neuen Geruchs nach ca. sieben Minuten ab. Erst nach weiteren sieben Minuten können wir denselben Geruchsreiz erneut riechen.
Auch unser Schmerzsystem taktet auf diese Weise, solange der Schmerz nicht zu vehement ist. Wir können Schmerz unterdrücken, uns von ihm ablenken, aber er kommt immer wieder, bis die Ursache geheilt ist. Das trifft auf körperliche Schmerzen genauso zu wie auf seelische. Unser Gehirn selbst ist schmerzunempfindlich, daher ist es für die Schmerzmeldung und -verarbeitung zuständig.
Unser Schmerzzentrum im Gehirn ist für beide Schmerzarten zuständig, für seelische wie für körperliche – wie eine Stadt, die aus zwei Stadtteilen besteht. Bei kleinen Kindern und einigen Erwachsenen sind die Stadtteile nicht voneinander zu unterscheiden. Sie reagieren dann in der Regel psychosomatisch, also gleichzeitig seelisch, emotional und körperlich.
Je nach Kultur und Sozialisation werden die Schmerz-Stadtteile im Laufe des Heranwachsens getrennt, manchmal werden sogar verbindende Straßen und Brücken blockiert. Dann somatisieren wir nur noch und nehmen unseren seelischen Schmerz nicht mehr wahr, oder wir nehmen umgekehrt nur noch den seelischen Schmerz wahr und ignorieren den körperlichen Schmerz. Eine Blockade in dem einen Stadtteil kann jedoch auch zur Blockade im anderen Stadtteil führen.
Neurowissenschaftler können eine sogenannte Schmerzsignatur identifizieren. Sie haben festgestellt, dass chronische, körperlich stark empfundene Schmerzen dazu führen können, dass das System ‚umspringt‘, es feuert dann Signale zunehmend mehr im emotionalen Bereich. Genauso können chronische seelische Schmerzen umspringen in körperlichen Schmerz. Menschen, bei denen die gesamte Schmerzstadt blockiert ist, leben in der Regel nicht lange.
Manche Menschen behaupten, keine Gefühle entwickeln zu können, wenn sie nicht auch ihren Körper spüren. Aber Menschen fühlen auch mit ihrem Geist oder Gehirn, selbst wenn der Körper betäubt ist. Natürlich können Gefühle intensiver wahrgenommen werden, wenn zugleich Körperempfindungen wahrgenommen werden, und natürlich erweitert sich die Gefühlsskala oder Gefühlspalette, wenn wir den Körper miteinbeziehen. Wir nehmen dann mehr Sinnesreize auf, vor allem aber haben wir dann mehr Worte dafür. Gefühle ohne Bezeichnung können wir schlecht bewusst einordnen. Wenn es um Selbstvergewisserung und Selbstverankerung geht, ist das Spüren und Bewohnen unseres Körpers sehr wichtig, ansonsten können wir uns abgeschnitten fühlen. Es ist beim Fühlen wie beim Schmecken. Auf den Eigengeschmack von Gefühlen wirkt das Bewohnen und Spüren des Körpers wie Gewürze. Entziehen wir die Gewürze, schmeckt alles erst einmal nach nichts. Jedoch können wir durch abgespeicherte Erinnerungen geistig nachwürzen.
Wir sind in ständiger Verbindung mit dem, was uns umgibt, von Anfang an, indem wir mitschwingen. Womit wir im Einzelnen mitschwingen, ist individuell verschieden, und Schwingen ist immer geprägt durch Dynamik, also Abweichungen. Mit einer Flatline können wir nicht mitschwingen. Wir schwingen uns auf unsere Mitmenschen ein, wir spiegeln ihren Tonfall, ihre Bewegungen, ihre Energie. Wir takten mit den Tageszeiten, mit den Jahreszeiten, mit der Erdumdrehung, mit den Lichtverhältnissen, mit den Aktivitäten unserer Organe (Biorhythmus). Die saisonal immer wiederkehrenden Farben in der Mode greifen diesen Mechanismus auf, wir wollen uns auch im Außen an die Verhältnisse anpassen.
Zusammenhängende Tonfolgen, also Musik, wird oft als das verbindende Medium zwischen Menschen, Völkern und Nationen beschrieben. Wenn wir in Verbindung mit einem Rhythmus gehen, fantasieren Neurotypische darüber eine Verbindung zu den Menschen, die sich zu dem gleichen Rhythmus bewegen und in ihm mitschwingen – Synchronizität als Kriterium für Verbindung oder gar Einssein.
Reiten triggert einen ähnlichen Mechanismus. Schon vorgeburtlich werden wir durch die Schritte der Mutter wiegend getragen. Später, als Kleinkinder, würden wir als Traglinge natürlicherweise auf der Hüfte der Mutter sitzen und die Beine um ihren Körper schlingen. Bewegt sich ein Pferd unter uns und wir können mitschwingen, fühlen wir uns deshalb von ihm angenommen. Wir glauben, in Verbindung zu sein, ohne auf das tragende Wesen achten zu müssen. Das kann zum Erfolg von Reittherapien beitragen, aber leider auch zu Fehleinschätzungen der Pferdebefindlichkeit.
Dadurch, dass wir für die Funktionsfähigkeit unserer Wahrnehmung Lücken oder Synkopen brauchen, ist unsere Wahrnehmung zwar immer gefüllt, aber nie vollständig. Auch unsere visuelle Wahrnehmung zeigt uns nicht alles, obwohl wir in der Illusion leben, alles zu sehen. Wir blinzeln an die zwanzigmal pro Minute, und mit jedem Lidschlag erzeugen wir eine visuelle Wahrnehmungslücke. Wir überbrücken sie mit Erwartungsbildern, die wir verknüpfen mit den zuletzt gesehenen Bildern, den Nachbildern. Gleichzeitig verknüpfen wir die Erwartungsbilder mit Bildern aus unserer Erinnerung, zumal wenn früher Erlebtes getriggert wird. Diese Fähigkeit zu Erwartungsbildern, die die Lücken in der Wahrnehmung füllen und uns suggerieren, unser Sehen zeige uns einen zusammenhängenden Film, ist eine Grundvoraussetzung einerseits für die Vorstellung von Zukunft, zum anderen für Fantasie.
Besonders im Zustand der ‚blinzellosen‘ Wahrnehmung (Trance, Meditation, drittes Auge) glauben Menschen, alles wahrzunehmen und nehmen alles für wahr. Sie können in dem Zustand nur schwer oder nur auf andere Weise denken oder fantasieren. Es fehlt dann die Lücke zur Verarbeitung, es gibt keine kognitive Dissonanz, keine Widersprüchlichkeiten. In diesem Zustand fühlen Menschen sich sicher und zeitlos. Sie glauben, frei zu sein von Glaubenssätzen oder subjektiven Interpretationsmustern. Aber auch eine Fliege verfügt über hervorragende Mosaik-Augen, und doch erkennt sie das Spinnennetz nicht und nicht die Glasscheiben unserer Fenster.
Im Übrigen blinzeln beispielsweise auch Schlangen; alle Lebewesen leben in Rhythmen. Schlangen blinzeln mit ihrem wichtigsten Sinnesorgan, der Zunge: sie züngeln. Jedes Mal, wenn eine Schlange ihre Zunge zurückzieht, damit diese nicht austrocknet oder festklebt und damit sie wieder neue Reize aufnehmen kann, hat sie eine Wahrnehmungslücke. Diese Lücke muss sie genau wie Menschen überbrücken mit Vorstellungen. Als Schlange tut sie dies vermutlich mit Erwartungs-Geruchs-Spürmustern.
Der Mensch ist mit Sicherheit nicht das einzige Wesen mit Vorstellungen zu Zukunft und Vergangenheit. Ebenso wenig ist er das einzige Wesen, das sich im Spiegel erkennen kann. Der Mensch definiert als Spiegel nur den visuellen Spiegel, nicht aber den Geruchsspiegel von Hunden oder den Tast-Spür-Spiegel von Katzen oder blinden Menschen. Der Mensch glaubte lange, nur er könne fühlen, denken, sich im Spiegel erkennen, fantasieren, sich erinnern… Alles Illusion. Immerhin sind einige Wissenschaftler mittlerweile bereit, noch andere Sinnessysteme anzuerkennen oder andere Aufbauten des Gehirns. Vögel und Oktopusse haben keinen Cortex, und doch sind auch sie nach menschlicher Definition sehr intelligent. Viele behaupten, Fische seien stumm und taub, dabei weiß jeder Fischer, dass dem nicht so ist. Aber erst, wenn es ‚wissenschaftlich bewiesen‘ ist, korrigieren Menschen ihre falschen Annahmen.
Verbindungen loslassen
Wir können nicht statisch oder dauerhaft auf gleiche Weise in der gleichen Verbindung sein. Nicht mit Menschen, nicht mit Ideen, nicht mit der Umgebung, nicht mit uns selbst. Denn weder wir noch sonst etwas ist statisch und unveränderlich. Auch Verbindungen sind Rhythmen unterworfen und brauchen Synkopen.
Nicht einmal die Vorstellung von ewiger Liebe währt ewig. Wir können sie nur ab und zu heraufbeschwören, und dabei verändert sie sich jedes Mal. Wir müssen immer wieder loslassen, seelisch, geistig und physiologisch. Lösen wir nicht immer wieder Verbindungen, spüren wir sie nicht mehr, und wir schaffen keinen Raum für Neues. Atmen wir nicht aus, können wir nicht einatmen; scheiden wir nicht aus, können wir keine neue Energie aufnehmen. Vergessen wir nicht, können wir nicht verlernen und Neues lernen.
Verbindungen jeglicher Art, seelisch, körperlich und geistig, können wir besser loslassen, wenn es in einem Prozess geschieht, wenn genügend andere tragende Verbindungen vorhanden sind oder gleichzeitig neue Verbindungen entstehen. Niemand wird versuchen, unter Wasser auszuatmen, wenn er nicht gleich wieder auftauchen kann – wir halten dann lieber die Luft an.
Menschen gehen unterschiedlich miteinander in Verbindung, je nach Entwicklungsphase, Vorstellungsvermögen und je nachdem, wie eine Verbindung vorwiegend erlebt wird: körperlich, geistig, seelisch oder in einer Kombination. Das Loslassen einer veräußerlichten linearen Verbindung fühlt sich anders an als das Loslassen einer innerlich empfundenen. Viele Menschen visualisieren Verbindungen ähnlich wie ausgestreckte Arme, die einen anderen berühren. Sie verkörperlichen ihre Vorstellung und halten sie in gewisser Hinsicht für linear. Andere fantasieren Verbindung als ‚rund‘, ähnlich wie Umarmungen, oder wie kleine Kinder, die umklammern und gehalten werden wollen. Noch andere stellen sich Verbindung als eine Einheit vor, dann ‚kleben‘ oder verschmelzen sie. Wird ein ausgestreckter Arm nicht ergriffen oder gar plötzlich losgelassen, oder wird man fallengelassen, reißt die gefühlte Verbindung ab oder wird abgeschnitten.
Es ist ein Unterschied, ob wir freiwillig aus einer Verbindung gehen, ob wir losgelassen oder gar verlassen werden. Ebenso macht es einen Unterschied, ob uns jemand von der Seite geht oder aus dem Herzen, ob jemand uns zur Seite stand wie eine Stütze, ob jemand hinter uns stand und dadurch Rückendeckung gab oder ob wir uns von jemandem umhüllt fühlten.
Wir können Menschen, die uns wichtig sind, in einer Familienaufstellung aufstellen und schauen, wo im Raum sie ihren Platz haben. Wir können dies auch in unserer Vorstellung tun. Dann stellen wir andere Menschen in unserem inneren ‚Sozialen Panorama‘ auf (der Begriff stammt von Lukas Derks, ‚Das Spiel sozialer Beziehungen‘). Wo ein Mensch in unserer Vorstellung verorten, spielt eine entscheidende Rolle dafür, wo der gefühlte Riss oder die Lücke entsteht, wenn jemand geht, und wie sichtbar oder spürbar das Fehlen ist. Jeder kann in seiner Vorstellung prüfen, wo ‚seine‘ Menschen verortet sind: Vorne, hinten, links, rechts, an der Seite, nah, weiter weg, größer, kleiner, leuchtender… Stehen die Menschen verlässlich an der immer gleichen Position, wechseln sie ihren Standort, sind sie klar zu erkennen? Wo schauen sie hin, wie schaue ich auf sie, zu wem spüre ich eine Verbindung, und wenn, auf welche Weise?
Je wichtiger eine Verbindung ist, desto eher mündet das Loslassen von ihr in einen Trauerprozess. Prozesse brauchen Zeit, doch in unserer Kultur soll auch Loslassen schnell geschehen: Hast du etwas verloren, kauf dir einen Ersatz, etwas Neues, etwas Besseres. Stillstand ist Rückschritt, die Rädchen müssen sich weiterdrehen, niemand darf den gemeinsamen Takt stören, der eine Grundverbindung unseres Miteinanders suggeriert. So stehen Arbeitsnehmern nach dem Verlust eines nahen Verwandten maximal drei freie Tage zu. Wer länger als zwei Wochen trauert, soll zum Arzt oder Therapeuten und erhält dann die Diagnose Depression. Entstandene Lücken sollen schnellstmöglich wieder mit ‚guten‘ Bildern gefüllt werden.
Ein gelungener Trauerprozess schließt natürlich immer mit versöhnlichen Bildern ab. Die Lücke ist dann zumindest diffus oder weich gefüllt, sodass sie nicht mehr akut schmerzt. Für den gegangenen Menschen wird ein anderer Platz gefunden, beispielsweise im Himmel, und andere Menschenbilder rücken in den Vordergrund oder näher an die Lücke heran, die sich dadurch verkleinert. Doch das gelingt nicht unter Druck oder in einem vorgegebenen Zeitraum.
Zudem ist das Verändern der Bilder und das visuelle Schließen der Lücke nur ein Aspekt des Trauerprozesses. Die Menschen, die gegangen sind, waren nicht nur mit Bildern verknüpft, sondern auch mit bestimmten Körperempfindungen, mit Glaubenssätzen, Erinnerungen und Sicherheiten, vielleicht auch mit Schuldgefühlen. Jeder Mensch hat sein individuelles Grundmuster. Manche Leerstellen können nicht oder nur unzureichend gefüllt werden (Broken Heart Syndrom), und manche Lücke sollte noch eine Weile betrachtet werden. Vielleicht taucht ein dahinterstehendes Bild auf, das vorher verdeckt war, und sonst wieder verdrängt wird, ein Bild, mit dem sich der Trauernde befassen sollte. Denn vielleicht leidet er nicht nur unter dem aktuellen Verlust, sondern auch unter dahinterliegenden, in früheren Zeiten erlebten Verlusten oder Erlebnissen, die noch nicht aufgearbeitet werden konnten.
Da die Verortung im inneren Familiensystem, im sozialen Panorama, und die Qualität der Verbindungen so unterschiedlich sein können, passen die offiziellen fünf Trauerphasen nicht für jeden Menschen, weder inhaltlich, noch in der vorgegebenen Reihenfolge (Verleugnung, Wut, Verzweiflung, Resignation und Akzeptanz). Kinder trauern ohnehin anders als Erwachsene, sie fühlen sich nicht verpflichtet und sind auch nicht imstande, 24 Stunden am Tag an jemanden zu denken. Sie gehen in die Trauer hinein und wieder hinaus in das Leben, sie wechseln hin und her und erstarren daher seltener komplett. Täten sie es, könnten sie innerlich und äußerlich nicht mehr wachsen, sie würden alle Verbindungen zum Leben abschneiden. Viele Erwachsene, die sich sogar verbieten, dass in ihnen ein Lächeln aufscheint, während sie in Trauer sind, verstehen das nicht und machen ihren Kindern bewusst oder unbewusst Vorwürfe. Aber Kinder leben mehr im Hier und Jetzt, wie Autisten.
Auch Frauen, die ein ungeborenes Kind verlieren, werden in dieser visuellen Welt selten verstanden. Ihre Trauer wird abgetan mit Sprüchen wie: ‚Das Kind war ja noch gar nicht da‘, oder: ‚Du kannst doch ein Neues haben‘. In der Tat haben schwangere Frauen ihr Kind noch nie gesehen. Ihre Trauer ist innerlich und körperlich, sie haben nur diffuse visuelle Vorstellungen. So hilft es den meisten, wenn ihre ‚Sternenkinder‘ schön fotografiert werden. Dann können sie eine visuelle Verbindung zu ihnen eingehen, die Verbindung darüber veräußerlichen, im Äußeren einen Platz schaffen und ein wenig loslassen. Und sie haben einen ‚Beweis‘, dass sie um etwas Reales trauern, sodass andere mittrauern können.
Je nach individueller Bevorzugung bestimmter Sinnessysteme brauchen wir beim Prozess des Loslassens Unterschiedliches, meistens mehreres gleichzeitig. Manche brauchen es, sich auszusprechen, manche wollen schreiben oder malen, manche sich bewegen. Für das visuelle System brauchen wir gute Bilder, je beunruhigender die letzten Bilder waren, umso mehr davon. Für das Namenlose, Unbegreifliche am Verschwinden eines Wesens brauchen wir gute Benennungen, Worte. Und für das verschwundene Körperlich-Wesenhafte brauchen wir einen Platz, sowohl im Außen, beispielsweise auf einem Friedhof, als auch in unserer Vorstellung.
Es ist schlimm für Menschen, wenn ihnen Nahestehende irgendwo in der Ferne gestorben sind und sie nicht genau wissen, wie und wo dies geschah. Im zweiten Weltkrieg, als deutsche Soldaten in Russland kämpften, steckten viele ihrer Söhne Fähnchen auf eine Karte, die den Frontverlauf markierten. Sie warteten auf die Rückkehr des Vaters, waren in Gedanken bei ihm, begleiteten ihn in einem sehr großen, fernen Land. Kam der Vater nicht zurück, blieben die Assoziationen an ihn mit dem fernen Land verbunden. Die Kinder hofften auch noch als Erwachsene auf ein Zeichen aus dem Land, das den Vater ‚beherbergt‘, sie suchten nach einem Zeichen. Selbst wenn manche Väter zurückkamen, waren sie verändert. Etwas von ihnen war in der Ferne geblieben, wie die Sehnsucht der Kinder nach den verlorenen, vaterlosen Jahren.
Dieses die Väter-in-der-Ferne-Verorten in Kombination mit diffusen Schuldgefühlen der damaligen Kinder – die Väter gehörten zu den Verlierern und wer weiß, was sie für Untaten begingen – mag die Dienstbarkeit einiger deutscher Politiker gegenüber russischen Machthabern miterklären. Die Sehnsucht nach dem Vater wird verschoben auf männliche Repräsentanten des fernen Landes; das Bedürfnis, dem Vater nahe zu sein, ihn zu unterstützen oder ihn zu rechtfertigen, trübt das Denkvermögen. Solche verschobenen Sehnsüchte können unbewusst weitergegeben werden, genauso wie etwaige Traumata.
Leider gibt es für Tote wie auch für Lebende immer weniger Raum und Platz, alles wird zunehmend in den unendlichen, visuellen Vorstellungsraum verlagert. Aber im Internet und im Metaverse bauen die Menschen die gleichen Städte, die sie in der Basiswirklichkeit kennen, und sie stellen auch die gleichen Regeln auf. Es wird alles verdoppelt, sodass die Menschen wie in einem (schöneren?) Spiegel zu dem ihnen Vertrauten in Verbindung gehen können, wenngleich nicht mit allen Sinnen. Ein trügerisches Sicherheitsgefühl entsteht, das abrupt enden kann, wenn die Datenwelt zusammenbricht, dann ist alles weg.
Zu plötzliches Loslassen, zu schnelle Trennung oder Kappung von Verbindung kann zu Schocktrauma und Phantomschmerz führen. Dann braucht es noch viel mehr, um loszulassen. Einige Menschen halten es daher für eine Lösung, erst gar nicht in Verbindung zu gehen, um Trennungsschmerz prophylaktisch zu vermeiden.
Buddhisten versuchen, alle Anhaftungen an das Irdische zu lösen. Leid entsteht ihrer Vorstellung nach durch Emotionen, Begehren, Streben, letztlich durch Hinzu-Bewegungen. Nur im rein geistigen Vorstellungsraum ist alles sicher, wahr und frei. Jedoch leben auch Buddhisten in Verbindungen und haften an, denn niemand kann nicht anhaften. Buddhisten haften beispielsweise an ihrem Heimatland, an ihren Ritualen, an ihren Glaubenssätzen, an Statuen, an ihrem Abt oder höchsten Repräsentanten; sie leben meist ihr Leben lang im gleichen Kloster, von Kindheit an immer mit den gleichen Brüdern oder Schwestern. Sie stehen immer zur gleichen Uhrzeit auf, haben eine Hierarchie und nur eine bestimmte Wahrnehmungsperspektive. Sie essen, was ihnen vorgesetzt wird, aber der Geruch der Räucherstäbchen ist nicht beliebig. Sie haben es auch nicht sonderlich eilig, in ihr Nirwana einzutreten. Manche halten sich für einen Bodhisattva, für einen Erleuchteten oder Erwachten, der beauftragt ist, sein Wissen weiterzugeben. Verlässt der Kapitän das Schiff aber als Letzter, bedeutet es, dass er an seinem Schiff hängt oder an seiner Pflicht. Buddhisten verstehen unter Anhaftung also nur eine Auswahl an möglichen Verbindungen.
Wir können Loslassen auch mit Vergessen, Entwerten oder Wegwerfen verwechseln. Wir haben alle gelernt, die Verbindung zu etwas eben noch Aktuellem, Wertvollen oder Interessantem abrupt zu kappen, da wir unsere Aufmerksamkeit in bestimmten Situationen abrupt auf etwas anderes richten müssen, zum Beispiel bei Gefahr. Wir können nicht auf alles achten, wir können nicht gleichzeitig in allen Sinnessystemen Verbindung zu allem spüren. Wenn Menschen behaupten, mit ‚Allem‘ in Verbindung zu sein, sind sie nur in Verbindung zu ihrer Vorstellung von ‚Allem‘.
Kleine Kinder üben fallenlassen und wiederaufheben, beides ist ihnen gleich wichtig. Später lernen sie von ihren Bezugspersonen, achtlos wegzuwerfen. Vielleicht galten die von ihnen gebauten Türmchen oder Puppenaufstellungen nichts mehr, sobald aufgeräumt werden musste oder der Staubsauger durchs Zimmer röhrte. Vielleicht galten sie selbst in bestimmten Situationen nichts. Eben noch lächelte jemand sie an, dann klingelte das Handy.
Jagte eine Mensch in früheren Zeiten ein Fluchttier, suchte er die Verbindung zu diesem über die Fährte, die Flugbahn eines Speeres oder Pfeiles. War das Wild erlegt, brach die Verbindung zu dem Lebewesen, das nun tot war, ab. Der Mensch kümmerte sich nur noch um das Verwertbare der Beute.
Es gibt also viele, sehr unterschiedliche Arten, in Verbindung zu gehen und Verbindungen zu lösen. Trotzdem gehen die meisten Menschen davon aus, dass alle anderen auf die gleiche Weise wie sie selbst Verbindung suchen und in Verbindung sind, was vor allem für Autisten zum Problem werden kann.
Zudem gehen Menschen nicht einfach in Verbindung zu anderen Menschen. Sie entwickeln Vorstellungen zu Menschen, innere Bilder, und gehen in Verbindung mit diesen. Sie legen ihre inneren Bilder auf das Außen, sie projizieren. Oft sind sie mehr in Verbindung mit ihren Bildern als mit den realen Menschen. Manche gleichen ihre Bilder nicht einmal mit den Menschen dahinter ab, sondern wollen diese an ihre Bilder angleichen.
Innere Bilder, Personenkonstanz, Schrödingers Katze
Zentral für menschliche Fähigkeiten, für die gesamte menschliche Kultur, ist unsere Vorstellungskraft. Sie entwickelt sich über den Wunsch nach Verbindung, meist nach Verbindung mit unserer ersten Bezugsperson. Durch die Entwicklung der sogenannten Objektkonstanz bzw. der ‚Personenkonstanz‘ bauen wir unser inneres soziales Panorama auf. Indem wir das Rätsel um Schrödingers Quanten-Katze lösen, finden wir einen wichtigen Unterschied zwischen Neurotypen und Autisten.
Selbst die fürsorglichsten Eltern können nicht ständig auf gute Weise bei ihren Kindern sein, weder körperlich noch geistig. Zudem kann kein Kind sich darauf beschränken, nur seine Eltern anzuschauen oder sie ständig körperlich zu spüren. Es braucht auch Raum für anderes. Menschenkinder entwickeln daher die sogenannte Objektkonstanz.
In der ‚modernen‘ Psychologie herrscht zurzeit Begriffsverwirrung zu den Begriffen Objektkonstanz und Objektpermanenz. Darauf gehe ich nicht ein. Ich arbeite im Folgenden mit dem Begriff Objektkonstanz und führe zusätzlich den Begriff der Personenkonstanz ein. Dieser meint Objektkonstanz in Bezug auf Menschen. Oder ist eine Mutter, meist ist ja sie die erste Bezugsperson, ein Objekt? Den Begriff Personenkonstanz gab es bereits, z.B. bei Gottfried Fischer, der sich hierbei auf Piaget bezieht (‚Die Beziehung des Kindes zur gegenständlichen und personalen Welt‘, 1986).
Auch andere Lebewesen entwickeln Objekt- und Personenkonstanz. Allerdings geht es bei ihnen viel schneller. Bei Menschenaffen, unseren nächsten Verwandten, sind sie nach spätestens drei Monaten schon abgeschlossen. Dass der Prozess bei Menschen länger dauert, ist bedingt durch seine Frühgeburtlichkeit. Die Aufrichtung zur Zweibeinigkeit, das aufrechte Gehen, führte einst zu schmaleren Becken, und diese führten zu früheren Geburten. Durch die Frühgeburtlichkeit benötigte das Kind für eine längere Zeit verlässliche Begleitung, das soziale Lernfenster wurde größer. Gleichzeitig wurde die Entwicklung der Objekt- und Personenkonstanz störanfälliger oder, positiv ausgedrückt, sie ließ mehr Raum für Varianten.
Objektkonstanz meint die innere Gewissheit, dass ein Gegenstand noch da ist, dass er existiert – auch wenn er im Außen nicht mehr wahrnehmbar ist. Hat ein Kind eine überdauernde Vorstellung beispielsweise von einem Ball entwickelt, hat es zu diesem eine Objektkonstanz entwickelt: Die Vorstellung des Balles hat sich von dem Objekt gelöst.
Während der Entwicklung der Objektkonstanz kommt also zu der Wahrnehmung eines konkreten Balles die Vorstellung eines Balles hinzu: Der Ball ist unter einen Schrank gerollt und nicht mehr sichtbar, aber er ist noch da, es gibt ihn noch. Die Vorstellung von dem Ball wird als Erinnerung abgespeichert und ist in der Gegenwart abrufbar. Es gibt nun also einen konkreten Ball und einen abstrakten Ball, den Ball an sich. Diese Ballvorstellung ist nicht nur Bild, sondern eine mehr oder weniger komplexe Gestalt. Sie kann auch aus Form, Ton, Geruch und Gefühl zusammengesetzt sein. Die Ballvorstellung steht nun stellvertretend für alle Bälle (erst später wird differenziert: Tennisball, Wasserball, Basketball, Fußball). Auch blinde und taube Menschen entwickeln selbstverständlich Objektkonstanz. Je mehr Sinnessysteme mit einer Vorstellung verknüpft sind, desto intensiver ist diese. Es ist jedoch schwer, starke Vorstellungen zu entwickeln nur über Bilder. Die Abbildung einer ‚Pizza‘ in einem Bilderbuch erzeugt in Kindern nur eine schwache Vorstellung. Backen sie hingegen eine Pizza mit anderen Kindern oder Erwachsenen und verspeisen sie anschließend, wird die Vorstellung ‚juicy‘.
Wenn wir für ein abgespeichertes Vorstellungsobjekt ein Wort haben, kommt eine Art Bilderrahmen hinzu. So können wir Bilder oder innere Filme durch Benennung einhegen und bannen. Taube Kinder bannen oder rahmen anders, vielleicht mit Farben und Formen. Blinde Kinder können mit Tönen, Rhythmen, Formen und Haptik konturieren.
Parallel zur Objektkonstanz entwickelt ein Kind eine Personenkonstanz: eine überdauernde Vorstellung von seiner ersten Bezugsperson. Diese Vorstellung ist überlebenswichtig. Jemand ist für mich da, jemand außer mir existiert, auch wenn ich niemanden sehe, fühle, rieche, oder höre.
Der Physiker Erwin Schrödinger entwickelte zu seiner Quantentheorie ein gedankliches Experiment, das einer etwas sadistischen Vorstellung entsprungen ist: Eine Katze wird in einen Käfig eingesperrt. Wenn ein ebenfalls darin befindlicher Atomkern zerfällt, stirbt die Katze. (Der zerfallende Atomkern löst entweder die Freisetzung von Giftgas oder den Mechanismus einer Pistole aus, die die Katze erschießt). Von außen ist nicht sichtbar, ob der Atomkern zerfällt und ob die Katze stirbt oder lebt. Ist die Katze nun da oder ist sie nicht da? Oder ist sie gleichzeitig da und gleichzeitig nicht da? Das Paradox ist so nicht lösbar. Bringen wir es aber in Analogie zur Entwicklung der Personenkonstanz, erscheint es logisch. Die Schrödingerfantasie entspricht dann m. E. einer Verdichtung des Erlebens kleiner Kinder in der Phase, in der sich die Personenkonstanz aufbaut: Das Kind beschäftigt sich immer wieder mit der Frage, ob die Bezugsperson da ist, ob sie existiert, auch wenn sie nicht mehr zu sehen, zu hören, zu riechen und zu berühren ist. Zerfällt das Bild von der Bezugsperson, wenn diese nicht anwesend ist, und zerfällt damit auch die Vorstellung von ihr? Dann gerät das Kind in einen gefühlt existentiell bedrohlichen Zustand, alleine kann es ja nicht überleben. Mit dem Bild der Bezugsperson ist bei Neurotypischen ein körperlich-seelisches Sicherheitsgefühl verknüpft. Nur wenn die Vorstellung der Bezugsperson, das Bild von ihr positiv und stabil ist, trägt es. Dann hilft es, eine gewisse Zeit ohne die Anwesenheit der Mutter zu überbrücken, dann ist diese durch die intensive Vorstellung irgendwie doch da.
Die Personenkonstanz steht also für eine zentrale innere Sicherheit. Sie wird zum Garant für die Existenz einer Bezugsperson – unabhängig von deren Präsenz.
Objekt- und Personenkonstanz erfüllen noch weitere Funktionen. Sie sind elementare Voraussetzung für Imagination und Abstraktion, sie stehen für die menschliche Fähigkeit, Geschichten zu erzählen. Wir könnten uns nicht über Bälle unterhalten, wenn wir keine Vorstellungen von Bällen entwickelt hätten. Ohne Objektkonstanz könnten wir nicht über Techniken oder Ideen sprechen, wir hätten keine gemeinsamen Metaphern, keine gemeinsame Narrative, keinen gemeinsamen Vorstellungsraum. Und ohne Personenkonstanz könnten wir nur schwer über Menschen, Lebewesen und Gefühle sprechen. Wir finden Bilder, Fotos und Filme faszinierend, weil sie eine Brücke bilden zwischen unseren Vorstellungen und der sogenannten Realität. Die Grenzen zwischen Personenkonstanz und Objektkonstanz sind natürlich fließend, und sie sind bei Neurotypen und Autisten verschieden.
Ich gehe davon aus, dass Autisten ihre Objekt- und Personenkonstanz auf eine etwas andere Weise als Neurotypen entwickeln. Das Objekt, der Ball bleibt, aber Schrödingers Katze zerfällt (mehr oder weniger, je nach Ausprägung des Autismus). Die Bezugsperson, die ‚Katze‘, baut sich nicht zu einer emotional-verkörperlichten Gestalt auf. Die potentiell angelegte Schablone für die Personenkonstanz wird anders gefüllt. Vermutlich enthält sie Licht, wie das Licht, dass wir angeblich als Letztes sehen, bevor wir sterben, aber sie enthält keine Person. Bilder haften darin nicht an. Die neurotypische, identifkatorische Art der Personenkonstanz kann auch im Nachhinein nicht gelernt werden. Sie erscheint Autisten als Lüge. Auch das soziale Panorama, das sich bei Neurotypen um die erste Bezugsperson herum ausbildet, ist bei Autisten dementsprechend diffuser, Gesichter bleiben vage. Die möglichen Gründe dafür beschreibe ich später.
Die Personenkonstanz steht auch für das Gefühl von überdauernder Verbindung. Jemand ist immer da. Dadurch bewerten viele neurotypische Menschen ihre inneren konstanten Bilder als wichtiger und wertvoller als die realen Personen. Reale Menschen werden dann leicht als unzuverlässig angesehen oder gar verachtet. Hingegen wird die Idee heilig. Nur sie ist zuverlässig da und bleibt vermeintlich ewig. Der von ‚modernen‘ Psychologen verwendete Begriff der Objektpermanenz ist jedoch eine Suggestion, denn nichts ist permanent oder unzerstörbar. Weder Gefühle noch Bilder noch Ideen noch die Herrschaft von Göttern oder Diktatoren.
Objekt- und Personenkonstanz entwickeln sich ca. in den ersten anderthalb Lebensjahren. Neurotypische Mütter spielen kulturübergreifend in dieser Zeit das sogenannte Guck-Guck oder Kuckuck-Spiel. Mal zeigen die Mütter ihr Gesicht, mal verdecken sie es, zum Beispiel mit einem Tuch. Das Kind wird sehr aufgeregt, wenn das Gesicht der Mutter verschwindet, und es strahlt, wenn das Gesicht wieder erscheint. Durch das Kuckuck-Spiel trainieren Mütter aber weniger die Personenkonstanz. Vielmehr emotionalisieren sie die Kinder, sie putschen sie auf. Mögen die Kinder das Spiel nicht, oder stimmt das Timing nicht, verstört es die Kinder und hat den gegenteiligen Effekt.
Es ist wie beim Kitzeln. Verpasst der Kitzelnde den Moment, in dem es für das Kind genug ist, schlägt das Kitzeln in Übergriffigkeit um. Die Kinder lachen schon gequält, aber der Kitzelnde hält es noch für lustig und fordert vom Kind ein, dass es weiter mitspielt. Viele Eltern überziehen, wenn sie selbst in Emotion und Aktion gefangen sind. Sie sind dann nicht empfänglich für feinere Signale.
Viele Eltern wollen aus Ungeduld oder aus anderen Gründen die Entwicklung der Personenkonstanz abkürzen. Vielleicht wollen sie mehr Zeit für sich allein oder sie glauben, schon kleine Kinder bräuchten ein eigenes Zimmer, wo es alleine durchschlafen soll. Doch eine Beschleunigung dieses Prozesses hat Folgen, genauso, wie wenn wir Hirnreifung oder Wachstum forcieren wollen, und sie stresst sowohl Kind als auch Eltern. Erlebt das Kind qualitativ und quantitativ nicht genug echte, gute Präsenz der Bezugspersonen, wird es dementsprechend auch keine zuverlässige Personenkonstanz entwickeln. Es wächst dann im Zweifel und in einer Lüge auf und wird seine Verbindungsimpulse anders oder an anderes koppeln. Es kann Kippbilder entwickeln von der guten oder der bösen Mutter; mal erscheint die eine, mal die andere, mal erscheint niemand. Diese Kippbilder finden sich später in entsprechenden Welt- oder Gottesbildern wieder.
Nach und nach erweitert sich die Vorstellungskapazität des Kindes, das Grundmuster für den Glauben an die überdauernde Existenz von Objekten und Lebewesen ist gefertigt. Zur ersten Bezugsperson treten weitere Bezugspersonen hinzu, das innere soziale Panorama entsteht und erweitert sich. Das innere soziale Panorama können wir uns als unbewusste Familienaufstellung im Kopf vorstellen, dazu mehr in späteren Kapiteln. Im Laufe des Lebens kommen also immer mehr Gestalten in verschiedenen Kontexten zur Kernfamilie hinzu: Die ersten Grundmuster für Personenkonstanzbilder werden auch auf andere Menschen übertragen, wir projizieren. Daher können wir mit Leichtigkeit Beziehungssituationen in systemischen Aufstellungen darstellen, in einem realen Raum mit realen Menschen, die als Stellvertreter für unsere unbewussten inneren Gestalten agieren.
Konstanzbilder sind verdichtet. Solche verdichteten Bilder, bei Blinden eher verdichtete Melodien, Rhythmen oder Formen, ordnen wir in unserer geistigen Vorstellung nach ihren Bedeutungen an. Die verdichteten ‚Bilder‘ können wie Icons oder Symbole auf einem fiktiven geistigen Bildschirm stehen. Werden sie angeklickt oder getriggert, öffnen sie sich. Mit der Aktivierung des Films oder der Melodie aktiviert sich auch die mitabgespeicherte emotionale Reaktion. Je stärker Film oder Melodie mit Körperlichkeit assoziiert sind, desto stärker erfolgt auch eine körperliche Reaktion.
Die ersten, prägenden Bilder und Vorstellungen bleiben starke Trigger auch im späteren Leben. Sie sind eine Mitvoraussetzung für neurotypisch definierte Liebe. Die ursprünglichen Bilder werden im Laufe der Zeit natürlich ergänzt oder überlagert, es entstehen Parallelbilder und Paralleldateien. Manche neuen Dateien werden in der Nähe der Ursprungsdatei abgelegt, andere weiter weg. Der Sehsinn durchzieht unser gesamtes Gehirn, daher gibt es unzählige Verbindungen zu anderen Gehirnabteilungen und verschiedene Ablage- und Erinnerungsmöglichkeiten. Doch alle neu hinzukommenden Menschenbilder stehen in Zusammenhang mit der ersten Personenkonstanz-Datei. Auch die Entwicklung des sogenannten Über-Ichs, die Vorstellungen von Big Brother und dem lieben Gott, der immer da ist und alles sieht, aber leider seine eigenen, unergründlichen Wege geht, steht mit der ersten Datei in Verbindung und baut darauf auf. Das Phänomen der Personenkonstanz ist jedoch kein Beweis dafür, dass es keinen Gott gibt. Gläubige Menschen könnten einwenden, Gott habe dem Menschen die Fähigkeit zur Entwicklung der Personenkonstanz geschenkt, um darüber das Göttliche zu erkennen.