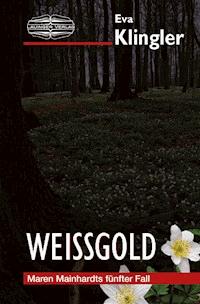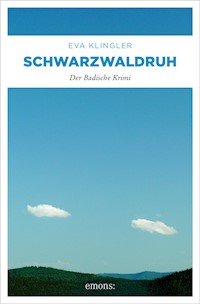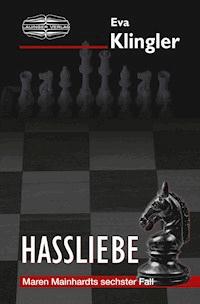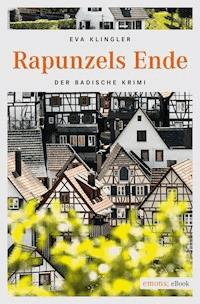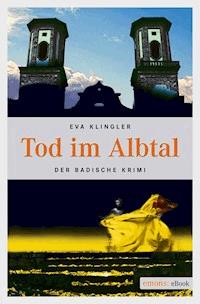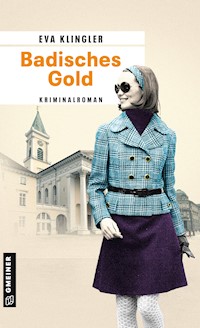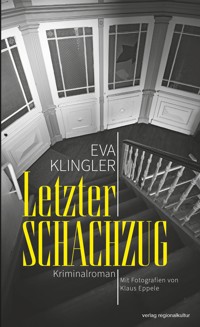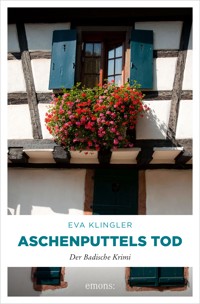Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: GMEINER
- Kategorie: Krimi
- Serie: Ex-Kriminalbeamtin Viktoria Herrmann
- Sprache: Deutsch
Karlsruhe in den 1950er Jahren. Die intelligente und abenteuerlustige Viktoria Hermann arbeitet in einem langweiligen Büro der Stadtverwaltung. Viel lieber wäre die 18-jährige bei der Kriminalpolizei, doch das kommt für ein Mädchen nicht in Frage. Dafür füttert sie ihr Verehrer, der Kriminalassistent Paul, mit Details zu einem ungeklärten Mord. Viktoria beschäftigt sich mit dem Fall, doch mit der Ermordung der Untermieterin ihrer Eltern rückt die Gefahr plötzlich näher als ihr lieb ist - und aus dem Gedankenspiel wird grausamer Ernst.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 307
Veröffentlichungsjahr: 2019
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Sammlungen
Ähnliche
Eva Klingler
Badische Sünde
Kriminalroman
Zum Buch
Tödlich erotisch Viktoria Hermann findet ihr Leben als Bürokraft ziemlich langweilig. Doch in den späten 1950er Jahren gibt es im bürgerlichen Karlsruhe für sie nur ein Ziel: Heiraten. Ganz anders sieht das die Untermieterin ihrer Eltern, Renate Bandusch. Die verstößt nicht nur gegen die Konventionen und trifft sich abends mit Männern in Kneipen, sondern kommt auch nachts nicht nach Hause. Nachdem Renate hinausgeworfen wurde, heuert sie in einer Bar als Animierdame an. Bei Viktorias letzter Begegnung mit ihr wirkt sie nicht glücklich. Sie hat Angst. Vor einer Person namens »M«. Als Renate kurz darauf unweit von Viktorias Zuhause umgebracht wird, stellen sich tausend Fragen. Hat der Mord etwas mit der toten Prostituierten zu tun, die vor Kurzem in der Karlsruher Waldstadt gefunden wurde? Wer ist »M«? Und steckt Viktorias eigener Bruder in der Sache mit drin? Für Viktoria gibt es nur einen Weg, das herauszufinden: Sie beginnt als Lockvogel in der Tahitibar zu arbeiten und gerät bald selbst in tödliche Gefahr – denn der Täter ist ganz nah …
Eva Klingler wurde im oberhessischen Gießen geboren. Ihre Jugend und die Studienjahre verbrachte sie in Mannheim, bevor sie nach Baden-Baden zog, um ein Volontariat beim Südwestrundfunk zu absolvieren. Nach einigen Jahren entschloss sie sich, selbstständig zu arbeiten und wirkte als Dozentin, Autorin und freie Journalistin in den Redaktionen in Baden-Baden und Bretten. Nach einem kurzen Zwischenspiel als Bibliotheksleiterin in Rheinstetten wurde sie endgültig als freie Autorin sesshaft. Ihre Bücher spielen meistens in Baden und im Elsass. Mit Mann und Hund lebt Eva Klingler nun in einem grünen Stadtviertel von Karlsruhe und betreibt die von ihr gegründete Wohltätigkeitsorganisation »20 Stühle«.
Impressum
Immer informiert
Spannung pur – mit unserem Newsletter informieren wir Sie
regelmäßig über Wissenswertes aus unserer Bücherwelt.
Gefällt mir!
Facebook: @Gmeiner.Verlag
Instagram: @gmeinerverlag
Twitter: @GmeinerVerlag
Besuchen Sie uns im Internet:
www.gmeiner-verlag.de
© 2019 – Gmeiner-Verlag GmbH
Im Ehnried 5, 88605 Meßkirch
Telefon 0 75 75 / 20 95 - 0
Alle Rechte vorbehalten
3. Auflage 2020
Lektorat: Claudia Senghaas, Kirchardt
Herstellung/E-Book: Mirjam Hecht
Umschlaggestaltung: U.O.R.G. Lutz Eberle, Stuttgart
unter Verwendung eines Fotos von: © NSU Lambretta, 1956
© ullstein bild und © hunterbliss / stock.adobe.com
Druck: CPI books GmbH, Leck
Printed in Germany
ISBN 978-3-8392-6134-7
Haftungsausschluss
Personen und Handlung sind frei erfunden.
Ähnlichkeiten mit lebenden oder toten Personen
sind rein zufällig und nicht beabsichtigt.
Prolog: Von Frau zu Frau ein guter Rat: Mit schöner Wäsche macht man Staat
Karlsruhe-Waldstadt, Sommer 1959. Der Tod von Vera S.
Das Mädchen trug auffallend schöne Wäsche: ein Geschenk.
Als der Schal um ihren Hals gelegt wurde, dachte sie zuerst an eine der vielen Zärtlichkeiten, die sich mit ihm verbanden. Sexspiele. Der Schal roch so gut und so vertraut. Nach heißen Nächten in einem zerwühlten Bett. Auch jetzt war eine heiße Nacht. Deshalb stand die Balkontüre offen, und sie war von der Liebe überrascht worden. Das Mädchen hob die Arme, um den Schal abzustreifen, sich umzudrehen und das Gesicht zu küssen, doch der Schal ließ sich nicht abstreifen. Im Gegenteil, er wurde fester zugezogen. Er drückte auf ihren Kehlkopf. Was sollte denn das? Während sie kämpfte, ahnte sie, dass sie einen Fehler gemacht hatte, dass sie bei ihrer normalen Kundschaft hätte bleiben sollen und dass sie jetzt – verdammt noch mal – sterben würde.
Was sie nicht wusste. Ihr entging so viel von dem, was ihre Altersgenossinnen noch erleben würden.
Sie würde Kennedy nicht mehr in Berlin sprechen und die Stones niemals grölen hören. Nie die Pille schlucken und die erste deutsche Bundeskanzlerin bestaunen. Sie würde mit keinem Großraumflugzeug fliegen, niemals Urlaub auf den Malediven machen und würde nicht erleben, dass man Filme in ein flaches Kästchen einlegen und auf einer kleinen Scheibe abspielen kann. Sie würde keine bequemen Leggings anstatt knisternder Perlonstrümpfe tragen und nicht in ein Handy sprechen, nicht mit einer Karte bezahlen. Auch das Ende der DDR, die sie noch gut gekannt hatte, würde sie nicht erleben.
Man fand sie am anderen Morgen, denn einer der Arbeiter, der die frisch entstehende Grünfläche hinter dem Haus bearbeitete, sah bei einem neugierigen Blick in das ebenerdige Wohnzimmer einen Arm hinter einem Sofa hervorragen. Er dachte eine Weile darüber nach und rief dann seinen Vorarbeiter, der den Bauleiter alarmierte. Die Polizei betrat die Wohnung, fand die Ermordete, und als Nächstes tauchte die Kripo auf, die man mit den neuen Funkwagen alarmierte.
Alle nahmen sich des Tatorts an und dachten an den grauenhaften Massenmörder Pommerenke, der Frauen überfallen und getötet hatte. Manche davon in ihren Wohnungen. Und alle hofften, dass er jetzt gerade sicher hinter Gittern saß.
Denn diese Tat trug seine Handschrift.
Karlsruhe-Rüppurr, Ende September 1959
Sie kamen nicht im Morgengrauen. Es waren auch keine schweren Stiefel, die die Treppe in unserem Wohnhaus ächzen ließen, und doch verbreiteten sie auch am helllichten Nachmittag im Karlsruhe des Jahres 1959 einen Respekt, der ihnen vorausging und über dessen Ursprung nicht nachgedacht wurde.
Vor dem Haus, auf der mittäglich leeren Straße, hatten sie ihre Grüne Minna geparkt; ein dunkelgrüner VW Käfer mit jetzt stummem Blaulicht, der auch damals schon ein klein wenig altmodisch wirkte und laut Zeitungsbericht bald durch modernere Autos ersetzt werden würde.
Natürlich waren es beides Männer, die sich da vor unserer Wohnungstür aufbauten: ein älterer mit Mütze und bärbeißigem Gesicht sowie einem wie eingewachsenen misstrauischen Blick und ein jüngerer, der keine Uniform trug, aber deshalb fast noch offizieller wirkte.
Da die beiden Beamten Geschöpfe der deutschen Nachkriegszeit waren, wussten sie vermutlich selbst, dass alleine schon ihr Auftreten in unserem Mietshaus eine Schande für die Aufgesuchten bedeutete: Polizei im Haus!
Ende der 50er-Jahre gab es eine Menge Autoritäten, vor denen man sich besser hütete. Den Hauswirt, der die Miete einmal im Monat einkassierte und peinlich genau in ein Buch eintrug. Den durch sein Schicksal verhärmten Parteibeamten der SPD, der bei Stahls im ersten Stock den Beitrag kassierte, und den jovialen Postboten, der die ersehnte Rente für die alten Leute brachte.
Doch Polizei war noch eine Stufe mehr, bedeutete immer Hab-Achtung.
Es klingelte schrill zweimal kurz an unserer Wohnungstür.
»Ja?«, fragte meine Mutter, und mir als jungem Mädchen war es peinlich, dass ihre Stimme so ängstlich klang. Ich mochte sie nicht, diese ewige Vorsicht der Eltern und der Großeltern. Immer, »was werden die Nachbarn denken?« und »Kind, was sollen die anderen von dir halten?«
Der uniformierte Polizist tippte kurz an seine Schirmmütze.
»Frau Hermann? Ist Ihr Mann zu Hause?«Die beiden Männer betraten die Wohnung ohne Einladung. Meine Mutter stand mit dem Rücken zu dem neuen Palisanderholzschuhschrank im Gang.
Ängstlich flogen ihre Augen hin und her. Hatte sie oder einer aus ihrer Familie etwas falsch gemacht?
»Nein. Er ist bei der Arbeit. Mein Mann arbeitet im Kaufhaus Hertie auf der Kaiserstraße. Als Herrenverkäufer. Früher Union.«
Am liebsten hätte ich gerufen: »Aber warum nach meinem Vater fragen, wir, wir sind doch hier. Das reicht doch, oder sind Frauen keine Gesprächspartner?« Doch so etwas sagte ein junges Mädchen nicht. Renate hätte sich vielleicht getraut. Renate traute sich sowieso alles. Ich vermisste sie in ihren hochhackigen Schuhen, ihren duftigen Petticoats und ihrem frechen Nickituch. So bunt, wie sie gekleidet war, hatte sie mir doch Erstaunliches erzählt von jungen Leuten in Paris. »Die sitzen im Café und rauchen und trinken und tragen alle schwarz, denn sie glauben an nichts.« – »Schwarz?«, hatte ich gefragt. »Ja«, hatte sie geschmunzelt. »Man nennt sie Existentialisten, und sie glauben an nichts außer …« – »Außer, Renate?« – »An den Tod!«, hatte sie ernst geantwortet. »Denn der ist das einzig Sichere im Leben.«
Unauffällig schälte ich mich jetzt aus dem Türrahmen meines Zimmers mit den bunten Tapeten, das immer noch das Kinderzimmer genannt wurde, und war nicht einmal überrascht oder beleidigt, dass meine Mutter die Tür zum Wohnzimmer fest vor meiner Nase schloss. Das war ich sowieso schon gewohnt. Und ich wusste auch, wie ich hören würde, was ich nicht hören sollte.
Das Nachbarzimmer, meines Bruders Reich, war nur durch eine gelbliche Milchglasscheibe getrennt vom Wohnzimmer; etwas, das mein Bruder sehr bedauerte, da er ständig aufgefordert wurde, die Hottentottenmusik leise zu stellen. Vor allem sonntags, dem einzigen Tag, an dem mein Vater frei hatte. Da wollte er seine Schlagerschnulzen oder Operettenmelodien hören. »Die Donau« von einem Mann mit schwer auszusprechenden Namen liebte er. Und den »Kaiserwalzer«. Meine Mutter verdrehte begeistert die Augen bei dem süßen »Für Elise«.
Der Jüngere der beiden Beamten sprach jetzt, und er sprach so leise, dass ich ihn nicht verstand, obwohl ich mein Ohr direkt an das Glas drückte. Um so deutlicher hörte ich den entsetzten, fast beleidigten Aufschrei meiner Mutter.
»Was? Um Gottes willen? Wie …? Welche Schande! Oh Gott.«
Ich atmete tief durch. Sie war doch schon ausgezogen, die Renate. Wieso machte sie meinen Eltern jetzt noch Schande? Es konnte nur um sie gehen, wenn sich meine Mutter so aufregte. Renate hatte ein Auto kaufen wollen. Vielleicht hatte sie einen Unfall gehabt.
Die junge Kindergärtnerin Renate Bandusch, die einige Zeit bei uns im oberen Stock gewohnt hatte und die sich das Bad mit uns geteilt hatte, war ein ständiger Dorn im Auge meiner Mutter gewesen. Wie die lebte, wie die sich kleidete! Mein Bruder war zwar auch ein Halbstarker, der sich mit anderen zusammen in einer fragwürdigen Kneipe Ecke Lammstraße aufhielt, da wo sie gerade neu bauten, aber solche Empörung verursachte meiner Mutter meistens nur Renate Bandusch. Auch wenn sie schon längst nicht mehr da war. Sie nannte sie immer »Fräun Bandusch«, eine lang gezogene Abkürzung von Fräulein, und das wiederholte sie so oft, dass man kaum vergessen konnte, dass es der 26-Jährigen offenbar immer noch nicht gelungen war, einen Ehemann zu präsentieren und in ihr eigenes Heim zu ziehen. Dann wäre sie Frau Sowieso und damit normal! Jetzt war sie sowieso gefallen und damit selbst das »Fräun« noch geschmeichelt.
Ich sah meine Mutter vor mir, obwohl ich sie nicht wirklich sah. Wie sie sich nervös durchs Haar fuhr, das wie festgefroren onduliert war, wie sie die Hände in ihre blassblaue Schürze steckte und sie wieder herausholte, wie sie die Lippen zusammenpresste. Der Lebensstil von Fräun Bandusch war ihr schon lange ein Dorn im Auge gewesen. Sie hatte nur gewartet, bis sie ihr kündigen konnte. Dabei wusste sie nicht mal alles. Sie wusste nicht das, was ich wusste und von dem ich mich hingezogen und abgestoßen zugleich fühlte.
Der Jüngere sprach weiter, der Ältere hustete dazwischen. Nun geschah etwas Außergewöhnliches – etwas, das in mir einen selten gespürten Funken Respekt für meine Mutter empfinden ließ. Ihr Schatten hinter der gelben Wand stand nämlich auf, wurde größer, und ehe ich fliehen konnte, hatte sie die Schiebetür aufgerissen.
»Komm rein, Viktoria«, sagte sie knapp. »Sie wollen es dir auch sagen! Schließlich bist du schon 18.«
Zu den beiden müßig dasitzenden Beamten gewandt: »Sie hat gerade ausgelernt. Sekretärin ist sie. Bei der Stadtverwaltung. Wir haben Glück gehabt, dass sie sie übernommen haben. Da ist sie doch sicher, bis sie heiratet. Die Stadtverwaltung ist immer sicher.«
Die Polizisten musterten mich abschätzend, aber jetzt doch mit einem Hauch mehr Respekt.
»Fräun Bandusch …« Meine Mutter löste die Bänder ihrer Schürze und enthüllte einen alten verwaschenen Wollpullover in Violett mit spitzem Kragen und einer kurzen Knopfleiste, »ist tot.«
Für einen Moment stand das Leben still. Wie in einem Brennglas nahm ich unser Wohnzimmer wahr. Das ausladende Buffet, in dem auch die gebügelte und gestärkte Tischwäsche lag. Der große Esstisch, der nicht mehr schön war und deshalb immer von einer gehäkelten Tischdecke geziert wurde. Das große Radio. Die Fernsehtruhe mit dem rundlichen Bildschirm, der zunächst 1954 mit dem NWDR die Welt zu uns nach Karlsruhe gebracht hatte. Der kleine gelb-schwarze hässliche Nierentisch mit den beiden Clubsesselchen, an denen meine Eltern manchmal Karten spielten. Die Bilder mit den Bergszenen.
»Was?«, sagte ich wie betäubt. »Warum denn?«
Meine Mutter ignorierte mich und sprach beschwörend auf den Uniformierten ein.
»Ich hab es geahnt. Eine, die nachts nicht nach Hause kommt. Ich habe es geahnt. Ich hatte ihr gerade noch rechtzeitig gekündigt. Ihre Eltern, Fräulein, so hab ich immer gesagt, Ihre Eltern hätten sich geschämt. Ich habe doch auch Kinder im Haus und so benimmt man sich nicht.«
Die Männer standen abwartend da.
Meine Mutter deutete auf mich. »Ich hab es dir immer gesagt, halt dich von diesem Fräulein fern. Ich hab es ihr nie erlaubt, Herr Inspektor, denn es ist verboten, aber die Dame hatte öfters Herrenbesuch. Auch mal nach zehn Uhr. Ich sage: Fräun Bandusch, bitte halten Sie sich an die Regeln. Sie wissen, dass ich das nicht dulden kann. Und dann … dann kommt sie gar nicht mehr nach Hause. Sie war doch Kindergärtnerin. Erzieht unsere Jugend. Das gab es früher nicht. Auch, wenn sie alle sagen, die Zeit war schlecht. Was ist nur mit unserem Land los?«
Darauf konnte ihr keiner eine Antwort geben.
»Das kommt von all diesem Rockabilly und den Jeans und den Ausländern.« Meine Mutter beendete ihre Aufzählung des Bösen mit einem Seufzen.
»Warum ist sie denn tot?«, fragte ich und hörte meine eigene Stimme so leise und so fremd, als habe ich Watte in den Ohren.
Der Jüngere musterte mich wie ein Objekt im Museum und gab natürlich keine Antwort. »Ihr Name ist Viktoria Hermann. Tochter des Hauses. Sie kannten Fräulein Bandusch gut?«
»Renate! Ja. Warum ist sie denn tot? Das kann doch gar nicht sein. Sie war doch nicht krank.«
»Die Fragen stellen wir, Fräuleinchen!«
Ich habe es dann erfahren. Renate Bandusch, unsere lebensfrohe ehemalige Untermieterin, die mir Nylonstrümpfe geliehen hat und mit der ich Schallplatten mit amerikanischer Musik gehört hatte, die mir gezeigt hatte, wie man die Augenbrauen richtig nachzieht und die mir einen Klecks der Wunderschönheitscreme Gelee Royale auf die Nase getupft hatte, die schon mal in Paris war und an der ich die erste Jeans an einer Frau gesehen hatte, war ermordet worden.
In einem kleinen Wäldchen nicht weit von unserem Viertel. Richtung Ettlingen. Genauer gesagt, auf der Terrasse des Sportvereins hatte man sie gefunden.
Man hatte sie erdrosselt, und mit ihr starb mehr als eine frühere Untermieterin. Es starb mein Traum von Freiheit und einem anderen Leben.
Karlsruhe-Rüppurr, Sonnenstift, August 2018
Dieser Moment, als die Polizei damals bei uns vor der Tür stand, war endlos lang vorbei, doch meine Erinnerung an den Tag stets hellwach. Es bedurfte nicht dieses heutigen Besuches, um das Geschehen wieder vom Grund des dunklen Sees meiner Erinnerungen nach oben zu holen.
Andererseits: Wie konnte ich die Ereignisse von damals jemals vergessen, wenn das GESICHT mich jeden Tag daran erinnerte? Es war Zufall gewesen, dass wir beide hier landeten und keiner dem anderen weichen wollte.
Ich sah meine zwei weiblichen Gegenüber an. Nun waren sie also da. Die Schatten aus Mariannes Vergangenheit.
Doch der Reihe nach.
Vorhin, ziemlich früh am Morgen, hatte eine gewisse Marlies Schätzle mich angerufen und zwar nicht auf dem Handy, sondern auf dem mit der Wand verbundenen Telefon, das man heute Festnetz nennt und das so selten klingelt, dass man fast erschrickt, wenn es sich zu Wort meldet.
»Mein Name ist Schätzle! Marlies Schätzle. Ich würde Sie gerne aufsuchen.«
Ich kannte keine Frau Schätzle. Eine Vertreterin, die mir ein Küchengerät aufschwatzen wollte? Da kam sie bei mir an die Falsche. Ich war nie eine Hausfrau und eine Köchin gewesen. Schon in den sauber gewienerten resopalgetäfelten 50ern, als ich hätte Haushaltsführung lernen sollen, konnte ich mich nicht an den wöchentlichen Kanon von Wäsche waschen, Wäsche bleichen, Kartoffelschälen und Einkochen gewöhnen. Jetzt wollte ich erst einmal Zeit gewinnen. Auf den Besuch von irgendwelchen Fremden ist man in meinem Alter nicht mehr eingerichtet.
»Gut, dann lassen Sie uns einen Termin ausmachen. Moment, ich blättere in meinem Kalender!«
»Ich bin aber schon da. Ich stehe unten am Empfang.«
Wenigstens nicht vor der Tür. Das kann hier nicht passieren. Ich lebe im Sonnenstift, einer eleganten Anlage für Senioren, die es sich leisten können. Eingeweiht 1971, also lange nach der Geschichte, die ich erzählen will, war das Wohnrecht in diesen drei Wohntürmen hier begehrt. Dass ich mir das Dach mit einer Person teile, die gemordet hat – nun, dafür kann die Verwaltung des Sonnenstiftes nichts. Sie können ja nicht in die Herzen derer schauen, die mit ihren Möbeln, ihren Koffern und ihrer Lebensgeschichte hier einziehen.
»Ja, aber was wollen Sie?«
Es tönte kraftvoll aus dem Hörer: »Sie kennen mich nicht, aber ich bin die Nichte einer Dame namens Marianne Reichert.«
Marianne Reichert. Da war er, der Name und mit ihm die ganze Geschichte. Wie lange hatte ich nicht gehört, dass jemand den Namen aussprach? Wäre nicht das GESICHT, so läge er unter all meinen späteren Fällen vergraben. Abgehakt. Nicht gelungen, aber endlich abgehakt. Und was sagte sie? Die Nichte einer Dame namens Marianne Reichert? Einer Dame!
Das konnte spannend werden. Offensichtlich hatte diese Frau keine Ahnung, dass ihre Tante eine stadtbekannte Rotlichtgröße gewesen war, die in ihrer Jugend in Sexfilmen aufgetreten war und Ringkämpfe mit splitternackten Mädchen in ihren Bars inszenierte. Ganz abgesehen von anderen Dingen, die in den Separees stattfanden.
»Dann kommen Sie hoch. Zweiter Stock. Wohnung 213.«
»Danke. Wir sind übrigens zu zweit.«
Das hätte ich mir denken können. So jemand wie Marlies geht nicht alleine in die Stadt und besucht eine fremde Person.
Kurz darauf klingelte es. Zwei Frauen standen vor der Tür; die Ältere streckte die Hand aus.
»Sie sind also Mariannes Nichte?«
Ich trat zurück und ließ die beiden Frauen eintreten.
»Ja, ganz recht. Die Tochter ihrer viel jüngeren Schwester Hiltrud. Die hat mich spät gekriegt und ich habe meine Eschter auch spät gehabt. War schon über 40!«
Ich wies auf mein Sofa. Die zwei Frauen nahmen Platz.
Ja, Marianne hatte eine Schwester gehabt. Den Namen hatte ich vergessen, aber es könnte Hiltrud gewesen sein. Eine viel jüngere Schwester. Solide und verheiratet. In irgendeinem Schwarzwalddorf. Man hatte sie wahrscheinlich niemals zu den Tatumständen der Morde befragt, denn sie war weit weg gewesen vom Milieu ihrer Schwester und hatte kein Motiv gehabt, ihr unbekannte Animiermädchen zu töten. So hatte man sie damals genannt.
Ich seufzte. »Und was wollen Sie von mir?«
Eigentlich wusste ich es. Das Vermächtnis wurde jetzt eingelöst, das Erbe übergeben. Aber erst, wenn sie alles wussten.
Frau Schätzle strahlte. Ich betrachtete sie genauer und versuchte, Ähnlichkeiten mit der skandalumwitterten Marianne Reichert in ihrem auffallenden hellblauen Mercedes zu erhaschen. Doch, wo dort eine energische Nase und zynisch gekräuselte Lippen gewesen waren, blickte mir hier ein rundliches freundliches Gesicht entgegen, mit den für die Schwarzwälder typischen dunkelgekrausten Haaren und rostbraunen Apfelbacken. Die Augen, die bei Marianne kühl und grau gewesen waren, kugelten hier munter und schwarz wie geschliffene Opale in ihren Höhlen umher. Mein Blick fiel nun auf das junge Mädchen, das sie begleitete und bisher wortlos geblieben war. »Und das ist also …« Erstaunt hielt ich inne. Graue Augen sahen mich an. Mariannes Augen und Mariannes Züge. Ein Schauer lief mir über den Rücken, und es klang in mir eine Melodie aus den späten 50ern auf. Alles war wieder da, und alles lag in diesen Augen.
»Ja, das ist unsere Esther.« Marlies Schätzle sagte Eschter.
Welch prätentiöser Name, dachte ich. Warum haben sie das Mädchen nicht gleich Tamar oder Batsheba genannt?
Marlies Schätzle fuhr in ihrem schwerfälligen Dialekt fort:
»Meine Tante Marianne wurde ja 1912 geboren und starb im Jahr 1997. Meine Tante Marianne hinterließ vor ihrem Tod einen Brief an meine Mutter, das war, wie gesagt, ihre Schwester Hiltrud. Da drin waren ein paar Hundert Mark und noch Namen von Leuten aus unserem Ort, denen sie Dank für irgendetwas schuldete oder die ihr Leben bestimmt haben. Und wir sollten jedem 100 Mark geben. Das haben wir auch gemacht.«
Fast trotzig sagte sie das, als beschuldige ich sie, Geld unterschlagen zu haben.
»Und dann schrieb sie noch was von Ihnen, die ihr wichtig war. Von einer Viktoria Hermann aus Karlsruhe, und dass wir sie besuchen sollen, wenn meine Tochter Esther 21 Jahre alt wäre. Und sie würden uns dann schon sagen, warum wir hier sind. Wenn Sie noch leben, natürlich. Und Sie leben ja! Wir haben Sie im Telefonbuch gefunden.«
»Sie hat meinen Namen erwähnt?« Viktoria, tu nicht so überrascht. Du kannst dir doch denken, was sie geschrieben hat.
»Ja. Ihr Name. Und sie hat in diesem Brief geschrieben, Sie hätten eine Botschaft und ein Geschenk für uns. Ich glaube, ich weiß, was es ist. Das Kreuz und die Familienbibel. Das hat sie nämlich damals mitgenommen, und wir haben die Sachen niemals wieder gesehen. Und da würde ich mich für meine Eschther freuen, denn wir sind nämlich gläubige Katholiken. Auch Marianne war sehr gläubig, hat mir meine Schwester erzählt.«
Esther wirkte unbeeindruckt. So wie das Mädchen auf mich wirkte, würde sie vor Begeisterung nicht in die Luft springen, wenn sie eigens nach Karlsruhe gereist wäre, nur um eine Bibel und ein Kreuz mit nach Hause zu nehmen. Hundert Euro wären der Kleinen zweifellos lieber.
Verblüfft starrte ich die Frau an. Marianne gläubig? Konnte es sein. dass sie wirklich überhaupt nicht wusste, was ihre Tante in Karlsruhe in den 50er- und 60er-Jahren getan hatte? Sie bemerkte mein Erstaunen nicht. In den Jahren bei der Polizei erworbene Menschenkenntnis verriet mir, warum. Diese Frau hier war zwar noch nicht wirklich alt, aber sie lebte in einer in sich geschlossenen Welt, in ihrem Dorf mit ihrer Landwirtschaft, ihrer Familie und ihrem kleinen Freundeskreis. Eine Welt, die Marianne aus ihrer Sicht mit in die Fremde genommen hatte und dort genauso weitergelebt hatte.
»Nun, jetzt sind wir bei Ihnen. Sie sind ja auch nicht mehr die Jüngste, aber es ist gut, dass unsere Eschter mal was hört von den damaligen Zeiten und wie alles früher so war.«
Esther sah aus, als sei ihr nichts gleichgültiger, als wie es früher gewesen war.
»Und natürlich«, zwinkerte Frau Schätzle jetzt beinahe neckisch, »interessiert mich schon, warum Tante Ihnen dankbar war oder warum Sie ihr Leben bestimmt haben sollen.«
Ich runzelte die Stirn. Warum war sie so erstaunt? Sah ich nicht aus wie jemand, dem man dankbar sein konnte?
Jetzt sah sich meine Besucherin um. »Aber schön wohnen Sie hier! So aufs Alter.«
Ich schrecke immer noch zusammen, wenn mich jemand als alt bezeichnet. In meiner eigenen Wahrnehmung bin ich noch 20 und stehe am Anfang eines aufregenden Lebens.
»Es freut mich, dass es Ihnen gefällt«, erwiderte ich lahm.
Das Sonnenstift liegt im Karlsruher Stadtteil Rüppurr. Ich kehrte also zurück zu den Wurzeln. Mit meiner Familie hatte ich als Kind zuerst in der Posseltstraße in Durlach gewohnt, bevor wir in ein Zweifamilienhaus in der Langen Straße in Rüppurr umzogen. Sozial gesehen war das kein direkter Aufstieg, doch mir gefiel es, denn die Felder und der nahe Friedhof sorgten für frische Luft und die Möglichkeit, stundenlang Fahrrad zu fahren. Fahrrad, das war Freiheit und Mobilität. Jedenfalls hatte ich es hier draußen besser als in dem engen Dörfle in der Innenstadt mit den schiefen Häusern, wo meine italienische Klassenkameradin Carlotta lebte. Ihre Familie waren die ersten Gastarbeiter, die halfen, das Wirtschaftswunder zustande zu bringen. Carlotta hatte Schneiderin gelernt, änderte Kleider und war fleißig. Doch im Dörfle lebten die Menschen anders als im Rest von Karlsruhe. Die Häuser dort waren renovierungsbedürftig und eng. Überall noch Spuren des Krieges. Auf der Straße spielten zahllose Kinder verschiedener Nationalitäten, und es hieß, bei Nacht sei es ein gefährlicher Ort, denn die Dirnen seien aufdringlich, und die Männer griffen schnell zum Messer.
Das Haus in der Lange Straße war bürgerlich. Unsere Wohnung lag im dritten Stock. Unten waren vier Zimmer, und am Ende des Korridors führte eine Wendeltreppe in das ausgebaute Dachgeschoss, in dem sich noch einmal zwei Zimmer befanden, die wir vermieteten. Unter uns lebte die Hausbesitzerin, eine ältliche Witwe mit ihrer Schwester, die streng und humorlos waren und die Hausordnung penibel überwachten. Allerdings hatten sie ein eigenes Telefon. Ganz unten hauste seit Ewigkeiten ein älterer Mann. Meine Gedanken schweiften ab. Weg von dem Frauenpaar mir gegenüber. Jetzt gestaltete sich das freundliche Gesicht meines Gegenübers um und verwandelte sich in eine neugierige bauernschlaue Frau vom Land. Neben ihr hing noch immer eine ziemlich gelangweilte Esther im Stuhl.
»Für was war meine Tante Ihnen denn eigentlich dankbar, oder was hatten Sie überhaupt mit ihr zu tun?«
Ich war längst entschlossen, den beiden eine harmlose Geschichte aufzutischen und sie bald loszuwerden. Das Bridge begann unten im Speisesaal. Da läutete das Handy der Kleinen. Ohne zu fragen, ob es störte, ging sie dran. »Ja, ich treff mich mit dir, aber du kennst die Bedingung. Okay. Und du hast das Fahrrad dabei? Guck, dass es geputzt ist, sonst wird nichts aus dem Deal. Gut, Elias, bis dann.«
Die Mutter missbilligend. »Esther, lass die Finger von diesem Elias. Der ist nicht anständig und will nur das eine.«
Das Mädchen reckte sich. Ein runder fester Busen schob sich in meine Richtung. »Gott sei Dank will er das eine«, erwiderte sie lässig, »denn ich will das Fahrrad.« Dann lachte sie, um ihren Worten das Schockierende zu nehmen. Und als sie lachte, bemerkte ich erneut die ungeheure Ähnlichkeit mit ihrer Großtante. Und sah ihre jugendliche Schönheit, die natürlich gröber werden würde und verblühen würde. So wie bei Marianne, die zum Schluss nur noch eine pummelige, alternde Kneipenwirtin gewesen war.
Esther schob sich einen Kaugummi in den Mund, kaute provozierend darauf herum und sah mich mit einer Mischung aus Verachtung und Langeweile an.
»Du hörst doch, Mum, dass uns die Frau nichts sagen will. Was kann das auch Interessantes sein? Komm, wir gehen. Ich will noch zu Primark.«
Und da fasste ich einen Entschluss.
Es war 10 Uhr morgens. Die Sonne fiel fast aggressiv in mein Wohnzimmer ein, und ich stand auf, um die Rollläden herunterzulassen.
»Doch, Esther, ich hab was Interessantes zu erzählen. Eine geile Story, wie du sagen würdest. Ich erzähle sie euch beiden, aber Primark muss vielleicht warten. Es wird nämlich ein bisschen dauern.«
»Von meiner Großtante?«
»Ja.«
Esther schien nicht überzeugt. Ich versuchte, die Situation mit ihren Augen zu sehen. Das Mädchen war genervt, wollte weg, einkaufen. Stattdessen sah sie sich umgeben von spießigen Möbeln, die ihr nicht gefielen, in einem ruhigen Raum ohne jegliche Musikberieselung. Saß in dem Zimmer einer uralten Frau, von der man noch froh sein konnte, dass sie nicht schlecht roch.
»Ich will lieber gehen. Das ist hier ja echt voll langweilig.«
Ich stand auf und ging zu meinem Schreibtisch, der nicht mehr so voll war wie früher. Zwei, drei Rechnungen, ein Brief. Mehr gab es nicht mehr zu regeln, wenn man in meinem Alter war.
Ich öffnete ein Seitenfach und holte ein Foto heraus, das ich schon so lange nicht mehr angesehen hatte, sodass es mir fast unbekannt erschien. Das Bild war in Schwarz-Weiß und zeigte ein schönes Mädchen in einer Bar, das nackt war, bis auf einen schwarzen Leder-BH, der die Brüste freiließ, und die Ahnung eines Perlenslips zwischen den Beinen. Hinter ihm thronte eine zufrieden lachende Frau mit einer Federboa um den Hals.
»Hey? Scharf!« Esther hörte auf zu kauen. »Wo haben Sie denn so was her?«
»Was ist denn das?«, fragte Tante Marlies entsetzt. »Tun Sie das Bild weg! Wir sind schließlich in einem Altenheim.«
»Sie würden sich wundern, was in einem Altenheim noch so alles geht!«, erwiderte ich beiläufig, doch dann deutete ich auf das Bild. »Das da! Die Frau da, hinter dem Mädchen«, ließ ich genüsslich fallen, »das ist übrigens Ihre Tante! In ihrer eigenen Stripteasebar.«
»Was?« Esther verschluckte sich fast an ihrem Kaugummi. »Mama, da hast du mir aber ganz andere Fotos gezeigt.«
»Das sieht unserer Marianne gar nicht ähnlich. Also, so was. Das ist ja ein ganz verdorbenes …«
»Ach«, schmunzelte ich, »ganz so verdorben ist es auch nicht. Sonst gäbe es nicht so viel davon. Auch heute. Nehmen wir mal Karlsruhe. In dem Moment, da wir miteinander reden, gehen etwa 300 Damen ihrer wichtigen Arbeit nach. Sie sind in etwa 80 Etablissments anzutreffen. Laufhäuser, Bordelle, Saunaclubs, aber auch in ihren Wohnungen, wo sie zu zweit oder zu dritt tätig sind.«
»So was gibt es bei uns nicht«, erklärte Marlies in kühlem Ton.
»Nein, Sie sind vom Dorf. Prostitution ist nur erlaubt in Gemeinden mit mehr als 35.000 Einwohnern. Ergo gibt es in Baden-Württemberg 46 Orte, in denen angeschafft wird.«
»Krass!« Esther war sichtlich beeindruckt.
Ich seufzte. »Ja, aber zurück zu Marianne. Warum dankte sie mir oder vielmehr was für eine Bedeutung hatte ich für ihr Leben? Ich habe ihren Freund gerettet. Vor dem Knast, der ihm als Mordverdächtiger drohte. Obwohl, bei dem Kreis um sie herum konnte man niemals ganz sicher sein, wer etwas auf dem Kerbholz hatte. Sie betrieb nun mal kein Frauenkloster. Aber Mord war selbst für ihre Leute eine Nummer zu groß.« Ich hielt inne und dachte nach: »Marianne war eigentlich eine anständige Frau. Sie mochte Kinder und Tiere. Zu ihren Mädchen war sie gutmütig.«
Marlies gab einen ungläubigen Laut von sich.
»Mord? Knast?«
Esther starrte mich mit ihren grauen Augen an. Die Flamme des Interesses züngelte erstmals darin.
»Sie lügen. Was erzählen Sie denn da?«, empörte sich Marlies und sandte böse Blicke in meine Richtung. »Da kommt man den ganzen weiten Weg aus unserem Ort hierher, um sich so etwas anzuhören. Komm, Esther, wir gehen. Ich spendier dir ein Eis.«
»Nee«, sagte Esther und lehnte sich genüsslich in ihrem Stuhl zurück, »hast du mal ’ne Cola für mich, Frau Hermann. Zero wär gut, weil ich auf meine Figur achte, wenn nicht, nehm ich auch light oder halt gar nix. Aber den Krimi würde ich doch gern hören.«
»Eschter!«
Esther und ich ignorierten beide einträchtig die Entsetzungsseufzer der Mutter.
»Gut, ich werde dir berichten. Die Geschichte wird aber eine Weile dauern, denn du musst verstehen, wie es damals war, in den späten 50ern. In Karlsruhe, und auch anderswo. Also musst zuhören und ein bisschen Geduld haben. Aber dafür wirst du belohnt mit Sex, Mord und Totschlag.«
Esther ignorierte ihre Mutter, die kurz davor war, in eine schickliche Ohnmacht zu fallen.
»Krass. Endlich mal Geschichtsunterricht, mit dem man was anfangen kann. Also, ich hab Zeit. Sind sowieso nur billige Lumpen, die T-Shirts von Primark. Zweimal gewaschen und kannst damit putzen gehen.«
Ich lächelte. Es war heute wie damals. Das Milieu der roten Lichter zog immer. Sex sells. Das hatte Marianne perfekt beherrscht, und sie hatte sich nicht einmal selbst die Hände schmutzig machen müssen.
»Prima. Dann erzähle ich euch die Geschichte. Zwischendurch können wir unten im Speisesaal etwas essen. Und heute Abend gegen acht Uhr, wenn ihr solange durchhaltet, werdet ihr dann einem Mörder begegnen.«
Marlies rief aus: »Einem Mörder begegnen? Wie meinen Sie denn das? Sie nennen uns einen Namen.«
Nachsichtig lächelte ich. »Aber bitte! Ich war doch früher mal eine korrekte Sekretärin. Wenn ich sage, begegnen, so meine ich, was ich sage!«
Marlies Schätzle schnaufte inzwischen nur noch, doch dann gab sie auf. Immerhin würde es etwas zu essen geben.
Ich lächelte die beiden an. Kaum zu glauben, dass Marianne irgendwann einmal aus dem gleichen Holz geschnitzt worden war wie diese Marlies. Wie hatte Marianne mir einmal gesagt: »Ich wollte raus aus einer Idylle, in der eine Beerdigung das gesellschaftliche Ereignis des Jahres ist.« Marlies machte den Mund auf und gleich wieder zu. Sie wirkte wie ein ondulierter Fisch. Ich setzte mich aufrecht hin.
»Begleitet mich also in eine andere Welt. Wie sah es denn aus in unserem Land, in unserer Stadt Ende der 50er-Jahre?«
»Keine Ahnung«, sagte Esther, »die Alten erzählen ja nix. Ich frag aber auch nicht. Geschichte ist nicht mein Ding.«
Meine Erinnerung war inzwischen wie ein Flickenteppich, und den breitete ich jetzt zögernd vor ihnen aus.
»Diese Jahre waren eine graue, aber auch eine spannende Zeit. Für mich bestand sie in erster Linie aus Baustellen. Heimatvertriebene brauchten nämlich Wohnungen, deshalb wurde überall gebaut. Die Läden schlossen um sechs. Vor Weihnachten gab es aber verkaufsoffene, sogenannte Goldene Sonntage. Ausbildungsplätze waren im Überfluss vorhanden, aber die Auszubildenden hießen Stifte und trugen oft Kittel. Die Jungs wollten aussehen wie James Dean und träumten von einem Moped. In Karlsruhe gab es schon früh einen Vespa Club. Schallplatten waren kleine, schwarze Dinge mit einem Plastikdreieck in der Mitte. Man hörte den River Kwai-Marsch. Die Mädchen wollten aussehen wie Audrey Hepburn. Weiße Blusen waren beliebt, und wenn man was erleben wollte, ging man in die zahllosen sogenannten Lichtspielhäuser. Am Bahnhof musste man eine Bahnsteigkarte lösen und die Kaiserstraße war hell erleuchtet von grellen Reklamen.«
Eine Flut von Bildern. Ich hielt inne.
»Endlich war der Samstag für die meisten arbeitsfrei, im Rhein konnte man noch schwimmen, und niemand dachte sich etwas bei Zigarettenwerbung. Die Deutschen erstarrten im Konsum. Altnazis in hohen Ämtern, die Atombome oder der Kalte Krieg wurden verdrängt. Und die Fragen der Jungen blieben unbeantwortet.«
»Wie heute«, maulte Esther. »Wann geht’s endlich los? Wann passiert der Mord?«
Ich lächelte und konnte ihre Ungeduld verstehen.
»Bald. Als die Geschichte mit unserer Untermieterin Renate begann, war einer der Morde gerade passiert. Das Mädchen, das erwürgt worden war, mochte in deinem Alter gewesen sein. Als Renate bei uns einzog, war Vera gerade ein paar Tage tot.«
»Gruselig.«
Ich lächelte. »Ich hole dir jetzt deine Cola, und um genau zehn Uhr fange ich an zu erzählen.«
Karlsruhe-Rüppurr, Sonnenstift, August 2018, zehn Uhr morgens
»Wir, Teenager des Jahres 1959, sind heute ältere Damen, wenn wir überhaupt noch leben, doch wir waren natürlich auch alle jung, in gewissem Sinne jünger sogar, als ihr es heute seid. Denn wir wussten nicht viel von der Welt, außer, dass sie vor ein paar Jahren für unsere Eltern, Lehrer und Tanten zusammengebrochen war. Wie dieser Zusammenbruch ausgesehen hatte und vor allem, wie er genau zustande gekommen war, wurde uns allerdings vorenthalten. Vielleicht, weil es so wenig erzählte Vergangenheit gab und weil so viele von unseren Vätern und Onkeln früh gealtert und wortlos aus dem Krieg gekommen waren, traten manche von uns mutig, ja trotzig ins Leben. Was gab es da zu verlieren? Noch wussten wir es nicht, aber wir würden die neue Generation sein, und unsere jüngeren Geschwister oder Kinder würden eine Art Musik hören und würden Bücher lesen, die für unsere Eltern noch unerhört waren. Hübsch sahen wir aus in unseren weiten Tupfenkleidern mit den neu in Mode gekommenen Petticoats drunter, die wir heiß und innig liebten. Ein bisschen hungrig waren wir. Und voll Hoffnungen und riesengroßen Erwartungen an das Leben, das eigentlich nur spannender werden konnte.
Als ich 18 war, lag der Krieg gerade mal 14 Jahre zurück, und wenn ich ein Geräusch von damals im Ohr habe, dann ist es das der knatternden Straßenmaschinen, die Altes wegbohrten, um hastig Neues und Wohnraum zu bauen und die letzten Ruinen in Karlsruhe zu beseitigen. Ihr Lärmen war ein Faden, aus dem der Teppich der Hintergrundgeräusche der 50er-Jahre gewoben war. Ich war also 18 Jahre alt und nach der Lehre in der Stadtverwaltung angestellt. Klar, ich lebte noch zu Hause bei meinen Eltern, wie es allgemein üblich war. Bis der richtige Mann kam, lebte man zu Hause. Junge Mädchen mit eigenen Wohnungen gab es nicht. Meine Eltern Sieglinde und Erich Hermann waren ordentliche bürgerliche Leute. Ins Büro sollte ich gehen, oder wollte ich vielmehr gehen. Das war etwas, wofür ich zu Hause hatte kämpfen müssen. Friseuse oder Verkäuferin hätte meiner Mutter als Berufsziel für mich sehr viel besser gefallen. Diese fraulichen Berufe, vor allem aber Kinderkrankenschwester oder Kindergärtnerin, waren sozusagen der Haken an der Angel, an dem als Fisch hinterher der Schwiegersohn meiner Eltern zappeln sollte. Adrette, nette Mädchen, die gute Hauswirtschafterinnen waren, wurden gerne geheiratet. Blaustrümpfe, die mehr Zeit in der Leihbücherei als im Kochkurs verbrachten, hatten es schwerer. Das führte zu dauernden Zwistigkeiten mit meiner Mutter …
In diesem Juli 1959 spulte meine Mutter mal wieder ihr Lieblingsprogramm über meine Zukunft herunter.
»Hauptsache, Viktoria, du bringst uns einen guten Mann, der anständig durchs Leben geht und sich nicht in Politik einmischt. Das andere kommt von selbst. Ihr lebt in einer guten Zeit. Vielleicht könnt ihr euch später sogar ein Auto und eine Fahrt nach Italien leisten. Wenn die Amis und die Russen vernünftig sind und es keinen Krieg gibt. Von solch einer Reise haben Papa und ich immer geträumt, aber es kam ja dann anders. Das Leben liegt noch vor dir, Viktoria!«
Seltsam, dass diese Worte niemals wirklich optimistisch und verheißungsvoll klangen. Warum auch? Es war ihre eigene betrogene Vorstellung vom Leben, die vor mir liegen sollte. Die Generation meiner Eltern baute Karlsruhe wieder auf, damit ich leben sollte, wie alles gewesen war, bevor ES geschehen war. ES, das war die Hitlerzeit, über die keiner gerne sprach, und wenn, dann nur in kleinem vertrauten Kreis, am Tisch mit Verwandten, mit engen Freunden. Eine Flasche Wein oder kleine Schnäpschen oder eine Bowle dienten als Erinnerungshilfe.
»Unsere Viktoria, eine feine kleine Vorzimmerdame!«, machte sich mein ein Jahr älterer Bruder über mich vor dem Abendbrot lustig.
Er hatte nach einer Ehrenrunde in der Oberprima im Max-Planck-Gymnasium in Rüppurr endlich Abitur gemacht und studierte im ersten Semester Maschinenbau. Der Bund war ihm erspart geblieben. Er hatte einen Bandscheibenvorfall. Er war natürlich in einer reinen Jungsklasse gewesen. Ich kannte sowieso kaum Mädchen, die auf die Oberschule gingen, etwa aufs Fichte-Gymnasium, das eines der ersten Mädchengymnasien in Deutschland gewesen war.
Die Gymnasiastinnen lebten sowieso ihr eigenes Leben wie in einem Goldfischglas und begegneten Jungens meistens in der Tanzschule zum ersten Mal seit der Sandkastenzeit wieder. Wir von der Realschule machten eine Lehre und landeten früher im richtigen Leben.
»Ich will ja gar keine Vorzimmerdame werden!«