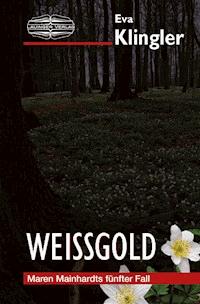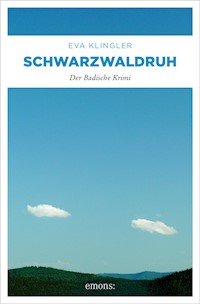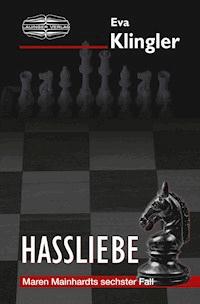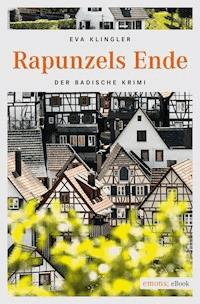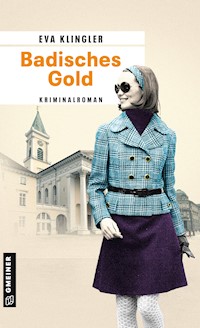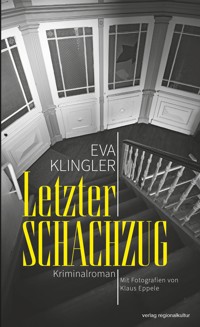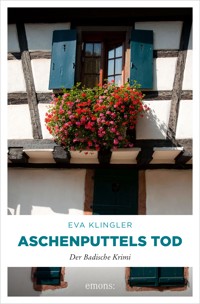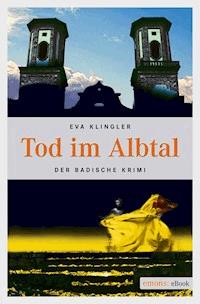
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Emons Verlag
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Serie: Der Badische Krimi
- Sprache: Deutsch
Während eines Einkaufs mit Stilberaterin Swentja Tobler wird Friederike Schmied in der Umkleidekabine einer Edelboutique ermordet. Die Polizei vermutet einen Raubmord und sucht den Täter im Drogenmilieu. Aber Swentja ist übrezeugt, dass die unscheinbare Friederike ihren Mörder kannte, und lässt sich mit dem aussehenden Kommisar auf eine Wette ein: Sie wird in der gehobenen Gesellschaft der badischen Fachwerkstadt Ettlingen eine heiße Spur finden. Doch mit ihren neugieren Fragen enttarnt Swentja nicht nur die Heuchelei der "besseren Kreise", sie setzt damit auch ihr eigenes Luxusleben aufs Spiel. Und dann schlägt der Mörder ein zweites Mal zu. Eva Klingler legt einen Krimi vor, der das gespflegte Badentum nördlich des Schwarzwalds liebvoll aufs Korn nimmt und dabei überaus spannend unterhält. Eva Klingler legt einen Krimi vor, der das gepflegte Badentum nördlcih des Schwarzwalds liebvoll aufs Korn nimmt un dabei überaus spannend unterhält.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 437
Veröffentlichungsjahr: 2012
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Eva Klingler, 1955 in Gießen geboren, lebt als Autorin in Karlsruhe und Selestat (Frankreich). Sie studierte Germanistik und Anglistik in Mannheim, absolvierte ein Volontariat beim Südwestrundfunk in Baden-Baden, arbeitete als Journalistin für Tageszeitungen, als Bibliotheksleiterin und als Dozentin in der Erwachsenenbildung. Die meisten ihrer zahlreichen Veröffentlichungen – oft Krimis – spielen in Baden oder im Grenzgebiet zum Elsass. Eva Klingler war Stipendiatin der renommierten »Reemtsma Stiftung für Nachwuchsautoren«. »Tod im Albtal« ist ihr erster Kriminalroman im Emons Verlag.
Dieses Buch ist ein Roman. Handlungen und Personen sind frei erfunden. Ähnlichkeiten mit lebenden oder toten Personen sind nicht gewollt und rein zufällig.
© 2012 Hermann-Josef Emons Verlag Alle Rechte vorbehalten Umschlagmotiv: Heribert Stragholz Umschlaggestaltung: Tobias Doetsch, Berlin eBook-Erstellung: CPI – Clausen & Bosse, LeckISBN 978-3-86358-176-3 Der Badische Krimi Originalausgabe
Unser Newsletter informiert Sie regelmäßig über Neues von emons: Kostenlos bestellen unter www.emons-verlag.de
Für Christoph Höver aus dem Albtal
»Tod um Ehebruch? Nein!
Der Zeisig tut’s, die kleine goldene Fliege.
Vor meinen Augen buhlt sie.
Laßt der Vermehrung ihren Lauf!«
William Shakespeare, King Lear, IV, 6
Prolog
»Haben Sie außer der Leiche etwas angefasst?«
»Bestimmt nicht. Das war unangenehm genug. Wie sie aussah! Das T-Shirt ist wohl auch nicht mehr zu retten!«
»Ihre Sorgen möchte ich haben!«
Der Mann mir gegenüber stammte eindeutig nicht aus meinen Kreisen.
Das allein wäre noch akzeptabel gewesen, denn unsere Kreise waren nun mal ziemlich eng gezogen. Aber er sah nicht mal aus wie ein solider deutscher Beamter.
Schmal war er, beinahe schlaksig, mit langsamen, lässigen Bewegungen, und sein freches Gesicht mit den wachen grauen Augen und der spöttischen Miene erinnerte an das eines schlauen Fuchses. Im Ohr glitzerte keck ein Strasssteinchen.
Dieses Strasssteinchen verriet ihn. Entweder war er schwul, oder er entstammte jener Schicht, mit der er beruflich zu tun hatte, nämlich der Unterschicht.
Ich tippte auf Letzteres. Dafür besaß ich ein feines Gespür.
Schon als Kind vermochte ich oben und unten instinktiv zu unterscheiden, wie mit einem eingebauten Sensor. Angeblich hatte ich bereits im Sandkasten nach den teuersten Designerförmchen verlangt und nur neben Arzt- und Anwaltskindern Sandkuchen gebacken.
Dieses Gespür ließ mich um solche Leute wie den Mann vor mir auch heute noch einen weiten Bogen machen. Man stelle sich vor, ich hätte mein Dasein als Ehefrau eines Kleinverdieners fristen müssen.
Von meiner neuen muschelfarbenen Chloe-Seidenbluse mit den handgenähten Biesen – als Stilmix toll zu Jeans, ich empfehle dazu ganz klassische Workers’ Levi’s, meine Damen – hätte ich in diesem Fall nur träumen und hätte sie nicht, dank meiner Barclay Card, Platin Edition, spontan mitnehmen können.
Sein starker nordbadischer Dialekt war ein weiterer Minuspunkt für ihn.
In den Zirkeln, in denen ich mich gesellschaftlich bewegte, war die geografische Herkunft nicht mehr zu erkennen. Könnten alle theoretisch Hannoveraner sein. Hannoveraner klangen immer fein, auch wenn sie nur die Bedienungsanleitung der Kaffeemaschine vorlasen.
Sina aus dem Golfclub, die oben in Bad Waldbronn wohnte und mit dem örtlichen Apotheker verheiratet war (im gemütlichen Erholungsort Waldbronn, wohin sich rüstige Senioren aus Karlsruhe gerne zurückziehen, ist das gleichbedeutend mit dem Besitz einer Goldgrube), stammte zwar angeblich aus Bayern, aber das merkte man nicht. Ich hatte sie noch nie Weißwürste essen sehen, und anstatt Bierkrüge zu stemmen, schlürfte sie Champagner gläserweise.
Elena Gontard, vor langer Zeit einmal Mitarbeiterin des berühmten Ballettchoreografen John Cranko in Stuttgart und jetzt Chefchoreografin am Karlsruher Staatstheater, soll zwar – so die Kleinstadtlegende – in Bad Cannstatt zur Welt gekommen sein, aber bei ihr schwang immer ein undefinierbarer Hauch Frankreich mit. Wir waren allesamt stolz, dass sie neben ihrer kleinen Wohnung in der Nähe des Theaters eine Maisonette in Ettlingenweier bewohnte, und dafür überschütteten wir sie mit Einladungen und Auszeichnungen. Elena war eine nationale und internationale Berühmtheit. Leuten vom Ballett stand ein bisschen Frankreich immer gut, vielleicht sogar gemischt mit einem Schuss (aber bitte nicht zu viel!) Osteuropa. Außerdem hatte sie tatsächlich französische Vorfahren, irgendwelche Tanten, wie sie mir mal erzählt hat. Die sprach sie mit »Sie« und »ma tante« an. Und es gab noch Cousinen, die in Paris lebten. Ich meinte, die Adresse »Avenue Foch« gehört zu haben.
Auf dieses genealogische Insiderwissen konnte ich stolz sein, denn Elena war noch eine Spur elitärer als ich: »Die Leute hier kennen meine Inszenierungen, mehr brauchen sie nicht zu wissen. Sie sollen kräftig fürs Ballett spenden und viele Abonnements nehmen. Der Rest ist Privatsache.«
Elena kaufte fast alles in Straßburg ein und war natürlich immer geschmackvoll gekleidet. Sie ließ keinen Zweifel daran, dass sie auf meine Dienste als Stilberaterin verzichten konnte. »Swentja, excuse-moi, aber ich brauche wirklich keinen, der mir sagt, ob mir ein schwarzes Etuikleid steht oder nicht. Und ich hasse es, wenn jemand ungeduldig vor meiner Kabine steht und fragt, ob ich so weit bin.«
»Ich hasse es auch!«, hatte ich zurückgegeben. »Deshalb lasse ich meine Kundschaft zuerst auch immer allein anprobieren. Danach sehe ich mir an, was sie sich aussuchen würden, und hänge es stillschweigend wieder zurück. Das ist der Moment, in dem meine Arbeit beginnt. Denn sie haben bisher immer falsch eingekauft, und sie wollen es wieder tun.«
Sie hatte gelacht. Ich vermutete, dass sie auch deshalb nach Straßburg fuhr, damit niemand sie dabei beobachtete, wie sie so etwas Profanes wie Küchenrollen oder Essig nach Hause trug. »Ein bisschen Nimbus schadet nicht. Die Ettlinger und die Karlsruher lieben jene Künstler besonders innig, die von weit her kommen. Typisches Phänomen von netten kleineren Großstädten. So werden die Brasilianer in meiner Compagnie geradezu vergöttert, und allesamt verehren sie die Australierin Tamatha, obwohl gerade die leider nicht die allerbeste Tänzerin ist. Käme sie aus Pforzheim, hätte ich die Kleine schon rausschmeißen können.«
Zurück zu meinem Gegenüber. Früher wäre er ein Fall für den Hintereingang gewesen. Einer, der finanziell gerade so rumkam. In unseren Kreisen hingegen hatte man Vermögen. Erarbeitet oder ererbt. Vielleicht manchmal auch ergaunert. Aber lebenslang verfügbar, jederzeit abrufbar. Vermehrbar und unter den Kindern teilbar. Dieser Mann hingegen verfügte vermutlich nur über ein bescheidenes monatliches Einkommen, das eines Tages in eine noch geringere Pension überführt werden würde.
Nachdenklich betrachtete ich ihn, so wie ich auch meine Fußpflegerin, meine Zugehfrau und die Bäckereiverkäuferin studierte. Ich fragte mich immer, wie sich all diese Durchschnittsmenschen zum täglichen Aufstehen und zum Arbeiten motivierten. Sie schufteten doch nur, um sich das Bestehende erhalten zu können. So ein Leben konnte ich mir beim besten Willen nicht vorstellen.
Ich wandte mich dem Mann mir gegenüber zu und merkte, dass er mich aufmerksam beobachtete. In seinem Blick lag sogar eine Spur Herausforderung, was mich überraschte, denn zu was sollte er mich schon herausfordern? Er sah nicht schlecht aus und hatte etwas von einem lässig-ironischen Draufgänger – eine Mischung, die zweifellos bei manchen Frauen ankommt –, doch wir beide hatten nichts miteinander zu tun und wären uns ohne diese Leiche niemals begegnet.
Er hatte sich kurz vorgestellt. Hagen Hayden.
Seltsamer Vorname. Vielleicht hatte seine Mutter in den sechziger Jahren die »Nibelungen« im Kino gesehen. Andererseits wäre ihr zweifellos volkstümliches Gemüt dann doch eher von dem netten blonden Siegfried als von der düsteren Figur des Hagen von Tronje beeindruckt gewesen, und dass Hagens Mama etwas vom Wohlklang eines Stabreims mit H und H gehört hatte, war ja wohl vollkommen ausgeschlossen.
Irgendeine Rangbezeichnung trug er natürlich auch, doch in der Aufregung hatte ich sie nicht genau verstanden. Er kam jedenfalls von der Außenstelle Ettlingen der Kriminalpolizei Karlsruhe. Sie residierte unweit der Herz-Jesu-Kirche in einem für den Zweck eigentlich zu niedlich aussehenden rosafarbenen Gebäude in der Pforzheimer Straße und hatte normalerweise – soweit ich es beurteilen konnte – nicht allzu viel Schreckliches aufzuklären.
Die romantische Fachwerkstadt Ettlingen, die sich entspannt zwischen dem Rand des Nordschwarzwalds über die Vorberge bis in die Rheinebene ausbreitete, war fürwahr kein Ort, in dem ein Kripobeamter täglich das Fürchten lernte. Die etwa achtunddreißigtausend Einwohner huldigten einer friedlichen Grundstimmung. Ebenso gelassen hatten sie vermutlich schon zu römischer Zeit an dieser alten Straßenkreuzung gelebt, die sie einerseits durch das Albtal mit den Straßen nach Pforzheim oder ins Murgtal und andererseits mit den Handelswegen zu Rhein und Neckar verband. Viele Leute zogen heutzutage nach Ettlingen, um dort den zweiten Teil des Lebens zu genießen. Das Geld dafür hatten sie zuvor in Mannheim, Pforzheim oder Karlsruhe verdient.
Um uns beide herum gingen noch zahlreiche weitere Polizisten und Zivilbeamte ihrer Arbeit nach. Alle sprachen so gedämpft, als könnte die frisch Ermordete von einem lauten Wort aufwachen. Doch nichts würde Friederike Schmied mehr aufwecken.
Ich selbst hatte es bereits versucht. Sie saß da, als wäre sie mitten im Anprobieren einfach eingeschlafen. Das Glas mit dem Sekt war ihr aus der Hand geglitten, auf dem Hemd waren unschöne nasse Flecken. Dennoch war mir aufgefallen, dass das Glas ordentlich auf dem Boden stand. Ihr Mörder musste es nach seiner Tat wieder aufrecht hingestellt haben. Ein gewissenhafter Mörder also, doch vielleicht hatte er nur eine vorzeitige Entdeckung durch das ausfließende Nass verhindern wollen.
Bei meiner Berührung hatte Friederikes Körper auf eine merkwürdig leblose Art nachgegeben und war noch weiter gegen die Rückwand der Umkleidekabine gerutscht. Ich schauderte bei der Erinnerung an den Kontakt mit ihrem nackten Arm. Er war noch warm gewesen!
Draußen fuhr gerade der Krankenwagen vor.
Dabei brauchte die freundliche Friederike ganz gewiss keinen Krankenwagen mehr. Wahrscheinlich war es zu pietätlos, in solchen Fällen gleich einen Leichenwagen zu bestellen, und deshalb nährte man auf diese Weise bei den Umstehenden die tröstliche Illusion, es sei noch etwas zu machen.
Die Boutique am Marktplatz, in der das unfassbare Verbrechen geschehen war, gehörte Frau Trost. Sie saß im Erdgeschoss, in der Nähe der reduzierten s.Oliver-T-Shirts, auf einem ihrer kleinen Anprobehöckerchen, fächelte sich Luft zu und schüttelte nur immerzu ihren wohlfrisierten Kopf. Jene Kundinnen, die sich in dem allgemeinen Wirrwarr nach der Entdeckung der Toten nicht rechtzeitig aus dem Staub gemacht hatten, standen zusammengepfercht in einer Ecke – bei den langweiligen Olsen-Pullovern (die Bedauernswerten) – und wurden von zwei Beamten verhört, die billig aussehende Blöckchen in den Händen hielten.
Ein Team mit Kameras und Koffern, in denen sich wahrscheinlich Spurensicherungsutensilien befanden, war die inzwischen mit einem Seil abgesperrte halbe Wendeltreppe in die kleine Exklusivabteilung hinuntergeeilt. Von dort vernahm man gedämpftes Stimmengewirr. Handys läuteten, und Gespräche wurden leise erregt angenommen.
Ich konnte mir denken, dass Frau Trost mich und das Schicksal dafür verfluchte, dass Friederike sich ausgerechnet in ihrem blühenden, mehrstöckigen Laden am heiteren Ettlinger Marktplatz hatte umbringen lassen.
Ohne etwas aufzuschreiben, feuerte Hagen Hayden rasch weitere Fragen in meine Richtung ab. »Ihre Personalien nehme ich später auf. Jetzt sollten wir keine Zeit verlieren. Sie kannten die Tote also?«
Ich spürte, wie sich feiner Schweiß auf meiner Stirn ausbreitete und mein perfektes Make-up zu zerstören drohte. So etwas hasste ich. Jede Pore, die sich jetzt öffnete, würde ich heute Abend mühsam mit meinen Dr.-Denese-Fruchtpads gründlich reinigen und wieder verschließen müssen.
»Ja, es ist Friederike Schmied. Hier … hier habe ich eine Karte mit ihrer Adresse.«
Hayden nahm die Karte entgegen und warf nur einen kurzen Blick darauf. Dann schnippte er mit dem Finger. Ein junger Uniformierter griff nach dem Kärtchen, Hagen Hayden nickte kurz, und der Junge entfernte sich. Aus dem Augenwinkel sah ich ihn draußen mit dem Handy telefonieren. Jetzt erhielt Horst Schmied wahrscheinlich die Nachricht. Wie grausam.
»Kannten Sie sie gut?«
»Gut? Ja, durchaus. Wir verkehrten in denselben Kreisen und …«
Hier zog er ironisch die Augenbrauen hoch, und sein Blick wurde eindringlicher.
Sollte er. Seit vielen Jahren war ich daran gewöhnt, dass die Leute mich neidisch und argwöhnisch betrachteten. Wir gehörten zu einer ganz eigenen Kaste: die Wohlhabenden und die Gutaussehenden! Die sich nicht für ihre Privilegien schämten oder entschuldigten, sondern mitsamt ihrem Geld sogar noch ein halbwegs glückliches Leben führten. In den Medien tauchten wir kaum auf. Den Bildschirm beherrschten die ewig zu kurz Gekommenen in ihren Jeans von Takko und ihrem Übergewicht.
Für Menschen wie uns sollte es ein Elite-TV geben, mit teurer Kosmetik, Mode und Tipps für Drei-Sterne-Restaurants.
»Frau Schmied war außerdem eine Klientin von mir. Wir waren heute das zweite Mal unterwegs. Da kennt man sich so, wie sich Frauen nun mal kennen.«
»Und wie ist das? Klären Sie mich auf!«
Ich dachte nach. »Sind Sie verheiratet, Herr Hagen? Wo geht Ihre Frau einkaufen?«
Er antwortete nicht. Also war er ledig. Das hätte man sich denken können. Das Beispiel eines nicht gelungenen Lebens: mieser Job, keine Frau, keine Familie, keine Perspektive.
Nun musterte er mich amüsiert und mit Interesse. »Ich heiße übrigens Hagen mit Vornamen. Und so weit sind wir beide eigentlich noch nicht. Na ja, vielleicht kommt das noch. Aber nicht jetzt. Jetzt haben wir erst einmal ein Kapitalverbrechen aufzuklären. Welcher Art genau ist Ihr Geschäft? Was hatten Sie mit Frau Schmied zu tun?«
Ich fand den Kerl ziemlich unverschämt. Kühl antwortete ich: »Ich habe mit ihr Kleidergeschäfte und Boutiquen aufgesucht.«
»Wie bitte? Können Sie mir das erklären?« Die Augenbrauen hatten sich wieder auf Normalposition begeben, dafür zuckten die Mundwinkel sarkastisch nach unten.
»Gerne. Obwohl ein Mann das wohl nicht verstehen wird. Sie hat mich dafür bezahlt, dass ich mit ihr shoppen gehe. Sie dabei berate. Meine Güte, ich sollte ihr sagen, was ihr steht und was sie kaufen soll.«
Er starrte mich mit seinen grauen Augen ungläubig an. Dann nahm er mich am Ellbogen, führte mich zur Seite neben das Drehgestell mit nichtssagenden Street-One-Blusen – mir blieb auch nichts erspart –, wies mir mit einer Kopfbewegung ein Stühlchen zu und setzte sich neben mich wie ein besorgter Arzt neben einen Verrückten.
»Erzählen Sie genauer!«
Ich blickte aus dem Schaufenster, vorbei an den großen Schildern: »Heute 50 Prozent auf exklusive Sommerware im ersten Stock.« Durch das Fenster sah ich, wie die Bahre hinaus auf den idyllischen Platz vor dem üppig verzierten Ettlinger Rathaus getragen wurde.
Wie oft hatte ich Rotariergattinnen von außerhalb im Rahmen einer launigen Stadtführung neben der Martinskirche – »Chorturm spätgotisch/romanisch, die reich gegliederte Turmlinie Barock, meine Damen« –, der Stadtmauer und dem Lauerturm mit dem dortigen Museum auch den Marktplatz und das prachtvolle Rathaus gezeigt und ihnen erklärt, dass das Gebäude aus dem 18. Jahrhundert stammte.
Es war seltsam, wie man plötzlich vertraute Dinge schärfer wahrnahm.
Mein Blick schweifte über unser Stadtwappen, einen Nachfolger des ältesten badischen Stadtwappens, mit dem roten Schrägbalken und dem silbernen Zinnenturm, und weiter zum Wohnhaus auf der anderen Seite, wo das Stammhaus des einstmals regional bedeutsamen Kaufhauses Schneider gewesen war.
Wie jeden Samstag war Markt mit etwa dreißig bunten Ständen, aber heute fand noch zusätzlich das Marktfest statt. Die ganze Stadt brodelte. Gut gelaunte Gruppen von Freunden oder einfach nur losen Bekannten bevölkerten die Straßencafés. Die appetitlichen Stände mit Blumen, Gemüse und Naturprodukten sorgten für eine fast provenzalisch anmutende Szenerie. Nicht umsonst war Ettlingen verschwistert mit dem französischen Épernay, wo der Champagner herkam.
Normalerweise kaufte ich ja bevorzugt in Feinkostläden ein, aber gelegentlich schlenderte ich über den Markt und erstand französischen Rohmilchkäse oder frisches exotisches Obst. Vor dieser alternativ angehauchten Kulisse hatte ich so wenigstens die Gelegenheit, meine Jacke von Green House im Ethnostil oder das kurze Blumenkleidchen im Retrolook von Oui auszuführen. Dazu wählte ich dann helle, flache Ziegenlederstiefel, ohne Strümpfe, sodass man meine braune Haut sah, und nahm meinen bunten Korb aus dem Weltladen über den Arm. Das kam bei den wohltätigkeitsbesessenen Damen aus meinen Kreisen gut an. Swentja Tobler als wandelnder Werbeträger für sich selbst, für ihren Mann und für ihren neuen noblen Einkaufsservice.
Zum Markt im heimischen Ettlingen das Gleiche zu tragen wie abends im Restaurant in Baden-Baden oder in Straßburg, wäre für mich hingegen undenkbar gewesen. Ich zog mich mindestens drei Mal am Tag um, und mit der Kleidung wechselte ich die Handtaschen, die Schuhe, den Schmuck und den Stil. Und die Persönlichkeit. Eine neu zugezogene Nachbarin in der Villa nebenan hatte lange Zeit geglaubt, in unserem Haus wohnten zwei Schwestern, die niemals zusammen das Haus verließen.
Friederike Schmied hatte sich einen heißen Tag zum Sterben ausgesucht. Draußen vor der Tür der Boutique, die allerdings mit einer starken Klimaanlage verkaufsfördernd heruntergekühlt war, entfaltete sich ein typischer badischer Frühsommer.
In der Kleinstadt Ettlingen, die von bewaldeten Hügeln umgeben war, konnte man es zwar etwas besser aushalten als in der benachbarten Großstadt Karlsruhe, wo die Hitze zwischen den Mietshäusern lastete, aber auch für unsere Verhältnisse war es heute wirklich drückend. Nicht einmal die Alb, die unweit von hier über flache Steine kullerte und dann zügig unter der pittoresken Holzbrücke hindurchfloss, vorbei am geheimnisumwitterten Neptunstein, brachte echte Kühlung.
Sanitäter hievten die Bahre auf eine Art Gestell, und mühelos glitt Friederikes Körper ins Innere. Zu ihrer vorletzten Fahrt.
Die Kinder, die sich zuvor mitten auf dem Platz mit Wasser aus dem alten Georgsbrunnen bespritzt hatten, standen still und stumm und waren sogar zum Kichern zu verblüfft. Auf einmal war der Tod viel näher als im Fernsehen. Zum Anfassen und zum Erschrecken nah.
Eine Polizistin wischte sich über die verschwitzte Stirn und entfernte das Seil, das den Eingang zur Boutique abgesperrt hatte. Ich kannte sie vom Sehen. Sie saß – in Zivil – oft abends im Vogelbräu, Ettlingens weithin berühmter privater Hausbrauerei mit Biergarten und zünftigem Essen. Am Wochenende, wenn dort der Jazzbrunch stattfand, gab es kaum eine Chance auf einen Sitzplatz. Manche behaupten ja, Ettlingen sei etwas für jene Schickis, die es nicht ganz bis nach Baden-Baden geschafft haben. Aber das stimmt nicht.
In Ettlingen und dem sanft bis in den Nordschwarzwald ansteigenden Albtal ließ sich ein ziemlich stressfreies Leben mit einem beinahe ganzjährigen Urlaubsgefühl verbinden. Die Stadt bedeutete eine gewisse Eleganz ohne billige Angeberei. Sie bot die Möglichkeit zu Understatement und Diskretion, lockte aber auch mit Privatschulbildung, noblen Seniorenstiften und schicken Architektenbüros in renovierten Fachwerkhinterhöfen. Hier gab es viel altes, ruhiges Geld aus Karlsruhe, Heidelberg oder Pforzheim.
Und da draußen auf dem hübschen Platz, umgeben von Läden und Cafés und von Samstagsgesichtern, die ein heiteres Sommerwochenende einläuten wollten, lag jetzt eine von uns auf ihrer Bahre. Sie war kein glücklicher Mensch gewesen, das hatte ich immer gespürt. Als wollte sie eigentlich eine andere sein, wüsste aber nicht genau, wer.
Und jetzt war sie tot.
Nachdem Friederike so lange nicht aus der Umkleidekabine gekommen war, hatte ich erst gerufen und dann, als keine Antwort kam, nachgesehen.
Ich hatte erwartet, sie aufgeregt und ein wenig verschwitzt inmitten von Kleidungsstücken und Bügeln vorzufinden. Stattdessen saß sie ganz still da, in diesem recht netten Seidenhemd von Aubade in einem zarten altrosa Puderton, neben sich das bewusste Gläschen Sekt, welches die Kundinnen von Frau Trost als Belohnung dafür bekommen, dass sie im Untergeschoss bei den teuren Designern kaufen, anstatt oben auf den Sonderangebotstischen zu wühlen. An ihrem Hals schwollen gerade hässliche rote Würgemale an, die Augen waren hervorgetreten, die Hände hingen schlaff herab. Das ganze Bündel Mensch lehnte an der Wand der Kabine wie eine Puppe.
Ich spürte, wie ich ganz leicht zu schwitzen begann, wenn ich mir den Anblick nochmals vor Augen rief.
Es würde Abend werden, bevor der kühlende Wind, der abends aus dem lang gestreckten und saftig grünen Tal von Bad Herrenalb herunterwehte – von den dankbaren Ettlingern liebevoll »der Albtäler« genannt –, für Erfrischung sorgen würde.
Verdeckt unter dem Tuch, ein langer, rundlicher Klumpen, wartete Friederike Schmied nun so geduldig, wie es auch zu Lebzeiten ihre Art gewesen war, darauf, dass der Krankenwagen wendete und sie endlich unseren Blicken entzog. Auf unserer neu angelegten, mit jungen Pappeln gesäumten Allee würde der Wagen Ettlingen verlassen und Richtung Karlsruhe fahren. Vermutlich ins Diakonissenkrankenhaus in Rüppurr gleich rechts am Ortseingang von Karlsruhe, aber vielleicht auch in die Städtischen Krankenanstalten am anderen Ende der Stadt.
Melancholisch blickte ich ihr nach. Mit ihr verschwand auch eine noch unbezahlte Rechnung, denn ich konnte dem trauernden Witwer schwerlich eine Honorarrechnung für eine Tätigkeit präsentieren, deren Ergebnis eine tote Gattin war. Ich hatte das Geldverdienen nicht nötig, aber ärgerlich war es doch. Friederikes Tod bedeutete schlimmstenfalls das vorläufige Ende meiner netten Geschäftsidee, denn bei meiner Art von Kundschaft kam es bestimmt nicht gut an, wenn gleich im ersten Jahr eine Klientin beim Einkaufsbummel mit mir ermordet wurde.
Der Kripobeamte mit dem seltsamen Vornamen hatte mich die ganze Zeit aufmerksam beobachtet. Mir wurde unwohl. Hoffentlich forschte er in meiner Miene nicht nach verräterischen Hinweisen, um mich als Verdächtige in seine Akten aufzunehmen. Zwar besaß ich für nahezu jeden Anlass das geeignete Outfit, doch beim Untersuchungsgefängnis müsste ich passen. Vielleicht könnte ich meine einfache Reisenthel-Weekender-Tasche – ein Werbegeschenk der Vogue – nehmen und einen schlichten Jogginganzug von Hanro einpacken. Welche Farbe wählte man am besten für den Knast? Grün und Blau könnten sich mit den Uniformen meiner Wärter beißen oder für Verwechslungen sorgen. Rot war zu aggressiv, und Schwarz wirkte deprimierend. Weiß würde zwar unschuldig aussehen, aber ich wusste ja nicht, wie man es im Untersuchungsgefängnis mit der Sauberkeit hielt. Weißes ist nun mal empfindlich.
Aber warum hätte ich Friederike Schmied ermorden sollen? Oder anders gefragt: Warum hätte irgendjemand die biedere, freundliche Friederike Schmied ermorden sollen?
Sie war harmlos und langweilig gewesen. Immer auf der Jagd nach ein bisschen Bedeutung, einem Pöstchen, einer kleinen Einladung oder einer neuen Freundin, die ihr Bedeutung verleihen sollte.
Bei mir sähe die Sache schon anders aus. Wahrscheinlich würde mich der eine oder andere ganz gerne erwürgen, denn ich konnte mit meiner Kritik ziemlich gnadenlos sein. Zumindest behauptete Elena das gelegentlich, obwohl dann eine gewisse Hochachtung in ihrer Stimme mitschwang. Die Einladungen zu meinen Partys etwa waren gefürchtet, vor allem bei denen, die keine bekamen!
»So, Frau Tobler. In diesem Laden hier, praktisch vor aller Augen, ist gerade eine Frau ermordet worden. Und von Ihnen hätte ich jetzt ganz gerne die Vorgeschichte in Kurzform.«
Ich holte Luft …
1
Bestandsaufnahmen
Ich heiße Swentja Tobler. Wem der Name für eine badische Pflanze seltsam vorkommt, dem sei gesagt: Es hätte noch schlimmer kommen können.
Wird es ein Junge, hatten meine Eltern damals beschlossen, so würde er auf einen der Namen getauft, die Mamma aus ihrer Südtiroler Heimat kannte (Federico? Luigi?), wird es ein Mädchen, so sollte es heißen wie die Schwester meines schwedischen Vaters. Und so kam es. Aus mir wurde Swentja Alström.
Mamma und mein Vater haben sich am Frankfurter Flughafen kennengelernt. In einem der Restaurants dort saßen die beiden zufällig am selben Tisch und löffelten Suppe: Mamma Nudelsuppe und Papa Krabbensuppe.
Und beide verpassten ihren Flieger, weil sie nur noch Augen füreinander hatten und nicht mehr für die Anzeigentafeln: Verliebt. Verlobt. Verheiratet.
Beide litten noch unter akutem Heimweh nach Meran beziehungsweise Malmö, und so beschlossen sie, an einen Ort ungefähr in der Mitte zu ziehen. So landeten sie in Karlsruhe in einer geräumigen Altbauwohnung in unmittelbarer Nähe des Bahnhofs, die Mamma durch ihre italienischen Verbindungen gefunden hatte.
In der Marienkirche unweit unserer Wohnung traf sich sonntags die italienische Gemeinde zum Gottesdienst. Da saß dann der kleine Pizzabäcker, sonntäglich gekleidet, neben dem eleganten italienischen Herrenschneider und der reichen Ehefrau eines Importeurs aus Milano. Und dazwischen ich, als Kind. Der Gottesdienst langweilte mich, also schaute ich um mich und schulte meinen Sinn für Eleganz und für Schönheit, denn am Sonntag achteten die Italiener besonders auf ihr Äußeres.
Zwar war die Wohnung groß, doch die Wohnlage nur mittelmäßig gut. Nachts hörte ich die Schreie der Tiere aus dem benachbarten Zoo, und manchmal roch es streng nach Elefant. Das war mir peinlich, wenn meine Kindergartenfreundinnen zu Besuch kamen, und so beschloss ich, später einmal im besten Viertel meiner Stadt zu wohnen.
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!