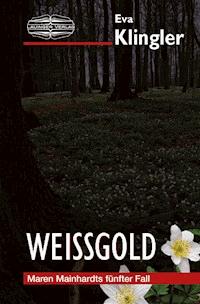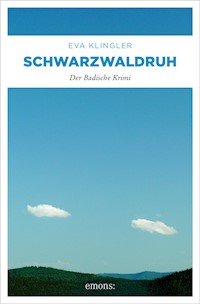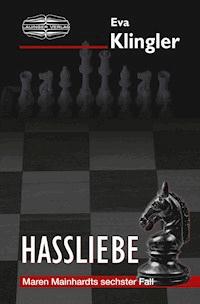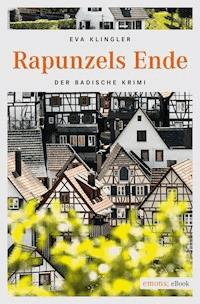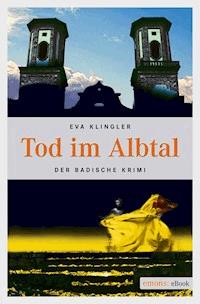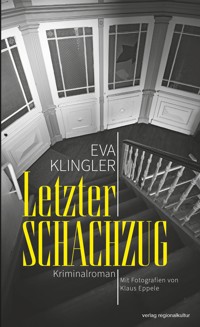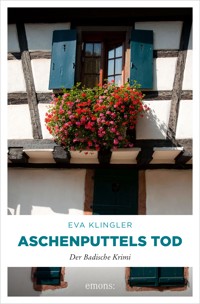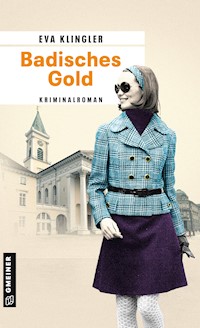
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: GMEINER
- Kategorie: Krimi
- Serie: Ex-Kriminalbeamtin Viktoria Herrmann
- Sprache: Deutsch
Während in Berlin die berühmte Kommune 1 die behäbigen Bürger mit Sex und Rock’n’ Roll aufscheucht, geht es 1967 in der ersten Karlsruher Kommune etwas gemütlicher zu. Als Rosi Baron, eine Bewohnerin der Kommune, während einer Demonstration in der Badewanne ermordet wird, übernimmt die junge Kripobeamtin Viktoria Hermann die Ermittlungen. Warum musste die klassische Schönheit sterben, die sich stets mehr für die Verführung der Männer als für Politik zu interessieren schien?
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 278
Veröffentlichungsjahr: 2022
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Eva Klingler
Badisches Gold
Kriminalroman
Zum Buch
1967: Wild. sexy. mörderisch! Victoria Hermann ist eine weibliche Kripobeamtin der ersten Generation. Während sie in der Kommune KA1, der ersten sündigen studentischen Wohngemeinschaft in Karlsruhe, zu tun hat, weil die Nachbarn von einem sehr jungen Mädchen berichten, dass sich dort aufhalten soll, lernt sie auch die Bewohner kennen. Besonders auffallend ist Rosi Baron, eine klassische Schönheit, die sich jedoch weniger für Politik, sondern mehr für die Verführung der Männer zu interessieren scheint. Während einer Demonstration auf dem Karlsruher Marktplatz, an der auch die Bewohner der KA1 teilnehmen, wird Rosi in der Badewanne der Kommune ermordet. Ihre Uhr schwimmt im Wasser und zeigt 17.05. Am Finger trägt sie einen teuren Ring, den ihre Eltern ihr zum Geburtstag geschenkt haben. Der vermeintliche Mörder wird neben der Leiche aufgefunden, ihr Mitbewohner Werner Lange. Seine Schuld hat er nie abgestritten, doch ist er wirklich der Täter?
Eva Klingler wurde im oberhessischen Gießen geboren. Ihre Jugend und die Studienjahre verbrachte sie in Mannheim, bevor sie nach Baden-Baden zog, um ein Volontariat beim Südwestrundfunk zu absolvieren. Nach einigen Jahren entschloss sie sich, selbstständig zu arbeiten, und wirkte als Dozentin, Autorin und freie Journalistin in Redaktionen in Baden-Baden und Bretten. Nach einem kurzen Zwischenspiel als Bibliotheksleiterin in Rheinstetten wurde sie endgültig als freie Autorin sesshaft. Ihre Bücher spielen meistens in Baden und im Elsass. Mit Mann und Hund lebt Eva Klingler nun in einem grünen Stadtviertel von Karlsruhe und betreibt die von ihr gegründete Wohltätigkeitsorganisation „20 Stühle“.
Impressum
Personen und Handlung sind frei erfunden.
Ähnlichkeiten mit lebenden oder toten Personen
sind rein zufällig und nicht beabsichtigt.
Immer informiert
Spannung pur – mit unserem Newsletter informieren wir Sie
regelmäßig über Wissenswertes aus unserer Bücherwelt.
Gefällt mir!
Facebook: @Gmeiner.Verlag
Instagram: @gmeinerverlag
Twitter: @GmeinerVerlag
Besuchen Sie uns im Internet:
www.gmeiner-verlag.de
© 2022 – Gmeiner-Verlag GmbH
Im Ehnried 5, 88605 Meßkirch
Telefon 0 75 75 / 20 95 - 0
Alle Rechte vorbehalten
Lektorat: Claudia Senghaas, Kirchardt
Herstellung/E-Book: Mirjam Hecht
Umschlaggestaltung: U.O.R.G. Lutz Eberle, Stuttgart
unter Verwendung eines Fotos von: © ullstein bild und Leonid Andronov / shutterstock
ISBN 978-3-8392-7320-3
Gedicht
Von guten Mächten treu und still umgeben,
Behütet und getröstet wunderbar,
So will ich diese Tage mit euch leben
Und mit euch gehen in ein neues Jahr.
Noch will das alte unsre Herzen quälen,
Noch drückt uns böser Tage schwere Last.
Ach Herr, gib unsern aufgeschreckten Seelen
Das Heil, für das du uns geschaffen hast.
Dietrich Bonhoeffer
verfasst in Gestapo-Haft Dezember 1944
Prolog 1 Ende Februar 2020
Es klingelte.
Ich betätigte den Türöffner und wartete im Flur des vierten Stockes.
Im Haus war es still. Totenstill. Das irritierte mich.
Dann fiel es mir ein. Die meisten Bewohner nahmen unten im Vortragssaal an dem Balalaika-Konzert teil, das schon lange mit einem Plakat angekündigt war.
Ich hatte das nicht gewusst, hatte das Plakat übersehen oder den Termin vergessen. Sonst hätte ich ihn bestimmt nicht für heute Abend zu mir bestellt.
Zu gefährlich. Doch jetzt war es zu spät.
Er stieg schon aus dem Aufzug.
Und er kam, um mich zum Schweigen zu bringen.
Wenn es sein musste – für immer.
Prolog 2 2. Juni 1967
Sie nahmen mich normalerweise niemals an einen Tatort mit. Keine Ahnung, warum nicht. Vermutlich, weil ich eine junge Frau war, noch immer nicht verheiratet, und deshalb nicht mit Unschicklichem zu belasten war.
Und die meisten Mordopfer sehen nun mal unschicklich aus. Sie haben sich besudelt, mit Exkrementen, oder sie haben erbrochen, bevor sie starben. Blut klebt an und auf ihnen, und meistens ist es alt und riecht unangenehm.
Ihre Augen treten hervor oder liegen trüb in ihren Höhlen, ihr Mund steht meist halb offen, Speichel hat sich in den Falten ihrer Gesichter eingenistet.
Mit einem Wort: Es ist nicht schön, einen Menschen zu sehen, den ein anderer umgebracht hat. Sie sterben eben nicht filmreif so wie bei Schirm, Charme und Melone, einer Fernsehserie, die ich liebte. Diese Diana Rigg war eine tolle Frau. Sie trug keine Kleider, sondern Hosen, mit denen sie an Fassaden hochklettern und in Sportwagen springen konnte. Und Mr Steed war allemal interessanter als meine Kollegen, die brav und behäbig daherkamen und nirgendwo anders denkbar waren als in Karlsruhe. Einer Stadt, die schon lange den Ruf einer behäbigen Beamtenstadt genoss.
Diesmal nahmen sie mich aber tatsächlich mit. Ich kletterte in den Opel Kadett, der zu unserer Abteilung gehörte und dessen Schlüssel an einem Haken neben dem Waschbecken des Chefs hing. Ich fand meinen Platz hinten: »Rück mal ein bisschen« neben einem jungen Beamtenanwärter, am Steuer saß mein Kollege Pepperkorn, und gemeinsam erreichten wir den Tatort.
Die Tatsache, dass die nackte Leiche in der Badewanne lag und dass sie nicht roch und sich nicht besudelt hatte, machte die Sache nicht viel besser. Tote aufgerissene Augen sind immer furchtbar, denn man fragt sich instinktiv, was sie als Letztes gesehen haben. Vielmehr wen? Könnte man ihre Netzhaut lesen, stünde da der Name ihres Mörders?
Die junge Frau war ertrunken, aber nein, das stimmte eigentlich gar nicht, denn offensichtlich hatte jemand sie lange, zu lange unters Wasser gedrückt und somit ersäuft. An ihrem Hals waren Kratzer, auf ihrer Brust rote Male, die sich bald in blaue Flecken verwandeln würden. Wenn sie noch lebte. Hektisch durchforstete ich gedanklich meine Ausbildungsunterlagen. Gerichtsmedizin. Spurensicherung, bildeten sich blaue Flecken noch bei einer Leiche? Warum wusste ich das nicht und warum dachte ich jetzt daran? Ich hatte sie gekannt. Hatte sie gekannt … mir wurde leicht schwindelig. Dann hörte ich Stimmengewirr, erkannte eine Stimme, die nur ein Wort sagte, und hoffte inständig, dass er nichts damit zu tun hatte. Die Stimme sagte nur: »Nein!«
Mein Blick wanderte noch einmal zu ihr. Am Boden des klaren Badewassers lagen ein Paar Ohrringe und bewegten sich leicht wie eine Muschel am Meer, wenn der Wind die Wellen kräuselt. Ihre Fußnägel waren frisch lackiert. Hellrosa, wie es Mode war.
Ich betrachtete ihr einst schönes Gesicht. Es hatte sich verändert im Tod. Der spöttische Zug war verschwunden.
Ob es ein Trost für sie gewesen wäre, dass wir kurz darauf erfuhren, dass sie am gleichen Tag wie ein Student namens Benno Ohnesorg im fernen Berlin gestorben war?
Sein Tod sollte die ganze Welt verändern, ihrer nur das Leben von ein paar Leuten. Unter anderem meines, denn ich verlor einen Mann, in den ich mich verliebt hatte.
1. Teil
1. Kapitel Februar 2020. Karlsruhe
Wenn man in einem Seniorenheim wohnt, hat man viel Zeit zum Nachdenken. Auch in einem so feinen Haus wie dem Sonnenstift, in dem immer etwas geboten wird, gibt es Stunden der Leere. Es wird einem ja alles abgenommen, was früher zu tun gewesen war. Kochen. Einkaufen. Putzen.
Natürlich gibt es immer wieder Aktivitäten, auf fröhlichen Zetteln aufgeschrieben und, mit einer gemalten Sonne verziert, neben den Frühstückskaffee gelegt, die die Zeit bis zum unausweichlichen Ende auf angenehme Weise verkürzen sollen. Sonnen waren das Wahrzeichen dieses gehobenen Hauses. Es hieß schließlich Sonnenstift.
Doch, so dachte ich oft und ketzerisch, in meinem Alter muss man die Zeit nicht vertreiben oder verkürzen. Sie wird kurz von ganz allein. Es gilt, sie sinnvoll zu füllen. Meine Mitbewohnerinnen waren da anderer Meinung: »Du mit deinem Sinn! Wir haben genug geleistet. Jetzt ruhen wir uns nur noch aus.«
Ich war anderer Auffassung. Da musste doch noch etwas kommen. Und wenn nicht – nun, dann ist die Beschäftigung mit der Vergangenheit vielleicht nicht das Schlechteste.
Zumal meine Vergangenheit, anders als die meiner Mitbewohner, in Teilen blutig, in Teilen traurig, immer aber spannend wie ein Film gewesen war. Auch wenn sich manche Filme so langsam entfaltet haben wie jene alten Krimis mit Maigret oder Miss Marple. Nicht massenweise Leichen pflasterten meinen Weg. Keine brutalen Serienmörder waren mir in die Hände gefallen. Aber Mörder, das schon.
Immer wieder muss ich an meine Anfänge denken. An den Mord aus dem Jahr 1959, als ich noch ein junges Ding war, das davon träumte, zur Kriminalpolizei zu kommen. Von Kriminalassistent Paul, der mir den Weg dahin ebnen sollte, und daran, dass die Stimmen der Vergangenheit eines Tages in Gestalt von zwei Frauen meinem behaglichen Seniorenwohnstift aufgetaucht waren und mich noch einmal mit allem konfrontiert hatten.
Erst war mir die Erinnerung an meinen ersten Fall peinlich gewesen. War ich wirklich so jung, so naiv und so leicht zu verführen dahergekommen? Dann fühlte sich die Reise in die Vergangenheit seltsam an. »Hast du nichts Besseres zu tun, Viktoria? Lern doch endlich Bridge!« Doch dann hatte mich noch einmal die Spannung von damals gepackt.
In meinem Alter ist es tatsächlich ergiebiger, zurückzublicken und nicht nach vorne, wo nicht mehr viel wartet. Und die Vergangenheit gehört nun mal zu uns, und je weniger Zukunft man vor sich hat, je wichtiger wird diese. Und je interessanter sie war, desto besser. Man zehrt davon.
Die beiden Frauen, denen ich von meinem ersten Mordfall aus dem Jahre 1959 erzählte, sind längst wieder weg, der Kontakt abgerissen.
Ein Jahr ist seither vergangen. Die schweigende Gestalt im Speisesaal, die mit ihrem Verbrechen davongekommen war, ist verschwunden. Man sagte mir, sie sei verstorben. Ich fragte nicht nach. Damit war die Wunde geschlossen. Dort, wo sie jetzt war, würde ewige Gerechtigkeit walten.
Und bei meinem langen Spaziergang um den kleinen Weiher, der zu unserer feinen Wohnanlage gehörte, habe ich mich gefragt, welcher Fall aus der Vergangenheit mich ebenfalls so sehr beeindruckt hatte, dass ich seinen Schatten mit ins Heute nehmen wollte. Ich könnte mich auf langen Spaziergängen mit dem Schatten unterhalten. Leise. Ganz leise.
Und wenn die Leute, die mir entgegenkamen, seltsam schauten, weil die ältere Frau, nein, die alte Frau, vor sich hin murmelte, dann sollten sie eben denken, ich sei wunderlich.
Ich hatte immer dieses Sonett von William Wordsworth geliebt: Die Narzissen. (The daffodils.). Jedes englische Schulkind kennt sie und hasst sie vermutlich ebenso wie wir damals Goethegedichte gehasst hatten.
»I wandered lonely as a cloud …«, später spricht der Dichter von »the bliss of solitude« – das Entzücken an der Einsamkeit. Ja, allein spazieren gehen und dabei zurückzudenken, das kann außerordentlich wohltuend sein.
Das war der Moment, in dem ich beschloss, die Zweifel und die Fragen und die schmerzhaften Gefühle des verrückten Jahres 1967 wieder aus meinem Innersten hervorzukramen und mich zu erinnern. Auch wenn es wehtat. Denn ich hatte mich in einen Mörder verliebt.
1967 – was für ein Jahr!
Große Koalition von Kiesinger und Brandt. Schiller sprach von der Talsohle der Konjunktur, und das löste allgemeines Entsetzen aus. Es musste wirtschaftlich immer aufwärts gehen, das war wie ein Naturgesetz. Keiner zweifelte am Segen des unerschöpflichen Wachstums. Umwelt war kein Thema. Den Gedanken an Klima gab es nicht.
Kinder saßen im Laufstall, es gab noch keine Pampers, dafür aber rosa und blaue Strampelhosen.
Obwohl langsam alles freier wurde, ging es sonntags in die Kirche und später an den Familienesstisch mit Schweinebraten. In Karlsruhe wurde das zerstörte Naturkundemuseum renoviert. Es würde prachtvoll werden. So prachtvoll, wie die Stadt gewesen war, bis 1944 die Bomben auf sie regneten. Die letzten Kriegsfolgen verschwanden allmählich. Auf den Dächern wuchsen dafür unschöne Wälder aus Antennen, denn fast jeder hatte inzwischen einen Fernsehapparat. … Ach so manches fiel mir wieder ein aus diesem Jahr. Doch dann dachte ich an den gewaltsamen Tod von Rosi Baron, die eigentlich Roswitha hieß, und an die traurigen Begleitumstände der Tat.
Ich setzte mich auf mein behagliches Sofa und holte das Damals ins Heute. Eine schöne Zeit war das für mich persönlich gewesen. Ich hatte die Ernte meines Fleißes und meiner Beharrlichkeit eingefahren, aber es war auch die Zeit einer unpassenden Leidenschaft … doch dazu später. Zunächst zur Ernte.
Es war mir nämlich tatsächlich gelungen, einen Sprung in meiner Laufbahn zu machen. Im Jahr 1967 nun bei der Karlsruher Kriminalpolizei. Natürlich nicht als Kommissarin, wie ich es mir immer gewünscht hatte. Diesen Titel gab es nicht für Frauen. Erst vier Jahre später würden sie Frauen in die normalen Ränge der Kripo aufnehmen.
1967 gehörte ich noch zur sogenannten Weiblichen Kriminalpolizei und kümmerte mich um Fälle, die man uns Frauen nun mal so zutraute: entlaufene Heimkinder, Mädchen, die vom Stiefvater belästigt wurden, Ladendiebinnen und Zigeunerkinder, die nicht zur Schule gingen. Ich schmunzelte. Ja, damals hatte man Zigeuner noch Zigeuner genannt, und kein Mensch hatte sich etwas dabei gedacht. Abwertend hatte es trotzdem geklungen.
Mit Erfolg hatte ich die Beamtenprüfung abgelegt und war nun im Rang einer Inspektorin eingesetzt. Alle staunten. Meine Eltern verstanden die Welt nicht mehr.
Ich saß damals in einem Büro mit der Sekretärin des Chefs, der gestrengen Frau Meister, an einem kleinen wackeligen Holztisch in der Ecke, eine altmodische Schreibtischlampe auf meinem Tisch, einen Block und ein paar Stifte. Glamourös war das alles keinesfalls. Nicht mal ein eigenes Telefon hatte ich am Anfang. Mit meinem »Kann ich mal kurz?« ging ich Frau Meister aber so auf die Nerven, dass mir schließlich ein eigener Apparat zugeteilt wurde. Unser Chef, Wilhelm Maas, ein schwerfälliger, großer Mann mit müden Augen, glaubte mich aber ermahnen zu müssen: »Aber keine Gespräche mit der Freundin über die neueste Mode, Fräulein Hermann!«
Dabei wäre gerade das ein gutes Thema gewesen, denn wir hatten bei der Mode nur einen Gedanken, der uns anfeuerte: Nur nicht aussehen wie unsere Mütter. Kurze Röcke kamen auf, schlabbrige Pullover. Oder kurze Kleider, hochgeschlossen. Die moderne A-Linie kaschierte manch Wohlstandsbäuchlein.
Andere Gesprächsinhalte als Kleider und Frisuren schienen meine männlichen Kollegen einer Frau, die am Telefon war, aber sowieso nicht zuzutrauen. Dabei war alles in Bewegung und kamen neue Ideen auf, nur merkten wir es noch nicht.
1967. Es war der Sommer der Liebe, wo sich junge Leute neue Wege erkämpften, und es war ein heißer Sommer in den USA, wo die Rassenkrawalle eine neue Dimension erreichten. Jetzt schien auch bei uns möglich, was man vorher unter den Teppich gekehrt, wo man geschwiegen hatte. Nazi-Ärzte standen vor deutschen Gerichten, und Mick Jagger zeigte den Stinkefinger als Schockfigur der Älteren. Eine Zeit im Aufbruch.
Vieles hatte sich geändert, aber das meiste war geblieben. Denn die Menschen brauchen länger als die Umstände, und meine Kollegen hier in Karlsruhe waren fast alle in den 30ern geboren. Hitlerzeit. Muss man mehr sagen?
Und natürlich war ich in den Augen der Abteilung zum Kaffeekochen geboren. Frau Meister delegierte diese ewige Frauenaufgabe gerne an mich, die Jüngere, und ich versah sie mit trotzigem Protest. Wir schrieben Ende Mai des Jahres 1967 – und ich sehnte mich nach mehr Bedeutung im Leben.
Es gab nämlich neue Stimmen mit weiblichem Klang. Romy Schneider hatte Deutschland längst verlassen und lebte ein skandalöses Leben in Frankreich. Nicht dass wir nicht alle gerne in den Armen dieses ungeheuer gut aussehenden Alain Delon gelegen hätten. Gitte und Katja Ebstein sangen Lieder, die sich nicht nur um Männer und Herzschmerz drehten, so wie auch Alexandra, die von einem Baum als Freund sang und das Lied eines Zigeunerjungen erklingen ließ. Die niedliche Uschi Glas, die in dem »Unheimlichen Mönch« toll aussah und von der wir hofften, man würde noch mehr sehen, war auf dem Sprung zu einer Karriere. Janis Joplin in Amerika bekannte, dass sie Nigger nicht hasste und deshalb wohl anders sei als die Masse. Womit sie offenbar recht hatte. Die kecke June Carter tourte mit Johnny Cash, doch weigerte sich, ihn zu heiraten, solange er drogenabhängig war. Eine starke Frau mit einem eigenen Willen, fürwahr.
Vieles hatte sich geändert seit 1959, auch in Deutschland, auch in Karlsruhe. Und vieles hatte sich nicht geändert. Das Land war unruhiger geworden, alte Regeln galten nicht mehr automatisch. Es wurde gefragt, es wurde widersprochen.
Muss ich erwähnen, dass man bei uns, der Polizei, dies beklagte? Ich konnte nicht zählen, wie viele Anrufe bei uns eingingen, dass Gruppen von »Bärtigen« auf den heiligen Rasenflächen vor dem Schloss herumlungerten. Gammelten vielmehr. Ja, es waren Gammler. Ein Unwort für diejenigen, die nach dem Krieg die Ärmel hochgekrempelt hatten.
Alles, nein nicht alles, aber vieles hatte begonnen an dem Tag, als 1967 Benno Ohnesorg in Berlin starb. Ich hatte die Bilder im Fernsehen bei meinen Eltern gesehen. Die Demonstrationen gegen den Schah, der zu Hause foltern ließ, und wie sie ihn eilig wegtrugen, den Studenten, den die Polizei erschossen hatte. »Was hätten die Kollegen machen sollen, wenn die Situation aus dem Ruder geriet. Mein Gott, der Mann wollte sich doch nur die Zauberflöte anschauen. Und er sah insgesamt doch sehr nett aus.«
Im Jahr 1967 gab es nämlich eine Menge junger Männer, die in den Augen meiner Eltern nicht nett waren. Die Welt war unberechenbar geworden. Die Autoritäten wackelten.
Das hatte schon damit angefangen, dass seit 1966 die SPD mitregierte. »Vaterlandsverräter an der Macht«, schimpfte mein Vater, der lebenslang für die CDU gewesen war und Kiesinger ordentlich und tüchtig fand. Willy Brandt war für ihn der Kerl »alias Frahm«! Junge Männer trugen lange Haare und Parkas, die ungepflegt wirkten, Cordjackets und Cordhosen, und die Mädchen waren nicht von ihnen zu unterscheiden, außer wenn sie Miniröcke, Kniestrümpfe und Schuhe mit Blockabsatz trugen, was die Sache nicht besser machte.
Seit dem Mord an Benno Ohnesorg war die Welt in Aufruhr. Und schien sich nicht mehr zu beruhigen. Diesen Tod wollte man nicht einfach so hinnehmen. Es musste sich etwas ändern.
Ich lehnte mich in meinen Sessel, und meine Gedanken wanderten durch die Jahrzehnte und landeten wieder in dem lichten milden Mai des Jahres 1967, als Benno Ohnesorg nur noch wenige Tage zu leben hatte, als ich das erste Mal in die Kommune kam und das erste Mal Rosi begegnete, die so strahlend wie ein Stern war und von der ich nicht wusste, dass sie bald verglühen würde.
Ihr gegenüber hatte ich mich wie ein kleines Mädchen gefühlt. Naiv und spießig. Obwohl das Jahr 1967 für mich persönlich ganz gut begonnen hatte.
Unter den skeptischen Augen meiner Eltern und denen einer kleinen, energischen Vermieterin, der Witwe Bahn, hatte ich im November 1966 den Vertrag für meine erste eigene Wohnung unterschrieben. Das war durchaus nicht selbstverständlich. Zwar hatte sich seit 1959 vieles geändert und vieles war freier geworden, aber noch immer betrachteten Vermieter alleinlebende Frauen mit Misstrauen. Doch die Tatsache, dass ich bei der Polizei war, hatte ein bisschen geholfen, auch wenn Frau Bahn beharrlich der Meinung war, dass ich nur so eine Art weibliche Schutzpolizistin war.
»Bei der Kripo?«, fragte sie in Richtung meiner Mutter, die natürlich bei der Unterschriftenaktion dabei war. So als sei ich noch sehr jung. »Also, das würde ich meiner Tochter nicht erlauben. Die Welt ist doch ganz durcheinander. Seit sie auf den Straßen Krawalle machen. Die Langhaarigen und die Beatniks. Was wollen die eigentlich? Sollen sie doch rübergehen, in die Zone, wenn es da besser ist.«
»Ich glaube«, sagte ich, obwohl ich wusste, dass mich das meine Wohnung kosten konnte, »die jungen Leute wollen nur ein anderes Deutschland. Offener. Und sie sind für Demokratie, die alle Menschen erreicht. Auch in Persien. Sie wollen auf die Zustände in Persien aufmerksam machen.«
»Aufmerksam macht man nicht mit Steinen, Eiern und mit Farbbeuteln und … wie nennen sie das … Sit-ins. Was soll denn das sein? Das hätte es früher nicht gegeben.«
Das stimmt, dachte ich. Das hätte es früher nicht gegeben.
Mit Hilfe eines Kegelfreundes meines Vaters und dessen Sohn Matthias hatte ich die Wohnung renoviert, hatte einige Möbel von zu Hause mitgenommen, aber auch etliches neu gekauft. Die hellen Kiefernholzmöbel, vor allem in dem Zimmer, das zum Schlafzimmer bestimmt war, erfreuten mein Auge. In dem dunklen Zeug meiner Eltern hätte ich nicht begraben sein wollen.
»Ob sich das alles lohnt«, hoffte meine Mutter immer wieder seufzend, »denn irgendwann wirst du ja wohl doch noch heiraten.« Wenn ich mit jemandem ausging, kam immer dieses neugierige: »Und ist er nett?« Stumm klang immer die Hoffnung mit, es wäre kein Ausländer.
Dieser Glaubenssatz vom Sowieso-Heiraten klang aber von Jahr zu Jahr schwächer, denn ich näherte mich der Altersgrenze für junge Bräute. Ich war nun 27 Jahre alt. Alle meine Schulkameradinnen waren verheiratet, nahezu alle bereits Mütter. Sogar mein Bruder hatte vor einem Jahr am Traualtar seiner Petra ewige Liebe und Treue geschworen. Das ersehnte Enkelkind ließ noch auf sich warten, doch immerhin war er verheiratet, und das war schon mal der erste richtige Schritt. Tief im Innern war mein Vater vielleicht später ganz froh, dass ich ausgezogen war. Zwei erwachsene Frauen an einem Herd, das klappt nicht. Aus seiner Sicht war ich aber unkontrollierbar geworden.
In jenem aufregenden Frühjahr wohnte ich also im obersten Stock des Mietshauses in der Oststadt, in der langen, von soliden mehrstöckigen Bürgerhäusern gesäumten Gerwigstraße. Direkt vor meinem Fenster würden im Frühjahr Kastanien blühen und Vögel zwitschern. Nach hinten hinaus verfügte ich über einen winzigen Küchenbalkon, der sich wie angeklebt halsbrecherisch an die Hauswand klammerte.
Das obere Stockwerk war in vier kleine Wohnungen aufgeteilt. Rechts wohnte eine alte Frau, Hetti Janosch, die irgendwie den Krieg überlebt hatte. »Die hat Glück gehabt, dass sie sie nicht geholt haben«, raunte Frau Bahn, ohne dieses Glück und den Grund dafür näher zu beschreiben. Die zweite Wohnung rechts gehörte einem jungen Mann, einem Handelsvertreter, der nicht oft da war. Direkt neben mir lebte Sonja Lauber, die sich selbst »Sonnie« nannte.
Sonnie war noch ganz jung, 18 Jahre alt, hübsch, mit dunklen Locken, ebensolchen Augen und einer leicht getönten Haut. Sie war sehr attraktiv und träumte von einer Karriere als Popsängerin oder Fotomodell. Mehrfach bereits hatte sie ihr Bild zur Redaktion der BRAVO geschickt. Sie hatte natürlich auch die BRAVO abonniert und saß oft bei mir in der Küche, die Beine hochgezogen, eine Zigarette im Mundwinkel und las das aktuelle Heft. Es schien ihr mehr Spaß zu machen, wenn ich dabei war, wenn irgendjemand dabei war, mit dem sie ihre Freude an dem Blättchen teilen konnte. Mir war das auch nicht unlieb, denn auf diese Weise hatte ich Kontakt zu den Leuten, die jünger waren als ich und vielleicht nicht ganz so eingespannt waren in ein System von Recht und Ordnung wie ich.
»Das passt mir nicht«, hatte meine Mutter allerdings mir gegenüber später geäußert, nachdem sie die junge Frau bei einem Besuch kühl von der Seite gemustert hatte. »Das ist ein Mischling. Ein Besatzungskind.«
Natürlich kannten wir alle den Ausdruck. Besatzungskind. Das war etwas Peinliches. Ein Kind von einem Besatzer. Und noch dazu von einem farbigen Besatzer. Wie konnte man denn so tief sinken? Und dann nicht mal aufgepasst, dass nichts passierte. Diese Schande sah man dem Kind immer und überall an. Lebenslang sozusagen. Wo sollte es denn hin? Nach Amerika, wo die Schwarzen durch diesen wortgewaltigen Prediger von sich reden machten? Besser war es dort für so ein Kind auch nicht.
Sonnie allerdings fand sich selbst offenbar überhaupt nicht peinlich.
Sie schüttelte ihre Haarpracht. »Was kann ich denn dafür? Ich weiß nicht genau, wer mein Vater ist. Es waren zwei Männer, mit denen Mama eine Liebschaft hatte. Gleichzeitig. Das heißt, sie betrog den einen mit dem anderen, und beide betrogen wahrscheinlich ihre Frauen. Für Zigaretten und Nylonstrümpfe und für die Hoffnung, dass einer von denen sie heiratete und mit nach Amerika nehmen würde. Doch sie sind beide abkommandiert worden und haben nie wieder etwas von sich hören lassen.«
Sonnie war nicht klassisch schön, aber nun mal exotisch-attraktiv, und als wir dann vertrauter waren, erzählte sie mir, dass die Firma Quelle sie gefragt habe, ob sie für den neuen Katalog im Bereich Tiefkühlkost als Modell auftreten wollte. »Nicht heiß, sondern kalt«, sagte sie, »soll das Motto sein. Warum soll ich das nicht machen. Besser mit einer Packung gekühlte Erbsen schmusen als mit einem Typen am sogenannten Strand, den sie da im Studio aufbauen.«
Ich jedenfalls genoss meine Wohnung und die neue Freiheit. Niemals hätte meine Mutter mir erlaubt, nachts noch eine Dose mit den beliebten Ravioli in Tomatensoße aufzumachen oder Radio so lange zu hören, bis feierlich die Nationalhymne um Mitternacht erklang. Von meinem nächsten Gehalt würde ich mir einen Fernseher anschaffen. Als Kriminalbeamtin musste ich doch wissen, was los war in der Welt. Die Welt war nämlich größer und bunter, wenn man einen Fernseher hatte. Auch wenn seine Bilder in Schwarz und in Weiß flimmerten. Natürlich hatten sie auch im Radio berichtet von den Überschwemmungen in einem Landstrich namens Bahia in Brasilien. Viele Menschen waren gestorben, 50.000 obdachlos geworden. Und noch mehr passierte. Da gab es einen gut aussehenden Arzt in Südafrika …
»Der hat«, wisperte mir Frau Meister heute Morgen zu, »ein menschliches Herz verpflanzt. Einem Zahnarzt, der schon 58 war. Und zwar das Herz von einem Schwarzen. Würdest du das wollen, Viktoria?«
»Weiß ich nicht«, erwiderte ich wahrheitsgemäß. »Ist doch besser als sterben, oder? Hat ein Herz eine bestimmte Farbe?«
Es war Ende Mai 1967, und die Männer in unserer Abteilung hatten sowieso andere Interessen. Sie beugten sich über die BILD-Zeitung und waren stolz. Rudi Altig, der auch noch ein Badener war, zumindest lebte er in Mannheim, das ja eigentlich zu Baden gehörte, oder zumindest war er kein Schwabe – der machte Furore als Radrennfahrer.
»Von dem hören wir noch einiges!«, mutmaßte Peter Patzer, der neue Kriminalassistent, der eigentlich auf der gleichen Stufe stand wie ich. Ich fand ihn etwas frech. Außer ihm gab es noch den Chef und zwei andere Männer. Ralf Blume, der ehrgeizig und strebsam war, und den stets zur Ironie neigenden Stefan Pepperkorn. Beide waren um die 40, verheiratet und insgesamt eher langweilig.
Ich schaute kurz durch die Badischen Neuesten Nachrichten, die auf dem Konferenztisch im Büro des Chefs lagen. Wir hatten gleich morgendliche Lagebesprechung. Vorne auf den BNN war ein Mann zu sehen, der gerade einen Sternenregen losließ, um zu feiern. Was das wohl für ein Sommer werden würde? Die Unruhen im Zusammenhang mit dem Schahbesuch würden ja hoffentlich abflauen.
»Kommst du mit ins Kino?«, wisperte mir Peter zu. »Es gibt Caprice mit Doris Day.«
Unser Bürolehrling Waltraud, 17 Jahre alt, war dafür zuständig, Papier und gespitzte Bleistifte bereitzulegen.
Sie zwitscherte: »Ich gehe heute Abend in die Tenne. Der Discjockey Dieter Beck legt Beatplatten auf. Knorke.«
»Ruhe jetzt mal, Herrschaften!«, rief unser Chef Wilhelm Maas. »Wir hatten einen Einbruch letzte Nacht. Radiogeschäft Müller in der Sophienstraße 35. Die Kollegen waren vor Ort und haben alles aufgenommen. Da sollte mal einer vorbeigehen. Sich bisschen umhören. Haben die einen Mitarbeiter entlassen in letzter Zeit, der sich rächen will, waren Bettler vor dem Laden. Also, Routine. Ralf, machst du das?«
»Okay, wird erledigt.«
»Kann ich mit?«, erkundigte ich mich.
Wilhelm Maas blätterte in seinen Unterlagen. »Nee, Kleene. Du gehst mit Pepperkorn in die Jollystraße. Da sind Beschwerden gekommen. Der dortige Hausmeister hat angerufen. Da wohnt doch die Kommune!«
Jeder bei uns im Dezernat kannte den Begriff »Kommune«, wie man neuerdings das skandalumwitterte Zusammenleben von jüngeren Leuten verschiedenen Geschlechts nannte, die keine Trauscheine aufzuweisen hatten. Vor etwa einem halben Jahr hatte sich in Berlin die Kommune 1 gegründet, und die BILD-Zeitung schlachtete immer wieder genüsslich deren wildes Liebesleben aus. Entstanden war sie aus Leuten der APO und der Studentenbewegung, die von jemandem wie mir staunend betrachtet wurde. Sie seien leidenschaftlich an sich selbst und ihrem Bewusstsein interessiert und scherten sich keinen Deut um die Werte der deutschen Kleinfamilie. Einer der Bewohner hieß Rainer Langhans, und es wurde gemunkelt, bald würden ein ganz verrückter Typ namens Fritz Teufel sowie eine bisher unbekannte Schönheit namens Uschi Obermeier dort einziehen. Die beiden waren schon im Visier der Presse, die sich bereits die Finger leckte, was da an Unmoralischem alles geschehen würde. Noch war Uschi nicht eingezogen. Es sollte bis zu ihrem Einzug allerdings noch ein wenig Zeit vergehen.
So, und nun hatten wir eben auch unsere Karlsruher Kommune. Eigentlich hatte sich die linke und unkonventionell lebende Szene im Stadtteil Durlach angesiedelt, wo es immer mal wieder Beschwerden gab. Doch die Kommune KA 1 in der Jollystraße hatte bisher keinen Ärger gemacht. Normalerweise wäre ihre Existenz vielleicht gar nicht aufgefallen, denn was ist schon Skandalöses an ein paar Studenten, die sich eine Wohnung teilen.
Doch die Jollystraßen-Kommune hatte ein Bettlaken aus dem Fenster gehängt, auf dem Badens Antwort auf Berlin. KA 1 in Karlsruhe. Make love not war stand. Das hatte die Leute sofort aufgescheucht, auch wenn der Slogan mit dem »Liebe-Machen« sogar für 1967 nicht mehr besonders originell war. Aber wir waren halt immer noch Provinz.
Die Kommune KA 1 lag in einem der bürgerlichen Wohnviertel der Stadt. Das ließ darauf schließen, dass es zumindest einen Geldhahn geben musste, der wenigstens tröpfelte, wenn nicht sogar lief. Regelmäßige Mietzahlungen waren heilig in den 60er-Jahren. Die Kommune KA 1 wurde beobachtet, es gab eine schmale Akte über sie. Wir wussten, dass sie aus fünf Personen bestand, zwei Frauen und drei Männern.
»Was denn für Beschwerden?« Pepperkorns Gesicht verzog sich genüsslich.
Maas, der schon um die 60 war, betrachtete den jungen Kollegen ohne viel Sympathie. Er war während der Hitlerzeit im Exil in Norwegen gewesen. Als Sozialdemokrat. Versteckt. Deutsche hatten ihn dort ins Visier genommen. Ganz zum Schluss noch. 1944 im Herbst. Was genau passiert war, hatte er nie erzählt. Dort war ihm jedenfalls zwar nicht das Leben, aber offenbar eine Art Grundvertrauen in die Menschheit abhandengekommen. Abgesehen von guter Laune und Humor.
»Es ist uns eine Anzeige zugelaufen. Wie gesagt, von dem Hausmeister, einem Herrn Rainer Kiesewetter. Jollystraße, ja? Eine Minderjährige soll sich in der Kommune aufhalten. Da sollten wir mal reinschauen. Nicht, dass da was passiert. Die Bevölkerung schaut uns auf die Finger. Wir sind hier in Baden und nicht in Berlin.«
»Sollen wir da nicht lieber die Sitte hinschicken?«, erkundigte sich Ralf Blume, der stets Eifrige. Sollte der doch lieber zu seinem Radioladen fahren.
Maas schüttelte den Kopf. »Mal langsam mit den jungen Pferden. Noch ist ja nichts passiert, was die Sitte betrifft. Pepperkorn, schaut euch den Laden einfach mal an. Nimm unser Fräulein Hermann mit, damit wir bei dem jungen Dämchen auf der sicheren Seite sind. Aber pass auf, dass unser Küken nicht auf dumme Gedanken kommt, wenn sie das Treiben da sieht. Eine Ehe mit einem ordentlichen Mann und ein paar Kinder sind immer noch das, was sich gehört.«
Und so was will Sozi gewesen sein.
In unserem Dienst-Opel Kadett fuhren wir Richtung Südweststadt. Eher selten hatten wir Aufträge in diesem bürgerlichen Viertel. Oft führten uns Anrufe stattdessen ins sogenannte Dörfle. Damals noch nicht saniert, wirkte dieser Haufen kleiner schiefer Häuser, zwischen denen Wäscheleinen gespannt waren, wie ein Stück Italien.
Wir warteten an einer Ampel. Die Autoflut schien jedes Jahr anzuschwellen, vor den Ampeln bildeten sich Schlangen. Parkplätze waren rar, aber nicht unauffindbar. Sie kosteten nichts.
Das sogenannte Sonntagsplätzchen in Karlsruhe ist ein besonders schöner Platz. Umrahmt von hohen Bürgerhäusern, die man Stück für Stück restaurierte und damit die letzten Spuren des Krieges tilgte. Traditionell war das Viertel, das man Südweststadt nannte, ein eher gehobenes Viertel. Richter und Justizangestellte, aber auch Beamte fühlten sich hier wohl. Ob es eines Tages hohe Richterinnen geben würde? Manchmal dachte ich, vielleicht könnte ich weiterkommen im Leben, wenn ich mehr hätte lernen können. Seit Anfang des Jahres gab es im Bayerischen Rundfunk das sogenannte Telekolleg, mit dessen Hilfe man die Fachhochschulreife nachmachen konnte. Mal sehen.
Die Adresse, um die es ging, gehörte zu einem eher kleineren Haus, das den Krieg ganz gut überstanden hatte. Drei Stockwerke. Es lag an einer Stelle der Straße, in der es ziemlich eng zuging. Zwei Häuser weiter vorne war eine kleine Bäckerei mit einem Café. Überall in der Straße standen im Moment Bagger und waren Bauzäune errichtet, denn es wurde in der ganzen Stadt eifrig gebaut und renoviert und der Straßenbelag ausgetauscht.
Pepperkorn versteckte sich hinter einem der großen Bagger mit nebenstehendem kleinen Bauhäuschen. Ich drehte mich um, suchte ihn, er rief: »Huhu, Vicky!« und kam dahinter vor. So was Albernes. Nur weil ich eine junge Frau war, veranstaltete er solchen Unsinn. Später sollte ich an diese Szene denken. Sehr viel später. Jetzt tippte ich mir erst mal an die Stirn.
Da war sie, die Nummer 13. Direkt gegenüber befand sich ein ähnlich aussehendes Gebäude, in dem unten eine Wäscherei war, die momentan umgebaut wurde und leer stand. Darüber musste wohl eine Wohnung sein. Der Balkon sah gemütlich aus und war schön begrünt. Ein Stuhl und ein Tisch sowie ein älterer Mann, der hinausschaute, gehörten zum Inventar. Die Wohnung darüber wirkte unbewohnt, die Läden waren unten.
Auf der Straße vor dem Haus, das uns interessierte, wartete bereits der Hausmeister. Ein Typ, den ich persönlich nicht besonders sympathisch fand. Rotes Gesicht, vierschrötig, noch nicht wirklich alt, höchstens Mitte 20. Auf seinem Gesicht lag ein unschön lauernder Gesichtsausdruck.
»Also, da muss mal eingeschritten werden. Da geht es zu wie Sodom und Gomorrha. Und solange die unter sich bleiben, sagt man ja nichts. Heutzutage darf man ja sowieso nichts mehr sagen. Ist man gleich ein Rechter. Diese Blonde, also diese Blonde, die hätte man früher ganz was anderes genannt. Studentin! Läuft halbnackt herum. Wenn der Herr Früh im Haus gegenüber nicht so ein alter Herr wäre, könnte der mit dem Fernglas jeden Zentimeter von der sehen.«
Kiesewetter wandte sich um und deutete auf das Haus gegenüber und auf den gemütlichen Balkon. Verächtlich: »Die hören Musik, die sich anhört wie die Tiere im Zoo. Was die studiert, möchte ich wissen … aber jetzt ist so ein halbes Kind da oben. Wenn das meine Tochter wäre … Dies hier war mal eine anständige badische Stadt.«
Ich hörte mir an, was der Mann zu sagen hatte. Seine Augen schillerten, wenn er von der Blonden sprach. Halbnackte Frauen? Sollte er doch weggucken, wenn es ihn störte, aber ich wettete, er stünde selbst nur zu gerne hinter dem Vorhang, wenn die am Fenster auftauchte. Die neuen jungen Frauen in hohen Stiefeln und kurzen Röcken weckten auch Begehrlichkeiten. Wir hatten dieses Jahr bis Juni schon mehr Vergewaltigungen gehabt als im ganzen vergangenen Jahr. Und noch immer kamen die Kerle viel zu gut davon, weil die Betonköpfe von Richtern augenzwinkerndes Verständnis zeigten.
»Dann wollen wir mal sehen!«