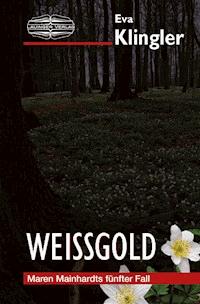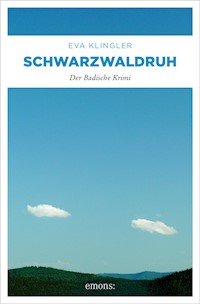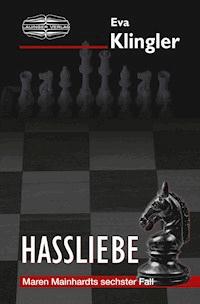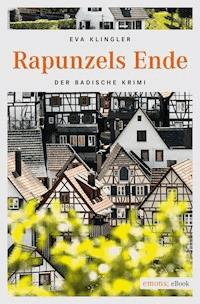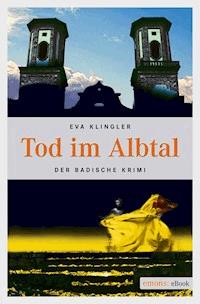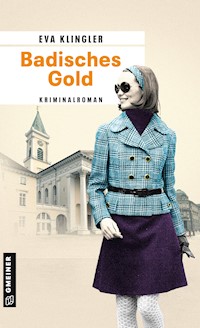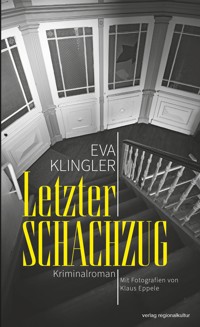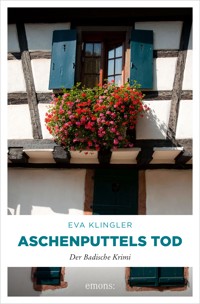7,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 7,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 7,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: hansanord Verlag
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Deutsch
Mord in der „Residenz des Rechts!
„Karlsruhe hat entschieden“.
Oft fällt dieser Satz, wenn die obersten Gerichte Deutschlands ein umstrittenes Urteil gefällt haben. Doch auch in Karlsruhe, der beschaulichen Stadt im Südwesten, wird profan gemordet! In diesem Buch sind vierzehn spektakuläre Fälle aus 150 Jahren vereint, die vor einem Karlsruher Schwurgericht verhandelt wurden. Dabei reicht die Bandbreite vom Mord aus verletzter Ehre, über eine Amokfahrt und ein Sexualverbrechen bis zu einem Mordprozess ohne Leiche.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 260
Veröffentlichungsjahr: 2021
Ähnliche
Eva Klingler, Wolfgang Wegner
Täter, Opfer, schwarze Roben
über die Autoren
Eva Klingler, gebürtige Oberhessin aus Gießen, ist in Mannheim aufgewachsen und hat dort auch studiert. Es schloss sich das Referendariat an, dann absolvierte sie in Baden- Baden beim SWF (heute SWR) ein Volontariat. Von Zeitungsjournalistin über Sprachlehrerin an der eigenen Sprachschule, von Bibliotheksleiterin über Ladeninhaberin – Eva Klingler hat viel gemacht. Eines hat sie nie aus den Augen verloren – das Schreiben. Über 40 Bücher: Satiren, Krimis, Romane und Sachbücher. Heute lebt sie mit ihrem Mann in Karlsruhe.
Dr. Wolfgang Wegner, Jahrgang 1965, studierte Germanistik und Politische Wissenschaft und ist seit über zwanzig Jahren als Germanist und Dozent für Deutsch als Fremdsprache tätig. Bücher und Geschichten waren schon immer seine Leidenschaft, bereits als Jugendlicher verschlang er einen Wälzer nach dem anderen. Im Laufe der Zeit veröffentlichte Wolfgang Wegner Bücher unterschiedlicher Genres von wissenschaftlichen Arbeiten bis zum Kinderbuch und Kriminalroman. Darüber hinaus ist Wolfgang Wegner als Kultur- und Medienschaffender aktiv, u.a. mit einem YouTube-Kanal zum Mittelalter und unterschiedlichen Kultur-Events. Mehr zu Wolfgang Wegner finden Sie unter: www.wolfgang-wegner.com
Impressum
Inhalt
Vorwort
Recht gesprochen wurde und wird überall in Deutschland. „Im Namen des Volkes“ ergehen täglich Urteile in der Republik, überall setzen Richter ihr Barett auf und lassen Milde walten oder ahnden mit der ganzen Härte der Paragrafen.
Warum also haben wir Fälle aus Karlsruhe ausgewählt? Nun, keine Stadt in Deutschland verbindet man so sehr mit dem Recht wie die sogenannte Fächerstadt im Südwesten. Die höchsten Gerichte, gegen deren Urteil kein Widerspruch möglich ist, regeln hier unser Zusammenleben und bilden die letzte Instanz.
Spektakulär sind die Entscheidungen, die heute regelmäßig von Reportern kommentiert werden – und unbequem für die Politik oft die Urteile, die von den Männern und Frauen in schwarzen oder roten Roben gefällt werden.
Bevor Karlsruhe die „Residenz des Rechts“ und somit zu einer Art „Gerichtshauptstadt“ Deutschlands wurde, war es eine mittelgroße und mittelmächtige badische Residenzstadt, die sich einer gewissen Toleranz und französischer Atmosphäre erfreute. Allerdings galt sie auch als langweilig und friedlich. Ein Irrtum, wie wir im Verlauf unserer Recherchen erfuhren.
Denn auch in Karlsruhe lauerten über die Jahrhunderte hinweg Verbrecher ihren Opfern auf. Hier unterschied sich die heutige Stadt der höchsten Gerichte in keiner Weise von anderen Städten. Auch nicht von Ihrer, verehrter Leser.
Die Motive, die Leidenschaft und die Verirrungen, die zum schlimmsten Verbrechen der Menschheit führten, dem Mord, existierten hier genau wie überall und wurden geahn-det wie überall.
Keineswegs immer waren es Asoziale, die in der Beamtenstadt zur Waffe griffen. Erstaunlich oft trafen wir auch den gutsituierten Mörder an, dessen Motive vielleicht noch mehr erschauern lassen, weil sie so unverständlich erscheinen in ihrer egozentrischen Gemeinheit sind.
Tödliches Ehrgefühl
Der Fall Brüsewitz ist unser „ältester“ Fall. Er geht zurück in die Zeiten, in denen es noch das berühmte „Oben und Unten“ gab: als Justitias Augen noch nicht verbunden waren und bestimmte Kreise mit arroganten Verbrechen davonkommen konnten.
Auch heute noch wirken die Kasernengebäude aus dunkelrotem Backstein imposant und einschüchternd, auch wenn sie schon lange nur noch zivilen Zwecken dienen. Wir spazieren über die große rechteckige Freifläche, die von den Gebäuden umrahmt wird. Immer wieder betrachten wir die alten Fotos, die wir uns besorgt haben. Sie zeigen den militärischen Alltag im Deutschen Kaiserreich. Man braucht nur ein wenig Fantasie, um sich ins letzte Jahrzehnt des 19. Jahrhunderts zurückzuversetzen: Die Kaserne des Badischen Leibgrenadier-Regiments Nr. 109 ist nun erfüllt von gebrüllten Befehlen, dem festen Tritt Hunderter marschierender Stiefel und dem Trampeln beschlagener Hufe auf staubigem Boden. Inmitten dieses Treibens steht er: Premierleutnant Henning von Brüsewitz. Stolzer Offizier in einem Rang, der dem eines heutigen Oberleutnants entspricht.
Er entstammte einem alten mecklenburgischen Adelsgeschlecht, das sich nach Pommern, Schlesien und Preußen ausgebreitet hatte und auf das er durchaus stolz sein konnte. Wie in diesen Familien üblich, waren bereits etliche hochdekorierte Militärs aus ihr hervorgegangen, so wie Karl Friedrich von Brüsewitz, der bis zum Generalleutnant der Preußischen Armee aufgestiegen war. Der Hauptakteur dieser Geschichte, Henning von Brüsewitz, repräsentierte den pommerschen Zweig. Er erblickte am 1. August 1862 in Bandesow (heute der polnische Ort Będzieszewo) in Hinterpommern nahe der Ostsee das Licht einer Welt, die von gesellschaftlichen Hierarchien und der Macht des adligen Junkertums geprägt war. Schon von Kind an wird ihm jener Standesdünkel eingetrichtert worden sein, der später zu einem Sargnagel der ersten deutschen Demokratie wurde.
Henning von Brüsewitz trat 1883 als Freiwilliger in das 1. Badische Leib-Grenadier-Regiment Nr. 109 ein, wurde ein Jahr später Leutnant und 1893 zum Premierleutnant befördert. Man mag sich fragen, warum ein Preuße in einer badischen Einheit diente. 1870 hatte das Großherzogtum Baden per Vertrag zugestimmt, dass seine Armee als Kontingent in der Preußischen Armee aufging. Durch diese Eingliederung erhielt das Regiment die Nummer 109 und war nunmehr eine preußische Einheit, in der auch der acht Jahre ältere Bruder unseres Premierleutnants seine militärische Laufbahn begonnen hatte. Stationiert war das Regiment in der gerade neu errichteten imposanten Kaserne in der Karlsruher Moltkestraße.
Wichtig für die Beurteilung der folgenden Ereignisse ist das hervorgehobene Ansehen des Leib-Grenadier-Regiments, dessen Kommandeur nach wie vor der Großherzog höchstpersönlich war und das als besondere Auszeichnung die Schlosswache stellen durfte. Die Offiziersränge waren gegen Ende des 19. Jahrhunderts – anders als in der Anfangszeit der Einheit – fast ausschließlich mit Adligen besetzt.
Henning von Brüsewitz verkörperte mit seiner Herkunft und seiner Uniform die beiden wichtigsten gesellschaftlichen Schichten des Kaiserreichs: Adeliger und Berufsoffizier. Diesem doppelten Standesdünkel entsprechend, zeigt ihn eine Fotografie mit harten Gesichtszügen, akkuratem Mittelscheitel und gezwirbeltem Kaiser-Wilhelm-Bart. Der 34-jährige Offizier gleicht darin vielen seiner Standes- und Berufsgenossen.
Am späten Abend des 11. Oktober 1896, es war ein Sonntag, saß Premierleutnant von Brüsewitz zusammen mit einem Bekannten in einem Lokal im Erdgeschoss des Hotels „Tannhäuser“, eines wuchtig-großen quadratischen Baus mit drei Stockwerken, der die südwestliche Ecke von Karl-und Kaiserstraße dominierte. Zu beiden Straßen hin gab es Eingänge in das „Wiener Café-Restaurant 1. Ranges“, wie sich das Lokal im Erdgeschoss auf Werbepostkarten selbst bezeichnete, das über mehrere Gasträume verfügte.
Auch zu vorgerückter Stunde war das Lokal noch immer gut besucht. Man wollte das Wochenende verlängern, so gut es ging. Der nächste Morgen würde alle Gäste wieder mit ihrem oftmals tristen Alltag konfrontieren.
Wir können uns gut vorstellen, wie Henning von Brüsewitz an einem der Tische in angeregter Unterhaltung mit seinem Bekannten sitzt und mit kräftiger, das Befehlen gewohnter Stimme den hohen Geräuschpegel durchdringt. Sein Begleiter hat es da schwerer, denn er ist kein Angehöriger der Preußischen Armee. Der 24-jährige Roderich von Jung-Stilling studierte Jura, ohne diesen Beruf später jemals auszuüben. Vielmehr trat er unter dem Namen Richard Starnburg als Schauspieler in mehreren Stummfilmen auf. Doch er kam ebenfalls aus einer angesehenen Familie: Sein Urgroßvater war der Augenarzt und Schriftsteller Johann Heinrich Jung, der sich selbst den Beinamen „Stilling“ gab und so die Familie Jung-Stilling begründete. Roderichs Vater war Friedrich von Jung-Stilling, Leiter des Statistischen Büros der Livländischen Ritterschaft in Riga. Dort wurde Roderich geboren und auch er trug wohl eine althergebrachte Vorstellung von Standesgrenzen und gesellschaftlicher Hierarchie in sich. Woher sich die beiden ungleichen Männer kannten, weiß man heute nicht mehr. Es ist für unsere Geschichte nicht weiter von Bedeutung.
Das Unheil nahm gegen 23.30 Uhr seinen Lauf, als sich eine der Türen öffnete und Theodor Siepmann zusammen mit einem Freund und zwei Damen den größten Gastraum betrat. Auch dem am 27. August 1865 in Altendorf bei Essen geborenen Siepmann war das Wesen des Militärs nicht fremd, ein Umstand, der für die Beurteilung des Folgenden nicht unwesentlich ist. Der Sohn eines Gastwirtsehepaars war nach seinem Militärdienst als Reservist zum Unteroffizier befördert worden. Um das Jahr 1891 herum wird er nach Karlsruhe gekommen sein. Zunächst hatte er bei der Deutschen Metallpatronenfabrik gearbeitet, dann als Mechaniker bei der Nähmaschinenfabrik „Junker & Ruh“, die gerade ihren großen Aufschwung erlebte.
Die Freunde steuerten voller Vorfreude auf ein Glas Wein oder ein kühles Bier einen freien Tisch an. Sie beachteten die beiden Herren am Nachbartisch, den Offizier und den Studenten, nicht weiter. Warum sollten sie auch?
Theodor Siepmann stieß beim Hinsetzen mit seinem Stuhl gegen den des Premierleutnants. Die Zeitungen der Badischen Hauptstadt berichteten später ausführlich über das auf den ersten Blick unbedeutende Ereignis. In der Beurteilung lagen sie dabei jedoch weit auseinander. Hierzu muss man wissen, dass es in Karlsruhe, wie in den anderen größeren Städten im Deutschen Reich, zu jener Zeit mehr als nur eine Tageszeitung gab. Die Leser konnten zwischen sieben Blättern wählen, vom linksliberalen „Badischen Landesboten“ über die konservative „Badische Landpost“ bis zur „Badischen Presse“ als Generalanzeiger für Residenz und Großherzogtum Baden. Je nach politischer Ausrichtung war das kleine Anrempeln für die Redakteure ein Versehen, das Siepmann gar nicht bemerkte, oder eine bewusste Provokation des Arbeiters gegenüber einem adligen Offizier.
Statt die Sache einfach auf sich beruhen zu lassen, verlangte der Offizier nach dem Wirt des Lokals, Josef Kritsch, um sich bei ihm über das flegelhafte Benehmen des Gastes am Nebentisch zu beschweren. Siepmann jedoch verbat sich dieses herablassende Verhalten des Offiziers und ging mit dem Wirt kurz in ein anderes Gastzimmer, um den Vorfall aus seiner Sicht zu schildern. Im sicheren Gefühl, die Sache geklärt zu haben, kehrte er zu seinen Bekannten zurück.
Etwa 20 Minuten herrschte Frieden, dann forderte von Brüsewitz erneut lautstark eine Entschuldigung von Siepmann, da er habe seine soldatische Ehre gekränkt habe. Ein solches Verhalten lässt auf ein gerüttelt Maß Alkohol im Blut des Premierleutnants schließen. Siepmann konterte: „Keine Antwort ist auch eine Antwort.“ Und mit diesem Satz eskalierte die Situation. Von Brüsewitz wollte den Säbel ziehen, doch der Wirt und ein aufmerksamer Kellner konnten das verhindern. „Ich bin in meiner Ehre tödlich verletzt, nun kann ich den Dienst quittieren!“ Mit diesen Worten zitiert die „Berliner Illustrierte Zeitung“ den Premierleutnant.
Wer nun glaubt, der aufgebrachte Offizier und sein Begleiter seien daraufhin gebeten worden, das Lokal zu verlassen, liegt falsch. Josef Kritsch bat Theodor Siepmann, sich mit seinen Bekannten in einen anderen Raum zu setzen. Der zog es jedoch vor, unverzüglich aufzubrechen, und stürmte ohne Mantel und Hut aus dem Lokal in den Innenhof. Sein Freund sollte ihm beides nachbringen. Auch von Brüsewitz sprang auf und wollte dem Kontrahenten folgen, wurde aber vom Wirt daran gehindert. Der gekränkte und nach Satisfaktion dürstende Premierleutnant verließ die Gaststätte nun ebenfalls durch den Ausgang zur Karlstraße. Hier könnte die Geschichte enden, doch von Brüsewitz gab nicht auf, suchte nach seinem Gegner. Um die Ecke, Eingang Kaiserstraße, traf er Siepmann, der den Innenhof verlassen hatte und ebenfalls auf die nächtliche Straße getreten war. Von Brüsewitz zog seinen Säbel, Siepmann rannte zurück ins Lokal und erneut in den Innenhof, aus dem es kein Entkommen gab. Der unbewaffnete Mechaniker hoffte vielleicht, sein Gegenüber würde es bei einer verbalen Attacke belassen. Laut der „Berliner Illustrierten Zeitung“ sagte er noch, er wolle sich entschuldigen, doch von Brüsewitz stieß mit enormer Wucht zu. Er traf sein Opfer in die rechte Brust, der Säbel durchbohrte die Leber, den Magen, das Zwerchfell und durchdrang die linke Brustwand. Diese enormen Verletzungen führten zum Tod Siepmanns wenige Minuten nach dem Angriff, laut Eintrag beim Standesamt um 0.45 Uhr am Montag, 12. Oktober. Seit Beginn der Auseinandersetzung um das Zusammenstoßen zweier Stühle war ungefähr eine Stunde vergangen.
Von Brüsewitz ging in die Gaststätte zurück und berichtete Roderich von Jung-Stilling, Siepmann sei „zur Strecke gebracht“, was geschehen war. Er fühlte sich keines Verbrechens schuldig. Am folgenden Tag nahm er wie gewohnt seinen Dienst auf und saß am Abend, als sei nichts geschehen, wieder in einem Wirtshaus – immerhin vermied er es, erneut ins „Tannhäuser“ zu gehen. Seine Tat bezeichnete er als „Antwort auf die Provokation einer Zivilkanaille“. Viele sahen es in den folgenden Monaten genauso, andere jedoch stellten das hierarchische Ständesystem infrage.
Zunächst aber geriet die badische Residenzstadt in Aufruhr. Der Karlsruher Abgeordnete Markus Pflüger äußerte in einer Sitzung des Reichstages am 17. November 1896, dass „der traurige Fall, die bedauerliche That des Herrn Lieutenants von Brüsewitz die heitere, sonnige Residenz unseres verehrten Fürsten […] in große Aufregung versetzte“.
Diese Aufregung könnte ihre Ursache in dem unguten Gefühl vieler Menschen gehabt haben, dass ihnen diese Sache selbst hätte passieren können. Auch eine, vorsichtig ausgedrückt, eher geringe Sympathie für die preußischen Truppen in der badischen Bevölkerung mag dazu beigetragen haben.
Als am 15. Oktober der Sarg mit dem Leichnam Theodor Siepmanns zum Bahnhof gefahren wurde, um nach Altendorf überführt zu werden, standen Hunderte, laut „Badischer Presse“ gar Tausende Menschen an der Strecke. Am Bahnsteig hatten sich die Arbeiter von „Junker & Ruh“ versammelt, denen die Firmenleitung für diesen Abschied freigegeben hatte. Auch Firmengründer Karl Junker erwies seinem Mechaniker die letzte Ehre. Für die große Anteilnahme der Bevölkerung bedankte sich die Familie in einer Zeitungsanzeige.
Da es sich bei dem Täter um einen Offizier handelte, wurde der Fall nicht vor einer zivilen Strafkammer, sondern vor dem Militärgericht verhandelt. In Preußen wurde der besondere Gerichtsstand des Militärs als Privileg betrachtet. Nach der Reichsgründung legte Artikel 61 der Reichsverfassung eine einheitliche Militärgerichtsbarkeit fest, aber erst 1898 wurde eine allgemein gültige Militärstrafgerichtsordnung erlassen. Dort legte Paragraf drei fest: „Der bürgerlichen Strafgerichtsbarkeit unterliegen die Militärpersonen des aktiven Heeres und der aktiven Marine, sofern sie nicht dem Offizierstand angehören […].“
Ein Gericht, dessen Richter dem gleichen privilegierten gesellschaftlichen Stand wie der Täter angehörte, musste natürlich das Misstrauen in der Bevölkerung zusätzlich stärken. Hinzu kam, dass das Gericht nicht öffentlich verhandelte. Kein Geringerer als der damalige Vorsitzende der SPD, August Bebel, brachte die Stimmung am 17. November 1896 in einer Sitzung des Reichstages auf den Punkt: „Wir stehen hier einem geheimen Vehmverfahren [sic!] gegenüber, das für das große Publikum ein Buch mit sieben Siegeln ist, in das niemand hineinblicken kann.“
Die Bluttat und der folgende Prozess schlugen in der Presse des Deutschen Reiches hohe Wellen. Die linksliberalen und sozialdemokratischen Blätter schlugen sich auf die Seite des Opfers. Das „Berliner Tageblatt“ initiierte gar eine Unterschriftenaktion für eine Petition an den Reichstag. Man forderte ein Verbot des Duellwesens und eine Abschaffung der Militärgerichtsbarkeit. 100.000 Unterschriften kamen zusammen. Aus dem vermeintlichen Einzelfall wurde eine grundsätzliche Debatte über die überbetonte Rolle des Militärs und den besonderen Ehrenkodex seiner Angehörigen, vor allem im Offiziersstand.
Die konservativen Zeitungen nahmen dagegen von Brüsewitz in Schutz, teilweise mit abstrusen Behauptungen. Die „Badische Landpost“ immerhin gab die Schuld des Premierleutnants zu, relativierte sie jedoch im gleichen Atemzug, indem sie von Brüsewitz Alkoholismus und ungezügelte Triebe unterstellte.
Am 17. und 19. November 1896 debattierte der Reichstag in Berlin über den Fall Brüsewitz. Vorangegangen waren zwei Anfragen der Freisinnigen Volkspartei an die Regierung. Gefragt wurde, was Reichskanzler Fürst Chlodwig zu Hohenlohe-Schillingsfürst zur Eindämmung der Duelle unternommen habe und welche Schlüsse die Regierung aus dem Karlsruher Fall zu ziehen beabsichtige. Während der zweitägigen Debatte wurden 20 Reden gehalten, in denen vor allem der Zusammenhang des Falls mit dem Ehrbegriff und dem Duellwesen thematisiert wurde.
Werfen wir einen genaueren Blick auf die Hintergründe: Im deutschen Adel, vor allem dem mit besonderer Affinität zu militärischen Karrieren, war noch im 19. Jahrhundert die Vorstellung eines „ritterlichen“ Standes vorherrschend. Dessen waffentragende Angehörige sollten sich selbst und ihre Ehre verteidigen können und müssen. Dabei ging es nicht nur um die persönliche Ehre, sondern auch um die des Standes, zu dem man sich als Adliger, Offizier oder Mitglied einer Studentenverbindung zugehörig fühlte. Mitunter konnten auch Bürgerliche zu diesem „ritterlichen Stand“ gehören. Angriffe auf die Ehre verlangten eine Zurücknahme der Beleidigung und Entschuldigung. Bis hierhin handelte von Brüsewitz also „standesgemäß“. Wurde die Zurücknahme verweigert oder wog die Beleidigung zu schwer, forderte der Gekränkte den Beleidiger zum Duell. Dieser Aufforderung musste nachgekommen werden oder man lief Gefahr, von seinen Standesgenossen gesellschaftlich geächtet und als ehrlos betrachtet zu werden. Ein Mechaniker war jedoch, wie man so schön sagte, „nicht satisfaktionsfähig“, konnte also nicht zu einem Duell gefordert werden.
Der aus heutiger Sicht absurde Ehrenkodex war stärker als die gesetzlichen Verbote. Seit 1871 war der Zweikampf mit tödlichen Waffen zwar im ganzen Reich verboten, jedoch lediglich mit einer geringen Haftstrafe zwischen drei Monaten und fünf Jahren belegt. Verurteilt wurde zu Festungshaft: Was martialisch klingt, war in Wahrheit eher milde und galt im Gegensatz zur Gefängnis- oder Zuchthausstrafe nicht als entehrend. Die konsequente Durchsetzung des Zweikampfverbots scheiterte nicht zuletzt daran, dass sich die Angehörigen der (Militär-) Gerichtsbarkeit und der Regierungen selbst dem Ehrenkodex verpflichtet fühlten.
Schon 1890 hatte ein Duell landesweit für Aufsehen erregt. Der Streit zwischen den Studenten Carl Vering und Eduard Salomon hatte mit einer verbalen Beleidigung in einer Gaststätte begonnen und endete mit einem Duell in einem Wald bei Freiburg. Salomon wurde dabei lebensgefährlich verletzt und starb einige Tage später in der Klinik.
Diese und weitere den Karlsruher Ereignissen vorangegangenen Duelle machen die besondere Stimmung deutlich, die letztlich den Abgeordneten Karl August Munkel dazu bewog, eine Debatte im Reichstag anzustoßen. In seiner Rede brachte er das gesellschaftliche Problem auf den Punkt: „Wenn es wahr ist […], daß ein Offizier, weil seine Ehre gekränkt ist, oder auch nur, weil er sie gekränkt glaubt, mit kaltem Blut denjenigen, der ihm die Ehre gekränkt haben soll, durchbohren und zu Tode bringen darf, dann ist die menschliche Gesellschaft durch solches falsche Ehrgefühl im höchsten Grade gefährdet.“
Beinahe wie ein Anwalt in seinem Plädoyer ergriff Kriegsminister Heinrich von Goßler die Partei des Offiziers und versuchte, die Person des Getöteten herabzuwürdigen: „Er ist ein ungewöhnlich kräftiger, herkulisch gebauter Mann gewesen. Er ist aus der Metallpatronenfabrik entlassen worden wegen schwerer Bedrohung seiner Mitarbeiter.“ Goßler schien nichts vom Trauerspalier der Belegschaft von Junker & Ruh gewusst zu haben, für die Theodor Siepmann wohl kein brutaler Zeitgenosse gewesen war.
Im Januar 1897 fällte das Gericht ein äußerst mildes Urteil: Henning von Brüsewitz wurde zu einer Freiheitsstrafe von drei Jahren und 20 Tagen verurteilt. Nach der Hälfte der Zeit wurde er entlassen, was der Feuilletonist Alfred Kerr kommentierte: "Wie trefflich er sich geführt haben muss, dass er schon jetzt aus dem Gefängnis – nicht etwa Zuchthaus – freikam.“
Kritik an der frühzeitigen Entlassung begegnete Kriegsminister Heinrich von Goßler im Deutschen Reichstag mit folgenden Worten: „Herr von Brüsewitz hat sich in der Gefangenenanstalt nicht nur in jeder Beziehung musterhaft geführt und alle ihm übertragenen Arbeiten zu vollster Zufriedenheit ausgeführt, sondern auch die Angehörigen des von ihm getödteten Siepmann durch Zahlung einer namhaften Summe zu entschädigen versucht. Zudem hatte seine Gesundheit so gelitten und war er so ernst erkrankt, daß seine Entlassung aus dem Gefängnis nur noch eine Frage kurzer Zeit war. Jedenfalls hatte aber dieses Leiden mit dazu beigetragen, die bisher verbüßte Strafzeit zu einer besonders qualvollen für den Verurtheilten zu gestalten.“
Der angeblich schwerkranke von Brüsewitz erholte sich nach der Entlassung jedoch derart schnell, dass er sich 1898 nach Südafrika einschiffen konnte. Dort rumorte es zwischen dem Britischen Empire auf der einen und der Südafrikanischen Republik (Transvaal) und dem Oranje-Freistaat auf der anderen Seite. Von Brüsewitz schloss sich als Freiwilliger einem deutschen Freikorps an, sehr wahrscheinlich dem von Adolf Schiel gegründeten „Deutschen Kommando Johannesburg“. Ein Foto in der Zeitschrift „Die Woche“ zeigt ihn im Kreis anderer Offiziere des Freikorps in einer zusammengestückelten Uniform: Zu einer offenbar grauen Uniformjacke trägt er einen Hut, der an eine bayerische Tracht erinnert, bei der lediglich der Gamsbart fehlt.
Am 23. und 24. Januar 1900 standen Teile des Freikorps zusammen mit weiteren burischen Einheiten einer britischen Übermacht an einem Bergkegel mit Namen „Spion Kop“ gegenüber. Am zweiten Tag der Kämpfe fiel von Brüsewitz dadurch auf, dass er immer wieder hinter schützenden Felsen hervortrat, um auf die Gegner zu feuern. Die Briten waren bereits sehr nahegekommen und der Deutsche war ein gutes Ziel. Der Südafrikaner Deneys Reitz schildert in seinen Erinnerungen, welches Bild sich ihm bot: Von Brüsewitz trat erneut vor, zündete sich eine Zigarette an und rauchte, von den umherfliegenden Kugeln scheinbar ungerührt. Eine Kugel traf ihn in den Kopf. Henning von Brüsewitz war sofort tot.
Zwischenruf: Das Richtschwert
Ein Hinrichtungsschwert in einem Stadtmuseum? Gewiss kein Exponat, das man sich gerne anschaut. Eher läuft einem ein sanftes Gruseln über den Rücken bei dem Gedanken, wie es auf einen entblößten Nacken herabsauste.
Kennt man die Geschichte des sogenannten „Karlsruher Richtschwerts“, das auf Umwegen zurück in die Fächerstadt kam, so wird aus dem sanften ein deutliches Gruseln.
Es versagte nämlich im entscheidenden Moment in der Hand seines Besitzers.
Doch zunächst zur Herkunft des Schwertes. Der Tübinger Scharfrichter Georg Friedrich Belthle, Spross einer Leonberger Scharfrichterdynastie, hatte die todbringende Waffe 1772 bei einem Waffenschmied in Karlsruhe bestellt. Es wurde geliefert und fiel zur Zufriedenheit aus: 1,15 Meter lang, zwei Kilogramm schwer sowie mit einer Inschrift versehen, die besagte, dass sich der Ausführende, also der Henker, als Knecht Gottes verstand. Auch der Ort, aus dem es stammte, war eingraviert: „Carlsruhe 1772“.
Das Schwert erfüllte seine todbringende Mission vorbildlich. 19 Hinrichtungen absolvierte es, geführt von der Hand des Belthle, bis diesem etwas Peinliches und Grausames geschah. Er sollte am 5. Juni 1820 einen gewissen Michael Starkmann vom Leben zum Tode befördern. Starkmann, damals Tagelöhner und 55 Jahre alt, hatte am 12. August 1818 den zwölfjährigen Schüler Josef Wiker in der Nähe von Zwiefalten auf dessen Weg zum Lateinunterricht wegen einer silbernen Uhr erstochen.
Starkmann wurde schnell ergriffen und zum Tode verurteilt. Zunächst sollte er aufs Rad geflochten werden, doch der württembergische König ersparte dem Mörder diese grausame Strafe durch einen Gnadenerlass und ordnete Tod durch Enthaupten an.
Der Verurteilte wurde vom Münsinger Rathaus zur Hinrichtungsstätte geführt und dort vorschriftsmäßig angeschnallt. Mit einem Hieb sollte er getötet werden. Dies gelang dem 63-jährigen Belthle aber nicht. Er schlug zu schwach zu, der Kopf des Mörders wurde nicht vom Rumpf getrennt. Ein zweiter Hieb ging ebenfalls daneben und auch ein dritter Versuch scheiterte. Der Scharfrichter Johannes Kratt entriss ihm das Schwert und beendete das grausige Gemetzel mit einem Hieb. 6.000 Zuschauer und mehrere abgeordnete Schulklassen wurden Zeugen dieses Schauspiels. Es war die letzte Todesstrafe, die Belthle vollziehen durfte.
Aber nicht die letzte Todesstrafe in Deutschland. Am 18. Februar 1949 wurde in Tübingen die letzte von einem deutschen Gericht angeordnete Todesstrafe vollzogen. Der Raubmörder Richard Schuh starb am frühen Morgen unter der Guillotine.
Carl Hau, die Hauptfigur des nächsten Kapitels, hat in seinem Buch „Lebenslänglich“ eindrucksvoll den Ablauf einer Hinrichtung in Bruchsal beschrieben. Er selbst sollte gerade noch einmal davonkommen.
Das Geld der Schwiegermutter
Der Fall Hau ist unser einziger Fall, der nicht mit 100-prozentiger Sicherheit „gelöst“ erscheint. Es gab niemals ein Geständnis und die Würdigung der Zeugenaussagen schien während des Prozesses mehr als sonderbar. Immer wieder beschäftigten sich Autoren mit diesem Fall, der alles hatte, was auch heute noch die Massen anzieht. Schillernder Ehemann, biedere Gattin, aufregende Schwägerin, reiche Schwiegermutter und ein allzu exklusiver Lebensstil. Und dann fällt ein Schuss.
„Schreiben Sie mir ein Theaterstück, das richtig spannend ist. Mit einem offenen Ende. Mit Liebe, Mord, Betrug, einem Todesurteil und einem Nachfahren, der nicht glauben kann, dass in seinen Adern das Blut eines Mörders fließt.“ So oder ähnlich könnte der Wunsch eines Theaterdirektors lauten, der sicher sein will, dass sein Stück ein Erfolg wird.
Der Autor braucht nicht allzu lange im Fundus seiner Fantasie zu graben. Er muss nur ein paar bestimmte Begriffe in die Suchmaschine eingeben. Und alles ist da: einschließlich des Zweifels, der am Ende bleibt.
Das Personal des Bühnenstücks ist schnell gefunden. Da haben wir einen jungen Mann, der strebsam ist, ehrgeizig und der die Frauen liebt. Wir haben zwei Schwestern: die eine betörend schön, die andere ein wenig stiller und unauffälliger. Und eine Mutter, die froh wäre, wenn sie ihre letzten Küken auch noch aus dem Nest entlassen könnte. Wenn diese Mutter nun noch eine wohlhabende Witwe ist und der neue Schwiegersohn chronisch über seine Verhältnisse lebt, dazu seine schöne Schwägerin etwas mehr mag als in der Verwandtschaft üblich – voilà. Dann haben wir ein herrliches Drama.
Und dann haben wir den berühmten Fall Hau aus dem Jahre 1905. Unter unseren Fällen ist dies der einzige, bei dem die Täterschaft bis heute Zweifel aufwirft. Denn in dem Personenkarussell, das sich auf der Bühne dreht, spielt noch ein geheimnisvoller Unbekannter mit …
Beginnen wir mit dem ersten Akt, der immerhin in Ajaccio auf Korsika spielt. In der
Erholen sollte er sich dort in der südlichen Sonne, der junge Mann namens Karl Hau. Er stammte aus Großlittgen, wo er 1881 als Sohn eines Bankdirektors in ordentliche Verhältnisse geboren wurde. Und erholen musste er sich in der Tat, denn er hatte alles andere als ordentlich gelebt, was seinen gesundheitlichen Tribut forderte.
Dabei hatte alles bürgerlich und durchschnittlich begonnen. Zwar verlor der stille, aber begabte Junge im Alter von drei Jahren seine Mutter, doch die Stiefmutter liebte ihn. Er wurde auf das katholisch-konservative Friedrich-Wilhelm-Gymnasium in Trier geschickt, wo die herrschende Moral noch etwas galt. Doch früh schon schuf sich der aufgeweckte Karl seine eigene Moral und zeigte ein unstatthaftes Interesse am anderen Geschlecht. Nach dem Abitur entglitt er den Eltern und studierte Jura in Freiburg und Berlin. Auch hier lockte das lose Leben so sehr, dass der junge Mann einen Blutsturz erlitt. Und so sehen wir ihn nun auf der Bühne in Ajaccio.
Dort promenierten nämlich drei Damen, die gewiss interessiert unter ihren Sonnenschirmen hervor nach dem deutschen Junggesellen lugten. Allein das Wort Junggeselle ließ die Herzen der Älteren im Kleeblatt höherschlagen. Die meisten ihrer zahlreichen Kinder hatte die Medizinalratswitwe Josefine Molitor bereits gut verheiratet. Jetzt waren noch zwei Mädchen im heimischen Nest: die hübsche und feinsinnige, wenn auch leicht überspannte Olga sowie die ältere Lina, die ernsthafter und bodenständiger war. Da für junge Frauen der oberen Mittelschicht eine Berufstätigkeit nicht infrage kam, blieb auch für intelligente und lebhafte Mädchen nur das Warten auf einen Ehemann. Unausgefüllte Stunden mit Handarbeit, geflüsterten Fantasien von Mädchenohr zu Mädchenohr, Lektüre von Hedwig Courths-Mahler, der „Gartenlaube“ oder Modezeitschriften aus Paris. Für Lina hatte Josefine Molitor bereits einen Heiratskandidaten in Aussicht: einen Offizier. Allemal keine Mesalliance. Für Olga war sie noch auf der Suche.
In dieser seelischen Gemengelage trafen sie auf den 20-jährigen deutschen Jurastudenten und sorgten für Verwirrung. Doch auch er war verwirrt. Die eine oder die andere?
Jedenfalls eine von den beiden sollte es sein, denn er wollte auf jeden Fall in gute Kreise einheiraten. Die wohlhabende Witwe Josefine Molitor stammte aus einer angesehenen Baden-Badener Hoteldynastie: Der Familie gehörte der Englische Hof, wo heute die Deutsche Bank residiert, mitten in der kleinen Kurstadt, unweit des reizenden Rokokotheaters und den Flaniermeilen rund um das Kurhaus.
Baden-Baden und eine Tochter aus gutem und vermögendem Hause – das passte durchaus in Karl Haus Lebensplan. Zunächst musste eine Entscheidung getroffen werden. Erstaunlich während der ganzen Zeit vor dem dramatischen Höhepunkt unseres Stückes waren von Anfang an die Reisetätigkeit und die Mobilität der Betroffenen. So begleitete der wohlerzogene und intelligent wirkende Karl Hau die jüngere Schwester, Lina Molitor, zu einer Tante nach Genua. Eine Chance für ihn, ihr auf der romantischen Überfahrt über das Mittelmeer näherzukommen. Doch da war noch die aparte Olga. Ihr begegnete der Heiratskandidat ein zweites Mal, und zwar in Montreux, wo Olga mit ihrer Mutter vorübergehend weilte. Auch mit ihr begann Karl Hau einen Flirt und fand sich dadurch in einem klassischen Dreieck wieder. Beide Töchter fühlten sich zu dem aufstrebenden Studenten hingezogen. Also war ein Besuch in Baden-Baden fällig, damit Karl Hau eine Entscheidung treffen konnte.
In unserem Theaterstück senkt sich jetzt der Vorhang über dem Mittelmeer; er hebt sich wieder, die Stadt Baden-Baden erscheint.
Seit 1897 lebten die Molitors hier in einer wunderschönen Parkvilla in der Stadelhofstraße 11. Diese Villa gibt es noch heute; auch die Stadelhofstraße liegt noch da wie ehedem: ruhig und vornehm. Etliche Führungskräfte des Südwestrundfunks (SWR), die es sich leisten können, wohnen in den ausladenden Villen mit den traumhaften Gärten. Die Lage ist günstig. Nahe zum Sender und nahe in die Stadt. Besonders dann, wenn man die für Baden-Baden typischen Fußgängertreppen, die Lindenstaffeln, in die Stadt wählt. Bei Dunkelheit allerdings ist dieser Weg für Frauen auch heute nicht die erste Wahl.
Die Wohngegend war damals schon begehrt, so wie der ganze Kurort Baden-Baden ein Ort der Begegnung für Erste Kreise war. Sogar im Winter ließ sich das kulturelle Leben durchaus sehen. Zwar waren die Tage der Clara Schumann und der unglaublichen Gastgeberin Pauline Viardot sowie die Ära Turgenjew und Dostojewski, die sich 1867 hier verfeindeten, zu Ende. Doch noch immer gab es Glamour in der Stadt.
1901 war Franz Molitor gestorben und hatte seiner Witwe ein Vermögen von etwa einer Million Reichsmark hinterlassen. Aufgrund der Stellung ihres Mannes und eben jenes Vermögens gehörte sie damit zu den Honoratioren der Kurstadt.
Von Freiburg nach Baden-Baden war es nicht weit, und so besuchte Carl Hau die Molitorfamilie im Herbst 1901 in Baden-Baden, wobei sich das Verhältnis zu Lina vertiefte. Sie hielten Briefkontakt und verhielten sich zunächst, wie sich junge Liebende auf der ganzen Welt verhalten. Sie schrieben einander und trafen sich heimlich. Etwa in Luzern und in Freiburg. Und nun wurden größere Pläne für eine gemeinsame Zukunft geschmiedet.
Die Witwe Molitor stand aber einer Verehelichung der beiden zurückhaltend gegenüber; der Verehrer schien ihr zu jung und stand überdies erst am Beginn seines Studiums. Sie strebte deshalb vorsichtshalber weiterhin die Verlobung mit dem interessierten Offizier an.
Bereits hier zeigte sich ein unschöner Charakterzug Karl Haus: Er war bereit, auch krumme Wege einzuschlagen, um sein Ziel zu erreichen. Er überredete Lina, 2.000 Mark von ihrem Konto abzuheben. Mit diesem Geld floh das Paar in die Schweiz, angeblich um sich trauen zu lassen.
Das Geld war bald ausgegeben, die Schweiz war auch damals schon exklusiv. Und dann kam es zu einem rätselhaften Vorfall, der später nicht gerade zu Karl Haus Gunsten sprach. Frau Molitor erhielt nämlich ein Telegramm, abgesendet aus Realp St. Gotthard, das besagte, ihre Tochter sei durch eine Schussverletzung verwundet und liege darnieder. Die besorgte Mutter eilte an das Krankenbett ihrer Tochter und fand sie nur leicht verletzt vor. Aus der Nähe abgefeuert, war eine Kugel in ihre Brust gedrungen. Was war passiert? Wollten die beiden gemeinsam Selbstmord begehen? Angesichts der Jugend Karl Haus eher unwahrscheinlich. Oder sollte auf diese zweifelhafte Weise Druck auf die Mutter ausgeübt werden?
Tatsache war: Die Aktion war eines Theaterstücks würdig, Hau hatte offenbar auf seine Verlobte geschossen. Wie auch immer – der bühnenreife Coup war erfolgreich, denn Josefine Molitor stimmte nunmehr einer Heirat zu, zumal sich inzwischen auch Karl Haus Vater, Hans Hau, besorgt eingefunden hatte. Die noch offenen Rechnungen wurden hastig beglichen und am 18. August 1901 wurde in aller Stille in Mannheim geheiratet. Die Ehre war damit wiederhergestellt, dem äußeren Schein Genüge getan.
Die Szene wechselt nun und wird kosmopolitisch.