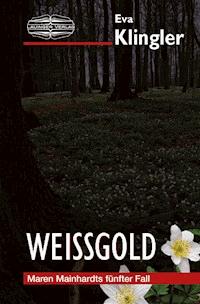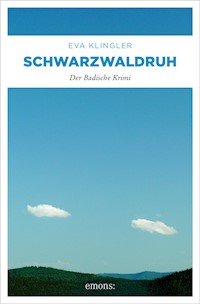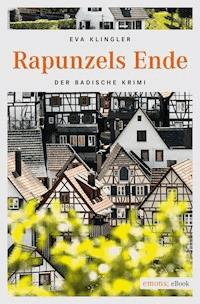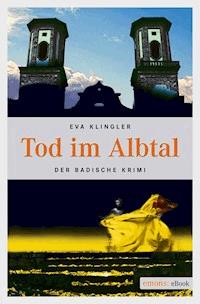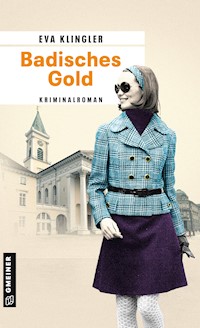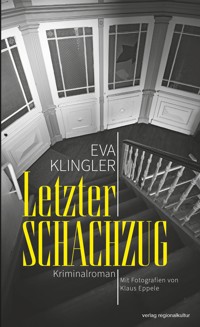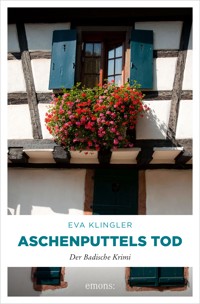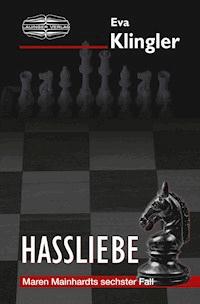
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Der Kleine Buch Verlag
- Kategorie: Krimi
- Serie: Maren Mainhardt ermittelt
- Sprache: Deutsch
Maren Mainhardts sechster Fall: Endlich Glück in der Liebe und dann noch ein gemeinsames Häuschen im elsässischen Selestat – für Maren Mainhardt scheint ein Traum in Erfüllung zu gehen. Doch während ihr Freund Oliver die meiste Zeit auf Konzertreise weilt, befindet sich die Ahnenforscherin bald unverhofft wieder auf Mörderjagd. Das Opfer, eine Baden-Badener Künstlerin mit eigener Galerie, hatte offenbar nur Feinde: Beleidigte Künstler, belogene Freunde, betrogene Kollegen – beinahe jeder hätte ein Motiv gehabt, Frau Freund zu töten. Aber ist eine vernichtende Kunstkritik wirklich ein Grund zum Mord? Oder hatte das Opfer ein dunkles Geheimnis? Im Lauf ihrer Ermittlungen deckt Maren immer neue Lügen der Ermordeten auf. Dann lernt Maren den reichen, charmanten Frédéric Brel kennen, der sich allzu sehr für sie interessiert – und plötzlich ergibt sich ganz unerwartet eine Verbindung zwischen Marens neuem Ahnenforschungsauftrag und der ermordeten Frau. Doch als Maren endlich auf die richtige Spur stößt, ist das Unglück bereits passiert … In ihrem neusten Fall arbeitet sich die unermüdliche Maren durch die Kunstszene von Baden-Baden und Karlsruhe. Doch ausgerechnet in ihrer neuen elsässischen Wahlheimat liegt der entscheidende Hinweis verborgen. Ein badisch-elsässischer Krimi mit viel Spannung, Witz und einem überraschenden Höhepunkt.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 348
Veröffentlichungsjahr: 2016
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Buch und Autorin
Endlich Glück in der Liebe und dann noch ein gemeinsames Häuschen im elsässischen Sélestat – für Maren Mainhardt scheint ein Traum in Erfüllung zu gehen. Doch während ihr Freund Oliver die meiste Zeit auf Konzertreise weilt, befindet sich die Ahnenforscherin bald unverhofft wieder auf Mörderjagd, diesmal sogar auf Geheiß der Kripo in Gestalt ihrer Freundin Elfie Kohlschröter-Oberst. Das Opfer, eine Baden-Badener Künstlerin mit eigener Galerie, hatte offenbar nur Feinde: beleidigte Künstler, belogene Freunde, betrogene Kollegen – beinahe jeder hätte ein Motiv gehabt, Frau Freund zu töten. Aber ist eine vernichtende Kunstkritik wirklich ein Grund für einen Mord? Oder hatte das Opfer ein dunkles Geheimnis? Im Lauf ihrer Ermittlungen deckt Maren immer neue Lügen der Ermordeten auf.
Dann lernt Maren den reichen, charmanten Frédéric Brel kennen, der sich allzu sehr für sie interessiert – und plötzlich ergibt sich ganz unerwartet eine Verbindung zwischen Marens neuem Ahnenforscher-Auftrag und der ermordeten Frau. Doch als Maren endlich auf die richtige Spur stößt, ist das Unglück bereits passiert …
In ihrem sechsten Fall arbeitet sich die unermüdliche Maren Mainhardt durch die Kunstszene von Baden-Baden und Karlsruhe. Doch ausgerechnet in ihrer neuen elsässischen Wahlheimat liegt der entscheidende Hinweis verborgen.
Ein badisch-elsässischer Krimi mit viel Spannung, Witz und einem überraschenden Höhepunkt.
Eva Klingler, geboren 1955, ist Journalistin und Autorin. Sie arbeitete als Redakteurin beim SWR und für verschiedene Tageszeitungen und veröffentlichte bisher zahlreiche Romane und Kurzgeschichten. In der Maren-Mainhardt-Reihe sind die Bände »Erbsünde«, »Blutrache«, »Kreuzwege«, »Weißgold« und »Blaublut« erschienen.
Impressum
Die deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen Nationalbibliografie; detaillierte bibliografische Daten sind im Internet unter www.dnb.de abrufbar.
© 2016 Der Kleine Buch Verlag | Lauinger Verlag, Karlsruhe
Das Werk einschließlich aller seiner Teile ist urheberrechtlich geschützt. Jede Verwertung außerhalb der engen Grenzen des Urheberrechtsgesetzes (auch Fotokopien, Mikroverfilmung und Übersetzung) ist ohne Zustimmung des Verlages unzulässig und strafbar. Dies gilt auch ausdrücklich für die Einspeicherung und Verarbeitung in elektronischen Systemen jeder Art und von jedem Betreiber.
ISBN: 978-3-7650-2144-2
Dieser Titel ist auch als Printausgabe erschienen: ISBN 978-3-7650-8577-2
www.derkleinebuchverlag.de
www.facebook.com/DerKleineBuchVerlag
Eva Klingler
HASSLIEBE
Ein badischer Krimi
Prolog
Karlsruhe, Januar 2010
Es war ein Wunder.
Elfie Kohlschröter und ihr Gatte Melchior Oberst, im Unterschied zu mir beide staatlich autorisierte Hüter von Recht und Ordnung, baten mich, ihnen bei den Ermittlungen zu einem Mordfall zu helfen.
Weniger schmeichelhaft war allerdings die mitgelieferte Begründung zum Wunder.
»Weißt du, Maren, du bringst die Leute irgendwie dazu, alles Mögliche und Unmögliche preiszugeben. Und woher kommt das wohl?«
Beim »wohl« ging Elfies Stimme nach oben, und sie sah mich mit jenem Blick an, der mich immer an meine allererste Grundschullehrerin erinnerte.
Im Gegensatz zu jener gab sie die Antwort allerdings gleich selbst: »Sie nehmen dich als Gefahr nicht ernst. Plappern drauflos, was sie bei uns natürlich nicht tun. Da überlegen sie sich jedes Wort und lassen lieber was weg. Nur niemanden belasten. Nur nicht vor Gericht erscheinen müssen. Das ist typisch deutsch.«
Da gelang es mir kaum, das Lachen zu unterdrücken. Niemand – außer vielleicht Heidi Klum – benimmt sich so deutsch wie Elfie.
»Und hinter all dem, was sie dir so erzählen, könnte sich eine winzige Spur verbergen.«
Nun ja. Sollte ich jetzt noch dankbar sein?
Von Elfies widerwillig angedeutetem Lob konnte ich keine Miete und keine Tankfüllung zahlen.
Bei der Karlsruher Kripo habe ich bekanntlich den undankbarsten Nebenjob der Welt. Gefährlich. Unbezahlt. Zeitraubend.
Ganz abgesehen davon war ihre Behauptung falsch. Bisher hatten meine Plaudereien nämlich wesentlich mehr als eine winzige Spur ergeben. Sie hatten zu handfesten Verhaftungen geführt.
Doch Elfie erging es mit ihren Fällen offenbar so, wie man es jungen Müttern nachsagt: Kaum ist die Geburt erledigt, sind alle Schmerzen vergessen, als seien sie nie gewesen. Nur noch das Ergebnis zählt.
So neigten auch Elfie und ihr Mann dazu, meine Mitwirkung an ihren Erfolgen hinterher unverzüglich zu verdrängen.
Dennoch lächelte ich aus purer Neugierde bescheiden und entgegenkommend.
Wer war diesmal das Opfer? Aus welchem Milieu kam es? Und wie war es gestorben?
Als sie mir dann nach vielen Ermahnungen, großer Geheimniskrämerei und der mehrfachen Abnahme von Diskretionsschwüren die Identität der Leiche enthüllten, weckte das keine Gefühle für die Tote in mir.
Aber eines konnte ich damals noch nicht wissen: Ihr Todesurteil war einige Zeit vor der Hinrichtung gefallen. Und ich kannte ihren Richter!
1. Kapitel
Sélestat, November 2009
Ich stand am Fenster und sah hinaus. Eine Gasse im November.
Drinnen knackte ein Elektroöfchen und verbreitete eine oberflächliche kurzlebige Wärme. Französische Wärme eben. Vom Mittelmeer bis zur belgischen Grenze heizen die Gallier auf diese Weise. Allein bei dem Gedanken daran erleidet jeder Deutsche einen Preisschock.
Schaltete man das flache Ding an der Wand aus, wurde es sofort kalt.
Die Wände selbst stammten übrigens aus dem sechzehnten Jahrhundert und hatten so eine Menge Zeit gehabt, unfreundliche Kälte zu speichern.
Gegenüber von meinem Fenster befand sich in der Entfernung eines verlängerten Armes das Nachbarhaus. Dort wohnte ein recht nettes Ehepaar. Sie hatten drei Papageien, und sie waren Franzosen.
Eine Selbstverständlichkeit sollte man meinen, da sich das Haus in Frankreich befand.
So war es aber nicht, denn der Rest der Straße befand sich fest in orientalischer Hand.
Das große Nachbarhaus zur Rechten war erfüllt vom Leben und Lieben einer marokkanischen, einer türkischen sowie einer tunesischen Familie.
Es war also beinahe wie in der Südstadt – und doch anders.
Kinder, die man den einzelnen Nationalitäten nicht zuordnen kann, spielen hier bis nachts auf der Straße.
Sie wachsen auf wie in ihrer Heimat, pflegen deren Bräuche, aber sie sind in erster Linie stolze Franzosen, und sie sprechen französisch miteinander.
Wenn sie mich sehen, betrachten sie mich neugierig, denn ich bin hier die Ausländerin, nicht sie. Sie sagen höflich aber scheu: »Bonjour, Madame.«
Ihre Mütter, mollige dunkelhaarige Frauen mit runden Gesichtern, betrachten mich etwas mitleidig von ihrem geschnitzten Holzbalkon herab.
»Ça va, Madame?«, fragen auch sie. Die Frauen sind sehr oft auf dem Balkon, denn sie trocknen ihre Wäsche dort. Täglich. Auch sonntags und auch jetzt im Winter. Im Schwäbischen würde man sich schütteln, im Badischen zumindest wundern.
Heute war aber Donnerstag, es war kalt, regnete fiese graue Bindfäden, und im Rücken unseres Hauses hatte die mächtige Hochkönigsburg – laut Reiseführer der zweitgrößte Touristenmagnet Frankreichs nach dem Eiffelturm – ihr Haupt in Regenwolken gehüllt.
Ein regnerischer Wintertag ist überall gleich trostlos.
In einer Kleinstadt im Norden Frankreichs ist er noch trostloser als in Karlsruhe. Denn Kleinstädte sind weltweit gleich, nämlich klein.
Die Läden hier in der Stadtmitte schließen überraschend früh, die Straßen sind abends im Winter leer bis auf die Hundehäufchen, die sich meterweit vertreten. Die Restaurants weigern sich, vor 18.30 Uhr aufzumachen, und ein Café gleich am Ortseingang schließt um 18.00 Uhr; und wenn man um 20 Uhr daran vorbeiläuft, ist es wieder offen.
Man hat überhaupt seltsame Öffnungszeiten hier. So macht erst um zehn Uhr auf der Hauptstraße ein Laden auf, hinter dessen Tresen ein müder Mann mit Tränensäcken bis zu den Knien steht. Reihenweise warten meist jugendliche Einwohner der Stadt und der umliegenden Orte auf Einlass. Er verkauft Lottoscheine und Zigaretten, denn es gibt keine Zigarettenautomaten in diesem ansonsten genussfreudigen Land. Warum er erst so spät öffnet, weiß ich bis heute nicht. Auch sonst ist manches anders in diesem Landstrich, den wir Badener lediglich als exotische Kräuterbutterkolonie betrachten: Samstags hat alles geöffnet, dafür montags alles zu.
Ich stand also immer noch an dem kleinen Fenster, sah hinaus auf die stille enge Straße, auf das verschachtelte Mosaik der Dächer und sehnte mich nach meinem Freund und nach mehr. Nach vertrauten Stimmen, nach dem Lachen meiner Freundinnen, nach meinem bevorzugten Lebensmittellädle in der Südstadt. Ich sehnte mich nach Oliver und meinetwegen auch nach Kelly, seiner Tochter, und fühlte mich wie ein Puzzlesteinchen im falschen Puzzle.
Fragte mich, ob ich nicht eigentlich nach Karlsruhe gehörte. Was machte ich in einem Land, dessen Sprache ich zwar holprig sprach, deren Nuancen ich aber vielleicht nie verstehen würde?
Leben wie eine Göttin in Frankreich hatte ich mir jedenfalls etwas anders vorgestellt.
Vor allem wärmer.
»Hauptsache, wir sind zusammen!«, hatte Oliver kühn behauptet, bevor er das Angebot für die Produktion einer CD und für mehrere Konzerte in Irland und England angenommen hatte und durch den Tunnel unterhalb des Ärmelkanals verschwunden war. Eine eigenartige Definition von ›zusammen‹.
Und so lebte ich jetzt in Sélestat, einer mittelalterlichen Kleinstadt im südlichen Elsass, anstatt in meinem heimischen Karlsruhe.
Bewohnte ein uraltes winziges Haus mit Balken von 1560 anstelle einer schicken Zweizimmerwohnung mit dem Komfort des 21. Jahrhunderts.
Alles hatte natürlich mal wieder mit einem Mordfall begonnen. Im Spargelmilieu. Keine schöne Sache. Ein Mann, der im Schwetzinger Schlossgarten gestorben und dessen Leiche verschwunden war. Und ein Rätsel, das ich beinahe zu spät gelöst hatte.
Sozusagen als Abfallprodukt hatte ich mich im Zuge der Ermittlungen in Oliver Oberst, Melchiors Bruder, verliebt. Gut, mochten meine Kritiker sagen – sie verliebt sich ja immer mal wieder, aber das heißt ja nicht, dass sie gleich aus der Karlsruher Südstadt wegzieht. Bestimmt nur eine kurze Sache
Diesmal war es aber mehr als das übliche Strohfeuer.
Oliver war Melchiors irisch-deutscher Halbbruder. Kripokommissar Melchior Obersts Halbbruder. Ja, genau. Jener Melchior, der ausgerechnet auf dem Jakobsweg mit seiner Kripo-Kollegin und meiner Freundin Elfie Kohlschröter angebandelt hatte. Auf dem Jakobsweg sollte man eigentlich zu sich und nicht zum Mann seiner Freundin finden. Aber so war es gewesen, und das Ganze hatte am Ende zu der Ausstellung eines behördlichen Trauscheins geführt.
Oliver Oberst, keltisch angehauchter Musiker und Vater einer Teenagertochter, hatte mich temperamentvoll und entschlossen aus meinem emotionalen Tief geholt. Gemeinsam hatten wir den Mordfall in Schwetzingen – gelöst wäre der falsche Ausdruck – gemeinsam hatten wir versucht, ihn zu lösen.
Dieses Abenteuer hätte mich fast das Leben gekostet, und wir hatten uns unter den dramatischen Umständen ineinander verliebt.
Oliver würde ab Sommer dieses Jahres eine Stelle an der Musikhochschule in Straßburg haben. Bis es soweit war, wickelte er noch verschiedene Projekte in England und Irland ab.
Straßburg ist – europäisch gesehen – ein teures Pflaster und deshalb hatten wir uns rechtzeitig dieses Haus im vierzig Kilometer entfernten Städtchen Sélestat gesucht.
Zwanzigtausend Einwohner, und für jeden zweiten davon gibt es anscheinend einen eigenen Supermarkt, denn Hypermarchés und Intermarchés umschließen die Stadt ringförmig wie moderne Festungsanlagen. Die Franzosen haben eine unheilbare Leidenschaft für gigantische Supermärkte.
Ich, die Deutsche, gewöhnt an dreischiffige Aldiläden, pflege mich schon alleine zwischen den hiesigen Käseregalen zu verirren. Sie sind mehr als mannshoch, und die Franzosen schieben riesenhafte Wägen zwischen einer unüberschaubaren Auswahl von Münsterkäsen und Camemberts hin und her.
Geriebener Käse wird hier gleich in praktischen Kilopaketen angeboten, Essig ist gut und preiswert, Olivenöl wird für fast alles benutzt, und Meeresfrüchte haben hier ungefähr den Stellenwert von Kochkäs’ mit Kümmel auf einem oberhessischen Kleinstadtmarkt. Es gibt sie preiswert und in allen Variationen für jedermann. Und nachdem ich aus Versehen einmal salzige Butter gekauft und für den Marmorkuchen benutzt hatte, achtete ich nun besser auf die Aufschrift auf der Butterpackung aus kariertem Papier. Die leuchtend blau verpackte Salzbutter kommt aus der Bretagne und transportiert Urlaubsgefühle in den fernen Osten Frankreichs.
Ansonsten herrscht in Sélestat eine Idylle fast wie im Bilderbuch.
Die Ill plätschert unternehmungslustig durch den Ort. Kanulehrer und Kanuschüler tanzen darauf. Die alten Männer sitzen witterungsresistent vor den Cafés und Bars und trinken aus kleinen Gläschen mit hohen Stilen ihren Weißwein.
Und die Hochkönigsburg schaut hochmütig auf das vom Krieg nie zerstörte Ensemble an Türmen, Türmchen, Dächern, Antennen und Storchennestern herab.
Die Haussuche hatte sich rückwirkend gesehen erstaunlich problemlos gestaltet.
In Sélestat gibt es mehr Immobilienmakler als Bäcker. Und das will im Land der bekennenden Weißbrotjunkies etwas heißen. Ich hatte in einer Straße mindestens zwanzig solcher Anbieter gezählt. Der Himmel weiß, wovon sie leben.
Diese Immobilienmakler haben kleine, von außen einsehbare Büros, die sie – wie in Frankreich üblich – mit glatten, bunten und für unsere Augen ein wenig billig aussehenden Möbeln einrichten.
Da sitzen sie, rauchen ungeniert und ohne jegliches schlechte Gewissen, und haben leere Schreibtische sowie modernste Computer vor sich.
Einer dieser Makler hatte ein Haus aus dem 16. Jahrhundert zu vermitteln. Sowohl der Mann als auch das Haus waren uns sympathisch gewesen – sympa, wie man in Frankreich sagt. (Sagen Sie einfach mal sympa, betonen Sie es auf der letzten Silbe und Sie werden sich gleich beinahe wie Romy Schneider fühlen – und so dem deutschen Spießertum in Richtung Freiheit und Erotik entkommen.)
Geübt, wie ich inzwischen war, gelang es mir, vor den staunenden und bewundernden Augen meines neuen Lebensgefährten den Preis um ganze zehntausend Euro herunterzuhandeln.
Im Unterschied zu seinen deutschen Kollegen, die dabei immer so taten, als habe man damit automatisch Hartz IV für sie beantragt, nahm es der Makler namens Herve Vogel gelassen und sportlich.
Ich denke, er hätte uns eher für verrückt gehalten, wenn wir den normalen Preis bezahlt hätten.
Der Ort Sélestat liegt nur ungefähr 120 Kilometer von Karlsruhe entfernt, und doch landeten wir mit einer Tankfüllung in einer anderen Welt.
Der Notartermin fand in Oberstufenfranzösisch statt und man händigte uns eine Urkunde aus, die aussah, als habe Nicolas Sarkozy persönlich Hand angelegt. Aus jedem einzelnen Dokument sprach die Würde der Grande Nation.
Wir mussten alles Mögliche unterschreiben – in Deutschland hätten wir uns über den bürokratischen Aufwand aufgeregt. So wurde uns bescheinigt, dass das Haus nicht hochwassergefährdet sei (hierzu wurde uns ein Hochwasserplan von einem Experten vorgelegt, auf dem das bedrohte Gebiet seltsamerweise haargenau vor unserem Haus endete), dass uns nichts von einem Kernkraftwerk in der Nähe bekannt sei – Fessenheim mit seinen Kühltürmen ist fast in Sichtweite – und dass man uns gesagt hätte, dass wir keine Termiten im Haus hätten. Auf den Gedanken war ich bisher noch nicht gekommen. Erleichtert nahm ich das Fehlen dieser Insekten zu Kenntnis. Es handelte sich eben um einen gesamtfranzösischen Vertrag, der auch auf Korsika und auf der Ile de la Réunion seine Gültigkeit hatte.
Herve vermittelte uns für die wenigen notwendigen Reparaturen einen Handwerker, der fast einen Monat anstatt der vereinbarten Woche brauchte und deshalb die letzten vierzehn Tage praktisch mit uns zusammenlebte.
Er hieß Sebastien, war geschieden und seither andauernd von der Liebe enttäuscht, rauchte ebenfalls wie ein Schlot, sprach abends beim Wein mit uns in einem unverständlichen Kauderwelsch aus Elsässisch, Französisch und Deutsch und wiederholte gebetsmühlenhaft den Lieblingsspruch der Franzosen »pas de soucis«, was soviel heißt wie »Macht euch keine Sorgen!« Leider lernen unsere Schüler diesen Satz im Französischunterricht nicht, dabei wäre er der wichtigste von allen.
Irgendwann verließ uns Sebastien, Bargeld in der Tasche und uns seiner ewigen Freundschaft versichernd.
Meine winzige Mischlingshündin Nessie hatte ihn gerne gemocht und sah ihm von der Eingangstür aus traurig nach, bis sich seine dünne Gestalt in den krummen Gassen verlor.
Oliver und ich verbrachten ein paar schöne, erotische und kulinarisch angenehme Tage und Nächte in unserem Haus, bevor er zurück auf seine grüne Insel musste.
Meine Sorgen lachte er weg und nahm die Pannen sportlich.
Oliver brauchte es als halber Ire nicht zu lernen, aber ich als ganze Deutsche hatte eine Menge Nachholbedarf in Sachen Lebensart: Es geht auch nicht-pünktlich, nicht-perfekt, nicht-wie-ausgemacht.
Oliver verhieß mir, es werde mit unserem gemeinsamen Leben wahrscheinlich genauso chaotisch weitergehen.
»Du hättest es einfacher treffen können. Doch du hast gewusst, worauf du dich einlässt: Ein Musiker, ein Vater, ein Ausländer, ein Irrlicht.«
»Aber eins, das nicht so schnell verlöscht, hoffe ich?«
Sein Engagement in Irland und das Schuljahr von Kelly gingen vor. Erst im nächsten Sommer würden wir als neue Familie endgültig vereint sein: Ein Ereignis, dem wir alle drei mit einer Mischung aus Spannung und Furcht entgegen sahen.
Ich brachte Oliver zum Flughafen in Straßburg, der ein wenig provinziell aussieht, winkte dem kleinen schlanken Stahlkörper nach, bis er als Punkt Richtung Westen verschwand, trank einen Café noir in einer Bar in der Halle und fuhr dann langsam über die gewundenen Landstraßen durch kleine Weindörfchen im Dornröschenschlaf nach Hause.
Dann war ich erst mal alleine. Und ich stellte einen großen Unterschied fest: Das Elsass ist gut und schön, wenn du abends hinfährst, Flammkuchen isst und danach nach Hause zurückkehrst. Immer dort zu leben, fühlt sich anders an. Heimat lernt man erst zu schätzen, wenn man sie von außen betrachtet.
Derartige küchenphilosophische Erkenntnisse gediehen in meiner Einsamkeit.
Vor allem im Winter, wenn es um vier Uhr dunkel wurde und sich an den gegenüberliegenden Fenstern die Schatten Fremder bewegten, vermisste ich Nachbarn, mit denen ich jene badischen Nichtigkeiten austauschen konnte, die irgendwie zum Alltag gehörten. »Geht’s?« »Muss!« »Kenn ich. Mir sehn uns mal. Ja?« »Ja, so wie ich mal zum Schnaufe komm. Trinke wir mal en Kaffee so wie früher!« »Du meld’sch dich.« »Mach ich. Bis dahin, lass der’s mal gut gehe.« »Du auch, bis dann. Und grüß daheim!«
Stattdessen versuchte ich mich in dem Irrgarten der französischen Grammatik zurechtzufinden. Diese Sprache blieb eine Herausforderung!
Eine Weile lang ist man ja vollkommen begeistert, wenn man herausbringt: »Une baguette, s’il vous plaît?«, aber irgendwann würde man auch gerne mal sagen: »Ein nicht so scharf gebackenes Roggenmisch, bitte, geschnitten, ach, ich sehe, da ist noch ein halbes, könnte ich das auch noch haben? Und täten Sie mir doch bitte eins auf den Montag zurück, ja?«
Es sind diese kleinen vertrauten Nebensätze, die das Leben prägen und die Heimat ausmachen.
Sélestat, Kleinstädtchen zwischen den funkelnden Sternen Straßburg und Colmar, hielt jedoch etwas in petto, um Touristen an der Autobahn abzufangen.
Der Ort nannte sich nämlich stolz die Heimat des geschmückten Weihnachtsbaumes, ohne den in unseren Breiten bekanntlich kein echtes Weihnachtsgefühl gedeihen kann.
Sogar hartgesottene Jung-Yuppies, die längst irgendwo in Berlin abchillen und von Meeting zu Meeting hetzen, kehren Weihnachten nach Hause zu den Eltern zurück und wären tödlich beleidigt, keinen Baum, der aussieht wie er immer aussah, und keine kalorientechnisch gesehen unkorrekten Fondantringe daran vorzufinden. So meine Erfahrung.
Und hier im reizenden Sélestat sah ich mich auf Schritt und Tritt von Tannenbäumen umgeben. Der gezierte Baum fand sich schon jetzt im November praktisch auf jedem freien Fleck des Städtchens wider. Am Ortseingang thronte er sogar ganzjährig.
Sympa.
Ich kannte mich inzwischen in den engen und bunten Fachwerkgassen, den etwas verwirrend angeordneten Plätzen und kleinen Parks einigermaßen aus. Wusste, wo ich gefahrlos mit Nessie spazieren gehen konnte (die Grünanlage vor der Synagoge mitten im Ort) und wo nicht (die Festungsanlagen von Altbaumeister Vauban – denn die gehörte jenen Hunden, die eigentlich Maulkorbpflicht haben. Eigentlich heißt hier in Frankreich: Sie tragen keinen!).
In Frankreich hat man sowieso ein anderes Verhältnis zum Hund. Es gibt mindestens einen halben pro Einwohner, denn die Hundesteuer ist hierzulande unbekannt.
Vielfach wird morgens die Tür geöffnet, der Hund verlässt selbstständig das Haus und streunt den ganzen Tag in der Stadt herum. Es gibt darunter viele kleine Kläffer, aber auch ein paar Kameraden, die aussehen, als diene ihnen Nessie bestenfalls als Amuse gueule, als Gratis-Gaumenkitzler, der hierzulande in den Restaurants vor den Hors d’oeuvre gereicht wird.
Ich wusste nach einer Weile, wo man gut aß, wo man preiswert, aber gut und wo man teuer einkaufen konnte. Eine alte Frau, Nachfahrin des früheren Nachtwächters ein paar Häuser weiter, passte auf Nessie auf, wenn ich beruflich nach Karlsruhe musste oder genervt war von meinem nonnenhaften Dasein auf 70 Quadratmetern und vier Stockwerken.
»Gehen Sie nur heim nach Dütschland!« Und sie strich Nessie übers struppige schwarze Haar. Nessie verehrte sie, denn sie kochte dem deutschen Pensionsgast immer Beinscheibe.
»Ich habe doch Zeit. Keine Enkelkinder. Meine Tochter hat noch keine Kinder. Traurig ist das. Mein Schwiegersohn wäre so ein guter Vater. Und er ist so ein hübscher Mann …«
Kinder, fuhr sie stolz fort, seien ja in Frankreich kein Problem. Die Kleinen wandern mehrheitlich schon als Babys in ihre bunten Kinderkrippen, die Crèches genannt werden, und die Mamans gehen elegant gekleidet zur Arbeit. Den Männern gleichgestellt.
So hört man es, und so scheint es zu sein.
Ich wusste noch nicht viel über das französische Schulsystem. Das einzige, was ich sah, waren erstaunlich diszipliniert wirkende Kinder, die um fünf Uhr nachmittags heimkamen und aussahen, als hätten sie nicht mehr allzu viel Energie für Randale übrig. Tagsüber sah man wenige Kinder auf den Straßen.
Mein Problem war genau das Gegenteil: Ich hatte zuviel Energie für das kleine Städtchen und das kleine Häuschen.
Zweimal am Tag rief Oliver an. Morgens flüsterte er, wie sehr er mich in der vergangenen Nacht vermisst habe und sagte ein paar unanständige Sachen auf Englisch, und abends wünschte er mir eine gute Nacht und sprach von seiner Sehnsucht.
In drei Wochen würden sie mich besuchen. Kelly und er.
»Sie freut sich schon auf dich!«, log er. Ich glaubte ihm nicht. Wäre ich Irin, dreizehn Jahre alt und müsste erleben, wie mein Vater eine Deutsche einschleppte, mit der ich in Zukunft unter einem mühsam gedeckten Dach zwischen mittelalterlichen Wänden in einem fremden Land auskommen sollte, hätte ich mich bestimmt nicht gefreut.
Nun ja. Was wusste ich schon von Kindern?
Sah ich sie doch meistens nur in ausgewählten Zeitfenstern. Festtage. Geburtstage. Beerdigungen. Bei Freunden manchmal. Sie sagten Hallo und verschwanden in ihren eigenen Zimmern und in ihrer eigenen Welt. Sie blieben mir oft fremd.
Meistens ging ich heim und war froh, nur für mich und Nessie verantwortlich zu sein. An schlechten Tagen blieb eine kleine Traurigkeit übrig.
Ich hätte mir schon vorstellen können, Kinder zu haben, aber es war kein alles beherrschender Drang gewesen. Mein Leben ohne Nachwuchs war nicht sinnlos und leer.
Hingegen war es leer ohne Arbeit und ohne meine Freunde.
Egal, ob mit Kindern oder nicht: Es musste etwas geschehen.
Ich brauchte Beschäftigung, wie auch immer.
Mein Ahnenforschergewerbe dümpelte natürlich auf Sparflamme vor sich hin.
Glücklicherweise hatte ich vor einem Monat einen Großauftrag abgewickelt und einer aus Dresden stammenden alten Dame einen höchst verzwickten und sehr edlen Stammbaum zusammengestellt, auf dem es zu ihrer Freude von Doktoren und Richtern sowie hohen Staatsbeamten nur so wimmelte.
Zuvor hatte sie mir zehn Kisten mit alten Fotos gegeben, die ich sortieren und den Namen auf den einzelnen Ästen zuordnen sollte – eine Arbeit, vor der sie sich begreiflicherweise ein Leben lang gedrückt hatte. Mit Hilfe der mit feinem Bleistift eingetragenen Daten auf den Rückseiten der vergilbten Fotos mit den gezackten Rändern hatte ich die Geburts- und Hochzeitstermine der einzelnen Personen verglichen und eine Excel-Liste angefertigt.
Der alten Dame war die Sache so wichtig gewesen, dass sie meine Honorarforderung widerspruchslos akzeptiert und sofort in bar beglichen hatte. Ich hatte also ein paar Rücklagen.
Auch sonst schien ich preiswert unterwegs zu sein.
Oliver hatte das Haus gekauft und zahlte die laufenden Kosten. Ich leistete einen symbolischen Beitrag fürs Essen und die Dekorationsobjekte, mit denen ich das Miniaturschlösschen geschmückt hatte: Kerzenleuchter, herabtropfende Efeupflanzen, Figuren aller Art und elsässischen Nippes, den ich auf Flohmärkten erjagte.
Doch das füllte mich nicht ganztägig aus.
Zumal wir nicht einmal einen Fernseher besaßen, denn wir hatten stolz darauf verzichtet.
Wir wollten alles besser machen als die Süchtigen drüben in Deutschland, die stundenlang mit zwei Lexmarkern über der Fernsehzeitschrift brüten und mit gelb das anstreichen, was sie anschauen wollen und mit grün das, was sie aufnehmen wollen, weil sie gelb und grün nicht parallel gucken können.
Jetzt fehlte er mir.
Ich schnappte mir Nessie, zerrte sie ein Stück aus der Stadt hinaus.
Hässliche Vorortstimmung in den Ausfallstraßen, dann kamen die flachen, weiten Auen der Ill. Rechts die gezackte Linie der Vogesen, auf deren Gipfeln Schnee lag, links der Kaiserstuhl. Ich dachte nach.
Was konnte ich hier machen? Mein Französisch war nur mittelprächtig. Doch ich kannte die Stadt gut.
Hatte mich für ihre Geschichte interessiert.
Mit diesen Kenntnissen konnte ich vielleicht als Fremdenführerin tätig werden. Eine Fremde führt Fremde. Mal sehen, was die Einheimischen dazu meinten.
Am anderen Tag zog ich ein Kostüm an und quälte mich auf hohen Absätzen übers Kopfsteinpflaster. Doch ich hatte beobachtet, dass Französinnen bei der Arbeit sehr feminin und korrekt gekleidet sind.
Das Tourismusbüro von Sélestat war in einem ausgedehnten Saal in einem der zahlreichen Altbauten der Stadt angesiedelt, die alle aussehen wie ehemalige Adelssitze. Drinnen Computer, modernste Technik und eine eher kühle Mitarbeiterin am Tresen.
Ich stotterte mein Anliegen auf Französisch zusammen und brachte vor, was ich sei (»généalogiste«) und warum ich hier sei (»avec mon mari« – gelogen, wir waren ja gar nicht verheiratet, in Frankreich nennt man solch eine Beziehung übrigens »pacs«) und wieso ich Arbeit suchte (»pour le temps« – zeitweise).
Man war nun recht freundlich und tat das, was man in Deutschland auch getan hätte. Was vermutlich international üblich war, um Arbeitssuchende höflich abzuwimmeln: Man notierte sich meine Angaben und Daten. Ich konnte nur hoffen, dass dieser Notiz nicht das internationale Schicksal beschieden war und sie in Akte 13, sprich im Papierkorb, landete.
Und eine Woche später hatte ich meine erste Anfrage.
Ein Kegelclub wollte die Kirchen von Sélestat besichtigen.
Schon nach der ersten wollten sie allerdings lieber die Kneipen besichtigen. Sie luden mich ein, und es wurde ein feucht-fröhlicher Abend. Sie bestellten Knacks und Frites und riesige Krüge mit Bier und flirteten mit der Bedienung.
Anders eine Gruppe evangelischer Ordensschwestern drei Tage später. Die blieben so lange in der Kirche St. Georges, dass ich Angst hatte, sie würden demnächst darin Asyl suchen.
»Nächste Woche, baldigst vor Weihnachten, wäre ein Gruppe aus Karlsruhe und die Umgebung«. Die stellvertretende Chefin des »Office de tourisme« konnte fast perfekt Deutsch. »Sie möchten Kirchen und Museen besichtigen und mit Sie schön gehen essen.«
»Gemischte Gruppe?«
»Pardon?«
»Frauen und Männer?«
»Ja. Männer und Frauen. Ist das ein Problem für Ihnen?«
Sie sah mich neugierig an. In Sélestat leben nicht viele Deutsche. Zu weit weg von der beruhigenden Grenze und zu französisch. Und selbst wenn welche hier wohnen würden, dann nicht in der engen Altstadt mit den winzigen Zimmerchen und den steilen Treppen. Deutsche sind verwöhnt. Iren weniger. Und Leute aus der Karlsruher Südstadt sind in diesem Punkt wie Iren anzusehen.
»Oh, nein«, erwiderte ich. »Im Gegenteil. Ich habe nichts gegen Männer.«
Aber ich war auch nicht mehr auf der Suche.
Im Gegensatz zu anderen Beziehungen, die ich in meinem Leben gehabt hatte, reichte bei Oliver sogar die Erinnerung an ihn, um mich ein bisschen glücklich zu machen. War doch ein gutes Zeichen, oder?
»Es sind, comment est-ce qu’on dit, wie sagt man, Dosenten und Dosentinnen von der Université Populaire.«
»Volkshochschuldozentinnen«, half ich aus.
»Genau. Das ›z‹ fällt mir schwer.«
»Wenn das alles ist. Mir fällt das gesamte Französisch schwer«, tröstete ich.
»Ja«, erwiderte sie stolz. »Es ist eine anspruchsvolle Sprache.«
Nett ausgedrückt. Ich hätte andere Begriffe parat für ein Idiom, das für jedes zweite Verb ein eigenes Endungssystem geschaffen hat, um Ausländer zu quälen.
»Und woher genau kommen diese Dozentinnen?«, wollte ich wissen.
»Aus dem Raum von Karlsruhe und eine Dorf namens … Ettlingen. Und Ortschaften in der Nähe von diese Dörfe.«
Heimatbesuch also. Ich freute mich patriotisch. Nur hätten die Ettlinger vielleicht etwas gegen die Bezeichnung »Dorf« gehabt.
2. Kapitel
Meine Besuchergruppe kletterte bestens gelaunt aus ihrem Bus, der auf dem großen Parkplatz am Ufer der Ill hielt. Es war eine kleine Gruppe. Kaum hatte ich angefangen durchzuzählen, war die Schlange schon fertig. Insgesamt waren es zwölf Leute.
Sie hatten keine allzu lange Fahrt hinter sich und mussten deshalb nicht die Glieder strecken und recken, sondern waren sofort tatendurstig.
Alle hatten warme Sachen an, meistens gesteppte Thermomäntel oder in der Leibesmitte mit einem Gürtel zusammengehaltene Steppjacken, die nur bei wirklich schlanken Frauen gut aussehen. Pelzmäntel gab es keine. In solchen Kreisen waren sie aus Gründen des Tierschutzes verpönt.
»Frau Mainhardt?« Eine sehr schmale Frau mit langen aschblonden Haaren, die zu einem Dutt hochgesteckt waren, trat auf mich zu. Als ich ihr die Hand schüttelte, bemerkte ich, dass sie einen auffallend festen Griff hatte. Sie sah mich mit einem forschenden und intensiven Blick an, der auf sehr genaue Wertvorstellungen schließen ließ.
»Angelika Richtig! Ich führe die Gruppe an.«
Der Name erstaunte mich nicht. Sie sah wirklich aus wie jemand, der Wert auf Richtigkeit legte.
Es stellte sich heraus, dass sie Pfarrerin war. Als Dozentin der Volkshochschule leitete sie den Fachbereich »Mitmenschliches Handeln«. Natürlich ehrenamtlich, wie sie betonte.
»Es ist schön«, stellte sie fest, »dass Sie pünktlich sind. Wir alle haben nur wenige Tage frei im Jahr, und diesen Tag heute wollen wir sinnvoll und tätig mit Kultur und Genuss verbringen.«
Das Wort Genuss hörte sich bei ihr an, als spräche ein Vegetarier von einem saftigen Rindersteak.
»Liebe Frau Richtig«, bemerkte ein älterer, nonchalant aussehender Herr, der etwas mühsam aus dem Bus kletterte, »wir wollen aber heute zuerst genießen und dann erst kulturell tätig sein.«
»Wer tätig ist, genießt immer«, beschied ihn die Richtig humorlos.
»Krozingen, Wilfried!«, stellte sich der Nonchalante vor. »Ich gebe Nachhilfe in Mathematik und Latein an der Volkshochschule. Umsonst für die, die sich keine teuren Privatlehrer leisten können. Ausländerkinder, Hartz-IV-Empfänger …«
»Empfänger von Tranferleistungen und Kinder mir Migrationshintergrund! Schon gut, lieber Herr Krozingen«, unterbrach die Richtig. »Wir sind alle im Interesse der Benachteiligten unserer Welt unterwegs.«
Krozingen schloss den Mund. Transferleistungen? Meine Güte!
Murmelnd versammelte sich die Gruppe in loser Formation. Krozingen wollte trotzdem noch etwas sagen.
»Und Sie wohnen wirklich hier?«, wollte er wissen.
»Ja, das bewundere ich. Alleine diese Sprache!«, warf ein anderer Mann ein. Ich sonnte mich ein wenig in dem seltenen Glanz meiner Heldentat, ins Ausland zu ziehen.
»Noch nicht sehr lange, aber wir haben ein kleines Haus. Nicht weit von hier«, gab ich zur Antwort.
Eine rothaarige untersetzte Frau raffte ihre Tasche an sich und sah sich besorgt um. Die Legende, dass man im Elsass permanent um Auto und Geld fürchten musste, hielt sich jenseits der Grenze offenbar hartnäckig.
»Schwindt. Mein Name ist Schwindt. Ich war früher Französischlehrerin und bin eine leidenschaftliche Hobbyköchin. Jetzt leite ich den Fachbereich ›Kochen für Menschen, die von Transferleistungen leben: Gesund und doch preiswert‹. Ich möchte, dass auch diese Leute auf Fertigprodukte und Tiefgefrorenes verzichten lernen und sich selbst etwas Leckeres aus Gemüse und Früchten kochen.«
Ich dachte an den behaglichen Vorrat von tiefgefrorenen Minischnitzelchen, Weinbergschnecken und Pizzas, die in meinem Tiefkühlschrank warteten und nickte pflichtbewusst.
Die Gruppe scharte sich nun wie Hühner auf einem Hof enger um mich. Ich gab ihnen eine kurze Einführung in die Geschichte von Sélestat: »Eine sehr alte Stadt, die schon zur Römerzeit besiedelt war. Im 8. Jahrhundert ein fränkischer Markt und Königshof. Karl der Große hat nachweislich hier 775 Weihnachten gefeiert. Später, Ende des 11. Jahrhunderts, besaßen die Staufer hier Güter. Alles in allem wird uns Sélestat mit einem geschlossenen und gewachsenen mittelalterlichen Stadtbild beglücken. Um die beiden Kirchen herum stehen prachtvolle erhaltene Bürgerhäuser aus dem 16. Jahrhundert.«
»Wohnen Sie in solch einem Haus?«, erkundigte sich ein Mann.
»Herr Bellheim, das glaube ich nicht«, warf Frau Richtig ein.
»Nein. Unser Haus ist auch alt, aber es ist nicht prachtvoll.«
Einige stellten noch Fragen zur Stadtgeschichte und manche schrieben sogar mit.
»Bevor wir zu der berühmten Humanistischen Bibliothek gehen, werfen Sie bitte einen Blick nach rechts. Neben dem Kulturzentrum sehen Sie die heutige, die moderne Bibliothek«, ich deutete auf den gläsernen Prachtbau auf der anderen Seite des Flusses. Alle drehten brav die Köpfe. Schön, so eine deutsche Reisegruppe.
»Bestens ausgestattet«, fügte ich an. »Und samstags wuselt es nur so von den Kindern, die dort ausleihen. Viele Ausl… Kinder mit Hintergrund. Migrationshintergrund«, bewältigte ich das Wortungetüm etwas atemlos.
»Es ist schön, dass die Kinder noch lesen«, bemerkte der gut aussehende Mann namens Bellheim, der etwas über fünfzig sein mochte. Er hatte sehr volles Haar, ein ruhiges, gut geschnittenes Gesicht und einen sensiblen Mund. Sympathisch. Etwas irritierte mich das Armkettchen mit Anhänger bei einem Mann seines Alters. Wahrscheinlich eine Initiale. Vielleicht hieß er Ludwig. Männer mit Herrentäschchen oder Schmuck jeder Art sind mir normalerweise suspekt. Das sind die, die Audi fahren, Guido Westerwelle wählen, bei Bon Jovi begeistert mitsingen und sich insgesamt moderner fühlen als sie sind. Aber dieser Bellheim schien sympa.
»Wenn sie lange genug in Ihre Kurse gehen, mein Bester, dann haben sie sowieso keine Zeit mehr zum Lesen«, bemerkte eine kräftige dunkelhaarige Person, und zu mir gewandt: »Die meinen dann, das ganze Leben ist nur ein taktisches Spiel. Alles berechenbar.«
Wir liefen langsam als Stoßtrupp auf die Altstadt zu, und dabei plauderten die meisten munter.
»Ich biete Kreatives Schreiben an, und er macht das Training für die ganz jungen Spieler im Nachbarraum von unserer Volkshochschule. Schach!«, wisperte die Dunkelhaarige. »Ich heiße übrigens Schöller. Corinna Schöller. Und er ist der Werner Bellheim. War früher mal richtig gut in seinem Sport. Eigentlich ist er Redakteur beim Hörspiel im Südwestfunk in Baden-Baden. Sehr kreativer Mensch. Gemalt hat er auch mal. Ein gutmütiger und netter Mann. Und er kann toll mit den Kindern umgehen. Hat selbst keine, ist aber nicht schwul. Seine Frau war wohl schon etwas älter. Sie ist früh gestorben.«
Offen gestanden fand ich alle diese Bekenntnisse etwas intim, bedachte man die relativ kurze Zeit, die wir uns alle hier kannten. Doch ich hatte schon öfters bemerkt, dass bei dem Thema Familienplanung offenbar andere Regeln galten als die üblichen Konversationsabläufe.
»Haben Sie denn Kinder?«, erkundigte ich mich, weil ich wusste, sie wartete darauf. Die Frage kam mir natürlicher von den Lippen, seit ich mit Oliver und Kelly zusammen war. Oder zusammen sein würde. Eines Tages. Kelly war nicht meine Tochter, aber sie würde als dritte Person zu unserem Familienleben gehören.
»Zwei«, gab sie zur Antwort. »Mein Sohn wohnt in Stockholm und meine Tochter in Karlsruhe. Sie fährt Anfang Januar zu Besuch zu ihrem Bruder. Jahresurlaub. Ich sage: Mädchen, fahre doch in den Süden, was willst du im Januar in Schweden, aber sie will ihre kleine Nichte besuchen. Kann man auch verstehen.«
In ihren Augen stand jetzt die entsprechende Gegenfrage. Ich schüttelte den Kopf.
»Ich selbst habe keine eigenen Kinder. Mein Lebensgefährte hat aber eine Tochter. Sie wird bei uns wohnen.«
»Dann wissen Sie ja bald, wie das ist. Mein Mann und ich leben leider getrennt, seit die Kinder aus dem Haus sind. Da verändert sich eben alles und man lebt sich auseinander. Ich habe mich damit abgefunden. Ist das aber ein entzückender Platz da. Und dieses Tor. Wie in Jerusalem. Und alles so romantisch geschmückt. Herrlich, die alten Häuser hier. Bisschen heruntergekommen natürlich, aber das gehört wohl zum Flair, nicht wahr?«
»Das ist der Neue Turm von 1634. Beachten Sie die vier Ecktürmchen. Und hier betreten wir die Altstadt.«
»Ich finde nicht, dass es hier heruntergekommen aussieht. Es ist eben nur nicht genau wie bei uns. Aber das muss es ja auch nicht. Zeugt von einer anderen Kultur und einer anderen Geschichte. Außerdem waren diese Städte nicht zerstört«, warf Bellheim ein und zwinkerte mir zu.
»Die Straßen könnten trotzdem reinlicher sein. Kaum ist man über der Grenze, bemerkt man den Unterschied. Irgendetwas ist anders. Es riecht sogar anders als bei uns in Ettlingen«, philosophierte Frau Schwindt. »Doch Sie haben Recht. Es ist ja eigentlich das herrlich Unperfekte, das man an Frankreich liebt.«
»Genau«, warf Frau Schöller ein. »Mein Sohn lebt, wie gesagt, in Stockholm. Da ist alles beinahe zu sauber. Geradezu steril. Und immer diese Dunkelheit. Kein Wunder, dass die alle trinken.«
»Meine Tochter ist zwar noch zu Hause, bewirbt sich aber gerade auch um ein Praktikum in Zürich. So ist das heute eben«, seufzte eine andere Frau aus der Runde.
»Kinder sind uns auf Erden nur geliehen«, warf Pfarrerin Richtig nun etwas sauertöpfisch ein.
»Na ja. Lassen wir mal die Kirche im Dorf. Irgendwann ist man ganz froh, wenn man wieder für sich ist.« Das kam von Wilfried Krozingen. »Ich war damals alles andere als begeistert, als meine Frau mir freudestrahlend mitteilte, es sei was unterwegs. Aus dem jugendlichen Liebhaber sollte ein Papa werden? Nein, danke…«
Die beiden Männer hatten aufgeschlossen. Einige Frauen jubelten beim Anblick der Guglhupfkreationen fast mit erotischem Entzücken auf und blieben wie angeklebt vor den Bäckereien stehen. Zwei gingen magisch angezogen hinein, pure Kaufgier in den Augen.
»Warten Sie«, mahnte ich vergeblich. »Wir gehen nachher noch zum Brotmuseum. Spätestens da werden Sie sowieso schwach.«
»Unsere Töchter sind verheiratet und aus dem Haus. Seither haben meine Frau und ich kaum noch Streit«, erzählte der nonchalante Krozingen. »Die Leute fragen, ob ich sie vermisse, und ich sage Jein.«
»Wenn man sie früh kriegt«, Corinna Schöller wich einem Hundehäufchen in letzter Sekunde aus, »dann ist es natürlich für alle besser. Aber es geht nicht immer alles wie geplant. Manche setzen andere Prioritäten. Eine Freundin von mir ist beruflich recht erfolgreich. Das war immer schon ihr Traum. Sie wollte nicht Mutter werden, bevor sie nicht etwas erreicht hatte. Ein Mann? Ja, bitte. Kinder? Nein danke. Damit es da keine Probleme gab, hat sie ihren Partnern erzählt, sie habe einen genetischen Defekt und dürfe deshalb keine kriegen. Nicht, dass es die wahrscheinlich groß interessiert hätte. Die meisten waren wahrscheinlich froh, denn welcher junge Mann ist schon unbedingt auf Kinder aus? Ich glaube, die meisten Männer geben unserem Nestbautrieb nur mit lauwarmer Begeisterung nach. Weil wir halt ab einem bestimmten Alter unbedingt Mama werden wollen. Mit Babys können sie sowieso nichts anfangen. Erst, wenn die alt genug sind, um eine Computertastatur zu bedienen, eine Schachfigur zu führen oder eine Geige zu halten, nicht wahr, Herr Bellheim?«
Sie lachte.
Der Angesprochene zuckte nur mit den Schultern, aber Krozingen schmunzelte: »Na ja. Irgendwie haben Sie damit Recht, meine Liebe!«
»Das hat sich alles geändert. Mein Mann und ich, wir wollten unsere vier Kinder nicht missen. Sie sind unsere direkte Verbindung zur Schöpfung. Und ist ihre kinderlose Freundin vielleicht glücklich geworden?« Frau Richtig blätterte missbilligend in ihrem Führer »Kirchenbauten in Sélestat«.
»Später ist sie dann ja noch Mutter geworden. Sie hat halt eine andere Reihenfolge eingehalten.«
»Spät finde ich zu alt«, wusste Angelika Richtig wieder alles besser. »Eine alte Mutter ist oft überfordert. Und das schadet dem Kind und seiner Entwicklung. Man soll der Schöpfung nicht ins Handwerk pfuschen. Kinder kommen, wann sie wollen.«
Warum muss man bei einer Pfarrerin immer mehrere Hürden überwinden, bevor das Über-Ich dem Es erlaubt, sie einfach nur unsympathisch zu finden? Ein blöder Elektroingenieur ist ein blöder Elektroingenieur, aber eine Pfarrerin blöd zu nennen, traut man sich irgendwie nicht. Als wäre sie selbst eine Heilige, nur weil sie uns sonntags aus der Bibel vorliest.
»Ich habe meine ja auch früh gekriegt«, beeilte sich Schöller, der Rudelführerin Recht zu geben. »Aber die hatte alles geregelt: Der Mann verdient gut, um die Kinder wird sich gekümmert und sie hat ihre Karriere.«
Ich beneidete diese unbekannte Frau. Alles haben! Musste sich gut anfühlen. Seltsam, dass genau diese Leute oft überhaupt nicht zufrieden mit ihrem Leben sind.
Corinna Schöller streichelte inzwischen einen dieser kleinen weißen Hunde, die die Franzosen bevorzugen. Die dazugehörige Französin blieb geduldig am anderen Ende der Leine stehen. Man lächelte sich wortlos an.
»Goldig ist der. Ihrer aber bestimmt auch, nicht wahr Frau Mainhardt? Haben Sie ein Foto dabei?«
Natürlich hatte ich! Nessie ist sogar mein Bildschirmschoner auf dem Handy. Stolz zeigte ich ihr kleines schwarzes Konterfei herum.
»Ich habe ebenfalls einen Hund«, kam es von Bellheim. »Wenn ich arbeite, ist er bei meiner Schwester. Am liebsten hätte ich einen kleinen eigenen Zoo. Für ausgesetzte Tiere. Und für alte, die keiner mehr will. Wenn ich in Rente gehe, dann werde ich im Tierschutz mitarbeiten.«
»Das ist gut«, lobte Pfarrerin Richtig. »Sehen Sie. Jeder hat seine Lebensaufgabe bekommen. Wichtig ist, für die Gemeinschaft da zu sein. Es müssen nicht immer eigene Kinder sein. Und Sie sind so beliebt bei unserer Jugend.«
Bellheim nickte, doch ich sah, dass da Traurigkeit in seinem Gesicht war. Ich finde solche Bemerkungen taktlos.
Angelika Richtig und ich würden nicht beste Freundinnen werden, das stand jetzt schon fest.
Schöller und Bellheim streichelten noch einen zweiten Hund, der sich dazugesellt hatte und blieben ein wenig zurück. Sie unterhielten sich lebhaft. Das ist das Schöne an der Liebe zum Hund. Du hast einfach eine Menge Gesprächsthemen.
Wir schlenderten durch die wunderschön beleuchteten Gassen und blieben immer wieder stehen. »Da ist die bedeutendste Sehenswürdigkeit von Sélestat: Die Humanistische Bibliothek. Gehen wir rein?«
Zwei Frauen aus der Gruppe interessierten sich nicht dafür.
Sie bildeten die kleine, aber stabile Guglhupffraktion und wollten sich stattdessen das Brotmuseum ansehen.
»Die beiden geben nur Backkurse!«, flüsterte mir Frau Schwindt ins Ohr. »Als ob Backen lebensnotwendig wäre. Sie backen an Weihnachten 76 Sorten Plätzchen. Unvorstellbar, oder? In Zeiten wie diesen.«
Doch der Rest von uns betrat die ehrwürdigen Hallen der Humanistischen Bibliothek. Eine junge Frau eilte auf uns zu, stellte sich als »Françoise Hueler« vor und erklärte sich bereit, uns zu führen.
Ich liebe diese uralte Humanistische Bibliothek. Immer, wenn ich dort bin, überfällt mich Ehrfurcht vor der Fülle des früheren Wissens, das dort aufbewahrt wird. Die Reihen alter Buchrücken in den Regalen.
Die alten Schriften haben für mich etwas Magisches. Ich sehe dann die Hand vor mir, die vor mehr als 1500 Jahren die Farbe aufs Papier gebracht hat.
»Hier wird auch der Beweis aufbewahrt, dass in Sélestat der Weihnachtsbaum erfunden wurde. Eine kleine Zeichnung und der Hinweis darauf, dass die Bäume zu bewachen seien. Wir können uns das gleich selbst anschauen.«
»Wann soll denn das gewesen sein?«
»1521!«
»So lange machen wir diesen Wahnsinn mit der alljährlichen Schmückerei schon mit!«, stellte Frau Schwindt fest, von der ich inzwischen wusste, dass sie Solveig hieß.
Pfarrerin Richtig warf ihr einen tadelnden Blick zu. »Unsere Traditionen sollen uns doch eine Freude sein und keine Belastung.«
Wir sahen und staunten, was die Humanistische Bibliothek an Schätzen barg. Alte Merowingerschriften, die erste Erwähnung des Wortes Amerika auf der Landkarte. Wir bewunderten geradezu rührend altmodisch aussehende Modelle der Kirchen von Sélestat – St. George und Ste. Foy – und jeder für sich ließ die Zeit Revue passieren.
In diesen Hallen war ein Hauch von Ewigkeit spürbar.
Schließlich griffen wir die beiden Bäckerinnen auf, die hastig und schuldbewusst eine Portion Plätzchen in ihren Handtaschen verstauten, während wir mit unseren Prospekten und Eintrittskarten hantierten und so demonstrierten, dass wir den Geist der Materie vorgezogen hatten.