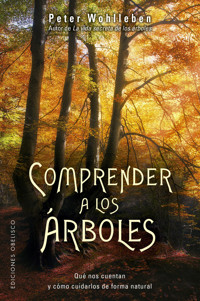Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: pala
- Kategorie: Wissenschaft und neue Technologien
- Sprache: Deutsch
Willkommen zu einem Sprachkurs der etwas anderen Art! Bäume stehen nur scheinbar still und stumm in unseren Wäldern und Gärten. Sie kommunizieren nicht nur untereinander, sondern auch mit uns – wenn wir ihre Sprache lernen. Wer besser versteht, wie ein Baum »tickt«, wer an seinem Wuchs und am Zustand der Blätter oder der Rinde erkennt, wie es ihm geht, wird langfristig mehr Freude an ihm haben. Das Buch erlaubt überraschende Einblicke in das Innenleben und die »Gefühlswelt« von Buche, Birke und Co. und verhilft so zu einer neuen Sichtweise. Die Wahl des richtigen Hausbaumes, Pflanzen und Schneiden von Laubbaum, Obstbaum und Hecke oder der Umgang mit Totholz: Das profunde Wissen des Autors über das Wesen der Bäume sowie über naturwissenschaftliche Hintergründe und ökologische Zusammenhänge hilft bei der naturgemäßen Pflege. Nach der Lektüre des Buches wird auch verständlich, warum sich heimische Buchen besser auf den Klimawandel einstellen können als Fichten und welche Folgen der Bioenergieboom und die rücksichtslose Ausbeutung der Wälder mit sich bringen.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 246
Veröffentlichungsjahr: 2020
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Peter Wohlleben
Bäume verstehen
Was uns Bäume erzählen, wie wir sie naturgemäß pflegen
illustriert von Margret Schneevoigt
Inhalt
Cover
Titel
Impressum
Dolmetscher gesucht
Im Porträt: die Eiche
Vom Mythos zum Plantagenbaum
Im Porträt: die Birke
Bäume in Freiheit
Die Wuchsform
Im Porträt: die Fichte
Die Wurzeln
Der Stamm
Die Äste
Im Porträt: die Linde
Im Porträt: die Pappel
Die Haut
Im Porträt: die Hainbuche
Das Laub
Im Porträt: die Vogelkirsche
Die Blüten
Die Embryos
Botschaften
Wasserhaushalt und Winterschlaf
Machtkämpfe
Tierische Mitbewohner
Im Porträt: die Kiefer
Pflanzliche Untermieter
Im Porträt: die Rotbuche
Nach dem Alter gefragt
Der tote Baum
Der Baum bei uns zuhause
Im Porträt: der Apfelbaum
Der kranke Baum
Menschengemachte Gefahren
Ein paar Worte zum Schluss
Der Autor
Index
Dolmetscher gesucht
Bäume sind rätselhafte Wesen. Sie stehen stumm in unseren Gärten, spenden in der Sommerhitze Schatten und lassen den Herbstwind durch das bunte Laub rauschen. Je nach Art beglücken sie uns mit reicher Ernte an Obst oder Nüssen, dienen als Gerüst für Hängematten und Schaukeln oder sind als Hausbaum ein markantes Stilelement. Sie sind die mächtigsten Lebewesen unseres Planeten, weisen die größte Lebensspanne auf, und doch wissen wir sehr wenig über diese Giganten. Manchmal ahnen wir, dass da noch mehr sein muss, dass unter der rauen Rinde Geheimnisse verborgen sind, die sich uns auf den ersten Blick nicht erschließen.
Erst in den letzten Jahrzehnten wurde der Vorhang ein wenig gelüftet. So machten Forscher in den siebziger Jahren des letzten Jahrhunderts eine aufregende Entdeckung. Sie beobachteten in den Savannen Afrikas, dass Pflanzenfresser in Bezug auf ihre Leibspeise, die Blätter der Akazien, ein merkwürdiges Verhalten an den Tag legen: Zunächst beknabbern sie minutenlang einen Baum. Allerdings nicht so lange, bis der Hunger gestillt ist, denn mit Fraßbeginn fängt die Akazie an, Bitterstoffe in ihr Laub einzulagern. Schmeckt es den Gazellen und Giraffen nicht mehr, so legen sie eine Distanz von 50 bis 100 Metern zurück, bevor der nächste Baum herhalten muss. Warum 50 bis 100 Meter? Die Forscher fanden heraus, dass sämtliche Nachbarbäume ebenfalls Bitterstoffe einlagern, und zwar binnen Minuten. Das wissen die Pflanzenfresser und fangen instinktiv erst in gewissem Abstand an, ihre Mahlzeit fortzusetzen. Die spannende Frage war, woher die anderen Akazien von der Bedrohung erfahren. Die Antwort liegt in einem Gas, Ethylen, welches der zuerst befressene Baum ausströmt. Dieser chemische Hilferuf alarmiert die Nachbarn und ruft die entsprechende Reaktion hervor.
Derartige Warnsignale sind mittlerweile von vielen Baumarten bekannt. Wahrscheinlich haben die meisten Pflanzen ein chemisches Kommunikationssystem, und wir sind umgeben von einer munter plaudernden Pflanzenwelt. Unter den Signalen sind sogar solche, die gezielt Fressfeinde bestimmter Raupenarten anlocken, die der Vegetation zu Leibe rücken. Da die Forschung erst am Anfang steht, darf vermutet werden, dass Bäume ein umfangreiches Vokabular an »Duftwörtern« besitzen.
Das Problem für unsere wissenschaftlich rational geprägte Gesellschaft ist, dass wir den Pflanzen seit dieser Entdeckung weitere Fähigkeiten zugestehen müssen. Gefühle zum Beispiel. Bohrt sich ein Insekt in die Rinde, so muss der Baum den Eindringling fühlen, es muss schmerzen, damit er mit Abwehrstoffen und der Warnung seiner Nachbarn reagieren kann. Bäumen Gefühle zuzugestehen, geht sicher vielen von uns zu weit. Bei Tieren haben wir weit weniger Probleme, weil diese uns viel ähnlicher sind. Gut, einige von ihnen haben mehr Beine, mehr Augen oder ein kleineres Gehirn, aber der grundlegende Bauplan ist im Groben doch derselbe. Pflanzen dagegen, ohne zentrales Nervensystem, scheinen so wenig durchschaubar zu sein, als wären sie von einem fernen Planeten. Dazu kommt das lebenslange Verharren am selben Platz, ein Zustand, der uns quirligen Menschen völlig fremd ist und das Verständnis für diese Mitgeschöpfe zusätzlich erschwert.
Dabei ist die Trennung zwischen Tier und Pflanze eine rein willkürliche. Pflanzen erzeugen ihre Nahrung selbst, während Tiere von anderen Lebewesen leben. Hieraus aber auch eine Trennung in fühlende, sich mitteilende Geschöpfe (Tiere) einerseits und automatisch funktionierende Bioroboter (Pflanzen) andererseits abzuleiten, ist angesichts der neueren Forschung nicht mehr angebracht. Dass dennoch Land- und Forstwirtschaft, ja unsere ganze Gesellschaft Pflanzen mehr als Gegenstände denn als Lebewesen sehen, macht den rücksichtslosen Umgang mit ihnen viel leichter. Würde man den aktuellen Forschungsstand berücksichtigen, so müsste der Forderung nach artgerechter Tierhaltung auch ein Appell nach einer entsprechenden Behandlung der Pflanzen folgen. Doch so weit ist unsere Gesellschaft noch nicht.
Wenn Bäume sich mitteilen können, so sollte es doch ein Leichtes sein, sie zu verstehen. Leider gibt es für solche Botschaften weder ein Wörterbuch noch ein Entschlüsselungsgerät. Als Baumfreund nützt Ihnen das Wissen um derartige Kommunikationsformen somit erst einmal nichts. Dennoch können Sie weit mehr erfahren, als es zunächst den Anschein hat. Als Vergleich mag die nonverbale Kommunikation beim Menschen dienen. Verhaltensforscher haben herausgefunden, dass wir in Gesprächen bei unserem Gegenüber blitzschnell und instinktiv erfassen, wie dessen Gemütszustand ist, welche Grundhaltung hinter dem Gesagten steht. Körperspannung, Haltung und Mimik sagen mehr als tausend Worte und entscheiden, wie wir auf die gesprochenen Botschaften reagieren. Exakt hier können wir ansetzen, wenn wir Bäume und deren Befinden besser begreifen wollen. Denn wie Menschen drückt ein Baum durch sein Äußeres sehr genau aus, wie es ihm geht, woher er kommt und wohin er will. Wenn man weiß, wohin man schauen muss und worauf zu achten ist, so sind diese Riesenpflanzen wie ein offenes Buch. Und erst mit dem Verstehen der Baumsprache können wir ihnen helfen, sich in unseren Gärten so wohl wie möglich zu fühlen, können rechtzeitig eingreifen, wenn ihnen Gefahr droht, und dafür sorgen, dass sie sich prächtig entwickeln und auch noch unseren Urenkeln Freude bereiten. Ob Apfel- oder Nussbaum, Platane oder Kiefer, Birke oder Buche: Jeder Baum hat viele Geschichten zu erzählen. Geschichten, die seinen Charakter formten, die tiefe Narben in seiner Borke und seinem Wesen hinterließen und ihn einzigartig machten. Dieser Ratgeber möchte Ihnen dabei helfen, die Bäume Ihrer Umgebung zu verstehen.
Willkommen also zu einem Sprachkurs der etwas anderen Art!
Im Porträt: die Eiche
Die beiden wichtigsten Eichenarten unserer Wälder sind die Stieleiche (Quercus robur) und die Traubeneiche (Quercus petraea). Wie wenig die Wissenschaft über Bäume weiß, kann man bei dieser Baumart bestaunen: Beide Arten vermischen sich, bilden Bastarde verschiedenster Ausprägungen, und genau genommen kann bis heute niemand mit Sicherheit sagen, ob es überhaupt zwei unterschiedliche Eichenarten sind. Ähnlich verhält es sich mit dem Alter. Jeder touristisch interessante Landstrich kann mit tausendjährigen Bäumen aufwarten, aber oft ist nur der Wunsch der Vater solcher Informationen. Mehr als 500 Jahre werden wohl selten erreicht. Zu allem Überfluss muss die Eiche auch den Titel des deutschesten aller Bäume abgeben, denn landschaftsbeherrschend im Großteil aller Gebiete zwischen Alpen und der Meeresküste war bis zur Umgestaltung durch den Menschen wohl die Buche.
Eichen sind sehr robuste Bäume. Egal, ob Nässe oder Trockenheit, verdichteter Boden oder Frostlagen, sie nehmen alles klaglos hin. Selbst großflächige Verletzungen, die bei anderen Arten in eine rasche Fäule münden würden, können sie dank ihres natürlich imprägnierten Kernholzes wegstecken, ohne dass die Stabilität gefährdet würde. Als Lichtbaumart steht sie gerne im vollen Sonnenlicht, zudem ist sie nicht zänkisch und verträgt sich gut mit anderen Arten. Insofern ist die Eiche der ideale Hausbaum. Im Garten erreicht sie nicht die Maximalgröße von 40 Metern.
Vom Mythos zum Plantagenbaum
Bäume spielten zu allen Zeiten eine bedeutsame Rolle im Leben der Menschen, lieferten sie doch den (neben Nahrungsmitteln) wichtigsten Rohstoff: Holz. Kein wärmendes Feuer, kein schützendes Zelt, keine Sicherheit bietende Waffen – ohne Bäume wäre der frühe Mensch kläglich gescheitert, seine Existenz bestenfalls eine Anekdote der Evolution geblieben.
Kein Wunder, dass die mächtigen Wesen verehrt wurden. Die heiligen Haine der Germanen waren gleichsam Kathedralen aus lebenden Stämmen, zwischen denen religiöse Rituale, wie etwa Tieropfer, abgehalten wurden. Christliche Missionare ließen daher alle infrage kommende Bäume fällen und pflanzten steinerne Heiligtümer auf die Hügel, um die Heiden zum Kirchgang zu bewegen.
Waren zur Römerzeit viele Wälder gerodet, so kehrte mit der Völkerwanderung um das Jahr 400 n. Chr. der Urwald in die verlassenen Siedlungen und Felder zurück. Doch schon innerhalb eines Baumlebens, also nach 500 Jahren, legten die zugewanderten Siedler wieder die Axt an. Die Namen der Orte, die in dieser Zeit entstanden, enden oft auf »-rath«, »-roth«, »-rode«, »-reuth« oder »-feld«. Trotz der Fällungen blieb aber noch ein ansehnlicher Teil unberührter Natur erhalten.
Die zweite mittelalterliche Rodungsphase setzte dem Wald weiter zu. Er musste nicht nur für Siedlungen weichen, sondern lieferte den Rohstoff für den Großteil des wirtschaftlichen Lebens.
Das Mittelalter mit seinen aufblühenden Städten wird als hölzernes Zeitalter beschrieben – ohne Bäume wäre es nicht denkbar gewesen.
Selbst die beginnende Industrialisierung stützte sich auf die geplünderten Wälder. Köhler, schwarze, verräucherte Gesellen, brannten zu Tausenden in stinkenden Meilern aus Buchen- oder Eichenholz Holzkohle. Auf kreisrunden Plätzen, zwischen fünf und zehn Meter im Durchmesser, errichteten sie ordentlich geschichtete Hügel aus Holz, die anschließend mit einer Erdschicht bedeckt wurden. In Brand gesetzt, kokelte und qualmte das Ganze etwa zwei Wochen vor sich hin, immer wieder begutachtet vom »schwarzen Mann«, der den richtigen Zeitpunkt zum Löschen nicht verpassen durfte. War es so weit, so wurde der Haufen mit Wasser aus einem nahen Bach durchnässt, und fertig war der begehrte Rohstoff. Um die Transportwege kurz zu halten, siedelten sich die ersten Stahlhütten, Glashütten oder Salzsiedereien inmitten der Wälder an. Und beschleunigten so deren Verschwinden.
Wälder mussten mit der Einführung des Ackerbaus den Anbauflächen weichen, außerhalb der Ackerflächen weideten Kühe oder Schafe. Halboffene Landschaften entstanden.
Erst die Entdeckung der Stein- und Braunkohle beendete den Raubbau in den verbliebenen Waldresten. Die Industriebarone wanderten zu den Kohleminen, etwa ins Ruhrgebiet, ab und konnten ob der schier unerschöpflichen Energieträger ungebremst expandieren.
Zurück blieben verödete Landschaften, deren Wiederaufforstung die sich bildenden Forstverwaltungen zur Aufgabe machten. Großen Teilen der verarmten Landbevölkerung war über die Generationen die Waldgesinnung völlig abhandengekommen. Das spiegelt sich sogar in den Märchen und Mythen, in denen Wald etwas Bedrohliches hat.
Die kargen Heidelandschaften wurden als Weidefläche für einen viel zu großen Bestand an Schafen und Ziegen benötigt – Bäume störten da nur. Zwar ließen die militärisch organisierten Forstverwaltungen Samen verschiedenster Baumarten an die Bauern verteilen mit der Order, diese in den ausgelaugten Boden zu säen. Doch die hungrige Bevölkerung dörrte das Saatgut nachts auf der Herdplatte mit der Folge, dass die unter den wachsamen Augen der Forstbeamten ausgebrachten Eicheln, Kiefern- und Fichtensamen zu keinem Erfolg führten.
Um die gleiche Zeit hatte sich, dem Zeitalter der Aufklärung sei Dank, der Blick auf die Natur geändert: Sie wurde so lange wissenschaftlich seziert, bis ihr schließlich das Mystische abhandenkam. Eingeteilt in Zahlen und Fakten schien sie berechenbar, besser noch planbar geworden zu sein. Dementsprechend legte man die neuen Wälder nun generalstabsmäßig an. Herangezogen in Pflanzgärten, ausgebracht von Bauern, die sich im Winter als Waldarbeiter verdingten, nahm die Wiederbewaldung bald große Maßstäbe an. Den Förstern, rekrutiert aus militärischen Jägerregimentern, waren dabei klare Linien am liebsten. Zugleich musste alles verbuchbar und kontrollierbar sein. Was lag da näher, als die neuen Forste in Kästchenform anzulegen? War beispielsweise eine Baumart in ihrem Wachstum auf 100 Jahre geplant, so waren im Laufe der Zeit 100 Waldquadrate zu pflanzen, eines pro Jahr. Erreichte ein Kästchen mit Bäumen das ihm zugedachte Höchstalter, so konnte es abgeholzt und anschließend wieder aufgeforstet werden. In dieser (theoretischen) Idealform stand in jedem Jahr eine Fläche zum Kahlschlag zur Verfügung, ohne dass der Nachschub stockte. Die Idee der Nachhaltigkeit war geboren. Zwar störten immer wieder Stürme oder auch Insekten das Konstrukt, indem sie ungefragt komplette Waldgebiete vernichteten. Dennoch halten bis heute die meisten Forstverwaltungen an dieser Flächenwirtschaft fest. Im Fachjargon wird sie Altersklassenwald genannt, weil die Bäume auf einer Flächeneinheit alle gleich alt (weil zum selben Zeitpunkt gepflanzt) sind. Mit Natur hat das Ganze allerdings nicht mehr viel zu tun. Um zu verstehen, wie weit diese monotonen Plantagen von ursprünglichen Wäldern entfernt sind, lassen Sie uns einen Blick in die Urwälder werfen.
Im Porträt: die Birke
Die häufigste Birkenart ist die Sand- oder Hängebirke (Betula pendula). Sie ist mit ihrer weiß-schwarz gefärbten Rinde und den hängenden Zweigen gut zu bestimmen. Ihr riesiges Verbreitungsgebiet von Süditalien bis Nordschweden lässt erkennen, dass sie eigentlich überall gut zurechtkommt. Nur wenn es besonders nass wird, wird sie von ihrer Schwester, der Moorbirke (Betula pubescens), abgelöst.
Birken sind wahre Einpeitscher: Alles muss schnell gehen, und so schießen sie in den ersten Jahrzehnten ihres Lebens teilweise über einen Meter pro Jahr in die Höhe (Endgröße etwa 25 Meter). Dabei dulden sie keine Konkurrenz durch andere Arten. Ihre hängenden, flexiblen Äste peitschen bei jeder Windbewegung die Kronen von Konkurrenten, sodass diese ihre obere Äste verlieren. Dieses egoistische Verhalten spiegelt ihre Natur des Einzelkämpfers wider, denn Birken brauchen keinen schützenden Mutterbaum, kommen bestens alleine zurecht. Sind sie allerdings ausgewachsen, so können in ihrem hellen Schatten viele andere Arten geschützt aufwachsen, denn Birken gehen mit Licht sehr verschwenderisch um und lassen davon jede Menge bis zum Boden durchdringen.
Das impulsive, stürmische Leben hat seinen Preis: Mit 120 Jahren ist das Höchstalter für Bäume sehr gering.
Bäume in Freiheit
Die Vorgänge, auf die wir in ursprünglichen Wäldern treffen, sind von einer unfassbaren Langsamkeit geprägt. Der moderne Begriff der »Entschleunigung« scheint wie gemacht für diese Ökosysteme.
Schon die winzigen Sämlinge werden von ihren Baumeltern im Wachstum gebremst. Die Resthelligkeit, welche durch die mächtigen Kronen bis zum Boden durchdringt, beträgt nur noch drei Prozent des Tageslichts – zu wenig zum Leben, zu viel zum Sterben. Um den Kleinen über das Schlimmste hinwegzuhelfen, knüpfen die Mutterbäume zarte Bande über die Wurzeln – und versorgen den Nachwuchs mit Zuckerlösung. Derart gebremst, aber auch gefördert, mickern die Jungbäume viele Jahrzehnte vor sich hin. Der biologische Sinn: Das ganz langsam gebildete Holz des Stämmchens ist äußerst dicht, damit sehr pilzresistent und flexibel. Stammverletzungen führen somit nicht zu einer lebensbedrohenden Fäulnis, und in Stürmen biegt sich der Baum, ohne zu brechen.
Der Lichtmangel ist natürlich kein Zufall: Er zwingt die Schösslinge dazu, gerade zu wachsen. Denn nur dann entsteht im Stamminnern ein gleichmäßiger Faseraufbau ohne Abweichungen oder Knicke, welche Sollbruchstellen darstellen würden.
Der lotrechte Wuchs wird erreicht, indem der Nachwuchs in regelrechten Kindergärten aufwächst. Diese Gruppen »streiten« sich um jeden Sonnenstrahl. Meint nun einer der Zöglinge, mit dem Leittrieb seitlich abbiegen zu müssen, so ziehen die anderen durch ihr Wachstum langsam an ihm vorbei und knipsen ihm das Licht aus. Der Krumme verhungert im Schatten der Musterschüler und wird wieder zu Humus.
Eines fernen Tages, wenn der Mutterbaum sein Leben aushaucht, seine verdorrten Äste die Helligkeit ungehindert bis zum Boden durchlassen, startet das größte Exemplar der Kindergartengruppe durch und wächst rasch zu einem stattlichen Baum heran.
Allerdings ist der Tod eines Riesen ein seltenes Ereignis. Die meiste Zeit über passiert in einem Urwald – nichts. Im Dämmerlicht können neben dem Baumnachwuchs kaum andere Pflanzen überleben, sodass ursprüngliche Wälder eher großen Hallen gleichen, zwischen deren Säulen der Wanderer umherwandeln kann – und zwar ohne Machete. Wälder hingegen, ob in Mitteleuropa oder am Amazonas, in denen Ranken und Sträucher den Weg versperren, sind grundsätzlich Sekundärwälder, Gebiete also, in welchen der Mensch schon einmal Holzeinschlag betrieben hat. Der Grund für die Dickichte: Fehlt die »Lichtbremse« in Form eines geschlossenen Kronendachs von Altbäumen, so kann am Boden allerlei Vegetation aufkommen, der es sonst zu dunkel wäre.
Bäume sind von Natur aus also sehr bedächtige Wesen, denen jede Hast fremd ist.
Baumsämlinge von Tannen, Fichten oder Buchen sind Nesthocker. Sie brauchen den Schutz und die Erziehung durch ihre Eltern.
Von Nesthockern und Nestflüchtern
Im Tierreich kennt man diese Begriffe: Als Nesthocker bezeichnet man Nachwuchs, der schön bei den Eltern bleibt und deren Fürsorge bedarf. Nestflüchter dagegen sind gleich nach der Geburt selbstständig, versorgen sich in Eigenregie und erkunden die Welt auf eigene Faust. Bei Baumkindern ist es nicht anders. Die meisten Arten brauchen, wie zuvor schon beschrieben, den Schutz und die Erziehung durch die eigenen Eltern. Vertreter dieser Kategorie sind beispielsweise Buchen, Eichen, Weißtannen oder Fichten. Notfalls genügen auch Stiefeltern, also fremde Bäume. Für einen gesunden Wuchs müssen aber in jedem Fall Altbäume über den Schösslingen stehen. Nesthocker haben daher in der Regel schwere Samen, die direkt neben dem Mutterbaum zu Boden plumpsen, damit die Kleinen schön bei der Mama bleiben. Trotzdem ist für einen Teil der Früchte auch ein gewisser Ferntransport wünschenswert, damit sich die Art neue Verbreitungschancen sichert. Manche bewerkstelligen dies mittels aerodynamischer Konstruktionen, wie etwa Propellern, mit deren Hilfe die Nüsschen vieler Nadelbäume, aber auch der Ahornarten Stürme für eine Art Auswanderung nutzen. Denn da Bäume ja nicht wandern können, müssen diesen Part die Embryos übernehmen (nichts anderes sind Samen nämlich). Bei den schwersten Baumsamen übernimmt den Transport ein tierischer Kurier. So legt der Eichelhäher nach jüngsten Forschungsergebnissen bis zu 10 000 Verstecke mit Eicheln oder Bucheckern an, die er aber nicht alle braucht. Die nicht verzehrten Leckereien keimen im Frühjahr in der Fremde und bilden den Grundstock für neue Eichen- oder Buchenwälder. Der größte Teil der Früchte bleibt jedoch in der Heimat.
Mithilfe solcher Tierkuriere in neue Landschaften aufzubrechen, ist ein langwieriger Prozess. Denn die Depots werden in der Regel höchstens einige Kilometer entfernt vom Mutterbaum angelegt. Nach 50 bis 100 Jahren Wartezeit geht die Reise weiter. Denn erst jetzt ist der aus den Samen entstandene Nachwuchs in der Lage, selber zu blühen und sich zu vermehren. Mit diesen Trippelschritten beträgt die Ausbreitungsgeschwindigkeit von Buchen und Eichen nur 20 Kilometer pro Jahrhundert.
Ganz anders ist dies bei Nestflüchtern. Ihre Embryos sind im Wortsinne federleicht. Um tatsächlich mit dem leisesten Windhauch auf Reisen zu gehen, geben ihnen die Eltern Flugkonstruktionen mit auf den Weg. Die schwereren Samen, etwa der meisten Nadelhölzer und der Ahornarten, besitzen Rotorblätter. Damit können sie den Fall vom Baum abbremsen und gleiten wie ein Hubschrauber durch die Lüfte.
Besser noch ist eine drastische Gewichtsreduzierung auf wenige Milligramm. Sind diese staubkorngroßen Samenkörner dann auch noch mit hauchzarten Haaren bestückt, steht einer Fernreise nichts mehr im Wege. So ausgerüstet können in einem Sturm Hunderte Kilometer überbrückt werden; entsprechend schnell kann die jeweilige Baumart wandern und neue Lebensräume erobern. Birken, Weiden und Pappeln sind solche Vertreter. Ihr Nachwuchs pfeift im Gegensatz zu Urwaldbäumen auf Erziehung und Schutz, ist ganz darauf trainiert, am neuen Standort flott in die Höhe zu schießen. Dazu brauchen sie allerdings viel Licht am Boden, welches es in waldfreien Gebieten im Überfluss gibt. Im Fachjargon nennt man sie auch Pionierbaumarten, weil sie überall dort Fuß fassen können, wo noch kein Wald existiert. Das rasche Wachstum hilft ihnen, der Konkurrenz durch Kräuter und Sträucher zu enteilen. Der Nachteil dieser Schnelligkeit und Hast, die ja eigentlich ganz baumuntypisch sind, besteht in einer erheblich kürzeren Lebenserwartung. So überschreitet kein Pionierbaum ein Alter von 150 Jahren, die wenigsten davon werden überhaupt 100 Jahre alt. Im dunklen Urwald haben Birken und Co. keine Chance, da ihr Nachwuchs im ewigen Dämmerlicht regelrecht verhungert. Daher sind sie auf Flächen angewiesen, in denen die Urwaldbildung gestört ist (wie etwa Waldbrand- oder Sturmwurfflächen). Oder auf Ihren Garten!
Die Wuchsform
Bevor wir ins Detail gehen und uns die einzelnen Bestandteile der Bäume genauer ansehen, sollten wir einen Blick auf die Gesamtform werfen. Denn diese verrät uns oft schon von Weitem, wie es um den Baum bestellt ist. Um die entsprechenden Schlüsse ziehen zu können, müssen wir uns zunächst einen Überblick darüber verschaffen, nach welchen Prinzipien Nadel- und Laubbäume wachsen.
Nadelbäume sind stur. Egal, was kommt, sie entwickeln schön gerade Stämme, die exakt nach oben weisen. Oder genauer gesagt streben sie immer in die entgegengesetzte Richtung wie die Schwerkraft. Ein Baum ist so gerade wie der andere, und das prägt auch die gewisse Monotonie von Nadelwäldern. Diese Uniformität macht es uns besonders leicht, Abweichungen festzustellen. So schaffen es starke Sturmböen manchmal nicht, einen Baum vollständig umzuwerfen. Mit letzter Kraft klammert sich dieser an den Boden, sodass sein Wurzelteller nur von der Windangriffsseite her hochgehoben wird. Auch wenn es nur wenige Zentimeter sind, so bewirkt diese Anhebung doch eine sichtbare Schiefstellung des Stammes. Gelingt es dem Baum, nochmals feste Erde unter die Füße zu bekommen, genauer gesagt, sich mit neuen Wurzelausläufern zu verankern, so kann das Wachstum weitergehen. Und zwar wieder senkrecht nach oben. Den schiefen Schaft kann der Baum nicht mehr korrigieren, da er ja immer nur an den Zweigspitzen, sprich oben, weiterwächst. Demzufolge entsteht ab diesem Moment eine Kurve im Stamm. Wenn Sie die Jahre von oben herab bis zum Beginn der Krümmung abzählen (siehe »Altersschätzung« auf Seite 117), so können Sie auch nachträglich den Zeitpunkt des Sturms feststellen.
Es gibt noch andere Kräfte, die einen Baum aus dem Gleichgewicht bringen. Wirken diese über lange Zeiträume gleichmäßig hinweg, wie beispielsweise häufige Winde in rauen Höhenlagen, so wächst der Stamm wie eine lang gezogene Kurve. Eine ähnliche Wirkung hat das sogenannte »Bodenfließen«. In Hanglagen ist die obere Bodenschicht oftmals instabil. Sie »fließt« im Laufe der Jahre wie zäher Pudding ganz langsam zu Tal, oft nur im Bereich von Zentimetern oder Millimetern pro Jahr. Mit bloßem Auge ist das nicht wahrzunehmen, aber die Bäume verraten die Bewegung. Im gleichen Maße, wie der Schaft durch den rutschenden Untergrund schiefgestellt wird, versucht er oben wieder gerade zu wachsen. Das Resultat ist ebenfalls ein bogenförmiger Stamm.
Laubbäume verhalten sich grundsätzlich nach denselben Gesetzmäßigkeiten. Sturm oder Boden können also zu gleichen Wuchsbildern, zu ähnlich schiefen oder gekrümmten Stämmen führen wie bei den Nadelbäumen. Es gibt aber doch einen entscheidenden Unterschied: Obwohl es bei Laubbäumen auch möglichst senkrecht nach oben geht, halten sie sich nicht sklavisch an diese Vorgabe. Sobald es die Chance gibt, irgendwo mehr Licht zu erhaschen, biegen sie ab. Sie recken sich mit ihren Ästen in Richtung Helligkeit, und aus dem kräftigsten dieser Äste wird später der Stamm.
Welche Ursache für den Schiefstand verantwortlich ist, verrät bei Laubbäumen erst ein Blick auf die Lichtsituation. Gerade an Waldrändern ist der Unterschied zwischen Laub-und Nadelbaum gut zu beobachten. Während die benadelten Kollegen brav aufwärts streben, drängeln sich junge Laubhölzer ungestüm zum Rand hin durch. Der Vorteil: Obwohl Bäume naturgemäß ihren Standort nicht wechseln können, kann ein Laubbaum seinen Kronenaufbau um immerhin bis zu fünf Meter seitlich verlagern. Klingt nicht viel, ist aber ein bedeutender Unterschied. Das vermag eine kleine Beispielrechnung verdeutlichen: Ein Nadelbaum kann einen Kronenradius von acht Metern erreichen. Somit ist er auf die Lichtverhältnisse angewiesen, die auf diesen 201 Quadratmetern herrschen (= Kreisfläche der Krone). Ist auf dieser Fläche nicht genügend Platz und kein ausreichendes Licht vorhanden, da hier schon Konkurrenten stehen, so kann aus dem Baum nichts werden. Selbst wenn einige Meter entfernt jede Menge Sonnenstrahlen auf den Boden treffen, nutzt das dem jungen Baum wenig, da er ja nicht zur Seite wachsen kann. Bestenfalls wartet er lange Zeit und hofft, dass einer der Vorgänger das Feld durch Absterben räumt und so das Licht von oben anknipst. Laubbäume dagegen können in der schon geschilderten Weise die Krone verlagern, indem sie einfach einen schiefen Stamm ausbilden. Bei angenommen maximal fünf Meter Verlagerung und gleichem Kronendurchmesser erhöht sich dementsprechend der Radius um den Stamm von acht auf dreizehn Meter. Damit vergrößert sich die Fläche, auf der sich eine Lichtmöglichkeit finden kann, auf beachtliche 531 Quadratmeter. Durchschnittlich haben Laubbäume mehr als doppelt so viele Chancen, ein Fleckchen mit genügend Licht zum Wachstum zu ergattern. Das kann für das Überleben entscheidend sein.
Laubbäume können ihre lichtarmen Standorte nicht wechseln, aber ihre Kronen so verlagern, dass sie viele Sonnenstrahlen einfangen.
Bäumchen im Wartestand, denen es momentan zu dunkel ist und die auf mehr Helligkeit in der Zukunft hoffen, können Sie übrigens recht einfach erkennen: Egal, ob Nadel- oder Laubbaum, alle bilden längere Triebe an den Seitenästen als am Leit-/Höhentrieb. Das hat einen simplen Grund: Mit Volldampf alles in das Wachstum nach oben zu investieren, ist vergeudete Energie, da die Kraft im Schatten großer Bäume einfach nicht zum Erreichen des obersten Stockwerks ausreicht. Sinnvoller ist es, das bisschen Licht, welches zwischen den Altbäumen den Boden erreicht, möglichst vollständig aufzufangen. Und das kann man nur, indem man mit den Ästen rasch in die Breite wächst.
Das alles kann man aber auch weniger theoretisch sehen, ohne den Blick für das Wesentliche zu verlieren: Achten Sie einmal bei Ihrem nächsten Waldspaziergang auf Laubbäume verschiedenster Größen. Auch ohne die vorangegangenen Erklärungen können Sie intuitiv deren Zustand erfassen. Sind es hohe, majestätische Bäume mit einer mächtigen Krone? Diese haben es tatsächlich geschafft und sind die Herrscher des Waldes. Oder stehen sie gekrümmt und geduckt unter den größeren Exemplaren? Solche Bücklinge leiden wirklich unter der »Lichtknute« der Herrschenden, ducken sich weg und kümmern vor sich hin.
Jede Baumart besitzt eine charakteristische Form der Krone und der Zweige. So biegen sich die Astenden von Rosskastanien wie altmodische Schnurrbärte nach oben, während ältere Birken die Arme hängen lassen. Dahinter steckt oft ein tieferer Sinn: So recken sich beispielsweise Buchenzweige himmelwärts, um jeden Regentropfen zu ergattern. Entlang der Äste rinnen diese dann zielgerichtet zu den eigenen Wurzeln.
Bei Fichten gibt es unterschiedliche Rassen. Die eine lässt die Zweige von den Ästen baumeln, ganz wie Lametta vom Weihnachtsbaum. Was ein wenig traurig anmutet, dient dem Auskämmen von Nebel: Wabern die Schwaden im Frühjahr und Herbst durch die Krone, so hebt unter dem Baum bald ein heftiges Tropfen an. Fichten dieser Kategorie lassen es somit regnen, während andere Arten noch dürsten müssen.
Vertreter der schneereichen Regionen ordnen ihre Äste und Zweige dagegen dachziegelartig übereinander an. Fällt im Winter die weiße Pracht, so summiert sie sich zu einer tonnenschweren Last. Die Äste werden heruntergedrückt, allerdings ohne zu brechen. Denn die obere Lage stützt sich auf der jeweils unteren ab, sodass der eingepuderte Baum schließlich mit angelegtem Grün schmal und wartend da steht.
Auch die Birke verfolgt mit ihrem hübschen Hängewuchs kein optisches Ziel. Die pendelnden Zweige erinnern an Peitschen, und genau dies ist der Sinn. Steht nebenan ein anderer Baum, so bekommt er mit jedem Windstoß einen Schlag. Über die Monate und Jahre hält das auch der stärkste Trieb nicht aus: Er stirbt ab, das Höhenwachstum ist damit vorerst beendet. Konkurrenten der Birke kommen neben ihr im Wachstum oft nicht recht voran und bezeugen ihr Leid mit einem zerfetzten Gipfel.
Kronengröße
Bäume sind soziale Wesen, und wie in jeder Gemeinschaft gibt es Hierarchien. Der absolute Spitzenplatz ist im Wortsinne ganz oben, über den Wipfeln der anderen. Hier scheint die Sonne ungehindert auf die Blätter, hier können Zucker und Holz im Überfluss gewonnen werden.
Im oberen Stockwerk bekommt der Baum am meisten Licht und bildet eine mächtige Krone aus. In Ihrem Garten oder in Parks gilt das für fast alle Bäume, da der Abstand zwischen ihnen meist so groß ist, dass sich jeder ungestört entwickeln kann. Im Wald sieht die Sache jedoch ganz anders aus, da sich hier Tausende Exemplare nach dem Licht recken. Sie kämpfen dabei zwar nicht gegeneinander (siehe Kapitel »Freunde« auf Seite 53), haben aber dennoch sehr unterschiedliche Stellungen. Man kann sogar ohne Übertreibung von einer Rangordnung sprechen, ähnlich einem Wolfsrudel. Auch hier würde jedes Tier gerne die Spitzenposition einnehmen, profitiert aber als rangniederes Mitglied ebenfalls von der Gemeinschaft.
Oberhäupter eines Waldes sind die großen Exemplare, welche mächtige Kronen gleichmäßig nach allen Seiten ausbauen konnten. Die ausladenden Äste tragen rund 200 000 Blätter, die über 1000 Quadratmeter Oberfläche bilden, bei ausgewachsenen Nadelbäumen sind es sogar noch einige Quadratmeter mehr. Neben ihnen stehen Bäume, die zwar gleich hoch sind, aber eine erheblich geringere Kronenausdehnung haben. Sie besetzen die kleinen Lücken, die zwischen den Riesen verbleiben. Auch sie sind in der Blüte ihrer Jahre, haben Teil am Sonnenbad in den Wipfeln, können aber wegen der kurzen Äste und der reduzierten Blattmasse deutlich weniger Kraft tanken als die mächtigen Nachbarn.
Steigen wir in der Rangfolge tiefer hinab, und zwar wörtlich. Denn das obere Stockwerk ist mit den zwei zuvor genannten Kategorien voll besetzt, sodass für weitere Bäume kein Platz mehr verbleibt. Wer es nicht bis ganz oben schafft, muss warten. So sind solche Exemplare etliche Meter kürzer und damit vom direkten Lichteinfall abgeschnitten. Ihre Krone ist schmaler, die Äste sind dünner. Oft biegt sich die Spitze zur Seite, so als ob der Baum resigniert. Diese Bäume sind die Kronprinzen, haben aber, ähnlich wie Prinz Charles in Großbritannien, schier endlos lange zu warten, bis sie an die Reihe kommen. Wachsam müssen sie aber dennoch sein. Denn wenn eines Tages eines der Oberhäupter müde wird und stirbt, so gilt es, rasch in die entstehende Lücke hineinzuwachsen, bevor es ein anderes Bäumchen tut. Denn sobald ein Nachrücker den Platz einnimmt, ist der Vorhang wieder geschlossen, und die nächste Chance kann durchaus erst in 200 Jahren kommen. So lange aber kann nicht jeder kleine Baum warten, für viele von ihnen ist die Reise schon vorher zu Ende, und sie zerfallen zu Humus.
Bei Lichtmangel verharren kleine Bäumchen jahrzehntelang. Ist der mächtige Nachbar eines Tages weg, wird für sie der Platz an der Sonne frei.
Von unten können Sie diese Rangordnung als Spaziergänger nicht immer einwandfrei erkennen. Es gibt aber ein einfaches Hilfsmittel: den Stammdurchmesser. Ohne Wenn und Aber gilt die Regel: je dicker der Baum, desto höher die Position. Denn in einem Wald wachsen entgegen der landläufigen Meinung nur die größten Bäume rasch; sie haben die umfangreichste Fläche an Sonnensegeln und produzieren damit auch die größten Mengen an Zucker, Proteinen und Holz. Die Kleinen unter ihnen verharren mangels Licht jahrzehntelang als dünne Bohnenstangen. Wie wenig das Wachstum solcher Zwerge voranschreitet, verdeutlicht ein Beispiel aus meinem Revier: Da steht eine mächtige, etwa 200 Jahre alte Buche neben einem mickrigen Bäumchen, dessen Stamm kaum zehn Zentimeter Durchmesser bringt und dessen Gesamthöhe rund sechs Meter beträgt. Seine flach abstehenden Äste signalisieren, dass es den Kampf ums Licht, den Trieb in die Höhe, vorerst aufgegeben hat. Das geschätzte Alter dieses Zwerges sind schier unglaubliche 150 Jahre.
Schlaksig oder stämmig
Bäume müssen, um erfolgreich zu sein, sehr alt werden. Zum einen setzt man sich nur dann gegen die Konkurrenz durch, zum anderen sollten zahlreiche Jahre mit reicher Samenproduktion folgen, um dereinst wenigstens einen Nachfolger mit dem eigenen Erbgut zu haben.