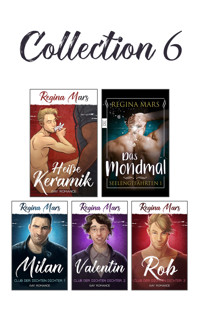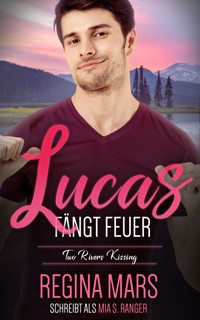4,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: via tolino media
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Liebe, Täuschung, Küsse im Schnee Mein neuer Job ist zu gut, um wahr zu sein: Als Privatlehrer ziehe ich ins ländliche Frankreich, in das prunkvollste Anwesen, das ich je gesehen habe: Beauregard. Endlich hat sich mein Schicksal gewendet. Dachte ich. Leider geschehen seltsame Dinge. Meine Schülerin gerät in Lebensgefahr, nachts flüstert die Villa mir ihre Geheimnisse zu und aus dem Wald erklingt ein Heulen, das nur ich höre. Und dann ist da Alain. Der teuflisch attraktive Sohn der Gutsbesitzer ist ständig da, wo ich ihn am wenigsten erwarte: in meiner Nähe. Seine Küsse rauben mir den Atem, sein Lachen lässt mein Herz beben ... und in schwachen Momenten denke ich, dass er dasselbe fühlen könnte wie ich. Aber das kann er nicht. Oder? Als ich merke, welches Spiel gespielt wird, bin ich längst in Lebensgefahr. »Beauregard im Nebel« ist eine atemberaubende M/M-Romanze mit düster-romantischer Atmosphäre und unvergesslichen Figuren.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2025
Ähnliche
Kapitel 1
Ich war zwölf, als ich verschwand.
Ich lernte, mich unsichtbar zu machen, in der Menge unterzugehen, vor weißen Raufasertapeten und blätternden Fassaden unbemerkt zu bleiben.
Es schützte mich. Gesehen zu werden hieß, von den falschen Leuten gesehen zu werden, und das gab immer Ärger. Das hatte ich schon an meinem ersten Tag im Heim gelernt.
Sie wussten nicht, wohin sie mich schicken sollten, nachdem meine Eltern gestorben waren. Keine lebenden Verwandten, keine Pflegefamilie, die mich aufnehmen wollte, niemand. Ich kam ins Rostocker Heim für Jungs, die niemand haben will.
Und verschwand.
Unsichtbar zu sein bedeutet nicht, ganz zu verschwinden. Die anderen sind sich bewusst, dass jemand da ist. Es interessiert sie nur nicht. Und das ist die wahre Kunst.
Ich sprach mit ihnen. Ich bewegte mich durch die tristen Räume, aß mit den anderen, zockte mit ihnen, war da. Aber niemand beachtete mich wirklich. Ich konnte mich so weit in mich selbst zurückziehen, dass sie später nicht einmal sagen konnten, ob ich dabei gewesen war oder nicht.
Bis auf eine Ausnahme.
Kapitel 2
Drei Wochen, bevor ich diesen Mistkerl Alain traf, stieg ich aus dem TGV.
Ich hatte die Fahrt in der Zugtoilette verbracht, um den Schaffnern zu entgehen, und der Geruch nach Desinfektionsmittel und Seife hing mir immer noch in der Nase. Sobald ich den Fuß auf den Bahnsteig setzte, atmete ich auf.
Es hatte funktioniert. Der gelbe Zettel mit der Aufschrift ‚WC inutilisable‘ hatte echt genug ausgesehen, dass niemand sich über die ständig geschlossene Toilette gewundert hatte. Sehr gut. Die Fahrkarte nach Paris hätte ich mir niemals leisten können.
Ein Stoß in den Rücken ließ mich zusammenzucken.
»Oh, pardon.« Überrascht sah der Mann hinter mir mich an. Er war gegen mich gestolpert. Ein Nachteil des Unsichtbarseins.
»Kein Problem«, erwiderte ich und sah, wie er mich bereits wieder vergaß.
Mein erster Austausch auf Französisch mit einem echten Franzosen. Offensichtlich hatte ich nichts verlernt. Zuhause hatten wir Französisch gesprochen, weil meine Mutter es in Rostock so vermisst hatte. Es war immer mein Traum gewesen, nach Paris zu kommen, und an diesem kalten Morgen erfüllte er sich.
Farben schälten sich aus dem Grau, als ich über den Bahnsteig schlappte, den schweren Rucksack geschultert. Ein erster Sonnenstrahl brachte die wartenden Züge zum Glitzern und ich gähnte. Aufregung rumorte in meinem Magen. Automatisch unterdrückte ich sie. Es ist schwer, unsichtbar zu sein, wenn man aufgeregt ist.
Ich bin da, dachte ich kurz darauf und erlaubte mir ein winziges Lächeln.
Schwankend, die Finger um die schmierige Metallstange des U-Bahn-Waggons geklammert, war ich da, wo ich immer hatte sein wollen: Paris.
Leider ging es ab hier weiter. Ich hatte keine Zeit, durch die Straßen zu schlendern, von denen meine Mutter mir erzählt hatte. Ich hatte einen Job.
Nicht meinen ersten Job, bei weitem nicht. Aber vielleicht den ersten, den ich nicht hassen würde.
Das Studium hatte ich mir in einem Laden namens ‚BurgerBoss‘ finanziert, und obwohl ich schon vor einem Monat gekündigt hatte, haftete der Duft nach schalem Fett immer noch an mir. Oder bildete ich mir das nur ein? Ich glaubte zumindest, ihn zu riechen, selbst jetzt.
Hast du Interesse an was Besserem?, hatte Thomas, einer meiner Kommilitonen, mich gefragt. Es ist grad was reingekommen.
Er kümmerte sich um die Jobbörse der Uni und war damit in einer mächtigen Position.
Klar, hatte ich gesagt und jetzt war ich hier.
Na ja. Ganz so leicht war es nicht gewesen. Ich hatte Mitbewerber gehabt. Viele. Die Stelle war dreimal so gut bezahlt wie mein bisheriger Job als König des ranzigen Bratfetts. Und erstaunlicherweise hatte ich ihn bekommen. Erstaunlicherweise war ich nicht wie sonst übersehen, sondern erwählt worden.
Privatlehrer.
Ich kam mir vor wie ein Hochstapler, wenn ich das Wort auch nur dachte. Privatlehrer, ich? Darunter stellte ich mir einen ergrauten Herrn mit Lederflicken an den Ellbogen seines Tweedjacketts vor, keinen unscheinbaren Zweiundzwanzigjährigen in einem schlecht sitzenden Hemd, das sich anfühlte wie eine Verkleidung. Cedric Joos, Privatlehrer. Das Schildchen juckte im Nacken, aber ich hielt es aus. Ich wollte wenigstens halbwegs angemessen aussehen, wenn ich bei meiner neuen Stelle ankam. Wie sehr das misslang, sah ich in der Spiegelung der Fensterscheibe, neben dem schlafenden Gesicht einer älteren Frau.
Das Hemd rettete nichts. Meine aschblonden Haare waren zu kurz geschoren, die Hansa Rostock-Bomberjacke zu abgewetzt, mein Gesicht zu jung. Ich sah aus wie ein erfolgloser Hooligan. Nicht wie der glatzköpfige Anführer, der dir das Hirn aus den Ohren kloppt, wenn du nicht schnell genug aus dem Weg springst. Sondern wie die blasse Pfeife neben ihm, die immer »Genau« sagt, wenn der Boss grunzt.
Und die man sofort wieder vergisst. Wie mich.
Von Paris sah ich nur besprühte Hochhäuser, das Innere mehrerer U-Bahnen und zwei Bahnhöfe. Als mein Zug vom Gare de Bercy aufbrach, wurde meine Brust eng.
Wir fahren nach Paris, Ceddy, hatte meine Mutter gesagt. Nur wir beide, na, vielleicht darf Papa auch mit. Wenn er lieb ist.
Ich bin immer lieb, hatte Papa behauptet. Er hatte nicht mal von seinem Handy aufgesehen.
Beweis es, hatte sie gesagt, und räum den Tisch ab.
Ächzend hatte er sich erhoben.
Natürlich hatten wir es nie nach Paris geschafft. Es war immer zu viel los gewesen und das Geld hatte nie gereicht. Nun, so viele Jahre später, hatte ich es fast geschafft … und dann wieder nicht.
Ich komme zurück, dachte ich. Auf dem Rückweg habe ich Geld, dann nehme ich mir ein Hotelzimmer, bleibe ein paar Tage hier und schaue mir alles an, von dem Mama erzählt hat.
Ich würde im Little Breizh ein Crêpe essen, mit Maronencreme UND Salzkaramell, weil meine Mutter behauptet hatte, das wäre das beste von ganz Paris. Ich würde an der Seine entlang spazieren und den Künstlern zusehen, wie sie Touristen malten. Am 14. Juli würde ich auf einem Grasstreifen unterhalb des Eiffelturms sitzen, der Musik lauschen und dem Feuerwerk zuschauen. Ich würde jede noch so klischeehafte Touristenattraktion mitnehmen, und zwischendurch, einen Moment lang, würde es sich anfühlen, als wäre ich mit meinen Eltern hier.
Ganz bestimmt.
Der 14. Juli war noch weit entfernt. Es war gerade einmal November und der Zug schoss durch klebrig-nasse Landschaften voller brauner Blätter. Weg von Paris, tief hinein ins ländliche Frankreich, aber das war egal. Ich war meinem Traum näher als je zuvor und ich würde es schaffen.
Privatlehrer in der Auvergne, bei Familie Rouanet. Das würde sich gut auf meinem Lebenslauf machen, der bisher leider wenig imposant war. Während meine reicheren Kommilitonen spannende Praktika machten, musste ich mich mit spritzenden Fritteusen, kotzenden Kindern und überlaufenden Toiletten herumschlagen. Und mit Leuten, die ausrasteten, weil das Ketchup nicht gratis war. Und das war nicht mal das Schlimmste an meinem Lebenslauf. Das Jahr im Jugendknast verschwieg ich inzwischen, das führte nur zu unangenehmen Fragen und außerdem Absagen.
Wieder fragte ich mich, warum Familie Rouanet ausgerechnet mich eingestellt hatte. Das Vorstellungsgespräch hatte per Videokonferenz stattgefunden. Natürlich auf Deutsch, schließlich hatten sie mich als Deutschlehrer eingestellt. Madame Rouanet hatte mich fünf Minuten lang zu meiner Ausbildung befragt und dann zu meiner Familie … die es leider nicht mehr gab.
Das übliche betretene Schweigen war glücklicherweise kurz gewesen. Sie hatte nicht, wie erwartet, das Thema gewechselt. Stattdessen hatte sie nachgefragt, wie ich aufgewachsen war, was eine nette Abwechslung darstellte. Leider gab es auch hier nicht viel Erfreuliches zu sagen. Ich behauptete, das Heim sei gut geführt gewesen, die Leiter sehr herzlich und die anderen Jungs wie Brüder.
Vielleicht trug ich etwas dick auf, aber ich wusste aus Erfahrung, dass Elend nicht sexy ist. Nie. Wenn man einen Privatlehrer für seine Nichte sucht, möchte man doch etwas Stabiles, Normales. Und nicht … na ja, mich.
Das Gespräch hatte kaum zehn Minuten gedauert und ich war sicher gewesen, dass bald eine knappe, höfliche Absage kommen würde. Stattdessen kam eine Zusage. Ich habe die Mail sicher fünfmal gelesen, bis ich wirklich sicher war, aber sie war echt. Meine erste wirkliche Chance seit zehn Jahren.
Mit dem Geld, das ich dort verdienen würde, konnte ich meinen Bachelor machen, ohne je wieder die Fettschwaden eines Fast Food-Tempels zu riechen. Ich würde Paris sehen. Ich würde frei sein. Es wäre die Art von Freiheit, die man nur durch Geld erreicht. Die Art Freiheit, die für viele meiner Kommilitonen so selbstverständlich war, dass sie sie nicht einmal bemerkten. So, wie man erst bemerkt, dass Luft fehlt, wenn man fast erstickt.
In der Zugtoilette wäre ich ebenfalls fast erstickt. Sie war deutlich verdreckter als die im TGV und ich konnte es kaum erwarten, so reich zu sein, dass ich mir ein ganzes Zugticket leisten konnte, nur für mich.
Ich stieg in Clermont-Ferrand um, und danach wurden die Bahnhöfe kleiner und kleiner. Wenn ich die Toilettentür vorsichtig öffnete, sah ich nur noch bröckelnde Bahnsteige mit viel Wald darum herum.
Überhaupt hörte der Wald gar nicht mehr auf. Stadtkind, das ich war, sah ich mehr Bäume als zuvor in meinem ganzen Leben. Dunkle Laubbäume, noch dunklere Nadelbäume und dann wieder Lichtungen, auf denen trübes Licht über Herbstlaub strich und Kühe zwischen Felsbrocken grasten. Die Sonne zeigte sich den ganzen Tag über kaum und als ich ausstieg, hing die Wolkendecke fast bis auf den Bahnsteig.
Jemand erwartete mich. Eine ältere Frau und eine nicht ganz so alte. Die zweite war Madame Rouanet. Sie musste fast fünfzig sein, aber als waschechte Französin hielt sie sich so gerade wie eine Zwanzigjährige. Ihre feinen Gesichtszüge erhellten sich zu einem Lächeln, als ich näher kam, stockten kurz und lächelten dann weiter. Sie hatte mich bisher nur bis zu den Schultern gesehen und wohl nicht mit der prolligen Bomberjacke gerechnet. Mist.
»Bonjour«, sagte sie und sprach dann auf Deutsch weiter. In vornehmem Hochdeutsch selbstverständlich. Sie hatte zwei Semester an der Humboldt-Universität zu Berlin studiert, das hatte sie mir während des Vorstellungsgesprächs erzählt. Ich hatte mein Bestes getan, um ihren Tonfall zu imitieren. »Ich hoffe, Sie hatten eine angenehme Reise.«
»Ja, danke«, sagte ich und war nicht sicher, wie ich weitermachen sollte.
Madame Rouanet war zu vornehm, um meine unpassende Kleidung zu kommentieren … die mir noch unpassender vorkam, nun, da ich sie sah. Ihr hellgrauer Mantel lag glatt um die schlanken Schultern, und auf den schwarzen Pumps war trotz des feuchten Bodens kein einziger Schlammspritzer zu sehen.
»Ist das alles, was Sie dabei haben, Monsieur Joos?«, fragte sie und deutete auf meinen Armeerucksack.
Ich schluckte. Meine innere Alarmanlage ging los. Ich stach heraus. Mit meiner Kleidung und ganz sicher mit allem anderen. Mein einziger Schutz, meine Unsichtbarkeit, drohte zu verblassen.
»Das ist alles.« Ich lächelte, um ihr zu zeigen, dass ich kein Hooligan war, oder wenigstens ein sehr höflicher Hooligan. »Ich dachte, dass es besser wäre, mit leichtem Gepäck zu reisen. Kleidung kaufen kann ich noch hier.« Sobald mein erstes Gehalt auf dem Konto war. Und sobald ich wusste, mit welcher Art Hemd, Hose und Schuhen ich am besten mit dem Hintergrund verschmolz, nun, da der Hintergrund sich geändert hatte.
Diesmal erreichte das Lächeln ihre Augen. »Eine ausgezeichnete Idee.« Sie deutete auf die andere Seite der Gleise, wo die ersten Häuser einer kleinen Stadt zu sehen waren, nun, da der Zug lärmend in der Ferne verschwunden war. »Ich empfehle Norbert, aber Marine kennt sich besser in Chambon-sur-Lac aus. Nicht wahr, Marine?«
»Ja«, sagte die ältere Frau und grinste mich an. »Ich kann dich übermorgen mitnehmen, wenn du willst. Da gehe ich eh auf den Markt.« Ihr Französisch ähnelte dem meiner Mutter und meine Brust weitete sich.
»Gerne.« Ich nickte. »Wenn ich mit irgendetwas helfen kann, sagen Sie gern Bescheid.«
»Mach ich. Und duzen kannst du mich auch.« Sie steckte die Hände in die Taschen ihrer Daunenjacke und ich hätte mein erstes Gehalt darauf verwettet, dass irgendwo darin eine zerknickte Zigarettenpackung steckte. »Netter junger Mann«, sagte sie zu Madame Rouanet. »Aber ob der eine Chance gegen die Kleine hat?«
»Sie ist ein liebes Mädchen«, sagte Madame Rouanet, so kühl, dass Marine sofort wieder ernst wurde. »Natürlich wird sie auf Monsieur Joos hören.«
Mir fiel nichts Besseres ein als krampfhaft weiter zu lächeln.
»Sie ist wirklich ein liebes Mädchen«, sagte Madame Rouanet zu mir. »Und ich bin sicher, dass Sie einen besonderen Draht zu ihr haben werden.«
»Sicher.« Warum das denn?
»Oh, eine Bitte noch: Könnten Sie mit Louise nur Deutsch sprechen? Es fällt ihr sicher leichter, die Sprache zu lernen, wenn sie keine Wahl hat.«
»Das ist eine gute Idee«, sagte ich. »Mein Freund Sergio hat mir einmal erzählt, dass er nur so schnell Deutsch gelernt hat, weil niemand im Kindergarten seine Sprache verstanden hat.«
Mein Freund Sergio hatte mir gezeigt, wie man mit einer Nagelfeile und einem Stielkamm ein Schloss öffnete. Er war einer der nettesten Jungs im Heim gewesen, und ich hatte geweint, als er mit einem geklauten Auto verunglückt war. Natürlich hatte ich heimlich geweint. Offen zu weinen markierte einen als Opfer, das Gegenteil von unsichtbar.
»Exakt.« Madame wirkte sehr erfreut. Ich beschloss, dass ich sie mochte. Sie wirkte auf mich wie aus einer anderen Welt, aber ich spürte nichts Falsches in ihr. »Gut, dann fahren wir los. Sonst sind wir erst zum Abendessen daheim. Sie möchten sich sicher frisch machen, Monsieur Joos.«
Falls ‚frisch machen‘ bedeutete, aufs Klo zu gehen, war ich sehr dafür. Ich verstaute meinen Rucksack im Kofferraum des schwarzen Porsche Cayenne, mit dem die beiden gekommen waren, und wir fuhren los. Durch schattige Mischwälder, zwischen denen sich die Straße hindurchschlängelte, als müsste sie sich mühsam einen Weg bahnen. Es wurde immer finsterer. Bald prasselten Regentropfen auf die Windschutzscheibe, und die Luft im Inneren wurde stickig und feucht.
Madame Rouanet fuhr. Marine saß hinten bei mir und erzählte davon, was es zum Abendessen geben würde. Glücklicherweise war sie zufrieden damit, dass ich ab und zu anerkennend schaute. Ihr Mann René war der Koch im Haus, und sie war sichtlich stolz auf ihn. Und auf das Haus.
»Beauregard ist ein Traum«, sagte sie. »Ein absoluter Traum. Das schönste Anwesen in der Auvergne.«
Natürlich hielt ich das für übertrieben. Aber sie hatte recht.
Nichts hätte mich auf den Anblick von Beauregard vorbereiten können.
Wir fuhren über viel zu schmale Serpentinen abwärts, als es endlich in Sichtweite kam. Die Baumkronen gaben die Aussicht frei und die Villa schälte sich aus dem Sprühregen. Selbst von weitem war sie beeindruckend. Mehr Schloss als Haus, thronte sie in der Mitte des Tals, so massiv, als würde sie seit Jahrtausenden dort stehen und hätte vor, alle weiteren Jahrtausende zu überdauern. Massive Steine bildeten Mauern, die von halbrunden Fenstern durchsetzt waren und in spitzen Turmdächern endeten.
Die Fenster waren hell erleuchtet, und erst jetzt wurde mir klar, wie finster es geworden war. Dabei war es erst Nachmittag. Ich war seit Mitternacht auf den Beinen und langsam senkte sich die Müdigkeit in meine Knochen. Ein leises Sehnen klopfte an, als ich das warme Licht hinter Beauregards Fenstern sah.
Ein Zuhause, dachte ich. So sieht ein Zuhause aus.
So hatte ich mich gefühlt, wenn ich abends vom Spielen nach Hause gelaufen war und das Licht in unserem Küchenfenster gebrannt hatte.
»Wunderschön, nicht wahr?« Marine deutete auf die Villa. »Ich bin schon seit zwanzig Jahren hier und die Aussicht wird nicht alt. Von innen ist es auch nicht übel.«
»Es ist riesig«, sagte ich. »Ich dachte … Ich wusste nicht …« Ich räusperte mich. »Um ehrlich zu sein, hatte ich etwas Kleineres erwartet.«
Um wirklich ehrlich zu sein, war ich vollkommen überfordert. Ich hätte es ahnen müssen, bei Madame Rouanets eleganter Erscheinung. Aber ich hatte wohl nicht wahrhaben wollen, wie wenig ich hierher passte. Wie sichtbar es mich machte.
»Es sieht aus, als würde ein König dort wohnen«, sagte ich.
»Ein König nicht, aber ein Herzog.« Madame Rouanet klang stolz. »Vor der Revolution war Beauregard der Wohnsitz eines Herzogs. Meine Familie hat es vor fast hundert Jahren gekauft. Aber keine Sorge, es wurde erst vor wenigen Jahren renoviert. Innen ist es sehr modern. Nur das WLAN fällt manchmal aus.«
»Wenn wieder mal ein Baum umstürzt und eine Leitung plättet.« Marine lachte herzlich. »Kommt höchstens fünfmal im Jahr vor.«
»Wir arbeiten daran, unterirdisch Kabel verlegen zu lassen.« Madame Rouanet klang amüsiert. »Nächstes Jahr sollte es endlich so weit sein. Dann müssen wir uns auch nicht mehr das Gefluche meines Mannes anhören, wenn er bei der Arbeit behindert wird.«
»Was arbeitet Monsieur Rouanet denn?«, fragte ich und kapierte im nächsten Moment, dass das eine unhöfliche Frage war. Ein Moment kühlen Schweigens breitete sich aus. Anscheinend war ich bei Leuten gelandet, die so viel Geld hatten, dass man nicht mehr über Geld sprach. Oder über die schmutzigen Dinge, die man tun musste, um an Geld zu kommen, wie Arbeit beispielsweise.
»Er verwaltet unsere Güter«, sagte Madame Rouanet schließlich. »Wir haben Anwesen in der ganzen Region und ein Großteil des Waldes hier und um Chambon-sur-Lac herum gehört ebenfalls meiner Familie.«
»Oh.« Ich überlegte fieberhaft, was ich sagen konnte, bestenfalls in fehlerfreiem Hochdeutsch. »Der Wald ist wunderschön. Ich freue mich sehr darauf, hier zu leben. Bisher habe ich nur die Stadtluft kennengelernt.«
Das war anscheinend das Richtige gewesen. »Furchtbar«, sagte Madame Rouanet. »Ich halte es nie länger als drei Tage in Paris aus, bevor ich das Gefühl habe, zu ersticken.«
»Das kann ich mir vorstellen.« Ich sah hinaus auf die rotgoldenen Baumkronen, deren abgefallene Blätter jede freie Fläche in ein buntes Meer verwandelten. »Ich stelle es mir jetzt schon schwer vor, wieder zu gehen.«
Sie lachte höflich. Ich fragte mich, ob es üblich war, dass die Gutsherrin den Privatlehrer abholte. In ihren Interaktionen mit Marine merkte ich Vertrautheit, aber auch eine gewisse Distanz. Auf Beauregard gab es offenbar zwei Schichten und mir war klar, zu welcher ich gehörte.
Obwohl ich lieber an meiner Unsichtbarkeit gearbeitet hätte, konnte ich mir eine Frage nicht verkneifen: »Ich weiß noch nicht viel über meine Schülerin. Ist sie …«
»Sie werden Louise gleich kennenlernen«, sagte sie und damit war die Unterhaltung beendet. Es schien, als hätte sie alles über mich herausgefunden, was sie wissen wollte. Mich in Person zu begutachten war vermutlich der Grund gewesen, aus dem sie gekommen war. Aus dem sie Marine mitgebracht hatte. Ich sah, wie die beiden einen Blick über den Rückspiegel wechselten. Was immer das Urteil über mich war, es war soeben gefällt worden. Und ich hatte keine Ahnung, wie es lautete.
Der Weg nach Beauregard führte über eine schmale Brücke, die über einen ebenso schmalen Bach buckelte wie eine alte Katze. Der Porsche rumpelte über Holzbohlen, dann Asphalt und schließlich die Pflastersteine, die die Villa umgaben.
Die Luft war nasskalt, als wir ausstiegen. Erstaunt atmete ich sie ein und glaubte, dass meine Lungen von innen beschlugen.
»Die Luft ist wirklich anders«, sagte ich.
»Natürlich ist sie das.« Ein knappes Lächeln, dann übergab Madame Rouanet die Autoschlüssel an einen herbeieilenden Mann mit sommersprossigen Wangen. Noch einmal drehte sie sich zu mir um. »Um siebzehn Uhr im grünen Salon. Sie werden Louise … ah!« Etwas zersplitterte zu ihren Füßen. Tonscherben und Erde spritzten über ihre glänzenden Pumps. »Louise!«
Sie legte den Kopf in den Nacken und ich folgte ihrem Blick. Auf einem Balkon, dessen steinerne Pfeiler mit Efeu umrankt waren, schloss sich eine Glastür. Alles, was ich von meiner zukünftigen Schülerin sah, war das Rad eines Rollstuhls, das für einen Moment zwischen den steinernen Streben aufblitzte. Die Scheiben bebten, als die Tür zugedonnert wurde.
Madame Rouanet seufzte. »Dieses Mädchen.« Sie zog ein Taschentuch aus ihrer Handtasche und wischte sich über die Schuhe. »Marine, sag Yves, dass er sich um die Scherben kümmern soll.«
Sie entschwand die Treppen hinauf durch die Haustür, die von einer Frau aufgehalten wurde. Diese Frau war etwa in meinem Alter und trug eine spitzenbesetzte Schürze über einem schwarzen Kleid. Ernsthaft. Sie hatten nicht nur Bedienstete, diese Bediensteten trugen sogar Uniformen.
Zweifelnd sah ich an meiner Bomberjacke und den labbrigen Turnschuhen hinunter. Wie sollte ich es schaffen, mich hier einzufügen?
»Habt ihr zufällig noch eine Uniform übrig?«, fragte ich Marine.
Die schnaubte. »Damit du besser hier reinpasst? Da wäre ein vernünftiger Mantel wichtiger. Und ein Hemd, das gebügelt ist.«
»Das ist mein einziges Hemd«, gab ich zu.
Sie musterte mich schweigend. »Ich sehe, was ich tun kann. Vielleicht ist noch was von Alains alten Sachen da.«
»Alain?«
»Der Sohn von Madame Rouanet. Ihr müsst ungefähr die gleiche Größe haben.«
Und das war das erste Mal, dass ich von Alain Rouanet hörte.
Dem Mistkerl.
Kapitel 3
Marine brachte mich in mein Zimmer, das ganz oben im Bedienstetenflügel lag, direkt unter einem der Türme.
Das einzige Fenster war schmal, aber da der Raum so weit oben lag, drang trotzdem genug Herbstlicht hinein. Mein Zimmer enthielt ein einfaches Bett, einen mit Schnitzereien übersäten Schreibtisch und einen puddingweichen Teppich, dessen Rot dem der schmalen Streifen auf der Tapete ähnelte. Die Einrichtung wirkte etwas zusammengewürfelt und der Raum etwas leer.
Ich legte meinen Rucksack auf die Bettdecke und setzte mich daneben. Atmete ein. Und aus. Und wunderte mich, dass ich hier gelandet war.
Als ich mich genug gewundert hatte, suchte ich die Toilette am anderen Ende des Gangs auf, wusch mir das Gesicht und packte schließlich meinen Rucksack aus. Die Klamottenstapel wirkten wie winzige Inseln im Inneren des Schranks. Ich brauchte mehr Kleidung. Bessere. So leid es mir um das Geld tat, ich würde es aufwenden müssen, sonst würde ich nicht lange hierbleiben. Das hatte Marine mir vorhin ziemlich unverblümt gesagt.
Es klopfte.
»Ja?«
Marine stieß die Tür auf und warf mir einen Stapel Kleidung zu. »Hier, probier das an. Hab die rausgesucht, in die kein Monogramm eingestickt ist. Es wäre besser, wenn die Rouanets nicht merken, dass du die Klamotten von Madames Sohn trägst.«
»Danke.« Ich zögerte. »Madames Sohn? Nur Madames?«
Sie lehnte im Türrahmen. »Ja. Madame und ihr Mann haben noch zwei Kinder zusammen, die kommen in den Weihnachtsferien wahrscheinlich rüber. Aber Alain ist nur ihrer. Den hat sie mit ihrem Ex gehabt.«
Ich fragte nicht weiter nach. Neugier war zu auffällig, machte einen zu sichtbar. Glücklicherweise redete Marine gern, und so erfuhr ich trotzdem mehr.
»Er ist tot. Der Ex, meine ich. Genau wie die Eltern von Louise. Diese Familie ist echt vom Pech verfolgt.«
»Das tut mir leid«, sagte ich.
»Kannst ja nichts dafür.« Sie brachte ein halbes Lachen zustande, aber sie war nicht mit dem Herzen dabei. »Sie hat mich eingestellt. Ihre Schwester, die Mutter von Louise. Gute Frau. Ich … Weißt du, ich war nur ein Mädel aus Chambon und nicht besonders begabt oder so. Als sie mich aufgegabelt hat, war ich arbeitslos. Aber sie hat gesagt, wir finden schon etwas für dich.«
»Das ist sehr nett.«
»Ja.« Sie wirkte etwas verloren. »Ich hab sie mal gerettet, deshalb. Sie war mit dem Pferd gestürzt und hatte sich ein Bein gebrochen. Draußen im Wald, wo’s keinen Handyempfang gibt, na, damals eh nicht. Ich hab sie zurück in die Stadt geschleppt und sie hat mich eingestellt. Ich hätte fast geheult vor Glück. Den Rouanets gehört die halbe Gegend, weißt du? Sie pumpen mehr Kohle in die Stadt als jeder andere. Ohne sie würde es hier ganz anders aussehen, aber zum Glück sind sie spendabel. Und Louises Mutter war die Großzügigste von allen. Wenn die mit ihrem Pferd durch die Gegend gejagt ist, haben alle ihr zugejubelt wie einer Königin.« Sie sah zu Boden. »Sie hat immer zu viel riskiert. Kein Wunder, dass sie … na, egal. Zieh dich um und komm dann raus. Ich bring dich in den Salon.«
Ich nickte. Als sie die Tür schloss, sah ich, dass ich schon wieder aus ihren Gedanken verschwand, falls ich je darin gewesen war.
Das neue Hemd war Welten von dem entfernt, das ich in dem Billigladen in Essen gekauft hatte. Obwohl es nicht perfekt saß, wirkte es ganz anders. Glatt schmiegte es sich an meine Haut, und selbst sein Geruch war edel. Es folgten eine gerade geschnittene Anzugshose, ein Pullunder, und mit einem Mal sah ich aus wie der, der ich sein sollte: ein Privatlehrer.
»Fehlt nur noch das Tweedjackett«, murmelte ich, als ich mich im Spiegel betrachtete. »Und vernünftige Schuhe.«
Meine ehemals weißen Turnschuhe wirkten, als hätte ein Hund sie ausgekotzt. Aber daran konnte ich gerade nichts ändern.
Ich fuhr mir durch die Haare. Ja, so konnte ich mit dem Hintergrund verschmelzen. Mein durchschnittliches Gesicht und mein gewöhnlicher Körper passten sich jetzt schon dem Raum an, als wären sie immer hier gewesen.
Marine brachte mich nach unten, wo uns Geschrei erwartete.
Geschrei?
Schon als wir über die dicken Läufer im Flur schritten, vorbei an funkelnden Wandleuchten, mattschimmernder Wandvertäfelung und einem chromblitzenden Aufzug, hörten wir es. Ohrenbetäubendes Jaulen, als würde ein Tier gequält. Nur war es kein Tier. Es war ein Mädchen.
»Louise«, sagte Marine, als wäre damit alles gesagt.
»Schreit sie öfter so?«
Marine blickte zu mir hoch, als hätte sie einen Moment lang vergessen, dass ich da war. Sehr gut. Ich fühlte mich etwas weniger unwohl.
»Ja, wenn man sie aus ihrem Zimmer karrt«, sagte sie. »Das trauen wir uns nicht oft. Nur, wenn Madame und Monsieur es verlangen.«
Ich schwieg. Keine Ahnung, was mich erwartete, aber ich brauchte diesen Job. Ich wollte Paris sehen, richtig sehen. Und ich wollte mein Studium beenden, arbeiten, eine gut bezahlte Stelle finden. Frei sein. Der Schlüssel zu dieser Freiheit lag hinter den offenen Türen des grünen Salons.
Flüchtig fragte ich mich, ob es auch einen blauen, roten und gelben Salon gab, dann traten wir hindurch. Marine räusperte sich.
Der Salon war ein halber Wintergarten. Nicht nur hatte er eine Glasfront, die auf einen Garten mit Teich hinausging, auch die Hälfte der Decke war verglast. Hunderte kleiner Scheiben, manche leer, manche mit Blumenmustern bemalt, ließen das trübe Nachmittagslicht herein. Die Einrichtung war protzig, aber gemütlich, und wurde von mehreren Sofas dominiert, die mit so feinem Stoff bezogen waren, dass ich mich auf keinen Fall darauf setzen würde.
Madame Rouanet thronte auf einem Sessel, die Hände im Schoß, das Gesicht unbewegt.
Die anderen beiden standen sich gegenüber wie Duellanten, wobei klar war, wer das Duell gewinnen würde: Monsieur Rouanet.
Nicht schlecht, Madame, dachte ich. Zumindest äußerlich hatte sie mit ihrem Ehemann einen guten Fang gemacht. Er sah aus wie ein Vollbluthengst: dunkelbraune, wellige Haare, nur an den Schläfen grau, breite Schultern und ein so markantes Gesicht, als wäre er mit einem Whisky in der Hand geboren worden. Er hatte die Aura eines Kriegers und die passende Haltung dazu. Kühl blickte er auf das Mädchen hinab, das vor ihm in einem Rollstuhl saß und brüllte.
Der Schrei brach ab, als Marine an den Türrahmen klopfte. Das Mädchen fuhr herum. Im Vergleich mit ihrem Onkel und ihrer Tante war sie vollkommen unscheinbar. Aschblonde Haare, die leichte Segelohren freiließen, ein magerer Körper in einem taubenblauen Kleid. Und sehr dunkle Augenringe. Sie wirkte, als hätte sie tagelang nicht geschlafen.
Wie alt sie wohl war? Ich tippte auf irgendetwas zwischen acht und zwölf. Ihr schmales Gesicht war leicht gerötet vom Schreien und ihre Brust hob und senkte sich. Ihre rechte Hand umklammerte ein Handy, das einen türkisfarbenen Glitzer-Schutzrahmen hatte.
»Louise.« Madame Rouanet stand auf und lächelte, als wäre nichts geschehen. Ich gab mir Mühe, ebenfalls unbeeindruckt zu schauen. »Das ist dein neuer Deutschlehrer, Monsieur Joos. Ich hoffe, dass ihr euch gut verstehen werdet.«
Louise starrte mich an. Ein Schauer lief über meinen Rücken und einen Moment lang wurde ich ins Heim zurückgeschleudert. Zu viele der Jungs hatten so geschaut. Ich glaube, wenn Louise in diesem Moment ein Messer gehabt hätte, wäre sie auf mich losgegangen.
»Guten Abend.« Monsieur Rouanet nickte mir zu. Sein Blick hakte kurz, als er meine Turnschuhe sah, danach wurde er gänzlich uninteressiert. »Quentin Rouanet. Erfreut, Sie kennenzulernen, Monsieur Joos.«
»Die Freude ist ganz meinerseits«, sagte ich und hoffte, dass ich den richtigen Ton traf. »Danke, dass Sie mir diese Chance geben.« Ich lächelte, obwohl ich jetzt schon wusste, dass es nichts bringen würde. »Und du musst Louise sein.«
Louise sah mich nicht einmal an, bevor sie die Räder des Rollstuhls packte und versuchte, loszufahren. Monsieur Rouanet packte den Griff und hielt sie fest. Der Rollstuhl stoppte so abrupt, dass sie fast herausgefallen wäre.
»Du bleibst hier«, sagte er ruhig. »Und begrüßt deinen neuen Lehrer.«
Wäre Louise eine Katze gewesen, hätte sie gefaucht. Stattdessen sah sie mich an, als wäre sie versehentlich in mich hineingefahren und als würde ich nun an einem der Reifen kleben und den Raum mit meinem Gestank verpesten.
»Bonsoir.« Ihre Stimme war rau, vermutlich vom Schreien.
»Auf Deutsch, Louise.« Madame Rouanet klang immer noch, als wäre das hier eine höfliche Unterhaltung.
Louise schwieg.
»Das reicht.« Wie ein Habicht packte Monsieur Rouanet Louises Handy und entriss es ihr. Sie öffnete den Mund, sagte aber nichts. »Ich gebe es dir morgen wieder. Benimm dich bis dahin besser.«
Widerwillig nickte sie. Ihre dünnen Haare tanzten um das Kinn.
Sie sagte kein Wort, die ganze halbe Stunde über, die ich im Salon verbrachte. Ich musste auf dem Sofa Platz nehmen und Madame Rouanet teilte mir mit, was sie sich von meinem Unterricht erhoffte. Es gab noch einen zweiten Privatlehrer, der den Großteil der anderen Fächer übernahm. Niemand erklärte mir, warum Louise keine normale Schule besuchte. Aber ich erfuhr, dass Louise bereits früher Deutschunterricht gehabt hatte, dass sie eine schwere Allergie hatte, gegen die ich ihr notfalls ein Mittel spritzen musste und, dass ich über sämtliche Fortschritte Aufzeichnungen führen sollte. Von Hand. Schaudernd erinnerte ich mich an meine Vier in Schönschrift.
Nachdem die Unterweisungen beendet waren, rollte Louise stumm aus dem Raum. Madame Rouanet atmete sichtbar auf, nachdem sie weg war.
»Sie müssen sie entschuldigen«, sagte sie und sah durch mich hindurch. »Louise hat es gerade nicht leicht. Es ist kaum ein Jahr her, dass ihre Eltern verunglückt sind und sie … beinahe wäre sie ebenfalls gestorben. Es ist schwierig für sie, mit der neuen Situation umzugehen. Mit der Lähmung und mit der Einsamkeit. Sie kann ein wenig störrisch sein.«
»Ein wenig.« Monsieur Rouanet lachte herzlich. Seine Zähne blitzten. Ich hatte nichts Falsches in seiner Frau gespürt, aber er … All meine Instinkte schrien, dass er mir etwas vorspielte. Ich wusste nur nicht, was. Da ich eh nichts dagegen machen konnte, lächelte ich höflich und fragte, was sie noch von meinem Unterricht erwarteten.
»Vor allem, dass er stattfindet.« Monsieur Rouanets Lachen war warm wie geröstete Kastanien. »Louise macht es ihren Lehrern nicht leicht. Ihre Chinesischlehrerin hat sie bereits hinausgeekelt.« Er ignorierte einen Blick seiner Frau, der ihn offensichtlich zum Schweigen bringen sollte. »Und den Hindilehrer auch.«
»Wir dachten, dass ihr eine europäische Sprache leichter fallen könnte«, sagte Madame Rouanet. »Wir wollen sie nicht überfordern, wenn es ihr offensichtlich nicht gut geht.«
»Das ist sehr nett von Ihnen.« Ich legte die Hände auf die Knie. »Ich werde mein Bestes geben.«
Sie nickten zufrieden und ich verstand, dass mein Bestes gerade ausreichend sein würde. Hoffentlich.
»Ich schätze, man hat Ihnen schon von Louises Eltern erzählt?« Monsieur Rouanet setzte sich auf die Lehne des Sessels und legte einen Arm um seine Frau. Sie neigte den Kopf, stützte ihn gegen seine Brust. »Davon, dass sie letztes Jahr verunglückt sind?«
»Ja.« Von weiteren Fragen sah ich ab. Jetzt schon merkte ich, wie meine alte Magie zurückkam, wie sie mich beinahe vergaßen, während sie mit mir sprachen.
»Es war ein schreckliches Unglück.« Seine Finger auf ihrer Schulter bewegten sich. »Ein Segelunfall. Louise war vorher ein liebes Mädchen, aber seitdem … Meine Frau hofft, dass Sie ein wenig helfen können. Sie studieren Psychologie, richtig?«
»Ja, aber erst seit zwei Semestern. Ich denke nicht, dass ich schon geeignet bin, ihr zu helfen.«
»Wer weiß?« Sie seufzte. »Vielleicht braucht sie jemanden, der sie versteht. Wir hatten einen wirklich guten, hochqualifizierten Therapeuten hier, und er war absolut nutzlos. Sie sehen ja, wie sie ist.«
»Es ist nicht leicht, seine Eltern in dem Alter zu verlieren«, sagte ich vorsichtig.
»Ist es nicht. Sie haben selbst die Erfahrung gemacht, richtig?« Madame Rouanets Gesichtszüge blieben weich. »Vielleicht können Sie zu Louise durchdringen.«
Und da hatte ich ihn endlich: den Grund, aus dem ich hier war.
»Hoffentlich nimmt sie sich ein Beispiel an Ihnen«, sagte Monsieur Rouanet. »Sie sind schließlich auch darüber hinweggekommen. Sie studieren sogar, trotz Ihrer Herkunft. Das ist wirklich bewundernswert.«
»Danke.«
***
Ich aß mit den anderen Angestellten zu Abend und wunderte mich, wie viele Leute benötigt wurden, um die Villa instand zu halten. Nicht nur ein Gärtner und zwei Zimmermädchen, auch ein Koch, ein Förster und sogar Diener. Sie waren alle nett und einige gaben sich Mühe, ein paar Worte Deutsch mit mir zu sprechen. Aber nach kurzer Zeit war die Unterhaltung ins Französische zurückgekehrt. Ich hielt mich zurück und lauschte.
»Habt ihr das Geschrei heute gehört?«, fragte Alice, ein Zimmermädchen.
»Ja, furchtbar. Und sie war so ein nettes Mädchen. Ein bisschen ruhig, aber echt nett.«
»Arme Kleine.«
»Die arme Kleine hat versucht, mir über den Fuß zu fahren, als ich sie geholt habe.« Der Sommersprossige, Timéo, schob sich einen Löffel Zwiebelsuppe in den Mund. »Wenn sie nicht ihre Nichte wäre, hätte ich der was erzählt. Aber die Rouanets lassen ihr ja alles durchgehen.«
***
Lange nach Sonnenuntergang sank ich auf das Bett und schlief sofort ein. Gesprächsfetzen des vergangenen Tages rauschten durch meinen Kopf wie vorbeifahrende Züge, dann wurde alles schwarz.
Ich erwachte und wusste einen Moment lang nicht, wo ich war. Finsternis schloss mich ein. Ich blinzelte. Erst nach und nach schälten sich die Möbel aus dem Raum. Dem eisigen Raum. Ich fröstelte. Die Decke um die Schultern gewickelt saß ich da und fragte mich, was mich geweckt hatte.
Dann hörte ich es.
Ein Heulen, das Schauer durch meinen Körper schickte. Ich umklammerte die Enden der Decke. Was war das für ein Laut?
Erneut hörte ich es, weit weg. Langgezogen und klagend. Irgendein Urinstinkt in mir war angesprungen, als ich es gehört hatte. Das war das Heulen eines Raubtiers.
Immerhin kam es von draußen.
Mit der Decke um die Schultern tapste ich über den eiskalten Boden und schob die Vorhänge zur Seite.
Mondlicht erhellte die Berge. Nebel wand sich zwischen den Bäumen hindurch wie feiner Stoff, versenkte den Wald in einem milchigen Meer. An einigen Stellen schauten nur die Baumspitzen heraus.
Ich lauschte, aber das Geräusch war verstummt. Mir war kalt. Obwohl ich Socken trug, froren meine Füße und die Holzdielen fühlten sich wie Eisschollen an.
»Kein Wolf«, sagte ich, um die Stille zu füllen. Zu hören, wie unstet meine Stimme klang, war ein kleiner Schock. »Beruhig dich, du Stadtkind. Selbst wenn es ein Wolf war, bist du hier oben sicher …«
Ich zuckte zusammen. Auf dem Berg gegenüber, auf einer Lichtung, bewegte sich etwas. Drehte sich um sich selbst und rannte auf vier Beinen durch die weißen Schwaden. Schnell. Und viel zu weit weg, als dass ich wirklich etwas hätte erkennen können, nur so viel: Das Tier war groß. Größer als ein Wolf? Selbst ich erkannte, dass es sich nicht um ein Reh handelte. Es bewegte sich mehr wie ein Hund.
Das Tier blieb stehen. Lauschte. Und schoss dann in die Dunkelheit der Bäume, als hätte es bemerkt, dass ich es beobachtete.
Zitternd starrte ich auf die leere Lichtung. Angst bohrte sich in meine Knochen und ich wusste nicht, warum. Auf Beinen, die sich wie morsche Stöcke anfühlten, ging ich zur Tür und schloss sie ab.
Cedric, dachte der vernünftige Teil von mir. Ein Wolf kommt nicht in die Villa. Er kann keine Türen öffnen, du Dummkopf.
Der unvernünftige Teil von mir flüchtete unter die Bettdecke, zog sich das Kissen über den Kopf und stellte sich vor, weit, weit weg zu sein.
***
Als ich Marine am nächsten Morgen davon erzählte, lachte sie mich aus.
»Größer als ein Wolf, ja?«, sagte sie. »Keine Angst, in diesen Wäldern ist nichts größer als ein Wolf. Höchstens ein Mensch.«
Kapitel 4
»Und, worauf hast du heute Lust?«, fragte ich und bekam wie üblich keine Antwort.
Sonnenlicht sprenkelte den gemusterten Teppich, der sich vor mir ausbreitete wie ein See. Ich saß auf einem Holzstuhl, der mit den geschnitzten Armlehnen genau zu dem passte, was ich nun war: ein Privatlehrer. Vor einigen Tagen hatte ich Marine in die Stadt begleitet und war nun stolzer Besitzer mehrerer Pullunder, einer langweiligen braunen Hose und sogar einer Wolljacke mit Lederflicken an den Ellenbogen. Ich spielte meine Rolle perfekt.
Wer nicht mitspielte, war Louise.
Sie thronte in ihrem Rollstuhl wie eine gelangweilte Prinzessin und sah durch mich hindurch. Ich war daran gewöhnt, dass man mich ignorierte, aber nicht daran, dass es aus Absicht geschah.
»Wir könnten über Beauregard reden«, schlug ich vor. »Hast du schon immer hier gelebt?«
Schweigen. Ich nippte an dem Kaffee, den ich vom Frühstückstisch mitgebracht hatte, und der bittere Geschmack breitete sich in meinem Mund aus. Ich war kein großer Kaffeefan, aber alle anderen hier waren es. Um mich anzupassen musste ich lernen, ihn zu trinken. In sehr kleinen Schlucken.
»Na gut«, sagte ich und gab auf. Wie jeden Tag. »Dann erzähle ich dir etwas über Essen.«
Falls sie zuhörte, zeigte sie es nicht. Meine Erzählung war auch ziemlich langweilig. Madame Rouanet hatte gewünscht, dass ich Louise die Geschichte meines Studienortes näher brachte, und gestern hatte ich den halben Nachmittag damit verbracht, den Wikipedia-Artikel auswendig zu lernen. Das meiste war mir selbst neu gewesen. In Essen hatte ich mich mehr damit beschäftigt, wo es die günstigsten Lebensmittel gab und wie oft ich laufen musste, statt den Bus zu nehmen, um mir eine Packung Zigaretten leisten zu können. In einem besonders verregneten Winter letztes Jahr hatte ich schließlich aufgehört zu rauchen.
Ab und zu gesellte ich mich zu den Rauchern, wenn sie sich nach dem Mittagessen im Hof versammelten. Immer noch sehnte ich mich nach einem Zug, wenn Marine neben mir Ringe blies, aber ich lehnte ab, wenn sie mir etwas anbot. Rauchen war zu teuer und ich musste sparen. Für Paris. Meine neue Kleidung hatte schon genug gekostet.
Allerdings würde ich nicht viel sparen können, wenn die Rouanets mich rauswarfen. Ich war eingestellt worden, um Louise Deutsch beizubringen, und falls sie irgendetwas von mir lernte, behielt sie es für sich.
Stures Mistkind, hatte der andere Lehrer gesagt. Monsieur Durand, der trotz seiner sechzig Jahre rank und schlank war und seine weißen Haare elegant zurückgekämmt trug. Sein Anzug konnte fast mit denen von Monsieur Rouanet mithalten. Wenn die Göre wollte, könnte sie lernen. Ich weiß ganz genau, dass sie mir zuhört. Aber sie will nicht. Nur ab und zu macht sie mal was, wenn man droht, ihr das Handy wegzunehmen.
Ich wollte Louise nicht drohen, und gerade ging es ohnehin nicht. Ihr Handy war gestern konfisziert worden, weil sie versucht hatte, die Villa zu verlassen und in den Wald zu gelangen. Draußen war es zu gefährlich. Mit dem Rollstuhl könnte sie jederzeit irgendwo steckenbleiben und nicht mehr weiterkommen. Die Gegend war dünn besiedelt und der Handyempfang fiel ständig aus … wenn er überhaupt vorhanden war.
Ich musterte ihr verschlossenes, schmales Gesicht und beschloss, einen letzten Versuch zu wagen. Für heute.
»Wolltest du gestern einen Ausflug machen?«, fragte ich. »Was wolltest du sehen?«
Sie antwortete nicht.
Die Mauern, die sie hochgezogen hatte, waren undurchdringlich. Die einzige Art, an sie heranzukommen war, sie herauszulocken. Aber dazu brauchte ich einen Köder, und ich wusste wirklich nicht, was …
Hm.
Langsam nahm ich mein eigenes Handy aus der Hosentasche und hielt es ihr hin.
»Willst du?«
Ein leichtes Zucken des Augenlids verriet, dass sie mich gehört hatte. Aber sie schwieg weiter, rührte sich nicht und ich gab endgültig auf. Für heute.
Als ich auf den Flur trat, spürte ich, dass etwas passiert war. Timéo ging an mir vorbei, mit beschwingtem Schritt und entschlossenem Gesicht. Alice kam aus der anderen Richtung, einen Berg Laken im Arm.
»Gibt es Besuch?«, fragte ich und sie nickte.
»Sie kommen über das Wochenende. Alle drei. Die Kinder der Rouanets.«
Ah. Das war natürlich ein Ereignis in Beauregard, wo bisher wenig los gewesen war. Und wo es wenig zu tun gab, zumindest für mich. Ich hatte aus Mangel an Möglichkeiten sogar angefangen, wandern zu gehen, aber das brachte neue Schwierigkeiten mit sich. Nämlich die, dass der Wald verdammt gruselig war.
Ich wusste nicht, ob es daran lag, dass ich ein Stadtkind war, aber die Stille in den Schatten machte mir Angst. Eigentlich war der Wald wunderschön. Es war herrlich, nur meine Schritte auf dem Moos zu hören, durch eisige, frische Luft zu laufen, durch die leuchtend gefärbte Blätter segelten. Die Wege schlängelten sich über Berge und zwischen Felsen hindurch, aber es war leicht, ihnen zu folgen und nicht verloren zu gehen.
Aber.
Ab und zu kam ich an einer zu dunklen Stelle vorbei, ab und zu hörte ich ein unbekanntes Geräusch. Und dann erinnerte ich mich wieder an das Tier, das ich gesehen hatte. Auf einmal waren die Schatten zu finster, konnte sich hinter jedem Gebüsch und in jeder Felsspalte eine Bestie verstecken, konnte jederzeit ein triefendes Gebiss auftauchen, nur bereit, mich zu verschlingen.
Egal, wie oft ich mir sagte, dass das Blödsinn sei, die Angst blieb. Ich blieb auch.