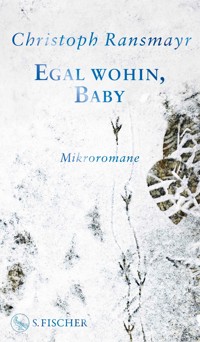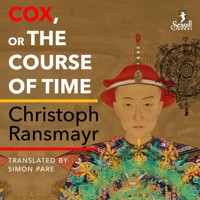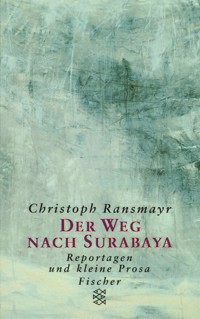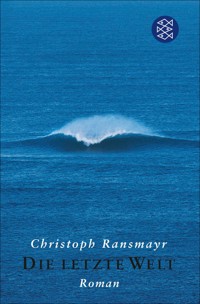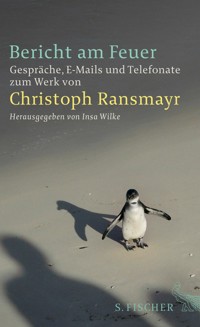
9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: FISCHER E-Books
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Deutsch
Das Geheimnis des Erzählens - Zum Werk von Christoph Ransmayr. Christoph Ransmayr erzählt in einem langen Gespräch von den Wegen seines Schreibens. Ins Innere seiner Geschichten folgen ihm drei seiner Übersetzer und zwei Wissenschaftler, die mit der Herausgeberin Insa Wilke über sein Werk gesprochen haben. Sie erzählen davon, welche eigenen Vorstellungswelten sich auf den imaginären Reisen geöffnet haben. So entsteht in den mündlichen und schriftlichen Korrespondenzen ein Buch über die Rätselhaftigkeit der Materie und die Erkundung der Welt im Schreiben, gewidmet einem der bedeutendsten Künstler der Gegenwartsliteratur. Eine Einladung, sich auf den Weg zu machen ins Unbekannte. »Schreiben gleicht manchmal dem Weg in die Wildnis: Da wie dort öffnen sich scheinbar grenzenlose, menschenleere Räume, in denen es aber nur wenige gangbare Wege gibt.« (Christoph Ransmayr)
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 331
Veröffentlichungsjahr: 2014
Ähnliche
Christoph Ransmayr
Bericht am Feuer
Gespräche, E-Mails und Telefonate zum Werk von Christoph Ransmayr
Biografie
Christoph Ransmayr wurde 1954 in Wels/Oberösterreich geboren und studierte Philosophie in Wien, wo er nach Jahren in Irland und auf Reisen wieder lebt. Neben seinen Romanen ›Die Schrecken des Eises und der Finsternis‹, ›Die letzte Welt‹, ›Morbus Kitahara‹ und ›Der fliegende Berg‹ erschienen zehn Spielformen des Erzählens, darunter ›Damen & Herren unter Wasser‹, ›Geständnisse eines Touristen‹, ›Der Wolfsjäger‹ und ›Gerede‹. Zuletzt veröffentlichte Christoph Ransmayr den ›Atlas eines ängstlichen Mannes‹. Für seine Bücher, die bisher in mehr als dreißig Sprachen übersetzt wurden, erhielt er zahlreiche literarische Auszeichnungen, unter anderem die nach Friedrich Hölderlin, Franz Kafka und Bert Brecht benannten Literaturpreise, den Premio Mondello und, gemeinsam mit Salman Rushdie, den Prix Aristeion der Europäischen Union.
Weitere Informationen, auch zu E-Book-Ausgaben, erhalen Sie bei www.fischerlage.de
Impressum
Erschienen bei FISCHER E-Books
© S. Fischer Verlag GmbH, Frankfurt am Main 2014
Covergestaltung: heilmann, hißmann, hamburg
Coverabbildung: Christoph Ransmayr
Abbildungen im Text: Alle Rechte an den Abbildungen liegen bei Christoph Ransmayr. Nachdruck nur mit Genehmigung von Christoph Ransmayr gestattet.
Abhängig vom eingesetzten Lesegerät kann es zu unterschiedlichen Darstellungen des vom Verlag freigegebenen Textes kommen.
Dieses E-Book ist urheberrechtlich geschützt.
ISBN 978-3-10-400689-5
Dieses E-Book ist urheberrechtlich geschützt.
Die Nutzung unserer Werke für Text- und Data-Mining im Sinne von § 44b UrhG behalten wir uns explizit vor.
Hinweise des Verlags
Abhängig vom eingesetzten Lesegerät kann es zu unterschiedlichen Darstellungen des vom Verlag freigegebenen Textes kommen.
Im Text enthaltene externe Links begründen keine inhaltliche Verantwortung des Verlages, sondern sind allein von dem jeweiligen Dienstanbieter zu verantworten. Der Verlag hat die verlinkten externen Seiten zum Zeitpunkt der Buchveröffentlichung sorgfältig überprüft, mögliche Rechtsverstöße waren zum Zeitpunkt der Verlinkung nicht erkennbar. Auf spätere Veränderungen besteht keinerlei Einfluss. Eine Haftung des Verlags ist daher ausgeschlossen.
Dieses E-Book enthält möglicherweise Abbildungen. Der Verlag kann die korrekte Darstellung auf den unterschiedlichen E-Book-Readern nicht gewährleisten.
Wir empfehlen Ihnen, bei Bedarf das Format Ihres E-Book-Readers von Hoch- auf Querformat zu ändern. So werden insbesondere Abbildungen im Querformat optimal dargestellt.
Anleitungen finden sich i.d.R. auf den Hilfeseiten der Anbieter.
Inhalt
Einleitung
I Das Menschenmögliche zur Sprache bringen
Ich habe damals ...
II Fragen Sie meine Übersetzer
Von der Musik entlegener Landschaften
Ransmayrs Sprache? – Mineralisch und zugleich beteiligt
Oben herrscht Friede und unten die pure Gewalt
III Metamorphosen gelingen dort, wo die Vorstellungskraft groß und die Haut des Einzelnen dünn ist
Im Gespräch 1: Chr. Abbt / Th. Wild / I. Wilke
Wortlaut der Erinnerung (Thomas Wild)
Angstwandeln (Christine Abbt)
Im Gespräch 2: Chr. Abbt / Th. Wild / I. Wilke
Bibliographie
Werke von Christoph Ransmayr
Buchveröffentlichungen
Theaterstücke
Herausgeberschaft
Reden, Reportagen, Artikel
Beiträge zu (Auswahl):
Hörbücher
Übersetzungen
Strahlender Untergang
Die Schrecken des Eises und der Finsternis
Die letzte Welt
Morbus Kitahara
Der Weg nach Surabaya
Der Ungeborene
Geständnisse eines Touristen
Der fliegende Berg
Damen und Herren unter Wasser
Der Wolfsjäger
Atlas eines ängstlichen Mannes
Sekundärliteratur
Interviews (Auswahl)
Zu einzelnen Werken
Angaben zu den Autorinnen und Autoren
Einleitung
Wenn das Schreiben ein Aufbruch ins Unbekannte ist, was nimmt ein Erzähler dann mit auf seinen »Weg ins Innere einer Geschichte«? Und was hebt er unterwegs auf, um die Daheimgebliebenen an dem teilhaben zu lassen, was er gehört und gesehen, ja, was er empfunden hat? Solche Fragen stellten sich mir, als ich überlegte, was das eigentlich ist: ein »Materialienband«. Einen solchen wollte der S. Fischer Verlag Christoph Ransmayr zu seinem sechzigsten Geburtstag schenken.
»Wenn du phantasieren willst, brauchst du die Wirklichkeit«, hat Christoph Ransmayr einmal gesagt. Das Material eines Schriftstellers muss also doch der Rohstoff vor seiner Formwerdung sein. Ein Rohstoff, der aber schon von der Suche nach der Form erzählt, von seiner Verwandlung in Literatur. Von diesem Rohstoff weiß nur der Schriftsteller selbst, dachte ich und fragte also Christoph Ransmayr danach, von dem es heißt, er hebe nie etwas auf. Alles Materielle verwandle sich bei ihm in Sprache, obwohl seinen Werken – von »Die Schrecken des Eises und der Finsternis« bis zum »Atlas eines ängstlichen Mannes« und den Bänden der »Weißen Reihe« – abzulesen ist, dass ihr Verfasser kein Theoretiker ist, sondern einer, der sein Material, aus dem er Figuren, Landschaften und ihre Geschichten erschafft, sinnlich erfahren hat, auf vielfältige Weise am eigenen Leib. Auf Zettelkästen, Erinnerungsstücke, aufgehobene Rechnungen oder wild kommentierte Zeitungsartikel und Notizen auf Bierdeckeln mit den spektakulären Spuren durchzechter Nächte dürfe ich trotzdem in diesem Fall nicht zählen, sagte man mir.
Was einer erzähle, könne »nirgends stärker sein als im Inneren seiner Geschichte«, hat Christoph Ransmayr in »Die Verbeugung des Riesen« geschrieben. »Danach kann er sich nur abwenden und davongehen, immer weiter, bis der Weg ins Innere einer neuen Geschichte erkennbar wird und er seine Stimme wiederfindet und zurückkehren kann in die Mitte der Welt.« Wer vor sein Werk trete und glaube, eine Erklärung schuldig zu sein, finde sich plötzlich in einer seltsamen Fremde wieder, in der andere Bräuche gepflegt und eine unverständliche Sprache gesprochen würden und nichts mehr gelte, was in der Zeit der Arbeit an diesem Werk von Bedeutung gewesen sei.
Tatsächlich runzelte Christoph Ransmayr an einem sonnig-kalten Tag im April des Jahres 2013 die Stirn, sobald ich an unserem Wiener Kaffeehaustisch auf Privates, auf seine Person und Zeugnisse seines Lebens als Künstler zu sprechen kam oder ihn vom Erzählen erzählen lassen wollte. Das sei doch alles uninteressant. Wieso nicht einfach ein mäanderndes Gespräch führen, rund um Materialien, auf die ich ihn allerdings schon selbst bringen müsse. Gespräche seien ja das eigentliche Material seiner Arbeit.
Das Gespräch als Grundform eines »Materialienbandes« über das Werk von Christoph Ransmayr festzulegen leuchtete mir ein. Um einen weiteren assoziativen Raum zu öffnen, habe ich Zitate aus den Werken von Christoph Ransmayr oft zufällig, auf jeden Fall aber sehr subjektiv ausgewählt und vom linken und rechten Rand der Buchseiten in die Gespräche hineinlaufen lassen. Die Form des Gesprächs ist, obwohl von ihm selbst vorgeschlagen, insofern eine Besonderheit, als dass es nicht leicht ist, Christoph Ransmayr, diesem »Kontrollwahnsinnigen« und geradezu besessen akribischen, ja, vielleicht sogar auch im besten Sinne »ängstlichen« Sprachmeister die losere, mündliche Form zuzumuten. Sich selbst zu viel Gewicht beizumessen, am Wesentlichen vorbeizureden, diese Vorstellung ist ihm ein Horror. Am 4. Juli 2013 sagte er, dem Gesprächsprojekt gegenüber wieder erhöht skeptisch, in einem Telefonat: »Mit welchem Ernst man von etwas spricht, hat ein Ablaufdatum.«
Die mündliche Formulierung ist sicher manchmal leichtsinniger, sorgloser auch und flüchtiger. Dafür aber lässt sie das unkalkulierbar Überraschende zu, legt Blickwinkel frei, die wieder durchlässig werden lassen, was im schriftlichen Werk so festgefügt schien. Das Gespräch könnte ein Weg sein, entschieden wir damals risikofreudig in Wien, den Transit-Raum, in dem Literatur entsteht und der so schwer nur zur Sprache gebracht werden kann, als Wunderkammer der Wirklichkeit zu entwerfen und begehbar zu machen. So ist dieses Buch entstanden.
Sein erstes Kapitel ist ein langes Gespräch mit Christoph Ransmayr (übrigens wie seine Werke in alter Rechtschreibung), das tastend um dieses Wort »Material« kreist. Mal als Kontrapunkte, mal als Illustration haben wir Fotos in den Text gesetzt. Bei ihnen handelt es sich um optische Notizen, die Christoph Ransmayr auf seinen Reisen spontan mit dem Telefon oder einer Kompaktkamera aufgenommen hat. Sie haben ihren Wert nicht als Fotografien, sondern eben als Notizen, von denen noch Tausende auf Christoph Ransmayrs Festplatte darauf warten, wieder angeschaut zu werden und vielleicht den ausschlaggebenden Funken für ein treffendes poetisches Bild oder gar einen ganzen Roman in der Vorstellung ihres Betrachters zu entzünden.
Aber bei einem Materialienband geht es nicht nur um die Rohstoffe, die sich unter den Händen und durch die Phantasie eines Schriftstellers zu Geschichten verwandeln und zwischen Buchdeckeln Gestalt annehmen können. Es geht auch um das Material, das der Schriftsteller uns, seinen Leserinnen und Lesern, für die Gestaltwerdung in unseren Köpfen liefert. Als ich mit Christoph Ransmayr darüber sprach, welche Lesenden sich in besonderem Maße mit seinen Romanen auseinandergesetzt haben, nannte er sofort seine Übersetzerinnen und Übersetzer. Sie kommen der Black Box des Schreibens am nächsten. Sie sind am wenigsten an die formalisierten Sprachen von Wissenschaft oder Journalismus gebunden und sind doch durch ihre sprachliche Distanz auf besondere Weise objektiv. Mit John Woods, Claudio Groff und Jean-Pierre Lefebvre haben wir drei der Übersetzer von Christoph Ransmayrs Werken gewinnen können, sich mit mir auf das Wagnis eines Gesprächs über ihre Arbeit und den Rohstoff einzulassen, den Christoph Ransmayr in ihre Hände legt. Und sie sind Teil des Echo-Raums, den die Literatur schafft.
Woods, Groff und Lefebvre kommen zwar mit den USA, Italien und Frankreich aus unterschiedlichen Ländern und Sprachen, gehören aber derselben Generation an. Sie sind alle Anfang der 1940er Jahre geboren worden, in ein Europa hinein, das sich gerade neu zusammensetzte und noch – erst schweigend und dann revoltierend – nachzitterte und zu formulieren versuchte, was sich hinter der zur Chiffre gewordenen Jahreszahl »1945« verbarg. Wie klingt das Echo von Christoph Ransmayrs Büchern in einer jüngeren Generation, vor dem Hintergrund anderer Werdegänge und Erfahrungen? Davon gibt das Gespräch mit Christine Abbt und Thomas Wild eine Vorstellung, in das zwei ungewöhnliche und erhellende Essays der beiden Wissenschaftler eingebettet sind.
Mit Christoph Ransmayr habe ich mich in Wien, mit John Woods in Berlin, mit Jean-Pierre Lefebvre in Paris getroffen und mit Claudio Groff im virtuellen Raum des Internets. Christine Abbt und Thomas Wild haben miteinander telefoniert, geskyped, und wir haben uns zu dritt gemailt. Die unterschiedlichen Gesprächswege haben die Texte jeweils geprägt. Aber vor allem haben das die Persönlichkeiten und der jeweils ganz eigene Ton der Gesprächspartner getan. Völlig unerwartet war für mich, und ich habe Hochachtung davor, wie persönlich sich alle Beteiligten auf diesen Versuch eingelassen haben, Christoph Ransmayr ins Innere seiner Geschichten zu folgen, bzw. wie sich der Schriftsteller selbst dazu bereiterklärt hat, den Weg in diese vertraute Fremde gegen seine Überzeugung noch einmal zu beschreiten. Wir haben einander davon erzählt, was uns am Wegesrand begegnet und durch den Kopf gegangen ist. Welche eigenen Vorstellungswelten sich in den imaginären Reisen mit diesem Dichter des Vergessens und Erinnerns geöffnet haben und vor welchen persönlichen Hintergründen sie sich so überhaupt erst öffnen konnten.
Ganz zufällig verknüpfen sich die Einzelgespräche, die von Deutschland nach Österreich, nach Italien und Frankreich, in die Schweiz und die USA geführt wurden, durch Übereinstimmungen und völlig entgegengesetzte Ansichten und Erfahrungen zu einem großen Gespräch über die Rätselhaftigkeit der Materie und die Erkundung der Welt im Schreiben und Lesen. Die Zitate aus den Werken von Christoph Ransmayr, die allerdings, wie gesagt, von der Herausgeberin und nicht vom Autor ausgewählt und arrangiert wurden, schaffen eine weitere Ebene der Korrespondenzen und Widersprüche.
Vielleicht werden Sie als Leserinnen und Leser also eine ähnliche Erfahrung machen wie Josef Mazzini, die abwesende Hauptfigur aus »Die Schrecken des Eises und der Finsternis«, dem im Gehen die Welt so groß geworden war, »daß er schließlich in ihr verschwand«. Aber auch dieser hoffnungsvolle Satz aus Christoph Ransmayrs Reportage »Der Weg nach Surabaya« beschreibt den Versuch, auf den dieses Buch ganz ungeplant zugelaufen ist: »Gemeinsam hatten wir aus Zeichen und Lauten eine Sprache, aus einem Spiel eine Geschichte und aus der Straße eine Zeile gemacht«. Ich danke allen Beteiligten dafür und möchte nun Sie einladen, uns auf den Weg ins Unbekannte zu folgen.
Insa Wilke, Bechtersweiler, im Oktober 2013
IDas Menschenmögliche zur Sprache bringen
Ein Gespräch mit Christoph Ransmayr über die Durchmusterung des Himmels und die äußersten Gegenden der Phantasie
Kolibri, abdrehend
Wie ein Adlerhorst liegt Christoph Ransmayrs Wohnung hoch oben in einem Wiener Altbau. Im Ausschnitt eines großen Fensters treiben Kumulus-Wolken im Blau. Christoph Ransmayr ist gerade aus Marokko zurückgekehrt. Jetzt schaut er den ziehenden Wolken nach und wippt mit dem Fuß, als ich frage: Im Jahr 2000 waren Sie »Dichter zu Gast« bei den Salzburger Festspielen – einer der wenigen Ausflüge in die Theaterwelt, bevor Sie sich wieder in die freieren Bezirke der Literatur »auf und davon« machten. Ist es für jemanden, der Welten allein durch die Kraft seiner Phantasie und Vorstellung errichtet, erlösend oder bedrückend, innere Bilder mit Hilfe einer Bühnenmaschinerie zu materialisieren?
Ich habe damals auf dem Instrumentarium der Salzburger Festspiele, einer Art viermanualigen Orgel, nach einjähriger Vorbereitung mit großem Vergnügen gespielt. Aber der Erzähler eines Romans muß beispielsweise bloß »Ein Küstenstrich« sagen, »in der Ferne Gebirgszüge, einige Gipfel kahl, andere vergletschert. Der Strand blühend, in der Brandung ein Wrack«, um in wenigen Zeilen die Farben, Schatten und Temperaturen der Wirklichkeit zu beschwören und Bilder entstehen zu lassen. Eine solche Szenerie als Bühnenbild umzusetzen ist dagegen ziemlich aufwendig. Natürlich gilt für die Umsetzung einer Geschichte auf der Bühne Ähnliches wie für die Verwandlung einer Geschichte im Kopf eines Lesers oder Zuhörers. Solche Verwandlungen sind weder erlösend noch bedrückend, sondern unumgänglich und jedenfalls ein Zeichen dafür, daß ein Erzähler sein Publikum auf die eine oder andere Art erreicht hat.
Die Offenheit des Titels, den Sie Ihrem Salzburger Projekt gegeben haben, widerspricht der Statik und Materialität eines Bühnenbildes: »Unterwegs nach Babylon. Spielformen des Erzählens«. Wie sind Sie den Produktionszwängen der Festspiele entwischt?
Ich wollte mit sieben einmaligen, tatsächlich unwiederholbaren Abenden einen Bogen spannen, der über einen Fächer von Erzählformen dorthin zurückführt, wo alles anfing, und damit zeigen: Keine Erzählung kann für alle Zeit überliefert und bewahrt werden. Jede sinkt irgendwann ins Vergessen zurück.[1]
Und die Bühne? Was haben Sie als Bild tatsächlich materialisiert?
Als mein Freund Reinhold Messner im Rahmen dieser Spielformen in der riesigen Salzburger Felsenreitschule an einem von sieben Abenden, der »Bericht am Feuer« hieß, am Schicksal der Shackleton-Südpolarexpedition die schriftlose Form des Erzählens vorführte, eine Form, in der ja schon Jäger und Sammler den Daheimgebliebenen berichtet haben und die wohl zu den Urformen alles Erzählens gehört, tat er das auf einer als Treibeisfeld gestalteten und tatsächlich gefluteten Bühne. Die ersten Sitzreihen waren mit weißen Tuchbahnen verhängt – Eisimaginationen. Hinter dem vor so großer Kulisse winzig wirkenden Erzähler erschienen und erloschen, sozusagen im Rhythmus seines Berichtes, etwa zwanzig Meter hohe Projektionen originaler Plattenfotografien von Shackletons Expeditionsfotografen. Tage später habe ich dann mit einem Auszug aus einem »Morbus Kitahara«-Kapitel – in weißer Schrift auf tiefblaue, hauchdünne Flugblätter gedruckt – den Hof der Salzburger Residenz sozusagen überflutet. Die Leute sind auf dem Weg zu ihren Plätzen einfach über diese Blätter gegangen, geschritten, getrampelt, und damit sollte auch vorgeführt werden: Was da verstreut herumliegt, ist nicht mehr zum Lesen, sondern nur noch Untergrund. Man geht über den Text, streift die Schuhe daran ab, weil es eine Wirklichkeit gibt, an die alles, was auf diesen blauen Flugblättern zu lesen war, zurückgefallen ist. Auf der Bühne wurde unterdessen gespielt, wovon das Kapitel handelte: ein Konzert im Freien. Am Ende verlor sich auch die Musik in der Dunkelheit, und es wurde genauso still wie am Anfang des ersten Tages.
Tor zum Atlantik, Brasilien
Als Kind hatten Sie Angst vor der Dunkelheit, die Sie jetzt beschwören. Es mußte immer eine Lampe brennen, wenn Sie einschliefen. Wann hat sich diese Angst verflüchtigt?
Diese Angst gehört ja wohl für viele Menschen zu ihren Kindheitserinnerungen. Die Sternennacht dagegen hatte für mich schon in frühester Zeit etwas Zauberisches. Die Dunkelheit in einem geschlossenen Raum ist ja etwas anderes. Dort ist die Finsternis wie in einer Höhle absolut, ohne den geringsten Lichtfunken. Und meine Angst galt jener Finsternis, in der sich ein Mensch befindet, der lebendig begraben oder in einem Verlies, einem Brunnenschacht gefangen ist. Gelangt man ins Freie, gibt es ja immer von irgendwo ein Lichtzeichen, das zeigt: Nicht alles ist schwarze Nacht. Und dann gibt es natürlich noch jene Form der Dunkelheit, in der man sich nicht vor Ungeheuern fürchtet, die aus einer Fensterhöhle, einem schwarzen Dickicht hervorbrechen könnten, nicht vor Gespenstern, Monstern und Bestien außerhalb des eigenen Wahrnehmungsfeldes, Einflusses oder Erfahrungsbereichs, sondern vor jenem Heer von Gestalten, die aus einem selber hervorstürzen können. Je dunkler und stiller, um so größer wird unter bestimmten Umständen die Wahrscheinlichkeit, daß es zu einem solchen Ausbruch dieser Bewußtseins- und Seelenmonster kommt.[2]
In der Leere können solche Monster auch am hellen Tag ausbrechen, in der Einsamkeit einer leeren Landschaft.
Aber dort gibt es kleinere und riesige Öffnungen. Der offene Himmel hat ja nur sehr selten, vielleicht bei extremen Windstärken, etwas Erschreckendes. Aber schon der bedeckte Himmel, der zweifeln läßt, ob es überhaupt noch etwas jenseits dieser Wolkendecke geben kann, nimmt manchmal und unter bestimmten Wetterbedingungen etwas Bedrohliches an. Und dann die Dunkelheit: Auch als Kind habe ich ja nicht gefürchtet, daß plötzlich ein Wolf leibhaftig auf mich zuspringen könnte, sehr wohl aber, daß Wesen es tun könnten, von denen ich in Märchen und Erzählungen gehört hatte und die in rasenden Geisterprozessionen durch meinen Kopf jagten. Ich habe für möglich gehalten, daß diese Phantasiekreaturen sich plötzlich materialisieren könnten, daß ich sie herbeidenke. Wenn es keine Ablenkung, kein Licht, keine Geräusche und Stimmen gab, die mich von diesem Herbeidenken des Ungeheuerlichen abhielten, wurden Stille und Dunkelheit gefährlich.
Die Furcht vor der Dunkelheit kann auch die vor dem Tod meinen. Viele Menschen tröstet der Gedanke, daß sie Spuren hinterlassen werden und durch die Erinnerung unsterblich sind. Von dieser Hoffnung, der Auslöschung zu entkommen, handelt auch »Die letzte Welt« und der Versuch der Hauptfigur Naso, Werk und Person gegen den Willen des Imperators und Schicksals in Stein zu meißeln. Ihre Werke setzen diesem Wunsch eine andere Vorstellung entgegen: Von mir wird nichts bleiben. – Ein tröstlicher Satz?
Im Kern ist jede Angst die vor dem Tod. Die Hoffnung auf das Bleiben ist kindlich, ja kindisch. Gerade im Zusammenhang mit der Kunst wird ja immer wieder diese blödsinnige Frage gestellt: Und was wird bleiben? Natürlich wird nichts bleiben. Aus diesem Bewußtsein heraus sollte man sich aber die Kostbarkeit dessen vergegenwärtigen, was ist. Für meine Salzburger Abende habe ich mir allerdings weder eine Predigt über das Verschwinden ausgedacht, noch wollte ich missionarisch für die Einsicht in die Unmöglichkeit der Dauer werben. Aber das Rauschen der Zeit sollte im Hintergrund immerhin hörbar sein. Schließlich haben damals ja nur wenige Zuschauer alle sieben Abende besucht, um den Zusammenhang zwischen der Stille am Anfang und der Stille am Ende tatsächlich zu erleben. Die anderen erlebten Abend für Abend die übliche Situation, in der es, wie immer, nach dem letzten Vorhang wieder dunkel und still wird und der Schlußapplaus alle Beteiligten wieder in die Wirklichkeit entläßt.[3]
Halbmond, Türkei
Warum ist es so schwierig, die eigene Vergänglichkeit zu akzeptieren?
Weil uns das Abschiednehmen, schon gar das allerletzte, schwerfällt, oft sehr schwer, und das Bleiben dagegen wie der Himmel erscheint. Aber natürlich zeigt sich in vielen Blickwinkeln, Komplementärwinkeln, ein anderes Bild. Abgesehen von religiös begründeten Paradiesbildern ist beispielsweise schon für einen Sonntagsastronomen wie mich das Drama der Materie ein alltägliches Ereignis. In den Zeiträumen, in denen wir leben, gilt dem »Bleiben« trotzdem die größte Sehnsucht. Ich möchte mich über diese Sehnsucht gewiß nicht erheben, denn natürlich will man alles, was man liebt und woran man hängt, möglichst lange behalten und sagt dann leichthin: »für immer« und weiß doch, daß die Ewigkeit für unsere Art von Dasein eine unerfüllbare Hoffnung ist. Schon vor naturgeschichtlichen oder gar astronomischen und astrophysikalischen Dimensionen sind wir ratlos. Aber es geht ja nicht darum zu sagen, der Wunsch nach Dauer sei lächerlich und das Verschwinden die einzige Wahrheit und der wahre Zugang zur Realität. Man sollte aber doch Bezüge herstellen zwischen den ungeheuerlichen Zeiträumen, in denen sich das Drama der Materie ereignet, und dem meteoritenhaften Erscheinen und Verschwinden organischer Existenz. Wir sollten uns bewußtmachen, wie kostbar diese flüchtige Existenz ist und wie unwahrscheinlich, daß es uns überhaupt gibt und jedes unserer Kunstwerke, sei es in der Musik, der Malerei, der Literatur oder wo auch immer. Die Frage: »Wie lange wird es dauern?« hat dann keine besondere Bedeutung mehr, jedenfalls nicht für mich.[4]
Also ist Ovids Wunsch nach Unsterblichkeit, wie Sie ihn in »Die letzte Welt« erzählen, töricht?
»Mein Name wird sich über die Sterne emporschwingen und unzerstörbar sein« habe ich in seinen »Metamorphosen« gelesen. Alle Achtung, diese Chuzpe beeindruckt mich. Aber was sind selbst die paar tausend Jahre, an die der verschollene Dichter dabei möglicherweise dachte, gegen den Lebenszyklus eines mittelgroßen Sterns? Wer von »Bleiben« spricht, meint also vielleicht eine Reihe von Generationen und den engen Zeitraum, in dem sich unsere Gattung gerade noch im Reich der Materie halten können wird.
Ihren Romanen würde ohne Ihre Faszination für Naturgeschichte, Astronomie und Astrophysik der basso continuo fehlen. Ich war neugierig, was diese Faszination ausmachen kann, und habe einen klugen Achtzehnjährigen gefragt, was ihn an schwarzen Löchern, roten Riesen und weißen Zwergen so beschäftigt. Er gab eine überraschende Antwort: Er halte nichts davon, Gottes Existenz abzustreiten. Intelligenter sei es doch, zu sagen, es kann einen Gott geben, und dann mit den Mitteln der Wissenschaft nach dem Ursprung unserer Welt zu fragen. Durch die Astrophysik sei beweisbar, daß es einen Urzustandgab, in dem unsere physikalischen Gesetze, Zeit und Raum nichts galten. Was uns wichtig sei, auch die Frage nach Gott, habe in diesem Urzustand keine Relevanz. Damit sei auch der Gedanke der Sterblichkeit ganz ohne Religion oder Atheismus irrelevant geworden. – Warum schauen Sie in die Sterne?
Moais, Osterinsel
Als Jugendlicher konnte ich schließlich mit diesem galaktischen und intergalaktischen Spezialinteresse Eindruck schinden. Und gelegentlich klappt das auch heute noch. (lacht)
Deswegen haben Sie also ab 1972 Astronomie studiert?
Noch profaner: Ich habe Philosophie studiert, aber in Wien bekamen Studenten, die an mindestens drei weit auseinanderliegenden Instituten Vorlesungen und Arbeitskreise besuchten, eine Netzkarte für die öffentlichen Verkehrsmittel gratis. Astronomie interessierte mich zwar, am Tag der offenen Tür war ich auch schon einmal in der einen und anderen Sternwarte gewesen, um dort aktuelle Himmelserscheinungen zu verfolgen. Also studierte ich Astronomie im Nebenfach und konnte von da an wie der Teufel mit öffentlichen Verkehrsmitteln herumgeistern, ohne mich zu fürchten – ich war zwar langhaarig und dem Wein und Haschisch zugetan, bin aber als braver junger Mann nur ungern schwarzgefahren. Mir war es einfach um die Zeit leid, die man dann auf Kosten der Straßenbahnlektüre wachsam sein mußte, um nicht erwischt zu werden.
Und wie war es, in den 1970er Jahren Astronomie zu studieren?
Es gab verschiedene Sternwarten in Wien, deren öffentlich zugängliches Instrumentarium allerdings ziemlich veraltet war. Ich hatte mich schon als Kind für Mikroskope, Fernrohre und andere optische Geräte interessiert, aber während des Studiums entdeckte ich die ungeheuren technischen Möglichkeiten, den Blick zu bewehren und zu schärfen, um in andere Dimensionen zu schauen. Leistungsfähige Instrumente sind natürlich eine Frage des Geldes. Ich habe mir im Bewußtsein, daß die antike Astronomie allein auf der mathematisch erweiterten, beharrlichen Beobachtung mit freiem Auge beruhte, damals eines der billigeren Teleskope gekauft, um wenigstens den Mond und die Sonnenflecken zu beobachten, und habe etwa ein Jahr lang die Entwicklung der Sonnenflecken aufgezeichnet und ein Journal ihrer Veränderungen erstellt.
War es der Entdeckerdrang, der Sie wie einige Ihrer Romanfiguren trieb?
Ich hatte nie die Ambition, im kartographischen oder naturwissenschaftlichen Sinn etwas zu entdecken. Mir war der Nachvollzug komplexer Einsichten wichtiger. Ich wollte beispielsweise das sehen, was andere vor mir bloß berechnet hatten: von Galilei bis Kepler. Was die mit Geräten, die ungefähr so gut und schlecht waren wie mein erstes Teleskop, entdecken konnten, war phantastisch. Für mich war es schon ein Triumph, etwa die Bewegung der Jupiter-Monde zu verfolgen oder die Cassinische Teilung der Saturn-Ringe und die Emissionsschleier des Orion-Nebels, einem Sternentstehungsgebiet, nach meinen Beobachtungen mit weißem Stift auf schwarzes Papier zu zeichnen.[5]
Wie haben die Himmelsbeobachtungen Ihren Blick verändert?
Ein geliebter Onkel hat mir noch in meinen Schuljahren eine vierbändige Nietzsche-Ausgabe geschenkt, aus der mich ein Satz geradezu ansprang: »Solange du die Sterne noch empfindest als ein ›Über dir‹, fehlt dir der Blick des Erkennenden.« Als Dreizehn- oder Vierzehnjähriger entdeckte ich da die Binsenweisheit, daß man in den Himmel auch hinabschauen kann. Den Blick zu heben war schließlich nur eine Möglichkeit von vielen. Der Himmel konnte plötzlich auch Abgrund sein oder etwas jenseits von unten und oben. Dieser Gedanke hat mich beschäftigt und provoziert: Ich wollte die Sterne nun wie Kiesel am Grund eines Sees betrachten.
Eisgeister, Höllengebirge
Ist es Ihnen gelungen?
Ich habe erlebt, daß, was oben und was unten ist, selbst Himmel und Hölle, menschliche Erfindungen sind, die nur wenig mit der Realität zu tun haben. Ich kam mir dann auch entsprechend klug vor, gerissen, mit allen Wassern gewaschen. (lacht)
Die Nietzsche-Begegnung hat aber ja vor der eigentlichen Himmelsbeobachtung stattgefunden. Wie hat die Anschauung, wie haben diese konkreten Wahrnehmungsspiele tatsächlich Ihren Blick verändert?
Der Himmel, sei es der Sternenhimmel oder einfach eine Wolkendecke, ist für mich Teil der Landschaft. Wenn ich betrachte, was mich umgibt, gehört immer auch eine Drehung um die eigene Achse dazu: Was ist hinter mir, was vor und neben mir. Das gilt nicht nur in der Horizontalen, sondern auch in der Vertikalen. Mich wundert, daß man diese Betrachtungsweise in den Bereich der Naturwissenschaften abgeschoben hat. Es heißt, unsere Probleme seien doch sozialer, politischer, bestenfalls ästhetischer Natur. Was gehen uns also die Sterne an? Das soll allein Sache der Astronomen und Physiker sein. Dabei ist doch unabweisbar: Wir sind mittendrin. Auf das Totenbildchen meines Vaters habe ich ein Herder-Gedicht setzen lassen, das er sehr mochte: »Wie Schatten auf den Wogen schweben / Und schwinden wir / Und messen unsere trägen Schritte / Nach Raum und Zeit / Und sind, und wissen’s nicht, in Mitte / Der Ewigkeit.«
Was hat diese Wahrnehmung mit dem Erzählen von Geschichten zu tun?
Wenn man fragt: Was ist eine Geschichte, was ist die eigene Geschichte und was die der anderen, wo beginnt eine Geschichte, und wo endet sie? Wenn man also in Geschichten denkt, klingt selbstverständlich immer die Frage mit, woher wir kommen und wohin es mit uns geht. Dann muß ich irgendwann aber auch den Kopf heben oder mich sonstwie bewegen und danach fragen, in welchen Räumen sich unsere Existenz ereignet. So werden allmählich die fernsten Weiten, selbst wenn es um Lichtjahre geht, Maßstäbe unserer Lebensrealität.[6]
Verschwinden wir nicht in diesen Räumen?
Die physische Winzigkeit, zu der wir unter einem Sternhimmel schrumpfen sollen, ist ein strapaziertes Klischee. Wie klein, wie groß, ist doch eine Frage der Betrachtung. Ob ich das Wort »Ewigkeit« säusle und darauf beharre, daß sie unser Vorstellungsvermögen übersteigt und wir keinerlei Anschauung von ihr haben, oder ob ich, wie in der Astrophysik, behaupte, daß wir ihre Grenzen vielleicht nicht sehen, aber doch vielleicht berechnen können – eines ist sicher: Die Ahnung, daß diese strahlenden, brennenden, in energetischen Prozessen verglühenden Materiezusammenballungen weit, weit draußen in der Finsternis zu uns gehören und wir zu ihnen. Was wir dort draußen sehen, ist das Material, aus dem wir gemacht sind.
Warum sind Sie nicht Astronom geworden?
Ich hatte nie vor, wissenschaftlich zu arbeiten. Als Erzähler wollte ich mich sozusagen am Himmel bloß entzünden. Es gibt ja kaum etwas, das so unglaubliche Informationen transportieren kann wie ein einfacher Lichtstrahl. Über die Spektralanalyse des Lichts, das uns aus den äußersten Räumen erreicht, läßt sich beispielsweise etwas über die elementare Beschaffenheit eines Kugelsternhaufens, über seine Temperatur, Geschichte und seine Zukunft erfahren. Licht ist eine nahezu unerschöpfliche Quelle des Wissens.
Wissen allein macht aber noch keine Geschichte, oder?
Es gibt Himmelsatlanten, in denen das aktuelle kartographische Wissen über den sichtbaren Sternenhimmel aufgeschlüsselt ist. Mit jedem Lichtpunkt, den wir in der Nacht über oder unter uns sehen, haben sich schon Menschen beschäftigt. Was auch immer uns da aus der Tiefe anstrahlt, jede dieser Lichtquellen, trägt also nicht nur die dramatische Information über die Entstehung von etwas und über seine Verwandlungen und sein Verschwinden ins Nichts, sondern auch die Geschichten seiner Erforschung, Menschengeschichten von der Durchmusterung des Himmels. Wer waren diese Menschen, die diese Punkte mit ihren Teleskopen oder bloßen mathematischen Gleichungen lesen konnten? Eine schöne Vorstellung: Das Universum als riesiges Feld von Geschichten.[7]
Erste Adresse, Wien
Erzählen diese Lichtstrahlen aber am Ende nicht immer dieselbe Geschichte von Entstehung und Zerstörung?
Sie repräsentieren sehr verschiedene Stadien der Entwicklungsgeschichte etwa eines Sterns oder einer ganzen Galaxis, und zum Teil sind die Datenströme nach wie vor höchst rätselhaft. Das All ist eben kein offenes Buch, sondern ein gewaltiges Rätselschauspiel. Jede beantwortete Frage wirft drei neue auf. Die berühmte Philosophenfrage »Warum ist überhaupt etwas und nicht vielmehr nichts?« stellt sich in tausenderlei Varianten. Warum gab es überhaupt einen Anfang? Und was ist das, ein Anfang? Wohin führt das begonnene Schauspiel? Mit den naheliegenden Antworten läßt sich spielen und spekulieren. Die astrophysikalischen oder gar kosmologischen Theorien sind immer auch große Erzählungen, die nur zum Teil in Sprache zu fassen sind. Für viele ihrer Schlüsse und Gleichungen gibt es keine Sätze mehr, sondern nur noch Formeln.
Die Namen unserer Sternbilder zeigen allerdings, daß naturwissenschaftliche Beobachtungen und welterklärendes Erzählen schon immer verknüpft wurden.
Die Naturwissenschaften haben seit je und in vielen Aspekten das Reich der Mythologie und natürlich auch das der Religionen berührt.
Und was lernt also der Schriftsteller Ransmayr, der im 21. Jahrhundert lebt, von der Beobachtung uralter kosmischer Prozesse?
Jede Information, jede genauere Betrachtung, alles Nachdenken über Erscheinungen und Phänomene, die man vor sich hat oder zu denen man hinaus-, hinab- oder aufschaut, sind Gewinne für das Erzählen. Es muß ja dabei nicht immer um den Kosmos gehen. Aber die dramatischen Prozesse der Einsicht in Entstehung und Auflösung jeder Existenz sind Hilfsmittel und Beispiele, um auch jeweils benachbarte und nächstliegende Prozesse besser zu verstehen. Und selbst wenn nur das Staunen über die Möglichkeiten bliebe, Neues und Unbekanntes zu erfahren, wäre das schon ein Vergnügen, für das es sich lohnen würde, sich mit der ungeheuren Formenvielfalt der organischen und anorganischen Natur zu beschäftigen.
Einer, der auch den Himmel beobachtet, ist Liam, eine der beiden Hauptfiguren Ihres Romans »Der fliegende Berg«. Mir ist aufgefallen, daß Sie an einer Stelle Ihren Erzähler über ihn sagen lassen, Liam »sehe« und »höre« als Beobachter nicht, sondern »träume« und »entwerfe«. – Albert Einstein soll einmal gesagt haben, nicht das Wissen sei ausschlaggebend, wenn man sich mit Sternenkunde beschäftige, sondern die Phantasie. Ich nehme an, ganz so einfach ist es nicht. Liam zumindest schreckt einen als Leserin auch ab, weil er so wenig von seiner Umgebung wahrnimmt und ganz auf seine Vorstellungen konzentriert ist. Zugleich ist er die treibende Kraft und derjenige, der überhaupt imstande ist, fremde Welten zu öffnen, weil er sie unbedingt – wenn vielleicht auch blind – sehen will.
Es gibt beides: Auf der einen Seite möchte ich mir die Räume zugänglich machen, die uns sozusagen in konzentrischen Kreisen umgeben. Ich möchte verstehen oder zumindest erahnen, was in dieser äußeren Welt vor sich geht. Auf der anderen Seite weiß ich, daß das ein maßloser Versuch ist. Schaut man in diese Räume, wird man mit einer solchen Größe, Tiefe und einer oft bedrückenden Rätselhaftigkeit konfrontiert, daß man nur kapitulieren kann. Da hilft vielleicht die Flucht in die Phantasie oder – wenn ich Kosmologe wäre – in eine kühne Theorie. Einige der astrophysikalischen Theorien sind ja phantastischer als beispielsweise die Genesis.
Das klingt resigniert.
Resignation wäre, zu sagen: Am Ende bleibt doch nur noch die eigene bescheidene Phantasie, die sich wuchernd in diesem Vakuum ausbreitet. Aber ist es nicht auch besänftigend, daß wir die Ränder des Ganzen, gar den Kern, nicht oder nur in unseren wenigen, lichten Momenten streifen? Der leere, dunkle Raum ist doch auch ein Raum der Möglichkeiten, der Glücks- und Erlösungsvorstellungen und nicht nur einer der finsteren Phantasien. Wie Ihr achtzehnjähriger Freund schon sagte: Je beharrlicher ich mich mit der, sagen wir ruhig, Natur beschäftige, desto mehr Gedanken kann ich über die Wirklichkeit entwickeln. Ich bin dann mit einer explosionsartig wachsenden Zahl von Möglichkeiten des Daseins konfrontiert und habe natürlich auch das Recht und die Freiheit, mich teilweise wie ein Irrer in diesem Reich der Möglichkeiten zu bewegen.[8]
Mit wem können Sie eigentlich über Ihre Himmelsbeobachtungen und die Gedanken, die Sie sich dazu machen, reden? Ich nehme an, es gibt nicht sehr viele Menschen, die sich mit Astrophysik und Astronomie auskennen.
Ich kenne einige Astronomen, die auf den großen Sternwarten und Observatorien in La Palma oder in Chile zu tun hatten. Wenn ich mit ihnen spreche, bin ich es, der Mühe hat zu folgen. Etwa in den Gesprächen mit dem Wiener Quantenphysiker Anton Zeilinger, dem ich freundschaftlich verbunden bin. Er errichtet theoretische Gebäude, vor denen die Geschichten, die sich etwa Dreifaltigkeitstheologen ausdenken, recht einfacher Stoff sind. Aber das Gespräch über das, was man sieht, hört, erfährt, erfordert keine Fachkenntnisse. Mich interessieren ja auch die alltagssprachlichen Grenzen: Wo beginnt das Reich der Formeln, und wo endet es? Zeilinger hat in Büchern wie »Einsteins Schleier« versucht, die kühnsten Theorien der Physik auch erzählerisch darzustellen, sagt aber selbst, daß es Regionen des Denkens gibt, in denen Ausdruck nur noch in Gleichungen möglich ist. Dorthin kann ich ihm kaum folgen, weil ich weder Mathematiker noch Physiker bin. Aber ich möchte diese Grenzen zwischen Formel und Sprache wenigstens so weit wie möglich hinausschieben. – Möchten Sie noch einen Kaffee? (Christoph Ransmayr entfernt sich, es klappert heftig in der Küche, und er kehrt mit einem Stapel Mohnkuchenstücke zurück.) Auf den langen Wegen durch die marokkanische Wüste ist mir mein erstes Büchlein »Strahlender Untergang« wieder eingefallen. Haben Sie das mal in der Hand gehabt?[9]
Ja. Wie kommen Sie jetzt darauf?
Da wird der Anspruch der Naturwissenschaften als langweilig und maßlos denunziert, das Meßbare zu messen und das Unmeßbare meßbar zu machen. Als ich über ein Gespräch mit Zeilinger nachdachte, kam mir in den Sinn, daß natürlich auch der Anspruch der Literatur, das Erzählbare zu erzählen und das Unerzählbare erzählbar zu machen, genauso maßlos und langweilig ist.
Im Edelweißbett
An welchen Ihrer Texte denken Sie dabei konkret?
Im »Atlas« habe ich mich zum Beispiel in sehr verschiedene, weit auseinanderliegende Bereiche begeben, von denen ich meinte, daß sie zwar erzählbar wären, aber so noch nicht erzählt wurden. Meine Wahrnehmungen seien im Luna-Park der Erzähler so noch nicht vorgekommen, dachte ich. In der Frage, was und warum man erzählen möchte, schwingt immer schon dieser Ehrgeiz mit: Erzählen, weil diese oder jene Geschichte noch nie oder so noch nie erzählt wurde.
Man ist aber selten der erste mit seiner Geschichte, oder? Angeblich gibt es ja nur sieben Grundkonstellationen in der Literatur, die immer wieder variiert werden.
Sicher kann ein Literaturwissenschaftler jeden Originalitätsanspruch leicht widerlegen und sagen: »Dein Topos ist schon drei, ach was, dreihundert Mal erzählerisch bearbeitet worden. Hast du den und den und den nicht gelesen? Die haben es dazu auch noch besser gemacht als du.« Aber mich bestimmt das innere System meiner Möglichkeiten. Aus irgendeinem Grund macht es mir eine geradezu hysterische Freude, an etwas zu arbeiten, das so, also in meiner Nuancierung, noch nie zur Sprache gebracht worden ist. Dabei ist etwas im Spiel, das wirklich mit Glück zu tun hat.
Woher rührt dieses Glücksgefühl genau?
Ich fühle mich dann vollständig und mit allen Fasern am Leben, weil das Schreiben dann ohne jeden Zweifel ganz und gar meine Sache ist. Während meines Studiums habe ich mich auch mit Musik beschäftigt, habe alle möglichen Instrumente gespielt und überlegt, mich etwa mit meiner Querflöte an der Akademie zu bewerben. Aber es gibt sicherlich nichts, was ich je besser gekonnt habe und besser können werde als schreiben, erzählen. Das heißt nicht, daß es nicht auch in dieser Arbeit verzweifelte Situationen gibt. Aber das Ende des Schreibens wäre immer auch mein Ende.
Im Gegensatz zu diesem Glücksgefühl bedeutet die Maßlosigkeit, von der Sie vorher sprachen, nichts Gutes in unserem Wertesystem. Kann man die Maßlosigkeit des erzählerischen Anspruchs vielleicht mit der Gier nach den weißen Flecken vergleichen, die einige Reisende Ihrer Romane treibt, zum Beispieldie furchtbare Expedition in »Die Schrecken des Eises und der Finsternis«?
Schädelstätte, Kambodscha
Mit Sprache kann man zwar kartographieren, was objektiv existiert, aber bisher noch nicht entdeckt wurde, aber die Literatur geht weit über diese objektive Realität hinaus: Ich kann als Schriftsteller auch weiße Flecken erschaffen. Mit der Sprache kann ich mich also einerseits der vermessbaren und abbildbaren Wirklichkeit zuwenden, habe aber gleichzeitig die Möglichkeit, das Komplementärbild zu entwerfen, die bloße Möglichkeit. Wenn ich etwa vom Bleiben rede, ist das legitim. Aber sinnvollerweise nur, wenn ich dabei auch das Komplementäre, das Verschwinden, mitdenke.
Es geht nicht um den Möglichkeitsraum allein, sondern um Gleichgewicht.
Nur wenn ich eine Ahnung davon habe, wie ungeheuerlich der Raum des Verschwindens ist, kann ich die Umrisse der Sehnsucht nach Unvergänglichkeit und Bleiben skizzieren.
Dieser Versuch ist doch der rote Faden, der durch Ihr Werk führt.
Als Schriftsteller begebe ich mich eher auf interplanetarische Reisen: Auf einem Planeten ging es beispielsweise um eine Arktisexpedition, aber dann, um Himmels willen, im nächsten Buch nicht schon wieder eine Expedition, schon gar nicht in die Arktis, und das nur, weil einige Leute sagen: »Das kannst du gut, mach das noch einmal.« Also auf zum nächsten Planeten, zu einer anderen Geschichte, zum Beispiel der eines unglücklich Verbannten namens Naso, Ovid, auf und davon in die griechisch-römische Mythologie. Natürlich wurde ich damals auch gefragt: »Warum das denn jetzt? Es gibt doch noch andere Schiffsgeschichten, Expeditionsgeschichten, erzähl besser die.«
Sie wollten aber in unendliche Weiten vorstoßen und zu neuen Galaxien aufbrechen.
Neue thematische Planeten erkunden und zur Sprache bringen, ja. Allerdings merkt man dann, daß auch dieser neue Planet annähernd rotationsgerundet ist, daß man ihn vielleicht sogar schon einmal äquatorial überflogen hat. Hebt man dann den Blick und sieht, da trudeln und kreisen noch andere Planeten, kann man sich natürlich auch ihnen zuwenden. Man muß eben auch neue Techniken entwickeln, um für sich etwas tatsächlich Neues zu finden. Darum führte meine Reise dann zu »Morbus Kitahara« und zum »Fliegenden Berg« und in das vernetzte Zusammenspiel von Lebensläufen auf allen Kontinenten im »Atlas«.[10]
Ein Kaleidoskop, das man immer ein Stück weiterdrehen kann, so daß ein neues Bild entsteht. – Sie haben einmal geschrieben, als Schriftsteller könne man eine Stadt mit nur einer Stimme und einem Ohr errichten, mehr brauche man nicht. Ein Kontinuum in Ihren Büchern ist aber die handfeste Materie, Urphänomene und -stoffe wie Sterne und Steine spielen immer wieder eine große Rolle.
Könnte ich noch einmal studieren, würde ich mich für ein naturwissenschaftliches Studium entscheiden. Der Philosophie würde ich mich erst nach vielen Semestern, in denen ich mich an den Gesetzen der Materie abgearbeitet habe, zuwenden. Die materielle Realität – ob das ein Stern, ein Stein, ein Organismus, eine unter dem Mikroskop betrachtete Zelle ist – bleibt eine unerschöpfliche Quelle der Inspiration, die immer wieder in die fernsten Gegenden der Phantasie führt.
Wäscheleine, Kollmannsberg-Alm
Was wäre ein Beispiel?
In der Nordsahara gibt es einen Höhenzug, den Jebel Bani. Er trennt die Sahara vom Anti-Atlas. Ich war gerade dort. Was in seinen Gesteinsformationen an Farben zu sehen ist: kilometerlange Bänder von Violett bis Rot über Grün und Blau, Gelb, Orange … Allein die Entstehungsgeschichte eines solchen Bandes ist voller Dramatik, Dynamik und Bewegung. Man würde auf sehr vieles verzichten, würde man die Literatur von naturwissenschaftlichen Fragen und den Erzählungen der Wissenschaft völlig trennen. Die natürlichen Abläufe im Mikro- oder im Makrobereich führen vor, was ein Drama ist, was Geschwindigkeit und Innehalten, was Erstarrung und Entstehung und Vervielfältigung bedeuten können. Schon allein des Formenreichtums der Materie wegen ist es gut, die äußere Welt nicht aus den Augen und dem Bewußtsein zu verlieren.
Dann sind wir aber wieder bei den Universalgelehrten des 18. und 19. Jahrhunderts, die heute selten geworden sind.