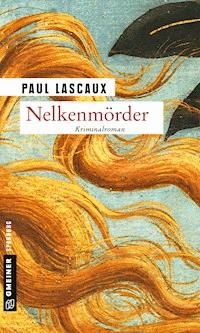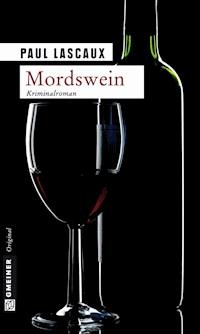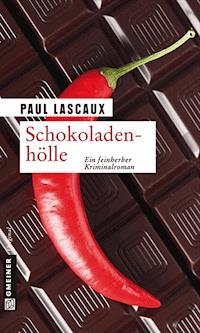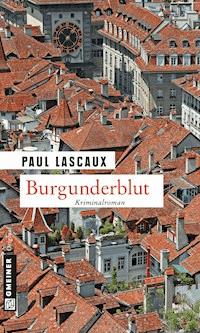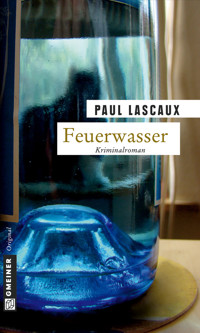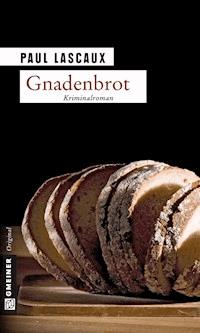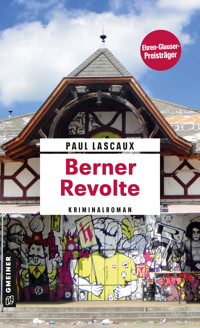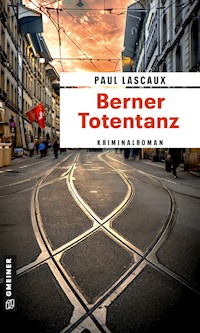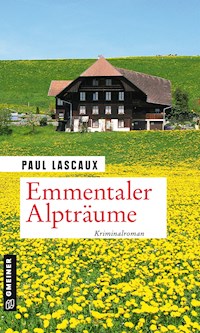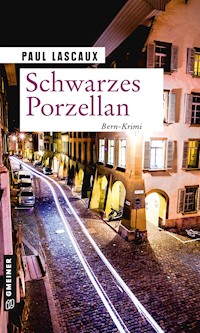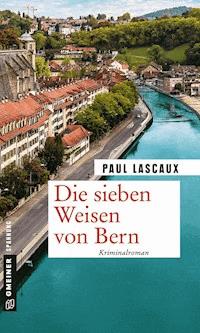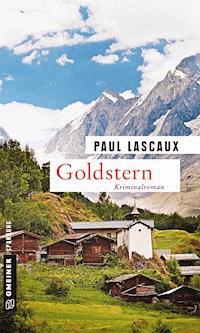Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: GMEINER
- Kategorie: Krimi
- Serie: Detektive Müller und Himmel
- Sprache: Deutsch
Kaspar Kempf, ein Sammler von Kuriosa und historischen Dokumenten, wird von einer ominösen Gruppe entführt. Das Erpresserschreiben enthält wirre Bedingungen, aber keine Lösegeldforderung. Als Markus Forrer von der Police Bern einen der mutmaßlichen Entführer festnimmt, schweigt dieser beharrlich. Die Zeit läuft Forrer davon. Seine letzte Rettung ist die Detektei Müller & Himmel. Gemeinsam dringen sie tief ein in ein dunkles Kapitel der Schweizer Geschichte, um den Entführern auf die Spur zu kommen.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 220
Veröffentlichungsjahr: 2024
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Paul Lascaux
Berner Gerechtigkeit
Kriminalroman
Zum Buch
Dunkle Vergangenheit „Das Kommando ›Gerechtigkeit für Jakob Schöni‹ hat den Blog-Verfasser Kaspar Kempf entführt. Für seine Freilassung verlangen wir die Einsetzung einer Kommission, welche die Aufarbeitung des Verdingkindwesens im neunzehnten Jahrhundert betreibt. Die Millionen, die üblicherweise für die Befreiung von Gefangenen verlangt werden, sollen in die Erforschung der düsteren Geschichte fließen. Um das Leben des Herrn Kempf nicht zu gefährden, erwarten wir Ihr zeitnahes Einverständnis, das Sie uns über die üblichen Medien zukommen lassen. Der Revolutionsrat entscheidet, ob Ihr Engagement ausreichend ist.“
Ein Erpresserbrief ohne Lösegeldforderung, Aufarbeitung des Verdingkindwesens? Die Police Bern steht vor einem Rätsel. Als das Team von Marcus Forrer einen der Entführer festnimmt, schweigt dieser beharrlich. Forrer läuft die Zeit davon. Dann wird die Leiche von Kaspar Kempf gefunden. Forrer bittet die Detektei Müller & Himmel um Mithilfe. Es gilt, die Gründe für das Verbrechen zu klären, um an die Helfer des Entführers zu kommen.
Paul Lascaux ist das Pseudonym des Schweizer Autors Paul Ott. Der studierte Germanist und Kunsthistoriker lebt seit 1974 in Bern und hat in den letzten 40 Jahren zahlreiche literarische Veröffentlichungen realisiert. Einige seiner Kurzkrimis liegen als Übersetzungen in Polen und in den USA vor. Im Jahr 2020 erhielt er den Spezialpreis der Deutschsprachigen Literaturkommission des Kantons Bern. 2021 wurde das von Paul Ott initiierte „Schweizer Krimiarchiv Grenchen“ eröffnet.
Impressum
Personen und Handlung sind frei erfunden.
Ähnlichkeiten mit lebenden oder toten Personen
sind rein zufällig und nicht beabsichtigt.
Die automatisierte Analyse des Werkes, um daraus Informationen insbesondere über Muster, Trends und Korrelationen gemäß § 44b UrhG („Text und Data Mining“) zu gewinnen, ist untersagt.
Immer informiert
Spannung pur – mit unserem Newsletter informieren wir Sie
regelmäßig über Wissenswertes aus unserer Bücherwelt.
Gefällt mir!
Facebook: @Gmeiner.Verlag
Instagram: @gmeinerverlag
Besuchen Sie uns im Internet:
www.gmeiner-verlag.de
© 2024 – Gmeiner-Verlag GmbH
Im Ehnried 5, 88605 Meßkirch
Telefon 0 75 75 / 20 95 - 0
Alle Rechte vorbehalten
Herstellung/E-Book: Mirjam Hecht
Umschlaggestaltung: U.O.R.G. Lutz Eberle, Stuttgart
unter Verwendung eines Fotos von: © AleksandarGeorgiev / istockphoto.com
ISBN 978-3-8392-7802-4
Zitat
»Sie brach daher auch zuerst das Stillschweigen und sagte meinem Vater, das gehe ihn am allerwenigsten an, er selbst sei nichts wert, und seine Schlampe und vier andern Fressmäuler habe man ihm lang genug umsonst gefüttert.«
Jeremias Gotthelf: Der Bauernspiegel (1837)
1
Schwere Träume. Ein ausgetrockneter Rachen. Und dann immer wieder dieses Lied, das ihm nicht aus dem Kopf ging. Es warf ihn in seine Jugend zurück, Mitte Achtzigerjahre. »What’s Love Got To Do With It« war der Titel, und er wusste keine Antwort. Eine kräftige Frauenstimme sang davon, dass die Liebe ein Gefühl aus zweiter Hand war, eine Emotion, die jemand schon abgelegt hatte, über die sie hinweg war.
Tina Turner. Der Name tauchte auf, als er langsam zu sich kam. Er hatte die Meldung noch im Radio gehört. Die Sängerin, die in Küsnacht am Zürichsee wohnte, war mit dreiundachtzig Jahren verstorben. Das war gestern. Also zählte man heute den 25. Mai 2023. Er machte die Augen auf. Es blieb düster. Die Wetterprognose hatte doch Sonne versprochen?
Er bemerkte, dass er sich in einem dunklen Raum befand, einem ihm unbekannten. Es musste ein Keller sein. Er lag auf einer harten Pritsche in einem feuchtkühlen Verlies, das nur durch ein spinnwebverhangenes Fenster etwas Tageslicht empfing. Gerade genug, dass er seine Kleidung ordnen konnte, als er sich aufgesetzt hatte. Er trug dasselbe wie gestern, allerdings waren Jackett und Hose schon arg zerknittert, und das Hemd roch nicht so, wie es riechen sollte. Es stank nach Schweiß und Chemie.
Langsam dämmerte ihm, dass er entführt worden war. Er war aus dem Haus gegangen, um Einkäufe zu erledigen. Unterwegs zum Supermarkt befand sich ein freies Feld, bevor der Dorfkern begann. Dort, so erinnerte er sich, hatte ein dunkler Kastenwagen angehalten. Ein junger Mann hatte ihn nach dem Weg gefragt, als er plötzlich von hinten eine Bewegung spürte und dann ein feuchtes Tuch, das ihm jemand ins Gesicht drückte. Vielleicht Chloroform, jedenfalls etwas, das für die Atemwege nicht gesund sein konnte. Er atmete tief ein und aus, bemerkte jedoch keine Beeinträchtigung, lediglich einen trockenen Hals. Er hatte lange nichts mehr getrunken. Und Hunger hatte er auch, wie er jetzt bemerkte.
Er konnte sich seine Situation nicht erklären. Er war Lehrer in Teilzeitanstellung an einer Gewerbeschule. Möglicherweise nicht der beliebteste der Pädagogen, denn er galt mit seinen zweiundfünfzig Jahren, seiner für manche vielleicht etwas nüchternen Art und dem sarkastischen Humor nicht unbedingt als Vorzugslehrer. Aber so unbeliebt, dass man ihn deswegen entführen und in ein Kellerloch sperren musste, war er nun auch wieder nicht. Bislang hatte es keine Gelegenheit gegeben, ihm den Grund für diese Aktion mitzuteilen. Gut, er hatte ein geringes Vermögen angespart und war Single. Das hieß aber auch, dass ihn kaum jemand vermisste und für ihn zahlen würde, falls entsprechende Forderungen eingingen. Aber davon bekäme er in seinem Kellerloch kaum etwas mit.
Und Tina Turners »second-hand emotion« half da auch nicht weiter, als sie sich wieder in seinem Kopf manifestierte. Er blickte sich um, guckte an die Wand und sagte: »Kaspar Kempf. Das bin ich. Falls es alle andern vergessen sollten, kannst du dich an mich erinnern.« Er fand in der gegenüberliegenden Ecke einen Kübel, der offenbar für seine Notdurft gedacht war. Er schaute sich um. Aber weder Esswaren noch Tranksame fand er. Er beschloss, sich mit anderem zu beschäftigen, um sich nicht weiter mit unbeantwortbaren Fragen verrückt zu machen.
Kempf hatte ein paar seltsame Hobbys und in den letzten Jahren ziemlich viel Zeug zusammengekauft, das seine Wohnung nach und nach füllte. Seltsam deswegen, weil er Artefakte sammelte, die sonst kaum jemanden interessierten. Vor einigen Monaten hatte er auf einer Auktionsplattform im Internet unter der Rubrik »Briefmarken« den Bereich »Vorphilatelie« angeklickt. Viele Leute nannten ihre Angebote »BoM«, also Briefe ohne Marken, was eine Zeitspanne bis in die Sechzigerjahre des neunzehnten Jahrhunderts umfasste. Oft waren im Angebot nur Umschläge abgebildet, manchmal aber hatte man die ganzen Texte fotografiert, die sogenannten »Faltbriefe«, einseitig beschriebenes Papier, das dann so zusammengefaltet wurde, dass daraus ein Couvert entstand, das schließlich mit einem Wachs- oder Presssiegel vor unbefugten Blicken geschützt wurde.
Es gab kaum Mitinteressenten, und wenn, dann suchten sie schöne Balken- oder Rundstempel, woran Kempf sich auch erfreute. Ihn jedoch begeisterten die Inhalte. Etwa die Hälfte der Korrespondenz bestand aus Geschäftsschreiben, die einem Wirtschaftsgeschichtsstudenten Auskunft über frühere Beziehungen zwischen Kunden und Anbietern von Waren geben konnten. Ein Drittel waren Anfragen und Auskunftsbegehren zwischen Ämtern und Gemeinden, wobei es oft um Erbschafts- oder Kostgeldfragen ging. Am Anfang hatte er nur einzelne Wörter entziffern können und Briefe nach Unterschriften oder Örtlichkeiten gekauft. Denn meistens waren sie in Kurrent verfasst, das er anfangs nur Wort für Wort entziffern konnte. Aber er hatte sich die Schrift inzwischen angeeignet, was ihm dabei half, bereits im Internet festzustellen, ob sich ein Kauf lohnen würde.
Ganz selten hingegen fand er private Briefe im Angebot. Die meisten davon hatte man vor oder nach dem Tod der Schreiber entsorgt, andere lagen womöglich noch in unzugänglichen Familienarchiven. Kam dazu, dass der größere Teil der Bevölkerung nur Briefe verfasste, wenn damit ein bestimmtes Anliegen verbunden war, und nicht einfach aus einem Mitteilungsbedürfnis heraus, denn das Schreiben war eine mühselige Angelegenheit, und die meisten Leute, denen man etwas mitzuteilen hatte, wohnten eher um die Ecke, sodass man es ihnen bei einem Umtrunk mitteilen konnte.
Einen solchen Privatbrief nun hatte Kaspar Kempf Mitte Februar gefunden. Er war an eine Jungfer Julie Ferrier gerichtet, die in Bern »gegen über der Caserne« wohnte, »hinter den Speichern«, hatte er mit gnädiger Hilfe seiner Facebook-Freunde entziffert. Für die Transkription war er hingegen noch auf andere angewiesen. Er hatte einen David aus Berlin kennengelernt, der als Hobby schöne Kurrentschrifttexte verfasste. So gelang es, Schritt für Schritt eine Vorstellung davon zu erhalten, was ein Gabriel Schiesser am dritten Februar 1836 zu Papier und die Post von Luzern nach Bern gebracht hatte.
»Bis dato habe sehr schlechte Witterung gehabt. Sonntag Morgen hatte es in Burgdorf sehr viel Schnee u gegen Sumiswald zu immer mehr u mehr u der Sturmwind hatte an vielen Orten die Straße unkenntlich gemacht u große Wächten zusammen getrieben so daß nur mit Mühe durch zu brechen war, mit mh: Chaise; der folgende Tag war nicht besser, denn es regnete in den vielen Schnee, so daß man im Pfuhl beynahe steckenbliebe, gestern war es noch nicht besser. Heuthe hingegen geht es besser der Schnee hat sich beynahe in hier verlohren.«
Kempf hatte den Text auswendig gelernt und erinnerte sich mit großer Zuneigung, nicht nur wegen des persönlichen Charakters, sondern auch, weil er einiges recherchieren konnte, was ihm die beiden Menschen nahegebracht hatte. Bevor er nach Bremgarten gezogen war, hatte er selbst an der Kasernenstrasse gewohnt, und er kannte einen Kollegen mit demselben Nachnamen, beides motivierte ihn zusätzlich, sich diesem Schreiben zu widmen.
Bald jedoch bemerkte er, dass die Kaserne damals noch nicht im Breitenrainquartier gestanden haben konnte, denn dann wäre sie außerhalb der zu verteidigenden Stadt gelegen, was widersinnig war. Tatsächlich wurde sie erst vierzig Jahre später dort gebaut, wo sie sich auch heute noch befand. In der ersten Hälfte des neunzehnten Jahrhunderts jedoch lag sie, das eruierte er mit einem Blick in das »Historisch-topographische Lexikon der Stadt Bern« recht schnell, im ehemaligen Predigerkloster hinter dem Kornhaus. Damit war auch das mit den Speichern geklärt.
Nun stimmte aber noch nicht alles. Es gab online ein »Adressenbuch der Republik Bern« aus demselben Jahr wie der Brief, also von 1836. Darin waren sämtliche Einwohner der Stadt Bern alphabetisch gelistet. »Ferrier, Geschwister, Elise, Ursula, Adriane, Julie, Modisten, Aarbergergasse, R. Qr., Nr. 43« lautete der Eintrag, also »Rothes Quartier«, denn seit der Helvetik war die Altstadt von Bern nach Farben geordnet, die auf die napoleonischen Truppen zurückzuführen waren. Man sagte dem französischen Heer nach, dass die betrunkenen Soldaten deswegen leichter in ihre Unterkünfte zurückgefunden hätten.
Dann fand Kempf den »Oppikoferatlas«, der ein genaues Straßen- und Häuserverzeichnis aus den Jahren 1818 bis 1822 bot. Anders als heute, da die rechte Straßenseite gerade und die linke ungerade Hausnummern aufwies, begann man damals mit der Nummerierung links, führte sie bis zum Ende der Gasse und zählte auf der andern Seite weiter, sodass nun die Aarbergergasse 43 in die Nähe des Waisenhausplatzes zu liegen kam, ein schmales Haus mit noch ein paar Bewohnern mehr als nur den Ferrier-Schwestern. Sie teilten es mit Rudolf Jakob Wasem, gewesener Flachmaler, sowie Johann Baptist Waßmer, der einen Eisenhandel betrieb. Aber nun stimmte die Adresse auch im Detail: Hinter den Speichern befand sich die Kaserne und dort gegenüber die Wohnung der Geschwister.
Mit diesem Brief hatte alles begonnen, so entwickelte sich eine neue Leidenschaft. Und nun saß er hier in diesem Loch. Wo war er überhaupt? Er konnte sich nicht mal daran erinnern, wie er hierhergekommen war. Das Betäubungsmittel hatte schnell gewirkt. Und lang anhaltend, wie er jetzt feststellte, denn ihn plagten plötzlich dräuende Kopfschmerzen, sodass er sich lieber wieder etwas ablenkte mit seinen Gedanken an die Jungfer Julie Ferrier.
Ihm fiel wieder ein, dass die erste Anfrage in der Suchmaschine vor allem Hinweise auf eine französische Schauspielerin und Sängerin brachten. Als er auf gut Glück »Julie Ferrier Bern« eingetippt hatte, ergab wie durch ein Wunder diese Suche einen einzigen Treffer auf einen erst vor Kurzem erschienenen Artikel in der »Berner Zeitung«, der sich wiederum auf einen längeren Text im »Burgdorfer Jahrbuch« 2023 bezog. Da war der Weg zu Frau Aeschlimann, die den Artikel verfasst hatte, nicht weit.
Er rief in Burgdorf an und erfuhr, dass es um eine verzwickte Liebesangelegenheit zwischen Julie Ferrier und besagtem Gabriel Schiesser ging, der in Burgdorf lebte, aber noch kein gesichertes Auskommen hatte, um seine Berner Angebetete zu heiraten. Julies Onkel wies jegliches Ansinnen ab, bis der inzwischen auch nicht mehr ganz junge Mann nach sechsjähriger Wartezeit und mit einem eigenen Handelsgeschäft im Rücken seine Geliebte 1838 doch noch zum Altar führen konnte.
In der Zwischenzeit schrieben sie sich Briefe, von denen nur diejenigen des Herrn Schiesser die Zeiten überdauert hatten. Oder doch nicht ganz. Denn die Originale waren zwar von einem älteren Herrn transkribiert worden, galten jedoch als verschollen. Sie datierten aus den Jahren 1833 bis 1835. So stellte Kaspar Kempf bald einmal fest, dass er mit seinem Brief nicht nur das jüngste Dokument besaß, sondern auch das einzige Original. Und er fasste das Papier von nun an mit einer ihm sonst nicht eigenen Art von Zärtlichkeit an.
»Sagen Sie mir doch einmal welches sind dan doch jene hundert Gedanken, die Ihnen durch Ihren Kopf gehen, u wie es mir scheint, mir nicht anzuvertrauen wagen, ich bitte Sie herzlich liebe Julie sagen Sie mir alles ohne gène, wenn dieses zu Ihrer Beruhigung beytragen kann. Nicht war Sie wollen es mir dan sagen wenn ich bey Ihnen bin. – Neues weiß ich Ihnen nichts mitzutheylen, den die Neuigkeiten finden bey mir auf der Reise keinen Eingang.«
Kaspar Kempf klammerte sich daran, dass diese Liebesgeschichte, die am Ende gut ausgegangen war, ein Omen für seine eigene Verschleppung sein könnte, die auf einem Missverständnis beruhen musste und für die es bestimmt eine rasche Klärung gab, sobald seine Entführer hier auftauchten und er sie zur Rede stellen würde. Er sank erschöpft auf die Pritsche und kehrte zu seinen wilden Träumen zurück.
2
Heinrich Müller saß ausnahmsweise als Erster am Frühstückstisch im Schwarzen Kater, denn die Schildpattkatze Lucy hatte ihn bereits mehrfach geweckt. Es herrschte schönes und warmes Wetter und die bald siebenjährige Dame hatte ihr Verhalten komplett geändert. Lag sie vorher die ganze Nacht eng an Heinrich geschmiegt auf der Bettdecke, wollte sie ab sofort nur noch draußen sein. Aber ihr Futter am frühen Morgen forderte sie nach wie ein. Grund dafür war vor allem, weil sie einen neuen Verehrer hatte, einen schwarzen Kater mit einem kleinen weißen Dreieck auf dem Bauch, der seit einigen Monaten herumschlich, um hauptsächlich nachts alle Futternäpfe leer zu fressen, auch die, die schon lange herumstanden und über die Lucy nur kurz einmal das Näschen gehalten und sie dann ignoriert hatte.
Auf dem Teller des Detektivs lag eine Schnitte Steinhauerbrot der Bäckerei Bohnenblust, beschmiert mit einem Dreieck Gala-Käse, dem leicht fettigen Brotaufstrich, der zwischen Milchsäure und -süße changierte und seit Jahrzehnten das Lieblingsfrühstück von Heinrich war, seit den Tagen, als er es bei seiner Großmutter im thurgauischen Amriswil als Delikatesse kennengelernt hatte. Und weil Müller nirgends allein sein konnte, ohne etwas zu lesen vor sich zu haben, lag da ein skurriles Buch über die mongolische Küche, das auch Rezepte enthielt, die kaum nachzukochen waren, da einfach zu viele Grundzutaten nicht greifbar waren. So blieb die theoretische Erkenntnis, dass die Hirten als Überlebensnahrung einen getrockneten Quark mit sich führten, der jahrelang haltbar war und den man erst irgendwo einfeuchten musste, bis er ausgelutscht werden konnte.
Aus der Schallplattensammlung hatte er eine LP von Quatermass aus seiner Wohnung im ersten Stock heruntergebracht, die sich nun auf dem Plattenspieler drehte und seltsame Geräusche von sich gab, wie die drei Grazien feststellten, die nun eine nach der andern in den ehemaligen Schankraum getreten waren, gefolgt von Nicole Himmel, der langjährigen Partnerin des Detektivs.
»Was ist das denn?«, fragte Gwendolin Rauch, die in ihren Biologievorlesungen noch nie etwas vom Progressive Rock der frühen Siebzigerjahre gehört hatte.
Eine beinahe schon kirchenlastige Orgel spielte ein melodisches Intro, das von der Barockmusik inspiriert sein mochte, bevor im Hintergrund eine dräuende Sirene auffuhr und in ein sattes Stück Rockmusik überleitete, das nun von der Pop-Orgel vor sich hergetrieben wurde.
Melinda Käsbleich sagte: »Ich höre da ›Black Sheep of the Family‹ heraus, das wäre ja passend«, und blickte vielsagend auf Heinrich. Auch in den Lehrplan des Design-Studiums hatte es die Band nie geschafft. Allerdings hielt Melinda nun den Umschlag der Schallplatte in ihren Händen, er zeigte einen Blick von unten in eine Häuserflucht aus Glasfassaden, dieselbe Front gespiegelt, zwischen denen ein paar Flugsaurier schwebten.
»Quatermass«, erklärte der Detektiv, »eine Prog-Rock-Band, die 1970 ihre einzige bedeutende LP beim damaligen Avantgardelabel Harvest herausgegeben hatte. Eine der damals beliebten Drei-Mann-Bands.«
»Dafür braucht es drei Männer?«, stichelte Phoebe Helbling, der das Studium der Wirtschaftswissenschaften offenbar nicht guttat.
»Macht euch bloß lustig«, seufzte Heinrich. »Ich habe meine nostalgische Phase. Ich habe die Band live gesehen, am 14. November 1970 im Stadttheater St. Gallen. Mein erstes Konzert mit fünfzehn Jahren. Großartig. Im Gegensatz zu vielen anderen späteren Auftritten kann ich mich noch daran erinnern. Als Vorgruppe traten übrigens die damals neu gegründeten Schweizer Hardrocker ›Toad‹ auf.«
»Ich nehme an, auch drei Männer«, stichelte Phoebe.
»Ja«, gab der Detektiv verunsichert zu.
»Es gibt also in nächster Zeit Popunterricht«, moserte Gwendolin. »Können wir dem etwas entgegenhalten?«
Müller erinnerte sich, dass sie ihm beim letzten Fall junge deutsche Sängerinnen vorgestellt hatten, deshalb lobte er sie dafür und fragte: »Was wird es diesmal sein?«
»Weiß nicht«, antwortete Phoebe. »Vielleicht graben wir uns selbst einmal durch die Musikgeschichte und entdecken die frühen Sechzigerjahre. Was meint ihr?«
Die andern beiden zuckten nur die Schultern.
»Was macht ihr überhaupt hier?«, fragte Heinrich, denn er hatte nicht mit ihnen gerechnet.
»Semesterferien«, entgegnete Melinda. »Die alte Heimat beglücken. Schauen, wie es der Detektei Müller & Himmel geht.«
»Was riecht hier angebrannt?«, fragte Nicole in die Runde und zupfte an ihrem Zick-Zack-Scheitel, den sie als Frisur wieder alltagstauglich gemacht hatte.
Heinrich hüpfte von seinem Stuhl hoch und rannte hinter die Theke zum Backofen.
»Ich habe das Frischbackbrot vergessen, das ich für euch zubereiten wollte.«
Er riss die Backofentür auf und holte das Gitter raus, auf dem sich einige leicht angekohlte Brötchen tummelten.
»Das geht als Toastbrot durch«, erkannte Melinda und klopfte dem Detektiv anerkennend auf die Schulter.
Heinrich Müller hatte in den letzten Monaten seinen alten Optimismus wiedergefunden und strahlte damit auf die ganze Detektei ab. Man kann aber auch sagen, dass es ihm ausnehmend gut ging, nicht mehr das karge Rentnerdasein wie zu Beginn der Pensionierung. Denn aus dem vorletzten Fall waren tausend Bitcoins hervorgegangen, die sie nun geschickt bewirtschafteten. Zuerst einmal hatten sie mit den Steuerbehörden einen für beide Seiten akzeptablen Kompromiss erreicht. Sie versteuerten die Bitcoins zu einem reduzierten Tarif als Vermögen und zahlten jeweils Einkommensabgaben auf diejenigen, die sie zu Bargeld machten. So gab es für alle ein regelmäßiges und auf längere Zeit hin angelegtes Einkommen. Beim aktuellen Kurs lösten sie vier Bitcoins ein, um mit hunderttausend Franken im Jahr über die Runden zu kommen. Das war etwa doppelt so viel, wie sie früher zur Verfügung hatten. Sie brauchten sich also keine Sorgen zu machen und mussten nie mehr für Geld arbeiten.
Phoebe blickte auf die Uhr und fragte: »Wann kommen die andern?«
»Wer sollte denn noch kommen?«, fragte Heinrich zurück.
»Na ja, alle eben«, erklärte Gwendolin. »Nicole hat uns doch zum Brunch eingeladen, zu Ehren deines achtundsechzigsten Geburtstags.« Sie blickte sich um. »Oder habe ich jetzt ein Geheimnis verraten?«
»Schon gut«, meinte Nicole Himmel und seufzte etwas zu laut. »Sie sollten bald hier sein.«
Kaum hatte sie den Satz ausgesprochen, öffnete sich die Eingangstür, die früher von der Straße in die Kneipe geführt hatte. Gemeinsam erschienen Markus Forrer, Kommissar bei der Kriminalabteilung der Police Bern, und Laura de Medico, die inzwischen neben Dr. Augsburger zur zweiten vollamtlichen Rechtsmedizinerin befördert worden war. Es gab ein großes Hallo, und es passte, dass sich die Nadel von der ersten Seite der Quatermass-LP abgehoben hatte und man nur noch die wild durcheinanderredenden Stimmen im Gastraum hörte.
»Mein Geburtstag war doch vor zwei Wochen«, sagte Müller, aber sein Einwand ging im Begrüßungslärm unter. Man hatte sich seit Monaten nicht mehr gesehen, »die Arbeit« lautete die übliche Ausrede der werktätigen Bevölkerung, »die Prüfungen« seufzte das studierende Jungvolk.
Schließlich hatten alle Platz genommen, das Schwarze war von den getoasteten Brötchen behelfsmäßig abgeschabt worden und jeder nahm nun seinen vorgesehenen Platz unter Butter, Konfitüre, Honig, Käse und Schinken ein.
Dann zeigte der Kommissar auf den Tresen und fragte: »Was ist das? Kriegt man davon auch einen Bissen?«
»Das sind Osterente und Osternashorn«, sagte Heinrich und stellte selbst fest, dass die Erklärung befremdlich wirkte. Aber die Schokoladentiere sahen genau so aus.
»So was geschieht, wenn der Herr Detektiv im Supermarkt ein Halb-Preis-Regal entdeckt«, meinte Nicole augenzwinkernd. Aber niemand schien sich daran zu stören. Sie machten sich voller Appetit über die Behelfsschokolade her und genossen es, wieder einmal alle zusammen zu sein.
»Und?«, fragte schließlich Gwendolin, »etwas Neues aus deinem Berufsalltag?«
»Wenn es nichts zu Gruseliges ist«, wandte Melinda ein, denn sie kannte die Vorliebe ihrer Freundin für makabre Geschichten.
Markus erwiderte: »Leider nein. Nur ein Lehrer, der vermisst wird. Ist gestern nicht zum Unterricht erschienen. Das ist das Spektakulärste, was ich zu bieten habe.«
»Geht bei uns als Alltag durch«, sagte Phoebe und zuckte die Schultern.
Und Nicole wollte wissen: »Seit wann kommen denn Vermisstenanzeigen bei dir vorbei?«
»Steht im Polizeiticker, den ich bei Dienstantritt konsultiere«, sagte der Kommissar in einem Tonfall, der erkennen ließ, dass er gern mehr geboten hätte und nicht sicher war, ob dieser Vermisstenfall sich zu etwas auswachsen würde, was die Detektei Müller & Himmel interessieren könnte.
3
Kommissar Markus Forrer saß gedankenverloren am Schreibtisch in seinem Büro am Nordring, der Zentrale der Police Bern. In einem Taschenspiegel betrachtete er seinen schwarzen Schopf und zählte die weißen Haare, die sich in letzter Zeit stärker bemerkbar machten. Er hatte nichts zu tun. Das Beruhigende daran war, dass die Abteilung Kriminalpolizei in den letzten Jahren nur mit wenigen Tötungsdelikten beschäftigt war. Das Beunruhigende: Da draußen schmiedete jemand Pläne gegen das Leben eines Menschen, die man nicht durchkreuzen konnte. Das Unbefriedigende: Markus Forrer kam stets erst im Nachhinein zum Einsatz.
Natürlich war es ein Erfolg, wenn die allermeisten Fälle aufgeklärt werden konnten. Leider wusste niemand, wie viele Ereignisse nicht stattfanden, weil die Polizeipräsenz die Verbrecher davor abschreckte, ihre Absicht in die Tat umzusetzen.
Die Zahl der Überwachungskameras hatte in den letzten Jahren enorm zugenommen. Die meisten zeichneten nur eine überschaubare Zeitspanne auf, und die Daten wurden wieder gelöscht, wenn sich nichts ereignet hatte, was die Strafverfolgungsbehörden auf den Plan gerufen hätte. Nun aber hatte die Police Bern ein Gesichtserkennungsprogramm eingekauft, das das umfangreiche Material aus den Kameras effizient und schnell auswerten und mit der polizeiinternen Datenbank abgleichen konnte.
Der Kommissar fand die ganze Angelegenheit zwiespältig. Einerseits war die neue Software für die Fahndung natürlich ein bedeutender Fortschritt, und je umfangreicher die Datenbank war, die zum Abgleich herangezogen werden konnte, desto mehr Erfolgsmeldungen würde die Polizei verbuchen. Andererseits gab es die verbrechensfreie Welt wohl einfach nicht. Die Delikte würden in einen Raum abwandern, der weniger gut überwacht war und auf den die Polizei wenig Zugriff hatte, beispielsweise ins Internet.
Den Fahndungserfolgen der Polizei stand auch eine Einschränkung der persönlichen Freiheit gegenüber. Das Dilemma dabei war: Jeder befürwortete eine möglichst große Eindämmung schwerer Verbrechen, vor allem gegen die körperliche Integrität von einzelnen Menschen. Gab es eine Grenze der Überwachung, die nicht überschritten werden durfte? Markus Forrer erkannte weniger einen Nutzen bei der Suche nach bestimmten Personen. Für ihn war das Überwachungs- und Identifizierungssystem dann erfolgreich, wenn es Verbrechen verhinderte.
So sinnierte er, als das Tischtelefon blinkte, das er auf lautlos gestellt hatte. Er hob den Hörer ab. Vom Empfang bekam er den Bescheid: »Der Stadtpräsident will Sie sprechen.«
Er wurde durchgestellt.
»Alec von Graffenried«, sagte eine freundliche Stimme am andern Ende.
»Markus Forrer«, replizierte der Kommissar. »Was kann ich für Sie tun?«
»Wir haben einen seltsamen Brief erhalten, den wir für echt und deswegen für bedrohlich halten. Eine mir unbekannte Organisation will einen Mann entführt haben und stellt für seine Freilassung seltsame Forderungen, die wir nicht erfüllen können, selbst wenn wir wollten.«
»Entführung, sagten Sie?«
»Ja. Lesen Sie selbst. Wir haben den Umschlag sowie den Brief fotografiert. Mein Sekretariat sendet Ihnen die Daten per Mail. Der Kriminaltechnische Dienst kommt gleich vorbei und sichert das Original.«
Forrer fragte: »Was erwarten Sie von uns?«
Der Stadtpräsident antwortete: »Wenn es sich wirklich um eine Entführung handelt, muss ich Ihnen ja nicht erklären, wie Sie Ihre Arbeit zu tun haben. Sie sind der Profi und haben mein vollstes Vertrauen. Was ich von Ihnen benötige, ist eine Handlungsanweisung, wie wir weiter vorgehen sollen. Sie erreichen mich unter dieser Nummer. Es ist meine Direktwahl. Ich zähle auf Sie.«
»Danke für Ihr Vertrauen«, entgegnete der Kommissar, bevor er sich verabschiedete und im Mailordner nachschaute, ob das Dokument bereits angekommen war. Dann las er folgenden Text:
»Das Kommando ›Gerechtigkeit für Jakob Schöni‹ hat den Blog-Verfasser Kaspar Kempf entführt. Für seine Freilassung verlangen wir die Einsetzung einer Kommission, welche die Aufarbeitung des Verdingkindwesens im neunzehnten Jahrhundert betreibt. Die Millionen, die üblicherweise für die Befreiung von Gefangenen verlangt werden, sollen in die Erforschung der düsteren Geschichte fließen. Um das Leben des Herrn Kempf nicht zu gefährden, erwarten wir Ihr zeitnahes Einverständnis, das Sie uns über die üblichen Medien zukommen lassen. Der Revolutionsrat entscheidet, ob Ihr Engagement ausreichend ist.«
Die verschwurbelte Sprache erstaunte den Kommissar. So etwas passte eher in die sozialrevolutionären Bewegungen der Siebziger- und Achtzigerjahre. Hatte er es hier mit Nostalgikern oder mit Nachahmern zu tun?
Das Dokument selbst ließ sich leider nicht rückverfolgen. Es war als Textnachricht über einen Mail-Account gelaufen, wahrscheinlich als SMS von einem anonymen Wegwerfhandy verschickt worden. Es blieb also noch Arbeit zu erledigen, was Markus Forrer einen Energieschub verlieh.
4
Es war keineswegs so, dass Kaspar Kempf gleich der Verzweiflung anheimgefallen wäre, als er wieder erwachte. Aber ein mulmiges Gefühl hatte er schon, umfing ihn jetzt doch komplette Dunkelheit. Er trug seine Uhr, stellte fest, dass es kurz nach Mitternacht war. Geisterstunde. Allerdings wusste er nicht, welche Geister er gerufen hatte und welche ihn hier festhielten.
Geweckt hatte ihn ein unbändiger Hunger, den er mit nichts dämpfen konnte. Genauso wenig wie den Durst. Er musste sich erst wieder beruhigen. In der Finsternis würde er nichts zustande bringen. Fragen drängten sich auf. Ob ihn bereits jemand vermisste? Er hätte doch zum Unterricht erscheinen müssen. Wie lange würde es dauern, bis jemand bei ihm zu Hause nachsähe, wenn er keine Anrufe beantwortete? Aber wo sollte man ihn suchen? Er wusste ja selbst nicht, wo er sich befand.
Dann konzentrierte er sich wieder auf seine Briefe, um sich von den drängenden Problemen abzulenken. 1829 hatte sich eine Maria Schaad aus Bern an einen Pfarrer in Weinfelden gewandt, wohl ihr Bürgerort. Der sehr sauber geschriebene Brief schien eher aus geübter Hand zu stammen, mithilfe eines Sachverständigen diktiert. Frau Schaad hatte aus besagtem Ort eine Rechnung über den Betrag von fünfundzwanzig Franken erhalten.