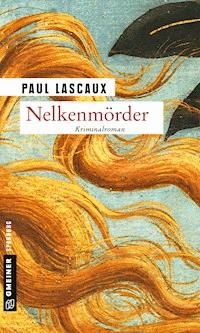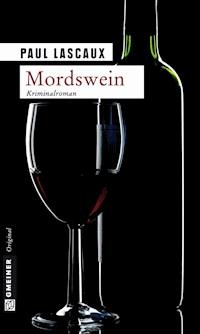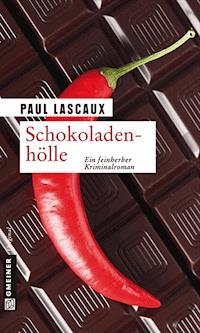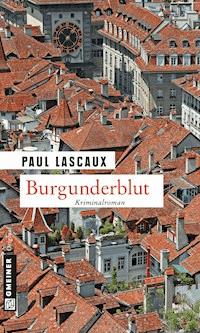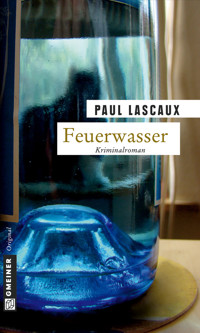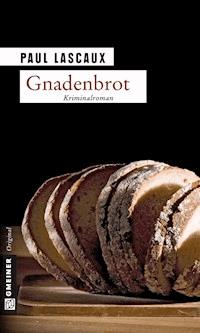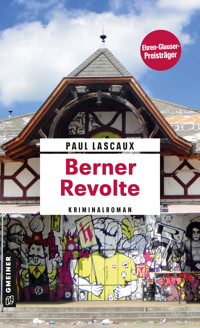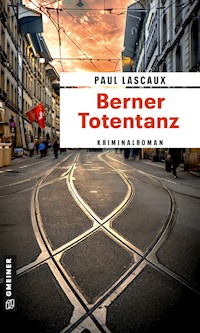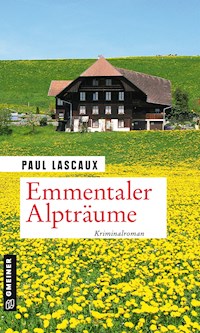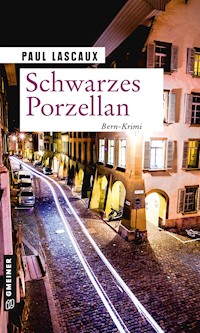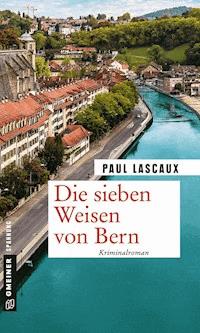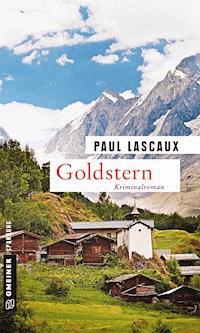Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: GMEINER
- Kategorie: Krimi
- Serie: Detektive Müller und Himmel
- Sprache: Deutsch
Kommissar Markus Forrer von der Police Bern offenbart sich ein grausames Bild: Eine Leiche mit einer Kopfverletzung, die an Ritualmorde aus der Steinzeit erinnert. Der Tote, Bernhard Altenburg, führte zusammen mit Tim Schaad ein Labor und forschte an einem neuen Impfstoff. Als Schaad zum Tod seines Geschäftspartners befragt wird, verhält er sich seltsam. Er gibt an, den Finanzminister getötet zu haben. Ist Schaad nicht zurechnungsfähig und verantwortlich für Altenburgs Tod? Kommissar Forrer und die Detektei Müller und Himmel stehen vor einem Rätsel.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 263
Veröffentlichungsjahr: 2023
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Paul Lascaux
Berner Strategie
Kriminalroman
Zum Buch
Dunkle Bedrohung Kommissar Markus Forrer von der Police Bern berichtet den beiden Detektiven Heinrich Müller und Nicole Himmel von Ritualmorden aus der Steinzeit und erwähnt beiläufig, dass am Tag zuvor eine ähnlich zugerichtete Leiche entdeckt worden sei. Die Tat entpuppt sich jedoch als Vertuschungsversuch. Damit beginnt ein unaufhaltsamer Ritt in den Abgrund. Der Tote, Bernhard Altenburg, arbeitete in einem Labor, das kurz vor dem Durchbruch bei einer Impfung gegen HIV stand. Doch er und sein Geschäftspartner Tim Schaad waren sich uneinig, was die Vermarktung des Produkts anging, denn Interessenten gibt es viele auf der Welt. Als Schaad von Kommissar Forrer zu dem Todesfall befragt wird, streitet er jede Beteiligung ab. Stattdessen erklärt er, den Finanzminister umgebracht zu haben. Diese Aussage bringt ihn in die Psychiatrie. Als der Finanzminister tatsächlich angeschossen wird, sind alle konsterniert. Wer sind Schaads Mittäter?
Paul Lascaux ist das Pseudonym des Schweizer Autors Paul Ott. Der studierte Germanist und Kunsthistoriker lebt seit 1974 in Bern und hat in den letzten 40 Jahren zahlreiche literarische Veröffentlichungen realisiert. Einige seiner Kurzkrimis liegen als Übersetzungen in Polen und in den USA vor. Im Jahr 2020 erhielt er den Spezialpreis der Deutschsprachigen Literaturkommission des Kantons Bern. 2021 wurde das von Paul Ott initiierte „Schweizer Krimiarchiv Grenchen“ eröffnet.
Impressum
Personen und Handlung sind frei erfunden.
Ähnlichkeiten mit lebenden oder toten Personen
sind rein zufällig und nicht beabsichtigt.
Immer informiert
Spannung pur – mit unserem Newsletter informieren wir Sie
regelmäßig über Wissenswertes aus unserer Bücherwelt.
Gefällt mir!
Facebook: @Gmeiner.Verlag
Instagram: @gmeinerverlag
Twitter: @GmeinerVerlag
Besuchen Sie uns im Internet:
www.gmeiner-verlag.de
© 2023 – Gmeiner-Verlag GmbH
Im Ehnried 5, 88605 Meßkirch
Telefon 0 75 75 / 20 95 - 0
Alle Rechte vorbehalten
Herstellung/E-Book: Mirjam Hecht
Umschlaggestaltung: U.O.R.G. Lutz Eberle, Stuttgart
unter Verwendung eines Fotos von: © Andreas Fischinger / unsplash
ISBN 978-3-8392-7438-5
Zitat
»Sie schlugen einen Seitenweg ein, den Nussbäume säumten und der vor Schatten ganz leise war, und unter den Füssen hatte man weiche Erde wie in einem Wald.«
Georges Simenon: Die Witwe Couderc
Vorbemerkung
Das Buch wurde im Frühjahr 2022 geschrieben. Alle aktuellen Angaben beziehen sich auf diese Zeit.
1
Als Heinrich Müller nach einer traumgeschwängerten Nacht erwachte, erwartete ihn ein giftgelber Himmel. Die Wetterprognose hatte Saharastaub angekündigt, also war der Detektiv nicht wirklich überrascht. Dennoch löste dieses Licht eine Unruhe in ihm aus, die keine genaue Ursache kannte. Es war, als ob der seit fünf Wochen tobende Krieg in der Ukraine einen Weg in den Garten des Schwarzen Katers gefunden hätte, der Basis der Detektei Müller & Himmel. Heinrich kannte zwar die Winde, die den Staub von Süden hierhertransportierten, also konnte das diesige, kränkliche Licht nichts mit Osteuropa zu tun haben. Aber die apokalyptische Botschaft trug es mit sich.
In dieser Stimmung stieg er aus dem ersten Stock in die ehemalige Bar des Schwarzen Katers hinunter, wo ihn seine Partnerin Nicole Himmel bereits mit dem Frühstückskaffee erwartete. Selbst ihr stand ins Gesicht geschrieben, dass es kein normaler Tag werden sollte.
»Markus Forrer hat angerufen. Er kommt heute Abend vorbei. Ich glaube, er hat einen neuen Fall«, sagte sie zur Begrüßung und berührte ganz gezielt die einzige graue Strähne, die sich unter ihr braunes schulterlanges Haar gemischt hatte. Der Zahn der Zeit nagte auch an ihr.
Müller vergewisserte sich: »Die drei Grazien sind ebenfalls zum Essen eingeladen?«
»Ein Familientreffen. Markus bringt noch Laura de Medico mit.«
»Wir gehen aber nicht ins Theater?«, wollte Heinrich wissen und kratzte sich am Viertagebart.
Nicole lachte.
Lucy, die Schildpattkatze der Detektei, erwachte aus einem Traum und gab ein Geräusch von sich, das einer meckernden Ziege zur Ehre gereicht hätte. Sie wälzte sich einmal über den Rücken auf die andere Seite und rollte sich wieder zu einer Kugel zusammen.
»Du solltest ihr weniger zu fressen geben«, sagte Nicole.
»Genau wie die Tierärztin«, maulte Heinrich und nahm einen Schluck Kaffee.
»Sie hat dir das schon gesagt?«
»Ja.« Heinrich redete nicht gern darüber, denn er wusste nicht, wie er die Katze erziehen sollte. »Ich habe ihr geantwortet, sie habe ein schlechtes Vorbild.« Er klopfte sich auf seinen eigenen Bauch, dem das häufigere Herumsitzen seit der Pensionierung nicht gutgetan hatte.
Die drei Grazien nutzten die Wohnung im dritten Stock nach wie vor als Rückzugsort, wenn sie sich in unregelmäßigen Abständen trafen, denn Melinda Käsbleich betätigte sich an der F+F Schule für Design und Kunst in Zürich, Phoebe Helbling machte sich an der Uni St. Gallen schlau, wo sie sich in die Wirtschaftswissenschaften vertiefte und als Fachfrau für Informatik fungierte, während Gwendolin Rauch als Einzige in Bern geblieben war und an der Uni Biologie studierte.
An den Wänden im Schwarzen Kater hingen immer noch die Fotografien der Aquarelle von Paul Klee, die im letzten Fall der Detektei eine entscheidende Rolle gespielt hatten. Niemand hatte sich dafür verantwortlich gefühlt, sie wieder zu entfernen. Nur um die eine, die den Halt verloren hatte und zu Boden gesegelt war, hatte sich Lucy gekümmert und sie behandelt, wie sie alles behandelte, das nicht an seinem angedachten Platz war und ihr Katzenuniversum störte: Sie hatte das Bild mit ihren Krallen zerfetzt. Man konnte sich darüber wundern, dass sie das Papier nicht auch noch gefressen hatte.
Alle fünf saßen beim Apéro mit einem Glas Verdejo von Rodriguez & Sanzo, das honigmelonengelb schimmerte, eine feine Zitrusnote aufwies, im Mund eine Amarenakirsche nachschob und im Abgang abtrocknete, kein Wunder, der Wein war zehn Monate in einem Sherry-Fass ausgebaut worden.
Im Hintergrund sang David Bowie von Major Tom, der aus dem Kontrollraum aufgefordert wurde, die Eiweißpillen zu schlucken und einen Helm anzuziehen, bevor er sich auf den Rückweg zur Erde machte. Als der Countdown begann, begleitet von einer verzerrten Space-Gitarre, schwebte der Astronaut längst hilflos im Weltall und bat noch wie ein Raumfahrt-Winkelried, Frau und Kinder zu grüßen, bevor er sich als »Space Oddity« – Weltraumkuriosität – auf einen Weg machte, wie er in Stanley Kubricks »2001: Odyssee im Weltraum« vorgezeichnet war.
»Hast du einen nostalgischen Anfall?«, dröhnte eine tiefe Stimme durch den Raum und der mit ihr verbundene Mann zog eine zierliche Frau durch die Tür, die er schnell wieder schloss, denn das Kunstlicht drinnen war wesentlich angenehmer als das Dämmerlicht draußen. Markus Forrer, Kommissar bei der Police Bern, begrüßte alle. Die Assistentin des Rechtsmediziners, Laura de Medico, musste er nicht mehr vorstellen, denn sie war inzwischen berüchtigt für ihr kulturelles Sendungsbewusstsein.
Nicole hatte für alle gekocht. Es war wie immer in der Detektei, es wurde Einfaches mit Komplexem kombiniert, heute scharf angebratene und gewürzte Lammkoteletts, ergänzt durch in Stücke gerupftes Steinhauerbrot von der Bäckerei Bohnenblust und den ersten Flugspargel des Jahres. Dazu gab es einen purpurschwarzen Syrah aus Chile, Polkura Block g+i, mit einem ausgeprägten Leder- und Stallgeruch, einen voluminösen Wein, der nach Brombeeren, Cassis, schwarzen Kirschen und Pfeffer schmeckte und dessen leichte Bitternote von den reichlich aufgetragenen Gewürzen konterkariert wurde.
»Ich beschäftige mich mit prähistorischen Kopfverletzungen«, begann Forrer nach dem Essen das Gespräch.
Nun war die Katze aus dem Sack, denn zu einem reinen Höflichkeitsbesuch war der Kommissar nicht erschienen.
»Mich interessiert deine Einschätzung als Anthropologin«, wandte er sich an Nicole.
»Woran denkst du?«, fragte sie.
Der Kommissar sagte: »Es gibt in verschiedenen Museen alte Schädel mit mehr oder weniger gut verheilten Kopfwunden. Ich meine nicht die länglichen Schnitte, die man einer Hieb- oder Stichwaffe zuordnen kann, sondern die runden Löcher.«
Nicole stellte fest: »Du redest von Trepanationen.«
»Wenn du es sagst. Was steckt genau dahinter?«
Nicole fasste sich kurz: »Man geht davon aus, dass die Menschen bereits kurz nach der letzten Eiszeit Operationen durchgeführt haben.«
»Indem sie den Schädel aufgebohrt und dann im Gehirn herumgewühlt haben?«, wollte Müller wissen.
»Letzteres wohl eher nicht. Es gibt verschiedene Umstände, die einen hohen Druck im Gehirn und damit heftige Kopfschmerzen erzeugen: Blutungen, Stürze, Schläge, Entzündungen. Man hat wohl versucht, mit einer Öffnung der Schädeldecke den Druck entweichen zu lassen. Meist hat man ein münzgroßes Stück Knochen entfernt.«
»Gruselgeschichten«, sagte Gwendolin und schüttelte sich. Ihre breiten Lippen verzogen sich bis zu den Ohrläppchen.
Melinda senkte die Augen und doppelte nach: »Wir möchten das Lamm gerne bei uns behalten.«
»Dann mag euch beruhigen, dass viele dieser brachialen Eingriffe erfolgreich verliefen«, erklärte Nicole.
Phoebe hakte nach: »Woran erkennt man das?« Ihr ohnehin schon bleiches Gesicht war inzwischen heller als das blonde Haar.
»Daran, ob die Knochenränder zugewachsen sind. Wenn nicht, ist der Schluss klar. Leider kann man auch bei verheilten Schädeln nicht sagen, wie erfolgreich die Operation gewesen ist und wie lange die Patienten überlebt haben.«
»Das Gehirn lag offen da?«, wunderte sich Gwendolin. In den Biologievorlesungen war so etwas bisher nicht vorgekommen.
»Das dürfte schwierig sein«, meldete sich Laura de Medico zu Wort und bemühte sich um Professionalität, die sie ihrer Stelle als Assistentin des Rechtsmediziners schuldete. »Wahrscheinlich hat man einen Hautlappen aufgeschnitten und ihn nach der Entfernung des Knochens wieder über die Öffnung gelegt.«
Phoebe würgte.
Nicole fuhr ungerührt weiter: »Ein Dokumentarfilm hat gezeigt, wie heutige indigene Völker das bewerkstelligen. Der Schamane kaut eine bestimmte Pflanze, speichelt sie ein und klebt die Masse auf die Wunde.«
Melinda verlangte nach einem Schnaps.
»Das Pflanzen-Speichel-Mus hat eine schmerzstillende und antibakterielle Wirkung und ist sehr effizient. Die Wunde verheilt binnen Tagen und hinterlässt kaum Narben. So ähnlich könnte es auch in prähistorischen Zeiten abgelaufen sein.«
Dann erbarmte sie sich der drei jungen Damen und brachte eine Flasche Vecchia Romagna und sieben Gläser.
»Den Brandy hat Heinrich aus der Landi mitgebracht, als er sein Auto wieder mal ausfahren musste«, sagte Himmel, als ob sie sich für seine mangelnde Qualität entschuldigen müsste, die dem Schwarzen Kater nicht angemessen war.
Heinrich nahm die seltsam geformte Flasche liebevoll in die Hand. Drei nach innen gewölbte Glasflächen bildeten das Markenzeichen des Herstellers und sahen von oben aus wie ein dreizackiger Stern.
»Etichetta nera«, sagte er und strich zärtlich über den runden schwarzen Aufkleber mit der weißen Schrift, der roten Jahreszahl »1820« und dem goldenen Haupt des Bacchus in der Mitte, das von Weinlaub und Trauben umhüllt war.
»Jetzt kannst du von Nostalgie reden«, wandte sich Heinrich an Markus. »Wenn man in den Siebzigerjahren nach Italien fuhr, galt das als edles Getränk, und man versäumte nicht, den Daheimgebliebenen eine Flasche davon mitzubringen. Damit hat man die ebenfalls mitgenommene Salami heruntergespült, die ich jeweils in einer Hinterhofsalumeria, die eher einer aufgelassenen Garage glich, vom Wursthimmel schnitt und die zu Hause in der Küche erst noch zwei bis drei Monate trocknen musste, bevor sie genussreif war. Tempi passati«, seufzte er. »Heute kriegt man beides im Bauerngroßmarkt zu Discountpreisen.«
Die leichte Süße und der Geschmack nach Rosinen überdeckten nur unzureichend den alkoholischen Branntwein, und man durfte durchaus fragen, was in der Jugendzeit sonst noch schiefgelaufen war. Andererseits sollte man nicht zu sehr grübeln, denn wenn sich die Erinnerung am Durchschnittsgrappa orientierte, dessen Höhenflug der Grappa alla Ruta war, also Tresterschnaps, der Blätter der Weinraute enthielt, war man mit dem Vecchia Romagna gut bedient.
»Früher gab es doch noch die Etichetta Oro«, dämpfte Forrer Heinrichs Begeisterung.
»Den konnten wir uns nicht leisten«, brummte Müller.
Phoebe hatte bereits gegoogelt. »Der wird nicht mehr hergestellt. Den gibt’s nur noch auf eBay, zu völlig überteuerten Preisen.«
»Was mich interessiert«, nahm Forrer den Faden wieder auf, »Waren das alles Operationen oder fielen auch ritualisierte Handlungen darunter, die zu Schädelöffnungen führten?«
Nicole erklärte: »Die Frage ist schwierig zu beantworten. Gesichert sind Operationen. Ebenso Schädelverletzungen durch Tötungen, meist wohl als Folge von Auseinandersetzungen. Ob auch Ritualmorde existierten, ist nicht gesichert und umstritten.«
»Was müsste man sich darunter vorstellen?«, fragte Laura.
»Es gibt Grabfunde mit mehreren Leichen. Eine davon war sozusagen die Hauptleiche, wahrscheinlich eine Person mit besonderem Einfluss. Ihr wurden weitere Menschen als Begleiter ins Grab gelegt. Ob das Familienmitglieder waren oder Gefolgsleute oder Abhängige, lässt sich nicht sagen. Es könnte auch sein, dass Verstorbene aus mehreren Gräbern gemeinsam bestattet wurden. Bedauerlicherweise gibt es keine Filmaufnahmen oder schriftlichen Reportagen.«
Melinda seufzte und griff nach der Nostalgieflasche.
»In den letzten Jahren hat man in Süddeutschland merkwürdige Totensammelstellen gefunden. Man geht davon aus, dass im Laufe mehrerer Jahrzehnte Treffen stattgefunden haben, zu denen Menschen aus halb Europa und von unterschiedlichen Stämmen unterwegs waren. Herxheim ist so ein Ort. Dorthin haben die Leute vor etwa siebentausend Jahren ihre Sterbenden und Toten geschleppt. Leichen, die wohl bereits eine gewisse Zeit beerdigt waren und die man wieder ausgrub. Bei ihrem Treffen vor Ort ist es zu rituellen Handlungen gekommen. Wobei unklar ist, welcher Art diese Rituale waren und welchen Zweck sie verfolgten. Jedenfalls hat man zertrümmerte Knochen gefunden, skalpierte Köpfe und zu Trinkgefäßen zurechtgeschnittene Schädel.«
Melinda goss sich den Rest der Flasche ein.
»Kannibalen«, hauchte Phoebe.
Himmel sagte: »Auch darüber weiß man nichts Näheres. Allerdings haben die Untersuchungen der Knochen gezeigt, dass die Menschen sehr gesund waren und nicht unter Mangelerscheinungen litten. Außerdem mussten die Leichen für Kannibalismus durchaus frisch sein.«
Sie zwinkerte Gwendolin zu und fragte: »Soll ich noch eine Flasche vom Besseren holen?«
Bevor sie eine Antwort erhielt, fragte Heinrich: »Markus, weshalb beschäftigst du dich mit prähistorischen Totenkulten?«
Der Kommissar erläuterte: »Wir haben eine Leiche.«
»Das ist doch euer Job«, sagte Gwendolin tonlos.
»Na ja, aber es ist das erste Mal, dass wir einen Toten mit einem trepanierten Schädel gefunden haben.« Forrer wollte nicht allzu viele Details preisgeben, fügte jedoch an: »Ein Mann. Man hat ihm nicht die Zeit gelassen, dass die Wunde wieder hätte zuwachsen können. Es gibt auch keinen Hautlappen mehr. Allerdings ist der Skalp noch vorhanden.«
Eine Flasche Talisker Storm, Single Malt Whisky, machte die Runde.
Es war Mittwoch, der dreißigste März 2022.
2
»Is there life on Mars?«, fragte David Bowie am andern Morgen in einem Song, in dem er von Rock zu Vaudeville changierte.
»Kann man das abstellen?«, bat Gwendolin, als sie zum Frühstück heruntergekrochen kam. »Nur Kaffee, schwarz«, stöhnte sie. Zu orangefarbenen Leggins trug sie ein warnwestengelbes T-Shirt. Die Kleidung hatte Gefallen an ihrem Körper gefunden und schmiegte sich eng an jedes Gramm.
Phoebe sah sie entsetzt an, als ob sie über Nacht einen Augenschaden davongetragen hätte.
Nicole meinte: »Der Vorteil ist, man findet sie schneller als alle anderen unter einer Lawine.«
Gwendolin erwiderte: »Es gibt hier keine Lawinen.«
»Nicht?«, seufzte Himmel. »Vielleicht sollten wir darum bitten?«
»Man nennt es auch Hangover«, spottete ein gut gelaunter Detektiv.
»Oder Schnapsleiche«, doppelte Nicole nach.
»Macht euch bloß lustig«, beklagte sich Melinda, die im Pyjama aus grauem Leder steckte.
Auch Phoebes Haare hatten noch keinen Kamm gesehen. Sie war in einer Stimmung, in der sie selbst die Arche Noah in die Luft gesprengt hätte, und sagte: »Eure Geschichten sind ganz schlecht für die Gesundheit.«
»Das stimmt«, entgegnete Heinrich, »die meisten Menschen, von denen wir erzählen, sind bereits tot.«
»Halb tot ist schlimm genug«, seufzte Melinda und versuchte, den pelzigen Belag auf der Zunge an den Zähnen abzureiben.
»Schöner wirst du dabei nicht«, ermahnte sie Gwendolin. Sie hielt zur Kontrolle die Hand vor den Mund, atmete aus und erklärte: »Man könnte an der eigenen Atemluft ersticken.«
Feste Nahrung war noch nicht so gefragt, also legte Nicole die frischen Gipfeli, die sie bereits besorgt hatte, auf die Seite. Irgendwann würden auch die drei Grazien ihre Magenschleimhäute beruhigen müssen.
Phoebe erkundigte sich: »Seid ihr jetzt wieder in einen Fall involviert?«
»Man weiß noch nichts Genaues«, antwortete Müller.
Sie fragte sich offensichtlich, warum die Detektei Müller & Himmel überhaupt noch existierte und warum man bereits wieder über Mord und Totschlag sprach. Denn seit dem letzten Fall saß sie je nach Tageskurs auf einem Bitcoin-Vermögen von dreißig bis fünfzig Millionen Franken. Allerdings war das Geld nach wie vor nur virtuell vorhanden. Nicole war es noch nicht gelungen, es gegen eine substanzielle Menge Bargeld einzutauschen. Auch stand sie noch in Korrespondenz mit den Steuerbehörden, die einen Anteil am Erwirtschafteten haben wollten. Es ging um die Frage, ob das Geld als einmaliges Einkommen versteuert werden musste, was bedeutet hätte, dass man einen ansehnlichen Teil der Bitcoins hätte verkaufen müssen, oder ob es als Vermögen galt. Letzteres wäre die bedeutend einfachere und nervenschonendere Variante. Der Alltag hatte sich vorerst nur so weit geändert, als dass man das vorhandene Einkommen sofort ausgeben konnte, weil man Reserven im Hintergrund wusste.
»Ich bin zwar in Rente«, fuhr Heinrich fort, »aber einfach nur auf der faulen Haut rumliegen, das passt nicht zu mir. Es kann aber sein, dass wir uns doch mehr auf die helfenden Dienste zurückziehen und weniger an vorderster Front mit dabei sind.«
Phoebe erklärte: »Ich glaube dir kein Wort. Du wirst wieder irgendwo ins Fettnäpfchen treten.«
Dann richtete sich die Aufmerksamkeit auf Lucy, die ganz aufgeregt aus dem Fenster schaute und seltsame Geräusche von sich gab, denn eben stiegen die beiden schwarzen Nachbarskater die ellenlange Spiralholztreppe aus dem zweiten Stock runter in den Garten. Man fragte sich, ob ihnen dabei nicht schwindlig wurde. Teddy, der nur ein einziges weißes Härchen auf der Brust hatte, sprang in das Revier von Lucy und setzte sich aufs Fenstersims der Detektei.
Offenbar wollte er die Kätzin abholen, denn die beiden verband seit einigen Tagen zwar noch nicht gerade Freundschaft, aber immerhin vertrieb Lucy ihn nicht mehr aus ihrem Garten. Teddy honorierte das, indem er sich vor ihr auf den Rücken warf und alle viere von sich streckte, um seine Harmlosigkeit zu zelebrieren. Lucy stieg darauf ein, achtete jedoch immer noch auf einen Sicherheitsabstand. Sie fauchte sofort, wenn dieser unterschritten wurde. Chili, der Kater mit dem weißen Dreieck auf der Brust, blieb derweilen tapfer auf dem Nachbargrundstück und blickte eifersüchtig auf seinen Bruder, der eine Gespielin gefunden hatte. Noch war zwischen den beiden nicht alles geklärt, aber die täglichen Fortschritte zu beobachten, hielt auch Nicole und Heinrich auf Trab.
»Seid ihr so weit hergestellt, dass wir uns wieder um das Thema von gestern Abend kümmern können?«, fragte Nicole die drei Grazien.
Gwendolin stöhnte. »Nicht schon wieder Leichen.«
»Versprochen«, sagte Himmel. »Es geht um Rituale und darum, wie man sie von anders motivierten Handlungen abgrenzen kann.«
»Das unterscheidet den Menschen vom Tier«, erklärte die Biologiestudentin. »Tiere haben keine Rituale, sie leben in einer rein materiellen Welt.«
»Lucy träumt«, entgegnete der Detektiv. »Losgelöster von Materie geht nicht.«
Gwendolin wehrte sich: »Ein Ritual besteht aus wiederkehrenden Handlungen zu einem bestimmten Zweck.«
»Dann zählt das Markieren des Reviers auch dazu«, meinte Müller. »Obwohl das Revier durchaus materielle Grenzen hat, ist es dennoch ausschließlich eine Imagination. Es ist nicht sichtbar, auch wenn sich die Rivalen an den Geruchsspuren orientieren können.«
Gwendolin widersprach: »Aber mit dem fortschreitenden Leben des Tieres ändert sich das Revier, und nach dem Tod existiert es nicht mehr. Menschliche Rituale hingegen sind losgelöst von einzelnen Individuen. Das erkennt man bei den Religionen.«
Nicole mischte sich ein: »Die meisten Rituale sind jedoch immateriell. Gebete, Kirchengesang, Segnungen – abgesehen vom aufgezeichneten gesprochenen Wort bleibt wenig übrig. Deswegen haben es Anthropologie und Archäologie so schwer, Nachweise zu finden. Eine zerbrochene weibliche Figur aus einem Abfallhaufen reicht eben nicht als Beweis für ein Matriarchat oder eine Göttin. Oft bezeichnet man etwas als Ritual, für das es keine vordergründige Erklärung gibt. Reine Denkfaulheit. Das öffnet die Tür für Spekulationen und Projektionen von heute auf früher.«
Melinda gab zu bedenken: »Viele rituelle Handlungen unterliegen der Geheimhaltung und dürfen nur von Schamanen ausgeübt werden. Sie gehen mit dem Tod des Eingeweihten verloren, wenn er nicht rechtzeitig für einen Nachfolger gesorgt hat. Damit hält er seinen Clan in Abhängigkeit und schützt seine eigene Position. Es gibt aber auch kollektive, öffentlich gefeierte Rituale wie den Kriegstanz der Maori, der heutzutage als ›Haka‹ vor Rugbyspielen aufgeführt wird, um den Gegner mit Lärm, Schenkelklopfen und Kampfgesang einzuschüchtern.«
Nicole griff das auf und sagte: »Die Maori haben ein Verbreitungsverbot erwirkt, denn der Haka war so beliebt, dass er öfter für Werbezwecke genutzt wurde, und das stand der Tradition der Ureinwohner Neuseelands entgegen.«
Rundum wurde Kaffee nachgeschenkt, auch die Gipfeli fanden nun ihre Abnehmerinnen.
»Denkt nur an die Höhlenmalereien, die noch gar nicht so lange bekannt sind. Sie sind nur erhalten geblieben, weil sie vor Wind und Wetter geschützt waren. Das macht sie zu magischen Zeichnungen an geheimen Orten. Aber wer sagt denn, dass es nicht viel mehr ähnliche Malereien gab, an den Wänden von Felsvorsprüngen oder auf den Stoffbahnen von Tipis?«, fragte Nicole.
»Oder auf Holz und Leder«, ergänzte Heinrich. »Alles organische Materialien, die relativ schnell zerfallen.«
Gwendolin blickte wehmütig auf ihr Pyjama.
»Ein weiteres Beispiel«, fügte Himmel an. »Die Sandbilder der Navajo in New Mexico werden bei einer Heilungszeremonie mit verschiedenfarbigem Sand auf den Boden gerieselt und bilden komplexe Strukturen, die jedoch sofort wieder verwischt werden, wenn das Ritual beendet ist. Wir kennen also weder die behandelte Krankheit noch die gesprochenen Worte oder das begleitende Sandbild. Und mit den Navajo kann man immerhin noch reden. Einen Höhlenbildmaler muss man lange suchen.«
Phoebe sagte mit Blick auf den Nutzwert: »Mir ist nicht klar, wofür es überhaupt Rituale braucht, vor allem wenn Tiere keine haben. Was verleitet den Menschen dazu, sich einem Ritual zu unterwerfen?«
»Unterwerfen ist das Stichwort«, erwiderte Himmel. »Mit einem Ritual macht man sich etwas zu eigen oder stellt eine Beziehung her. Falls die Höhlenmalereien Jagdrituale sind, bannt man die Tiere, die es zu erlegen gilt, um das eigene Überleben zu sichern. Bei den Sandrieselbildern nimmt man eine Krankheit in die Pflicht. Und beim Gebet stellt man eine Beziehung zu einem unsichtbaren höheren Wesen her. Man unterwirft sich selbst oder jemand anderen. Es ist also letztlich ein Ausdruck von Machtstrukturen.«
»Wenn es bei dem Mann, den Forrer gestern erwähnt hat, um eine ritualisierte Handlung geht«, überlegte der Detektiv, »dann macht sich der Täter das Opfer zu eigen, übt bis über den Tod hinaus Macht aus?«
Nicole entgegnete: »Das könnte man so sehen. Dann hätten wir es mit einem potenziellen Wiederholungstäter zu tun.«
»Da ist es schon wieder«, protestierte Phoebe, »dieses empörende und nicht wiedergutzumachende Machtgehabe.«
»Das ist zwar richtig«, schloss Müller, »hilft aber bei den Ermittlungen nicht weiter.«
3
»Tatortbesichtigung«, sagte der Kommissar, als er am Nachmittag des einunddreißigsten März im Schwarzen Kater auftauchte. Das Polizeiauto stand vor der Tür, Forrer musste allerdings wegen der Bauarbeiten für den neuen Breitenrainplatz einen Umweg fahren. Über den Guisanplatz ging es zwischen dem Silberturm des Novotels rechts und den Ausstellungshallen des BEA-Geländes links bis zum nächsten Kreisel und dort rechter Hand in die Bolligenstrasse. Das Gelände fiel leicht ab in die Parcoursanlage des Nationalen Pferdezentrums, links reihten sich die Siedlungen im Bereich Baumgarten um ein paar alte Campagnen mit Neben- und Wirtschaftsgebäuden. Entlang der Straße verlief eine Sandsteinmauer, von der Zeit ausgewaschen und vom Zeitgeist mit Graffitis bestückt, die den ästhetischen Wert nicht unbedingt erhöhten.
Durch ein Tor fuhren sie in den Hof einer behäbigen Villa aus dem neunzehnten Jahrhundert, auf deren im Kreis angeordneter Zufahrt bereits ein paar Wagen geparkt waren. Das Ziel war jedoch nicht das repräsentative Herrschaftsgebäude, sondern die Nebenliegenschaft, die früher als Pförtnerhaus oder gar als Pferdestall gedient haben mochte und die wie das Hauptgebäude drei Etagen aufwies, die jedoch deutlich geduckter wirkten und von hohen Bäumen verschattet waren. Die Wände des Parterres waren verputzt und weiß gestrichen, mit dem grauen Ton, der nach frischer Tünche verlangte. Das obere Stockwerk bestand aus unverputztem Sandstein, das Dachgeschoss aus Lukarnen in einem abgeknickten Walmdach. Auf den beiden Seiten des Erdgeschosses lagen Wintergärten, vielleicht eine mit Glas geschlossene Loggia. Darunter wohl ein ehemaliger Gemüsekeller.
An diesem Nachmittag halfen die Fenster nicht viel, denn das Haus blieb im düsteren Halbdunkel. Es brannte überall Licht, damit der Kriminaltechnische Dienst, der seit dem Morgen vor Ort war, seine Arbeit machen konnte. Das junge Team befand sich jedoch bereits im Eingangsbereich, einzelne Personen rauchten draußen vor der Tür. Sie hatten die Plastikoveralls zur Hälfte ausgezogen, diejenigen, die keine Zigarette im Mund hatten, behielten die Maske auf.
Der Kommissar begrüßte die Truppe, die er erst ein Mal bei der Arbeit gesehen hatte, und die Leiterin, Hanna Dürst, stellte ihre Mitarbeiter vor: Sabine Schwarz, Jonas Klein und Severin Blindenbacher, alle zwischen Mitte zwanzig und Ende dreißig.
»Der Geruch ist noch sehr ausgeprägt«, erklärte die Chefin den beiden Männern. »Wir sind so weit fertig, die Spuren sind gesichert. Aufräumen müssen andere.«
Dann machte sie den Weg frei.
Es roch nach Nelken in einer Siedfleischsuppe, nach Lakritz mit einem schweren, süßlich modrigen Unterton, ein Geruch, der sich ins Gedächtnis einbrannte und bei der nächsten Gelegenheit sagen würde: »Ich war schon einmal in deiner Nase.« Im Flugzeug hätte man die Kotztüte bereitgehalten.
Das Wohnzimmer, in dem der Mann zu Tode gekommen war, belegte zwei Drittel der Fläche des Erdgeschosses. Daneben gingen eine Küche und eine Toilette ab. Vom Eingangsbereich führte eine alte Holztreppe zu den Zimmern in den oberen Stockwerken, die zum Schlafen und als Lagerräume genutzt wurden.
»Der Mann lebte alleine hier«, erklärte Forrer. »Bernhard Altenburg. Wir wissen erst, dass er in einem Labor arbeitete, von dem er der Mitbesitzer war. Er tauchte die letzten beiden Tage nicht in der Firma auf, meldete sich auch nicht ab. Deshalb kontaktierte sein Compagnon die Polizei und bat darum, nachzusehen, weil er dieses Verhalten merkwürdig fand und sein Partner auch weder auf Anrufe noch auf Mails reagierte. Aber da ein Streifenwagen in der Nähe patrouillierte, die Polizisten ergebnislos geklingelt und auch im Nachbarhaus nur den Bescheid bekommen hatten, man habe Herrn Altenburg seit ein paar Tagen nicht mehr gesehen, obwohl sein Auto neben dem Haus stehe und nicht bewegt worden sei, haben wir das Notfallteam mit dem Schlüsseldienst vorbeigeschickt.«
Forrer strich sich gedankenverloren durch das immer noch kräftige schwarze Kopfhaar, das pandemiebedingt so lang war wie schon seit Jahren nicht mehr.
Der Raum, in dessen Eingangsbereich sie nun standen, wies nur kleine Fenster auf, die wegen der Wintergärten wenig Licht hereinließen. Das Essen wurde offenbar auf der vorderen Veranda oder in der Küche eingenommen, denn es gab im Wohnzimmer keinen Tisch. An der straßenseitigen Wand hing ein Flachbildschirm mit einer Diagonale von hundertdreiundsechzig Zentimetern. An der linken Wand fand sich ein Lesesessel mit einer Stehleuchte und einem Beistelltisch, an der rechten ein Regal mit einer Musikanlage sowie CDs und DVDs, daneben ein Einbauschrank mit geöffneten Türen.
An der Wand dem TV gegenüber nahm ein Ecksofa aus rissigem braunem Leder den gesamten Platz ein. Dort hatte Altenburg gelegen, denn die Fundstelle war mit gelbem Klebeband markiert. Im Leder und auf dem dunklen Parkettboden erkannte man geronnenes Blut.
Was Forrer und Müller aber daran hinderte, das Wohnzimmer ganz zu betreten, war die sich ihnen bietende Unordnung. Hatte man vorher noch Gestell und Schrank gesagt, so erkannte man bald ein wildes Durcheinander von allem, was ehemals säuberlich verstaut gewesen war.
»Am Beistelltisch haben wir ein paar Blutspuren entdeckt«, sagte Hanna Dürst, die zu ihnen getreten war. Ihr dunkles, rechts gescheiteltes Haar war zu einem Dutt gebunden. »Sonst Fehlanzeige. Sollte es Fingerabdrücke gegeben haben, wurden sie sorgfältig weggewischt.«
»Und DNA?«, fragte der Kommissar.
»Jede Menge, vor allem vom Toten. Ein paar Haare auf dem Sofa, von denen wir noch nichts Weiteres wissen.«
Müller fragte: »Keine Gläser, Flaschen, Apérozeugs?«
»Nein. Wahrscheinlich gespült oder mitgenommen.«
»Hat ein Kampf stattgefunden?«, wollte Forrer wissen.
Dürst antwortete: »Lässt sich nicht ausschließen, auch wenn wenig darauf hindeutet. Immerhin gibt es leichte Schleifspuren auf dem Parkett.«
Müller bemerkte: »Nach einem Einbruch, bei dem der oder die Täter überrascht wurden, sieht es auch nicht aus.«
»Jedenfalls sehen wir keine Spuren eines gewaltsamen Eindringens. Entweder stand die Tür offen, oder der Mann muss seinen Mörder selbst ins Haus gelassen haben.«
»Oder seine Mörderin«, stellte Forrer fest.
»Oder seine Mörderin«, bestätigte die Frau vom KTD.
Der Kommissar dachte laut: »Also steht Bereicherung nicht im Vordergrund?«
»Die Interpretation des Tatorts gehört zu Ihren Aufgaben, nicht zu meinen.«
»Aber Sie haben sich bestimmt Gedanken gemacht.«
Dürst entgegnete: »Es sieht eher nach ›Gelegenheit macht Diebe‹ aus. Vielleicht ein Unfall, den jemand zu nutzen wusste?«
Heinrich Müller stieg vorsichtig über Bücher, CDs und DVDs und stand mitten im Zimmer still. »Darf ich das Material anfassen?«, fragte er.
Die Chefin warf ihm ein paar Handschuhe zu. »Wir sind zwar fertig, aber wenn ein übereifriger Erbe plötzlich Fingerabdrücke findet …«
Der Detektiv trat zur Musikanlage, drückte die Power- und die Play-Taste. »Hello Louise« klang es wie ein Echo aus vergangenen Zeiten aus den Boxen, ein simpler Hintergrund-Rhythmus, der durch das gesamte Musikstück mäandrierte und nur leicht in der Tonhöhe wechselte. »As if we were still lovers«, summte Heinrich den Refrain mit. »The Human League«, sagte er zu den Anwesenden. »›Louise‹ heißt der Song. Offensichtlich hatte der Verstorbene eine nostalgische Phase, erinnerte sich an eine verflossene Liebe, die er nie zurückgewinnen würde – weder die Liebe noch seine Jugend.« Dann schaltete er das Gerät aus, bückte sich, nahm ein Album vom Boden hoch, blätterte es durch und stakste dann damit zu Forrer und Dürst. »Entweder Amateure, oder der Diebstahl ist nur vorgetäuscht.«
Der Kommissar wandte ein: »Vergiss nicht, um diese Frage zu beantworten, müssen wir uns nicht nur anschauen, was hier herumliegt, sondern auch herausfinden, was fehlt.«
»Das kann ich beantworten«, sagte Dürst. »Wir haben keinerlei Elektronik gefunden, also weder Handy noch PC oder Laptop. Noch nicht einmal USB-Sticks. Weder hier noch in den anderen Räumen. Das heißt«, folgerte sie sogleich, »da diese Teile eher schwer verkäuflich sind und der attraktive TV noch hängt, schätze ich, es geht eher um den Inhalt als um die Geräte selbst.«
»Es sei denn, die Diebe haben nur mitgeschleppt, was sie tragen konnten. Für einen großen Flachbildschirm bräuchte man zumindest ein Auto. Was offenbar gefehlt hat.«
Zu Müller sagte er: »Was hast du gefunden?«
»Das ist eine Briefmarkensammlung.«
Dürst spottete: »Noch schwerer verkäuflich.«
»Aber nicht, wenn es sich um frühe Exemplare handelt, sogenannte Altschweiz-Stücke aus der Mitte des neunzehnten Jahrhunderts, wie die Ortspost-, Rayon- oder Strubeli-Marken. Die bringen zwar nicht mehr so viel ein wie früher, hinterlassen aber, wenn man sie einzeln verkauft, kaum Spuren.«
»Wenn man sich gar nicht damit auskennt«, gab Forrer zu bedenken, »schleppt man sie aber auch nicht mit sich herum.«
»Das stimmt. Dennoch erweckt der Raum den Eindruck eines gewollten Chaos. Wieso sollte man sonst CDs und Briefmarkenalben aufs Parkett kippen?«
»Junkies, die nach Geld suchen?«, schlug Dürst vor. »Die Menschen horten Bares an den seltsamsten Orten.«
Der Kommissar schüttelte den Kopf.
»Wie ich den Mann einschätze, hätte er keine Junkies empfangen. Und wenn Drogenabhängige unter Stress geraten, räumen sie ihre Spuren nicht dermaßen penibel hinter sich weg. Irgendetwas entgeht noch unserer Aufmerksamkeit. Versiegeln Sie die Räumlichkeiten. Vielleicht ist ein weiterer Augenschein vonnöten, wenn wir zusätzliche Informationen haben.«
4
Es war nicht so, dass sich Heinrich Müller nach der Rechtsmedizin gesehnt hätte. Vielleicht nach einem Gespräch mit Dr. Augsburger und Laura de Medico, aber nicht nach einem neuen Toten. Dennoch kam es ihm nicht ungelegen, wieder mal ein paar Schritte aus dem Haus zu machen, und nach der Tatortbesichtigung von gestern Nachmittag drängte sich dieser Gang geradezu auf.
Der Detektiv ging zu Fuß Richtung Bahnhof, denn an der Welle 7 wollte er sich mit Markus Forrer treffen. Beide ohne Auto, aber Bus und Tram fuhr Müller immer noch höchst ungern, denn es schwirrten nach wie vor zu viele Coronaviren durch die Luft. Neuerdings nannte man sie Omikron. Das griechische Alphabet war bald durch, also müsste auch die Pandemie schnellstmöglich beendet sein. Der Bundesrat hatte die Aufhebung aller Maßnahmen beschlossen, aber es galt nach wie vor: It’s better to be safe than sorry.
Etwas früher als von der Wetterprognose angekündigt, begann es zu schneien. Aprilwetter. Die nassen Flocken schmolzen auf dem noch warmen Asphalt. Der Winter trotzte hoffentlich ein letztes Mal dem Frühling. Der Kommissar stand mit einem frischen Kaffee to go unter dem Dach.
»Das Wetter passt zu meiner Stimmung«, mümmelte er hinter einem dicken Schal.