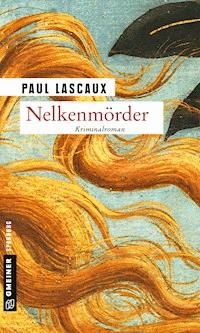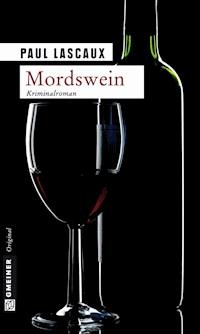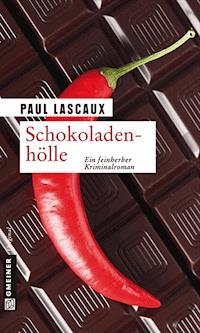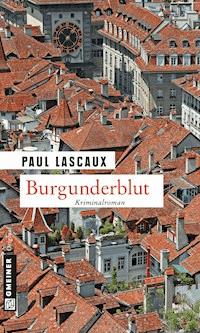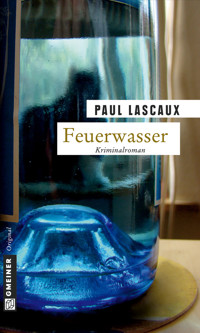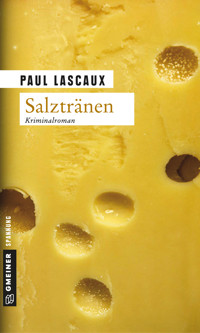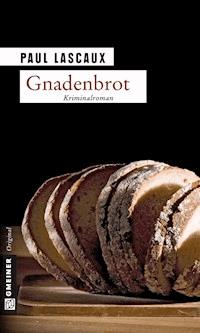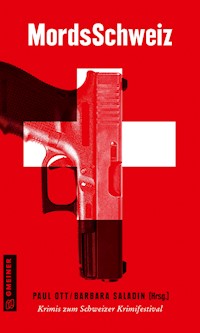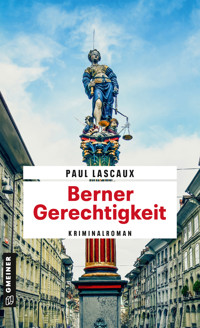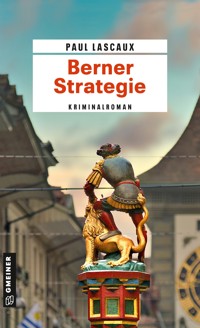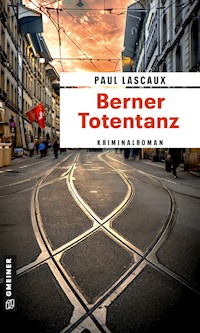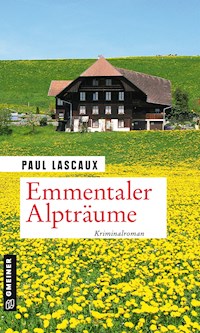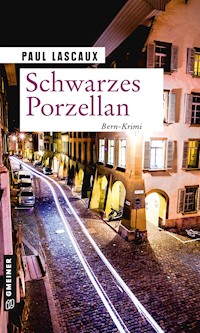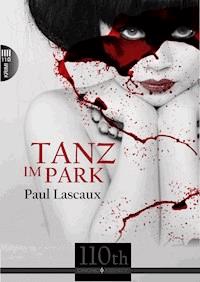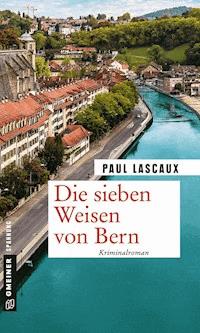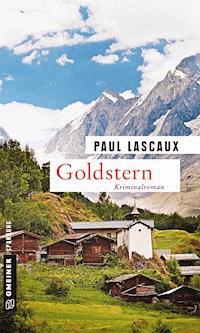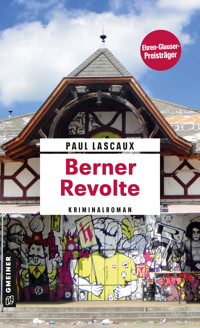
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Gmeiner-Verlag
- Kategorie: Krimi
- Serie: Detektive Müller und Himmel
- Sprache: Deutsch
Martin Schnyder, einst eine Größe der Berner 1980er-Bewegung, liegt tot auf einer Dachterrasse in der Altstadt. Die Polizei geht von einem Suizid aus. Schnyder war viele Jahre untergetaucht. Warum ist er nach Bern zurückgekehrt? Und warum nahm er sich hier das Leben? Der Reporter Simon Bauer wittert eine Story und recherchiert die Hintergründe. Dabei stößt er auf alte Seilschaften, seltsame Finanzflüsse, Geldwäsche und Erinnerungen an eine Zeit, die auch heute noch Anlass für Verbrechen ist.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 246
Veröffentlichungsjahr: 2025
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Paul Lascaux
Berner Revolte
Kriminalroman
Zum Buch
Schwarzes Schaf Vor vielen Jahren aus Bern verschwunden, taucht Martin Schnyder plötzlich wieder in der Stadt auf. Die Größe der 1980er-Bewegung wurde tot auf einer Dachterrasse gefunden. Der Reporter Simon Bauer möchte einen längeren Artikel über Schnyder verfassen und begibt sich auf dessen Spuren. Diese führen ihn zur Detektei Müller & Himmel. Durch Detektiv Müller erhält Bauer Zugang zu Kommissar Markus Forrer von der Police Bern und erfährt: Die Polizei hat Schnyders Tod längst als Suizid zu den Akten gelegt. Aber Simon Bauer und Heinrich Müller können das nicht glauben. Gemeinsam finden sie heraus, dass der Verstorbene mit Geldern von alten Freunden ein Finanzkonglomerat aufgebaut hat, das offenbar auch zur Geldwäsche diente. Eine seiner Firmen kaufte in Bern Bauland für die Errichtung einer sozialen Alterssiedlung. Als auf dem Grundstück eine skelettierte Leiche gefunden und Bauer mit einem Pflasterstein attackiert und verletzt wird, nimmt die Police Bern den Fall wieder auf.
Paul Lascaux ist das Pseudonym des Schweizer Autors Paul Ott. Der studierte Germanist und Kunsthistoriker lebt seit 1974 in Bern und hat in den letzten 40 Jahren zahlreiche literarische Veröffentlichungen realisiert. Einige seiner Kurzkrimis liegen als Übersetzungen in Polen und in den USA vor. Im Jahr 2020 erhielt er den Spezialpreis der Deutschsprachigen Literaturkommission des Kantons Bern. 2021 wurde das von Paul Ott initiierte „Schweizer Krimiarchiv Grenchen“ eröffnet. 2024 erhielt er vom Syndikat den Ehren-Glauser für seinen unermüdlichen Einsatz für die Kriminalliteratur.
Impressum
Personen und Handlung sind frei erfunden.
Ähnlichkeiten mit lebenden oder toten Personen
sind rein zufällig und nicht beabsichtigt.
Die automatisierte Analyse des Werkes, um daraus Informationen insbesondere über Muster, Trends und Korrelationen gemäß § 44b UrhG (»Text und Data Mining«) zu gewinnen, ist untersagt.
Bei Fragen zur Produktsicherheit gemäß der Verordnung über die allgemeine Produktsicherheit (GPSR) wenden Sie sich bitte an den Verlag.
Immer informiert
Spannung pur – mit unserem Newsletter informieren wir Sie
regelmäßig über Wissenswertes aus unserer Bücherwelt.
Gefällt mir!
Facebook: @Gmeiner.Verlag
Instagram: @gmeinerverlag
Besuchen Sie uns im Internet:
www.gmeiner-verlag.de
© 2025 – Gmeiner-Verlag GmbH
Im Ehnried 5, 88605 Meßkirch
Telefon 0 75 75 / 20 95 - 0
Alle Rechte vorbehalten
Satz/E-Book: Mirjam Hecht
Umschlaggestaltung: U.O.R.G. Lutz Eberle, Stuttgart
unter Verwendung eines Fotos von: © Krol:k, CC BY-SA 3.0 <https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0>, via Wikimedia Commons; https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Reitschule_DSC04012.jpg
ISBN 978-3-7349-3178-9
Zitat
»Im Verkehr mit Menschen muss man mit vertraulichen Geständnissen sparsam sein. Die Zahl der tatsächlichen Ereignisse, die man mit Stillschweigen übergehen muss, ist weit größer als die der erfundenen, die sich offen erzählen lassen.«
Giacomo Casanova: »Geschichte meines Lebens« (1797)
Prolog: Vergangenheit
»Ich höre auf«, sagte Heinrich Müller am fünften Januar 2024 zu Nicole Himmel, die er in das gemeinsame Detektivbüro gebeten hatte. »Ich stehe nur noch für Beratungen zur Verfügung.«
Er hatte zwei Gläser mit bestem Champagner gefüllt und eines davon Nicole in die Hand gedrückt.
»Die Detektei Müller & Himmel ist Geschichte.«
Der späte Morgen war ungewöhnlich düster. Winteröde. Es hatte wieder Regen eingesetzt, der die melancholische Stimmung unterstützte. Nicole war über den Zeitpunkt der Erklärung überrascht, aber sie nahm sie sportlich und nicht wie jemand, der bei einer Entscheidung übergangen worden war.
»Ich habe lange darüber nachgedacht«, sagte Heinrich. »Einmal muss man einen Schlussstrich ziehen. Ich werde bald neunundsechzig, und an Geld mangelt es nicht.«
Mit spürbarer Erleichterung erwiderte Nicole: »Endlich keine Leichen mehr im Haus. Noch nicht einmal in Gedanken.« Und sie fragte sich, ob sie recht behalten würde.
Müller ergänzte: »Es sei denn, du möchtest die Detektei alleine oder mit einem neuen Partner weiterführen.«
Sie winkte ab. Dann fügte sie an: »Bei historischen Recherchen stehe ich zur Verfügung.«
Die drei Grazien waren anderweitig beschäftigt, meinten später aber nur: »Du wirst bestimmt rückfällig.«
Kommissar Markus Forrer und die Rechtsmediziner Dr. Augsburger und Laura de Medico wussten noch länger nichts von Heinrichs Entschluss.
Heinrichs Miene hellte sich auf. Dann kam er auf sein neues Hobby zu sprechen, zu dem ihn der letzte Fall inspiriert hatte. Er pflegte hin und wieder auf Online-Plattformen zu stöbern und klickte durchaus einmal zu oft auf den Kaufen-Button. Nun hatte er private Briefe gefunden, die um das Jahr 1850 herum geschrieben worden waren und in jeweils unterschiedlicher Manier eine beunruhigende Phase im Leben eines Menschen dokumentierten. Heinrich hatte einen Bekannten darum gebeten, die in Kurrent geschriebenen Texte zu transkribieren. Sie gingen an Xaver Siegwart in Thorbach bei Flühli im Kanton Luzern. Der wohnte bei seinem Vater, Johann Joseph Siegwart.
Bevor der Detektiv die Briefe gekauft hatte, schlug er in Online-Verzeichnissen die genannten Namen nach. Dabei stellte er fest, dass die weitverzweigte Familie Siegwart als Glasmachersippe in die Geschichte eingegangen war. Sie war hauptsächlich im neunzehnten Jahrhundert vor allem im Schwarzwald und im Entlebuch tätig geworden, also in waldreichen Gebieten, die sie wohl mit wenig Rücksicht auf die Ressourcen der Gegend für die energieintensive Glasbläserei abgeholzt hatten, bis sie an einen anderen Ort weiterzogen und dort von Neuem begannen. Das alles sehr zum Unmut der ansässigen bäuerlichen Bevölkerung, der der Wald nicht etwa als romantischer Rückzugsort diente, sondern in erster Linie zur Brennholzgewinnung, aber auch zum Jagen und Sammeln.
In Thorbach zwischen Flühli und Sörenberg stand die größte dieser Hütten, die jahrzehntelang das nach ihr benannte Flühli-Glas produzierte, zuerst vor allem Alltagsglas, dann aber auch ein paar Kunstgläser, die zu feierlichen Anlässen benutzt wurden – als Taufflaschen oder zu Hochzeiten – und die mit mehr oder weniger kunstvollen Malereien verziert worden waren und deshalb heute, mit dem gebührenden historischen Abstand, gerne gesammelt wurden. Käuflich zu erwerben waren sie jedoch selten, hauptsächlich fand man sie in kleineren Museen oder privaten Sammlungen.
Heinrich Müller war dieses Thema komplett fremd. Zwar hatte er Hergiswil schon einmal besucht – die Siegwarts gehörten auch zur Gründergeneration dieser heute unter anderer Besitzerschaft stehenden Glashütte – und hatte als Tourist auch schon im venezianischen Murano in Kunstglasbläsereien gestanden und zugesehen, wie mit schnellen, geschickten Handgriffen aus dem zähflüssigen Material Tiere und andere Gegenstände gezogen und in Form geblasen wurden. Aber einen Bezug zu Glaswaren hatte er dadurch nicht aufgebaut. Dennoch faszinierte ihn der Gedanke an diese frühe industrielle Kultur, die zumindest in der Schweiz fast vollständig verschwunden war.
Die Gemeinde Flühli immerhin erinnerte an die Geschehnisse mit einem Glasereipfad. Beginnend beim heute ohne h geschriebenen Torbach fand man die erste Hinweistafel, bevor man dem Rotbach in den Chragen hinein folgte. Und hinter einem Haus, das früher als Kneipe gedient und die Glasbläser nach ihrem anstrengenden Arbeitstag um ihren Lohn erleichtert haben mochte, erhob sich eine steile Felsfluh, aus der im Chessiloch ein Wasserfall hervorbrach, der bei passablem Wetter ein paar Wandervögel anlockte. An die Glasbläserei erinnerte jedoch kaum etwas. Ein paar verrottete Baumstämme lagen als frühere Wassersperren noch im Wildbach, vielleicht hätte man auch ein paar Mauerreste finden können. Der Wald war entweder nachgewachsen oder durch Alpwirtschaft ersetzt worden. Nichts, was die Vorstellungskraft besonders provozierte.
Und doch faszinierte Heinrich diese Ausgangslage. Er erkannte darin kein Thema für sich selbst, aber die Grundlage dessen, wie er jeweils bei einem Fall gearbeitet hatte. Die Geschichte setzte sich aus zahlreichen Leerstellen zusammen. Die konnte man zwar mit einiger Fantasie füllen, dennoch blieb es Stückwerk. Zeitzeugen gab es keine mehr, auch Berichte von damals waren spärlich. Dennoch waren Lücken in einer Erzählung oft das Einzige, wovon er ausgehen konnte. Denn es war das Verborgene, worauf es ankam, das Nicht-Gesagte, das Verschwiegene, was nicht dasselbe sein musste. Etwas nicht zu erwähnen, konnte mit einer Scham zusammenhängen, mit dem Vergessen von Details oder damit, dass man Dinge für selbstverständlich hielt, von denen der Gesprächspartner keine Kenntnis hatte. Das Verschweigen hingegen war ein bewusster Akt, mit dem man verhindern wollte, dass jemand Kenntnis von bestimmten Vorgängen erhielt.
Blieben die Briefe, die Müller zum wiederholten Mal näher betrachtete. Er nahm den einen zur Hand und zeigte ihn Nicole, die ihre braunen Locken aus der Stirn schob. Er war in Waldshut abgestempelt. Eine Frau, die leider nicht unterzeichnet hatte, richtete sich an ihren Bruder in Flühli. Sie hatte offenbar ins Ausland geheiratet und wurde nicht glücklich damit, denn sie schrieb: »Die meinigen werden wohl gisagt haben ich möge nichts verleiden […] so ist es nicht wenn ich es so machen thäte so würde ich schon lange im küllen Grabe liegen […]. Wen ich dir wolte schreiben wie mein Mann mit mir und meinen Kinder umgegangen ist du würdest sagen ist es auch möglich aber lieber Theurer Bruder ich kann dir mit freudigem Herzen melden daß sich mein Mann nicht mehr so grob mit mir benimmt Gott seÿ dank mein Gebet und Seufzen sind erhert worden.«
Bald kommen neue Ängste: »Theurer lieber Bruder ich kann nicht unterlaßen zu melden ob auch unsers Marili beÿm Hr Bruder ist oder ob es auf der Post ein Unglük widerfahren ist daß mir kein schreibens von ihm kommt es sind doch bald 4 Wochen verflosen und noch keine Antwort alle Leute wer im kent fragen ihm nach du kanst dir vorstellen welchen kummer ich habe wegen dem Kind.«
Dass eine Frau das Scheitern ihrer Ehe eingestehen muss, sich nur dem Bruder anvertrauen kann, beunruhigte Heinrich über die Jahrhunderte hinweg, denn er hatte längst begriffen, dass er hier wie auch in den anderen Briefen ein Schicksal in Händen hielt, das er nicht mehr verändern konnte, zu dem er nichts beizutragen hatte. Das beschäftigte ihn über alle Maßen, auch wenn die Siegwarts kaum unter Hunger litten. Allerdings hatte er in der Familiengeschichte gelesen, dass erstaunlich viele Familienmitglieder an Typhus verstorben waren.
Die Gedanken schweiften ab. Heinrich dachte darüber nach, weshalb er so wenig über die Glasbläserei im neunzehnten Jahrhundert gehört hatte, und stellte fest, dass er generell nicht viel über diese Zeit und die damals ausgeübten Tätigkeiten wusste.
Was konnte man überhaupt von der Vergangenheit kennen? Aus dem Mittelalter? Oder gab es etwas, das von den Römern überlebt hatte? Gab es noch Berufe, die man vor zweitausend Jahren bereits ausgeübt hatte, so wie man sie heute noch kannte? Müller dachte an die Winzer, aber nicht ohne vorher aufzustehen und die angebrochene Flasche Champagner aus dem Kühlschrank zu holen. Da erkannte er den doppelten Fehler. Erstens gab es damals keine Kühlmöglichkeiten, zweitens kein wie heute vinifiziertes Getränk, denn die römischen Weine besaßen nicht die jetzige Fruchtigkeit und Geschmeidigkeit, nein, man sagte ihnen nach, sie seien entweder als mit Wasser verdünntes Alltagsgetränk zu sauer oder als Dessertwein zu süß. Selbst wenn es also Traditionen gab, die bis zu den Römern zurückreichten, existierte doch nichts mehr aus der Zeit.
Nicole Himmel unterbrach seine Gedankengänge, die er teilweise laut ausgesprochen hatte, und fragte: »Wie kommt es, dass du ausgerechnet diese Briefe gekauft hast?«
Da fiel es ihm wie Schuppen von den Augen und er erzählte: »Ich bin wohl nicht aus reinem Zufall darauf gestoßen. Denn aus meiner Vergangenheit tauchte das Bild einer lebhaften Frau auf. Ich hatte sie damals auf einer Reise zum Carnevale di Venezia kennen und lieben gelernt, und wir blieben für die nächsten Monate zusammen. Das hat zwar keinerlei Einfluss auf meine heutigen Entscheidungen. Dennoch: Sie hieß Siegwart, und wahrscheinlich ist in meinem Hirn eine Erinnerung aufgeploppt, als ich den Namen wieder las.«
»Gibt es denn einen Zusammenhang zur Glasbläserfamilie aus dem neunzehnten Jahrhundert?«
»Das weiß ich nicht mehr. Allerdings braucht es immer einen Anstoß zu einer Entscheidung. Der Familienname war der eine, der Ortsname Flühli der andere. Denn von dort aus habe ich mit einem inzwischen verstorbenen Bekannten eine Wanderung begonnen, die uns zwischen Schrattenfluh und Hohgant zum Kemmeriboden-Bad geführt hat, wo nach den konsultierten Unterlagen ebenfalls eine Glasbläserei gestanden hatte. Man kann es als Reihung von Zufällen bezeichnen oder als sich selbst erweiterndes Konglomerat. Egal. Ich habe jedenfalls eine neue Bestimmung gefunden.«
»Ist das nun die Vergangenheit oder die Gegenwart?«, fragte Nicole.
Heinrich konterte: »Ich würde meinen, es betrifft die Zukunft.«
1
Ihm war schwindlig vor lauter Zahlen. Sie nannten es Businessplan. Er erkannte vor allem Ausgaben und wenig Einnahmen. Außerdem war er hungrig. Er hatte gehofft, man würde ihn zum Essen einladen, denn sie trafen sich zur Mittagszeit im Restaurant Du Nord eingangs des Lorrainequartiers. Aber das ließ das enge Budget wohl nicht zu. Rundherum räumten sie bereits die Tische ab, während sie immer noch vor ihrem ersten Kaffee saßen und von der Bedienung missbilligend begutachtet wurden. Die Küche würde bald schließen. Und er würde sich im Lokal nicht mehr sehen lassen können, während es die andern beiden nicht beeindruckte. Er, das war Simon Bauer, und er betonte gern, dass ihn die Eltern so genannt hatten, damit alle Vokale in seinem Namen vorkamen. Sozusagen als Basis für sein zukünftiges Leben als Reporter. Die anderen, das war einerseits Amanda Bergmann, eine kühle Brünette gegen Ende dreißig mit klaren Konturen in Gesicht und am Körper, eine Frau, die man umstandslos als schön bezeichnet hätte, wenn nicht diese gewisse Härte in ihren Gesichtszügen gewesen wäre. Andererseits saß ihm Leo Feuz gegenüber, ein Mann um die dreißig, also etwas jünger als er selbst, mit noch jungenhaftem Gesicht und einer Langhaarfrisur mit Mittelscheitel, wie er sie zum letzten Mal auf Schallplatten aus den Sechzigerjahren gesehen hatte.
Die beiden betrieben das Online-Magazin »Sondernummer« und hatten es sich auf die Fahne geschrieben, einen unerschrockenen, investigativen Journalismus an die Leute zu bringen. Ob es dafür auch einen Markt gab, hatten sie wohl nicht genügend abgeklärt. Oder sie lebten vom Prinzip Hoffnung. Denn es existierten keine Redaktionsräume, das Ganze wurde aus der eigenen Wohnung heraus konzipiert und online gestellt, und man traf sich mit Menschen irgendwo in Cafés oder Restaurants, wo man einen WLAN-Zugang hatte.
Die fehlende Marktsicherheit und die Aussicht auf brotlose Arbeit hinderte sie aber nicht daran, Kritik zu üben, denn Amanda sagte nun: »Dein letzter Text hat uns nicht gerade von den Socken gehauen. Da war zu wenig Biss drin. Man merkt, dass die zugrunde liegenden Informationen nicht ausreichten und du zu viel spekulieren musstest.«
Das war zwar korrekt, dennoch kam die Gegenfrage nicht über seine Lippen, die da gelautet hätte: »Wann kommt der Gehaltsscheck?« Irgendwann musste ja Geld fließen, denn sonst lag für den freien Reporter Simon Bauer keine andere Arbeit auf dem Tisch. Also mal hören, was sie zu bieten hatten.
Feuz begann: »Ich habe den Auftrag, die Berichterstattung sozusagen aufzuräumen, also zu überblicken, was noch aufgearbeitet oder weiter recherchiert werden könnte. Deshalb gehe ich auch die Polizeirapporte und die Todesanzeigen durch. Dabei ist mir aufgefallen, dass am achtzehnten Oktober 2023 ein Martin Schnyder tot aufgefunden wurde. Die näheren Umstände wurden nicht kommuniziert. Man bekommt allerdings den Eindruck, dass der Mann Suizid begangen hat.«
»Dieser Schnyder war vierundsechzig Jahre alt und ist von einem längeren Auslandsaufenthalt zurückgekehrt«, ergänzte Bergmann. Sie bemerkte erfreut das Staunen in Simons Augen. »Ich war Mitte Januar am Galerienwochenende unterwegs und habe das eine oder andere Gespräch aufgeschnappt. Eine mir bekannte Galeristin hat sich zu einer Besucherin, alle im Vorpensionsalter oder knapp darüber hinaus, über den Verstorbenen geäußert. Niemand glaubt an eine Selbsttötung.«
Bauer hakte nach: »Wieso hat sie der Tod des Mannes noch zwei Monate später beschäftigt? Das ist ungewöhnlich.«
»Genau, du sagst es«, antwortete Amanda. »Der Mann war ein Exponent der Achtzigerbewegung, also der Berner Revolte vor über vierzig Jahren. Wir sind alle viel zu jung, um davon etwas mitbekommen zu haben. Deine Aufgabe besteht nun darin, in einer ausführlichen Reportage die damaligen Ereignisse neu aufleben zu lassen und sie mit dem Tod von Martin Schnyder zu verknüpfen. Umfang spielt keine Rolle. Aber knackig und emotional muss es sein.«
»Wühl ruhig ein bisschen im Dreck«, setzte Leo nach. »Du kannst ja suggerieren, dass du nicht an Suizid glaubst und die Polizei schlechte Arbeit geleistet hat. Kommt gerade gut an.«
Bergmann fügte an: »Die Galeristin hat erwähnt, dass sie den Tod noch mal untersuchen lassen würde, wenn sie ein persönliches Interesse an diesem Schnyder hätte.«
»Und, hatte sie?«, fragte Simon.
»Mögen die Eichhörnchen Nüsse?«, gab sie zurück. »Sie hat noch eine Detektei erwähnt, die sie bei der Lösung eines Falles beeindruckt hatte. Ich glaube, sie hieß Müller & Himmel oder in die Richtung. Vielleicht können die helfen?«
»Bis wann willst du einen Text?«
Amanda erklärte: »Hängt davon ab, was du zusammenträgst. Wenn es sich lohnen sollte, machen wir eine Serie. Falls wir jemanden aufscheuchen, der etwas zu verbergen hat, warten wir ab.«
Simon Bauer stand an einem Wendepunkt in seinem Leben. Insgeheim hatte er schon länger gespürt, dass sich etwas ändern musste. Da er aber nicht genau wusste, was ihn störte, noch, worauf es hinauslaufen könnte, blieb es vorerst bei der inneren Unruhe.
Er war 1989 geboren, am Tag, als in Berlin die Mauer fiel. Auch wenn er in Bern zur Welt gekommen war, blieb sein erster Tag auf dieser Erde für immer mit dem epochalen Ereignis vom neunten November verbunden. Er war also sozusagen seit seinem ersten Tag in eine Welt voller Veränderungen hineingeworfen, von denen er nichts mitbekommen hatte.
Seither war sein Lebensweg in geruhsamen Bahnen verlaufen. Natürlich nicht ohne die privaten Aufregungen, durch die jeder hindurchmusste. Auch nicht ohne den einen oder andern aufregenden Zwischenfall im Weltgeschehen. Aber insgesamt in geordneten Verhältnissen und in mehr oder weniger finanzieller Sicherheit.
Nach der schulischen Laufbahn und einem Studium in Germanistik und Journalistik hatte er eine Anstellung bei einer bedeutenden Tageszeitung gefunden, die er vor einigen Jahren infolge von Strukturbereinigungen wieder verloren hatte. Seither arbeitete er als unabhängiger Reporter mit einem Faible für Fotografie, sodass er oft beide Bereiche abdecken konnte, was im Normalfall für den Lebensunterhalt sorgte.
Obwohl er in seinem Alter durchaus noch viel Zukunft vor sich sah, fiel es Simon zunehmend schwerer, Themen für seine Reportagen zu finden, die auch in den Printmedien Anklang fanden. Er war noch vom alten Schlag, hütete sich vor jeder übertriebenen Darstellung und vor kurzlebigen Schnellschüssen oder gar fingierten Textteilen, die einem schnell das Genick brechen konnten, denn in den letzten Jahren waren die Redaktionen hellhörig geworden, wenn etwas Spektakuläres auf ihrem Tisch landete. Sie hatten zu viele Beispiele von Reportern erlebt, die mehr vortäuschten als lieferten.
Darunter litt nun auch Bauer. Stets sollte er die von ihm ausgesuchten Geschichten der Redaktionskonferenz zum Absegnen vorlegen und lief dadurch immer wieder Gefahr, dass sich jemand seines Themas bemächtigte und einen Text veröffentlichte, bevor er in seiner gemächlichen Arbeitsweise zum Ziel gekommen war. Deshalb blieb er lieber im Vagen und verriet nicht allzu viel von seiner Idee, was wiederum zu manchem Stirnrunzeln führte, weil die Redaktionen zu wenig Fleisch am Knochen sahen. Da war der Anruf von Amanda Bergmann gerade rechtzeitig gekommen, auch wenn keine finanzielle Garantie damit verbunden war. Simon fühlte sich oft in die Welt hinausgeworfen, zumindest bis die Chefredaktorin sagte: »Lass alles stehen und liegen, an dem du gerade arbeitest. Wir brauchen dich.«
Nach dem Treffen im Du Nord fuhr er mit dem Fahrrad hinauf zum Viktoriaplatz und von dort Richtung Obstberg, vorbei am Rosengarten und an der berüchtigten Geschwindigkeitsradaranlage, die genau dort stand, wo man am wieder abfallenden Hang richtig Fahrt aufnahm. Gut, er musste sowieso bremsen, denn er wohnte an der Bantigerstrasse, in einem Haus, in dessen Parterre jahrzehntelang eine Tierarztpraxis existiert hatte, die vor Kurzem erst umgebaut und dann endgültig geschlossen worden war. Nun wusste niemand so genau, wie es mit dem Haus weiterging und ob einem die Wohnung früher oder später wegen Luxussanierung gekündigt würde.
2
Die Schildpattkatze Lucy, inzwischen im Alter, das sie laut Katzenfutterverpackung als »adult« auswies, lag schon seit Stunden auf der Bettdecke und hatte sich in einem kugeligen Zustand in den Schlaf gemümmelt, aus dem sie nur ungern geweckt wurde. Und sie tat lange Zeit so, als ob sie überhaupt nicht aufwachen könnte, als Heinrich Müller ins Bett stieg und seinen Platz unter dem Duvet beanspruchte.
Da es nun einmal nicht anders ging, stellte sich Lucy auf ihre Pfoten, streckte Beine und Rücken durch und gähnte herzhaft. Wo sie gelegen hatte, hinterließ sie eine aufgeheizte Schlafdelle. Dann guckte sie um sich, reckte den Schwanz in die Höhe und stakste auf Heinrichs Kopf zu. Langsam senkte sie ihr Haupt und näherte sich, bis ihr feuchtes Näschen Heinrichs Nasenspitze stupste, dabei den Geruch überprüfend. Als das zufriedenstellend ausfiel, setzte sie sich auf die Hinterpfoten und begann unter kräftigem Schnurren mit rhythmischen Milchtritten, was nach konzentrierter Arbeit aussah, denn alle fünf bis sechs Mal hielt sie die linke Pfote für ein paar Sekunden angewinkelt in der Luft und schien zu überlegen, bevor sie die Pfote wieder auf die Decke setzte. Dann endlich drückte sie sich in die Kuhle bei Heinrichs Bauch und schlief beglückt ein, während er sich noch etwas hin und her wälzte und die Ereignisse des Tages überdachte.
Am nächsten Morgen, Heinrich war unüblich früh aufgestanden, markierte Lucy mit den Wangen seine Beine und maunzte mit einer bestimmten Absicht vor sich hin. Müller kannte diesen Ton, stand auf und folgte ihr in die Küche …
Dann setzte er sich vor den Computer und schaute eine Skiabfahrt der Damen an, während er auf einen Simon Bauer wartete, der irgendein Begehren hatte, das er am Telefon nicht ausführen konnte. Eben hatte eine Fahrerin in einer engen Kurve fast das Gleichgewicht verloren. Der Co-Kommentator, ein früherer Trainer, bemerkte in nüchternem Ton: »Zu viel Rotation im Oberkörper, dann geht das Heck weg vom Ski.«
Müller quittierte mit einem sarkastischen Lächeln. Er mochte die Sprachpoesie der Sportreporter.
Vor dem Haus, das man Simon Bauer angegeben hatte, versperrte ein Laster die Straße, auf die schwere Nassschneeflocken fielen. Auf der Plane stand »TKF«. Was ennet des Ozeans als cooles Kürzel einer Hip-Hop-Band durchgegangen wäre, hieß diesseits einfach nur »Tiefkühl-Fredy«. Der Kleinlaster blockierte die gesamte Einbahnstraße, weil Fredy ein Päckli gefrorene Pouletflügeli abliefern musste. Als ob es das nicht auch im nebenan gelegenen Supermarkt zu kaufen gegeben hätte. Aber manche Leute waren inzwischen zu faul, deswegen aus dem Haus zu gehen. Wann muss man ihnen wohl das Essen direkt in den Rachen stopfen, sinnierte Fredy, der eben ins Führerhaus zurückgekehrt war, und dachte an Gänseleber, bevor er den nächsten Kunden anpeilte.
Der Reporter hatte noch nie mit einem Detektiv zu tun gehabt, deshalb wusste er nicht, was ihn erwartete. Er stand im Breitenrain vor dem ehemaligen Lokal »Schwarzer Kater«. Die Schrift über der Eingangstür war verblasst, die Buchstaben c und w abgestürzt. Rechts daneben fand Bauer den Hauszugang, neben dem auch fünf Briefkästen übereinander angeordnet waren. Der unterste war zugeklebt, er hatte der Kneipe gedient. Der zweite trug den Namen der Detektei Müller & Himmel. Auf dem dritten stand »Heinrich Müller«, darüber »Nicole Himmel« und zuoberst »Helbling, Käsbleich und Rauch«, worauf er sich keinen Reim machen konnte. Genauso waren die Klingeln angeordnet. Er drückte diejenige der Detektei. Ohne großen Verzug summte der Öffner, Simon stieß die helle Holztür auf und trat in einen schmalen Gang mit orangeblassen Fliesen.
»In den ersten Stock«, hörte er die Stimme eines Mannes.
Oben angekommen, begrüßte ihn anscheinend Heinrich Müller und führte ihn in das Büro der Detektei, in dem eine beträchtliche Unordnung herrschte.
»Entschuldigen Sie das Chaos«, sagte er, während er einen Stuhl freiräumte, damit der Ankömmling sitzen konnte. Vor dem Detektiv saß ein Mittdreißiger mit dunkelbraunen Haaren, die oben hell aufblondiert waren und doch die Geheimratsecken nicht verstecken konnten. Eher kantige, streng wirkende Gesichtszüge, eine gerade Nase, ein schmallippiger Mund, der in Grübchen endete, und wache hellgrüne Augen.
»Sie sind also Herr Bauer«, stellte Müller fest. »Auch wenn es nicht so aussehen mag: Ich bin am Aufräumen. Die Detektei wird entrümpelt und steht nicht mehr für Ermittlungen, sondern nur noch für Beratungen zur Verfügung. Ich habe es Ihnen bereits am Telefon erklärt. Wie kann ich helfen?«
»Man hat Sie mit dem Hinweis empfohlen, Sie könnten über die Berner Achtzigerbewegung Auskunft geben«, sagte Simon Bauer.
»Kann schon sein«, entgegnete Heinrich. »Aber wer will das wissen und wozu?«
»Mein Name ist, wie Sie bereits wissen, Simon Bauer. Ich soll im Auftrag des Online-Magazins ›Sondernummer‹ eine Reportage über einen Martin Schnyder schreiben.« Als keine Reaktion kam, fügte er an: »Falls es sich lohnt.«
Dann zog er eine Kopie der Todesanzeige aus seinem Rucksack und reichte sie über den Tisch, wo Heinrich Müller im Bürostuhl fläzte. Aufmerksam las der Detektiv den Text:
»Bern, 25.10.2023
Wir nehmen Abschied von unserem guten Freund und alten Kollegen
Martin Schnyder
24.6.1959–18.10.2023
Er hat unter seiner fortschreitenden Krankheit nicht lange leiden müssen und ist im Frieden mit sich selbst von uns gegangen.
Möge deine unstete Reise ein glückliches Ende gefunden haben.
Die Beisetzung hat im kleinsten Kreis bereits stattgefunden. Es werden keine Trauerzirkulare verschickt.«
Unterzeichnet ohne Adressangabe von Alexandra Zbinden, Yvonne Käser, Ariane Stettler und Tim Stettler.
»Das tönt nach Exit, einem Verein, der Sterbehilfe und Suizidbegleitung anbietet«, sagte Heinrich. »Wissen Sie mehr?«
»Leider nicht«, antwortete Bauer. »Exit wird keine Auskunft gebe. Falls sie überhaupt beteiligt waren.«
»Das nicht. Aber möglicherweise die Polizei?«, schlug Müller vor.
Der Reporter sagte: »Ich habe den Polizeiticker vom letzten Oktober durchgeschaut. Es war nichts Auffälliges dabei.«
»Wenn es um Sterbebegleitung oder einen Suizid geht, wird das auch nicht öffentlich gemacht«, erwiderte Müller. »Das heißt aber nicht, dass der Todesfall nicht untersucht wurde. Haben Sie eine der Unterzeichnerinnen der Todesanzeige konsultiert?«
»Nein. Ich wollte damit warten, bis ich weiß, ob sich die Recherche lohnt.«
Der Detektiv erkannte: »Wäre also noch nachzuholen. Eine Frage zwischendurch: Sie wollen mich engagieren?«
Simon räusperte sich: »Ich wollte mich erst einmal erkundigen, ob sich das rechnet.«
»Wenn Sie es als Spesen bei Ihrem Online-Magazin abbuchen können«, meinte der Detektiv und nannte seinen Stundenansatz.
Bauer kicherte hilflos.
»Bevor Sie jetzt gleich in Ohnmacht fallen: Der Name Martin Schnyder sagt mir nichts. Ich habe jedoch ein schlechtes Namensgedächtnis. Außerdem trugen viele von uns damals Spitznamen und gaben ihre weiteren Daten nur ungern bekannt. Hilfreich wären Fotos aus der Zeit, vielleicht erkenne ich das Gesicht.«
»Genau deswegen wollte ich Sie persönlich treffen«, nahm der Reporter die Initiative an sich. »Ich habe nicht nur Zugang zu den Plattformen wie e-periodica, also den digital abrufbaren Zeitungsarchiven, sondern könnte auch die Archive im Keller der größten Tageszeitung nutzen, für die ich auch schon gearbeitet und wo ich deshalb nach wie vor Zutritt habe. Dort findet sich auch alles, was nicht publiziert wurde, aber dennoch wert war, es aufzuheben. Dazu gehören vor allem Bilder. Nicht alle Fotos haben die vierzig Jahre seither gut überstanden, vielleicht helfen sie trotzdem bei der Identifizierung von einzelnen Personen, nach denen ich dann weitersuchen kann.«
Er legte Heinrich Müller einen kleinen Stapel Schwarz-Weiß-Fotos vor, den dieser akribisch musterte. Der Detektiv drehte sie um und erkannte: »Es stehen nirgends Namen drauf. Offenbar haben die Fotografen nicht gewusst, wen sie aufnehmen. Das überrascht mich ein wenig, denn aus unserer Sicht waren das potenzielle Helfer der Polizei, die mit den Aufnahmen gezielt Personen aus der Masse hätten herauspicken können.«
»Die Fotos sind nicht aus dem Haus gegangen«, behauptete Bauer.
Müller entgegnete: »Nicht glaubwürdig. Möglicherweise sind die Negative an die Polizei überreicht worden. Egal. Nichts, was mich heute noch beschäftigen würde.« Dann setzte er sein Fazit: »Ich erkenne André, Adrian, Benjamin, den Echsenmann, Stefanie, Susanne und Claire. Über die Nachnamen muss ich mir erst noch klar werden. Und ja, die Stettler und Zbinden sind auch dabei, aber nicht die Käser. Und hier haben wir wohl den Martin Schnyder.« Er zeigte auf einen kleinen Mann hinter einem Transparent, auf dem nicht genau zu lesen war, was draufstand. »Es ist der Mann mit den langen Haaren, der Skibrille und der Skimütze, die er auch im Sommer trug, weil er glaubte, man würde ihn nicht erkennen. Besonders viel bringt es allerdings nicht.«
»Nun gut, immerhin haben wir nun eine beträchtliche Liste von Namen und somit einen Ansatz, auf dem sich aufbauen lässt.«
»Wen meinen Sie mit ›wir‹?«, fragte Müller.
»Sie sind doch mit dabei?«, fragte Bauer.
Der Detektiv seufzte vernehmlich und lotste den Reporter in das Parterre, wo er ihn an die Bar setzte und aus dem Kühlschrank eine Flasche Neuenburger Weißwein holte, zwei Gläser damit füllte und beim Anstoßen sagte: »Ich bin Heinrich.«
»Simon«, gab der andere zurück.
»Jetzt finden wir erst einmal die genauen Todesumstände heraus. Ich rufe Kommissar Forrer an und frage, ob er Zeit hat.«
3
Der Weg führte die beiden über den Breitenrainplatz und dann die Breitenrainstrasse hinunter, beim Spielplatz rechts, und nach knapp zehn Minuten standen sie vor der Hinterseite der Police Bern. Sie nahmen die Rampe, wo sich im Untergeschoss früher das Gantlokal befand, und stiegen auf der anderen Seite wieder hoch, um zum Haupteingang am Nordring zu gelangen.
»Unser Detektiv ist in voller Fahrt«, begrüßte Kommissar Markus Forrer die beiden, »mit einem Lehrling im Schlepptau.« Er strich sich mit der Linken durch sein immer noch kräftiges dunkles Haar, das erste Silberstreifen zeigte, bevor er ihnen die Hand schüttelte.
Heinrich antwortete: »Lehrling ist nicht passend. Ich stelle dir Simon Bauer vor. Er ist freier Reporter und recherchiert im Auftrag eines Online-Magazins. Ich bin ihm wahrscheinlich behilflich.«
»Was bedeutet ›wahrscheinlich‹?«, wollte Forrer wissen.
Simon schaltete sich ein: »Wir brauchen zuerst genügend Informationen. Bisher besitzen wir einzig eine Todesanzeige, und man hört Gerüchte.«
»Welcher Art?«, fragte der Kommissar.
»Nun, die Todesanzeige suggeriert einen Suizid oder eine Sterbebegleitung. Aber man glaubt allgemein nicht an eine Selbsttötung. Was genau dahinterstecken könnte, wissen wir nicht. Deshalb sind wir hier.«
»Setzen Sie sich erst einmal«, sagte Forrer und wies auf die Besucherstühle. »Nach deinem Anruf habe ich die Akte holen lassen.« Er wiederholte und wandte sich besonders an Simon Bauer: »Ja, es existiert eine Akte, denn die Polizei wird bei jedem nicht natürlichen Todesfall beigezogen. Wir werden meist von Ärzten gerufen, denen die Todesumstände sonderbar vorkommen, manchmal auch von Menschen, die einen Toten gefunden haben. Logischerweise vor allem dann, wenn es sich nicht um Angehörige handelt.«
»Wer erben kann, ruft selten die Polizei«, machte Heinrich einen Witz, der nicht nur gut ankam.
»Mag sein«, brummte der Kommissar. »Hier lag der Fall jedoch anders. Im Prinzip handelte es sich um eine besondere Form von Stalking, bei der ein Mensch nur beobachtet wird, jedoch vorderhand nichts davon mitbekommt.«
Müller sagte: »Jetzt machst du mich neugierig.«