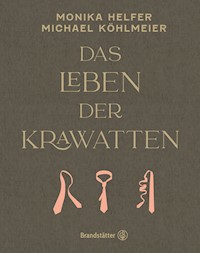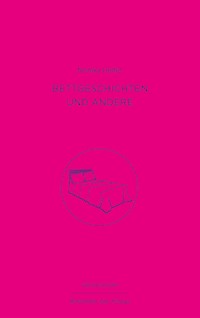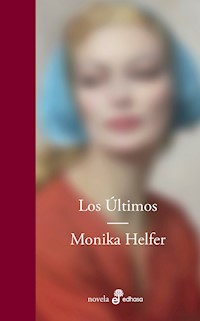Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Zsolnay, Paul
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
osefine Bartok, genannt Josi, ist Psychiaterin in Wien mit einem nüchternen Blick auf die menschliche Seele. Sie hat eine Krebsoperation hinter sich, und ihr Mann Tomas bekennt sich nach zwanzig Jahren Ehe zu seiner Homosexualität. Das Unglück muss man ernst nehmen, findet Josi, so ernst wie Don Quijote die Windmühlen. Tatsächlich hat Josi mit diesem Helden viel gemeinsam. Sie erfindet sich nach der Trennung neu, beschließt, nur mehr Anzüge zu tragen, verliebt sich in Griechenland in Max und schließt Freundschaft mit Paula, einem zwölfjährigen Mädchen. Ein Roman über eine ungewöhnliche Frau, die nach und nach beginnt, neue Formen des Glücks für sich zu entdecken.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 267
Veröffentlichungsjahr: 2010
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Deuticke eBook
Monika Helfer
Bevor ich
schlafen kann
Roman
Deuticke
Für Michael,
Oliver,
Undine,
Lorenz und
Paula
eBook ISBN 978-3-552-06162-0
Alle Rechte vorbehalten
© Deuticke im Paul Zsolnay Verlag Wien 2010
Das Gedicht von Robert Frost (Originaltitel: Stopping by woods on a snowy evening) wird zitiert nach dem Film »Telefon« von Don Siegel, USA 1977.
Satz: Eva Kaltenbrunner-Dorfinger, Wien
Datenkonvertierung eBook:
Kreutzfeldt digital, Hamburg
Unser gesamtes lieferbares Programm
und viele andere Informationen finden Sie unter:
www.hanser-literaturverlage.de
Des Waldes Dunkel
zieht mich an,
doch muss zu meinem Wort
ich stehn
und Meilen gehn, bevor
ich schlafen kann
und Meilen gehn,
bevor ich schlafen kann.
Robert Frost
ERSTER TEIL
Erstes Kapitel
1
Das Glück, meine Liebe, wird die Frau zur Deckenlampe hinauf sagen, wenn es überhaupt kommt, kommt nur einmal, höchstens zweimal, und wenn es tatsächlich zweimal kommt, dann vergeht vom einen zum anderen Mal eine ziemlich lange Zeit. Beim Unglück sieht es anders aus. Es kommt immer zweimal oder dreimal oder viermal sogar, und immer kommt es kurz hintereinander.
Und nun stell dir eine Frau vor, wird sie weiter zur Deckenlampe sagen, und diese Frau geht zur Routineuntersuchung, Mammographie, was bei ihren winzigen Brüsten gar nicht so einfach ist, und man stellt Brustkrebs fest. Befallen sind beide Seiten. Ich könnte zwei Schmucknarben versuchen, sagt der Arzt. Bitte, was sind Schmucknarben, fragt die Frau. Oh, zum Beispiel, sagt der Arzt, könnte ich die Haut auf jeder Seite zu je einem Stern zusammenziehen. Zu einem Stern? Ja, zu einem Stern, sagt der Arzt, es gibt fünfzackige Sterne, davon rate ich aus verschiedenen Gründen ab, es gibt sechszackige, auch davon rate ich ab, es könnte missverstanden werden, überall spielt die Politik hinein, ich habe einen sehr schönen siebenzackigen Stern entwickelt, sieben ist eine interessante Zahl. Nein, keine Sterne, ruft die Frau aus, nur ja keine Sterne, Sterne wären ja Glück, und hier wird vom Unglück gesprochen. Muss ja nicht sein, sagt der Arzt, dann eben nicht Sterne. Sondern? Ach, sagt die Frau, wenn Sie Sterne können, können Sie sicher auch Kreuze, das ist bestimmt sogar um einiges weniger Arbeit. Irrtum, sagt der Arzt, das ist mehr Arbeit, da kann ich nicht so viel vertuschen, das wird immer wie Kreuze mit Strahlen aussehen. Wollen Sie wirklich Kreuze? Ja, Kreuze, sagt die Frau, richtig schöne Kreuze.
Sie hieß Josefine Bartok und wurde Josi genannt. Was sie immer geliebt hatte. Was sie gefördert hatte: »Alle sagen Josi zu mir, sag doch du auch Josi! Nur bitte nicht Tschosi.« Sie hatte Überblick über die Menschen, die sie so nannten. Viele waren es nicht, es waren schon mehr gewesen.
Sie lebte in Wien und war Psychiaterin im Otto-Wagner-Spital auf der Baumgartnerhöhe, wo die Raben von Wien ihre Schlafplätze haben und in der Dämmerung zu Hunderten einfliegen. Bis zu ihrer Krankheit hatte sie dort gearbeitet. Danach hatte sie um Frühpension angesucht. Das Verfahren lief noch.
Ihr Mann hieß Tomas, seine Eltern war 1956 aus Ungarn geflohen, er unterhielt ein Fitnesscenter und war im Begriff, eine Kletterwand zu errichten, wie es vergleichbare nur in Amerika gab. Ihre Kinder waren Anfang und Mitte zwanzig, der Sohn hieß Bruno, die Tochter Karla. Karla arbeitete am Theater, Bruno wollte Maler werden.
Was noch?
»Weil der erste Hieb«, wird Josi zur Deckenlampe in ihrer neuen Wohnung in der Piaristengasse im 8. Wiener Gemeindebezirk sagen, »ja, weil der erste Hieb so überaus gut gelungen war, schlug das Unglück gleich noch einmal zu, ließ mir gerade eine kleine Verschnaufpause …«
2
Im vorangegangenen Jahr war Tomas oft spät in der Nacht nach Hause gekommen, manchmal erst in den Morgenstunden. Das Fitnesscenter, das er betrieb, ging gut, er wollte ausbauen. Die Sensation sollte eben diese Kletterwand werden, »vergleichbare sind nur in Amerika zu finden«. Es war geplant, die Fassade einer alten Fabrik in Ottakring zu mieten und daran einen Klettergarten aus Zement hochzuziehen, mit Klüften, Kaminen und überhängenden Felsen, das Ganze gespickt mit Griffen in allen Farben, die von innen beleuchtet werden sollten. Er treffe sich mit möglichen Partnern, für ihn allein sei die Sache zu groß. Diese Leute seien anspruchsvoll, niemand fahre von wer weiß woher nach Wien und wolle dann Wien nicht sehen, vor allem Wien bei Nacht.
Was Josi nicht im Geringsten interessierte.
Bei Redensarten wie »Wien bei Nacht« oder, was er auch schon gesagt hatte, »die halbe Stadt ist auf den Beinen«, fuhr ihr ein Giftstoß ins Hirn, und sie dachte, er lügt. Er will mich beschwichtigen. Der Wortschatz der Harmlosigkeit besteht aus leeren Hülsen. Dahinter ließ sich viel verbergen. Sie musste achtgeben, dass sie nicht die Augen verrollte, wenn er zu erzählen begann. Kaum ein Satz, der nicht aus Phrasen, Stereotypen, Floskeln, Klischees bestand. Sonst redete er nicht so. Das irritierte sie. Natürlich lief das nicht bewusst bei ihm ab, Tomas war nicht raffiniert. Aber vielleicht war ja sein Unterbewusstsein raffiniert. Wenn die Kollegen im OWS geahnt hätten, was für Vorstellungen von der Seele Frau Dr. Josefine Bartok hatte, nämlich dass es dort unten zugehe wie in Zeichentrickfilmen mit kleinen bunten quiekenden Fantasietieren oder, wie im Fall von Tomas’ Unterbewusstsein, kleinen durchtrainierten grinsenden Neunjährigen, die Kollegen hätten – was hätten sie? Wahrscheinlich wären sie begeistert gewesen und hätten ihre eigenen Vorstellungen ausgebreitet, die nicht weniger kindisch, nicht weniger riskant, nicht weniger verrückt gewesen wären. Psychiater glauben ebenso wenig an die Seele wie Theologen an Gott.
Und dann war Tomas zwei Tage und zwei Nächte gar nicht mehr nach Hause gekommen. Hatte nicht angerufen. Hatte sein Handy abgedreht. Es tat ihr weh, sie konnte ihn verstehen, und das tat noch mehr weh. Sie war darauf vorbereitet gewesen.
Eine der Krankenschwestern, Irene, die in ihrer Abteilung beschäftigt war und mit der sie manchmal nach ihrem Dienst ein Bier getrunken hatte (was ihr nicht schmeckte, was sie aber auf den Boden brachte und gleichgültig werden ließ gegenüber der durch und durch bewussten Verrücktheit in der Psychiatrie), hatte irgendwann ausführlich die Geschichte ihrer gescheiterten Ehe erzählt und dabei so viel Vertrauen über Josi ausgeschüttet, dass sie ihrerseits zu erzählen begann, hauptsächlich, um die Frau nicht zu beschämen, denn ganz sicher hätte sie sich geschämt, wenn nur ihr Innerstes nach außen gekehrt worden wäre. Damals hatte Josi noch nichts Dramatisches zu bieten gehabt, ihre Ehe mit Tomas war normal, sie hätte jedenfalls normal dazu gesagt – abgesehen davon, dass er nur zwei Abende pro Woche zu Hause verbrachte und am Morgen nach seinen zwanzig Minuten Pilates und zehn Minuten Frühstück mit angewinkelten Armen hinunter zum Parkplatz lief und in seine merkwürdige Welt davonbrauste. Irene aber runzelte die Stirn. Da bahne sich etwas an, sagte sie. Nichts Gutes. Gar nichts Gutes. »Was denn?«, hatte Josi gefragt. »Was habe ich dir denn erzählt, das so einen Schluss zulässt?« »Ich höre heraus, dass er ein furchtbar armer Mann ist«, hatte Irene geantwortet. »Wenn du nicht aufpasst, ist das der Anfang vom Untergang.« Josi war erschüttert gewesen, sie hatte keinen Tau, worauf Irene anspielte. Augenblicklich konnte sie diese Frau nicht mehr leiden. »Du bist ihm in allem überlegen, das ist sein Problem«, fuhr Irene fort. »Er hat Sport und Geographie studiert, du Medizin und Psychologie. Du hast den Doktor mit Auszeichnung gemacht, er hat sein Studium abgebrochen. Du verdienst ein Vielfaches von ihm und hilfst den Menschen in ihrer größten Not. Er probiert hier etwas und dort etwas, treibt sich mit blöden Bodybuildern herum, riecht den ganzen Tag ihren Achselschweiß und muss sich ihre Körper anschauen, die von Anabolika aufgebläht sind, und wird am Ende von niemandem anerkannt. Dich schätzen alle.« Und dann hatte sie noch gesagt: »Mach dich gefasst, dass er eine Freundin hat. Aber mach dir keine Sorgen, sie wird ein dummes Ding sein, die ihn für einen Traummann hält.« »Ich halte ihn auch für einen Traummann«, hatte Josi gesagt und war sich bewusst gewesen, dass dies in Irenes Ohren wie Spott klingen musste. »Außerdem habe ich den Doktor nicht mit Auszeichnung gemacht, sondern mit im Gegenteil, und Tomas verdient nicht weniger als ich.«
Jetzt ist es also so weit, hatte Josi gedacht, als Tomas in der ersten Nacht nicht nach Hause gekommen war. Wenn ich jetzt nicht aufpasse, beginnt hier womöglich der Untergang. Und wenn die Neue gar nicht blöd ist? Sondern schöner als ich und jünger, umgänglicher als ich, an Sport interessierter als ich, lustig, aber nicht ironisch, und besser im Bett als ich? Ich bin nicht gut im Bett, dachte sie. Aber ich will gar nicht gut im Bett sein. Was soll das überhaupt heißen? Dass man sich bewegt wie in der Turnstunde? Dass in möglichst kurzer Zeit möglichst viele Stellungen und möglichst viele andere Methoden der körperlichen Befriedigung jenseits des landläufigen GV absolviert werden? Oder dass man Sachen sagt, die man in angezogenem Zustand nicht sagen würde? Tomas war auch nicht besonders gut im Bett. Unauffällig. Gemütlich und gütig. Ihre Tage in der Klinik waren anstrengend. Nicht ein Tag, an dem sie sich nicht überfordert vorgekommen wäre, als eine Verbrecherin, die Hilfe verspricht und Gift gibt. Eine Dealerin. Sie zweifelte an der Existenz der Seele, aber nicht an den Schmerzen, die sie einem Menschen zufügen konnte. Manchmal sagte Tomas: »Was du machst, ist anstrengender als die Tour de France. Komm leg dich auf den Bauch, ich massier dich ein bisschen und wir schlafen gleichzeitig ein bisschen miteinander.« Mehr hatte sie nie erwartet. Und er? Er mochte es, wenn sie ihn mit der Hand befriedigte. Hätte sie deswegen misstrauisch sein sollen?
Dass Tomas etwas passiert sein könnte, daran hatte sie nicht gedacht. Sie war im Bett gelegen und hatte gewartet, war eingeschlafen, nach einer Stunde aufgewacht, hatte auf die Uhr gesehen und hatte gewartet. Hatte ein Xanor geschluckt, um nicht in Panik zu geraten, um ihre Atemfrequenz herunterzufahren, weil ihr beim schnellen Luftholen die Narben weh taten. Sie kühlte innerlich aus. Irene hatte einen Eindruck von Tomas gewonnen, und dieser Eindruck war grundfalsch. Aber sie, Josi, hatte ihr diesen Eindruck vermittelt. Wie war es dazu gekommen? Dass sie Tomas unbewusst niedermachen wollte? Das einzige Indiz für die Existenz der Seele, dachte sie, bestand darin, dass alle daran glaubten. Sie beobachtete ihren Mann, das hatte sie immer getan, und sie hatte es gern getan. Tomas war ein Musterbeispiel von schillernder Oberfläche. Was sollte daran nicht gut sein? Musste denn unbedingt etwas darunter liegen? Er war stark, durchtrainiert, erstaunlich biegsam, sie hatte sich an seinem Körper nie satt sehen können. Unter Minderwertigkeitskomplexen, wie Schwester Irene vermutete, litt dieser Mann mit Sicherheit nicht. Dass er kein Grübler war, hieß nicht, dass er nichts im Kopf hatte. Josi bewunderte ihn. Er war zu schnellen Entschlüssen fähig. Das war sie nicht. Er konnte verschlungene Zusammenhänge mit einem Blick erfassen. Das konnte sie nicht. Sie waren im Theatercafé an der Linken Wienzeile gesessen, an den Nebentisch setzte sich ein Paar, und nach einer Minute bereits sagte Tomas, er schätze, die beiden hätten sich übers Internet verabredet, dies sei ihr erstes Treffen und es werde nichts daraus werden. Der Mann war bald gegangen, die Frau hatte geweint, Josi hatte ihr ein Taschentuch gereicht (mit der gleichen Geste, mit der sie ihren Patienten die Kleenex Schachtel reichte), die Frau hatte erzählt, und alles war genau so gewesen, wie es Tomas mit einem Blick erfasst hatte. Ein kluger, gedankenschneller, empathischer Mann. Unsentimental. Träume nur solche, die sich innerhalb eines Jahres verwirklichen ließen.
Tomas war der Feige gewesen.
Nachdem sie zwei Tage und zwei Nächte nichts von ihm gehört hatte, sperrte er abends die Tür auf, Josi stand gerade im Flur, im Begriff, das Haus zu verlassen, weil sie es nicht mehr unter dem Dach aushielt.
Tomas zog Edgar am Oberarm ins Haus und sagte: »Er ist mein Freund, er wird mit dir reden.«
Und war weg.
Edgar war weiß im Gesicht und sehr verlegen und holte zweimal, dreimal, viermal tief Luft. Hör auf, dachte sie, sonst hyperventilierst du und fällst um, bevor du mit mir reden kannst. Er setzte sich auf die Stiege, Josi stand beim Heizkörper, die Arme verschränkt.
»Ich bin sein Freund«, sagte er. »Damit ist eigentlich alles gesagt.«
Und Josi fügte aus diesen beiden Sätzen eine Geschichte. Jeder hätte das getan. Nie entstehen schneller Storys als in solchen Situationen. Man sollte ausgebrannte Drehbuchautoren gezielt solchen Situationen aussetzen. Er betrügt mich mit der Frau seines Freundes. Betrügt also doppelt. Betrügt genau genommen dreifach, denn er hat mir auch den Freund verheimlicht. Nicht, dass Tomas in der Vergangenheit Bekannte nach Hause eingeladen hätte, aber erzählt hatte er doch von ihnen. Von einem Freund hatte er nie erzählt. Er hatte nie den Eindruck erweckt, dass ihm Freundschaft etwas bedeute. Der da aber war sein Freund. Warum hatte er nie von ihm erzählt? Und dann hat er einmal einen Freund, dachte Josi, was ja etwas Wertvolles im Leben ist, und gleich zerstört er diese Beziehung wieder, indem er ihm die Frau ausspannt. Und warum bringt er ihn her? Will er ihn mit mir verkuppeln? Partnertausch übers Kreuz? Alle haben es am Ende gut? Und keiner hat ein schlechtes Gewissen?
Andere Gedanken waren ihr nicht gekommen.
»Wissen Sie denn, was ich damit meine?«, fragte Edgar, und er sah ihr direkt in die Augen.
»Ich habe so eine Idee«, sagte Josi.
»Eine Idee?«
»Ja«, sagte Josi und wusste, dass sie natürlich keine Idee hatte, dass die Geschichten, die sich in der Sekunde in ihrem Kopf zusammengefügt hatten, allesamt Unsinn waren.
»Was für eine Idee haben Sie?«, fragte Edgar.
»Sie fragen mich, und ich soll’s rauskriegen?«
»Nein, natürlich nicht. Entschuldigen Sie. Ich heiße Edgar.«
Er streckte ihr seine Hand entgegen. Sie streifte mit den Fingern an.
»Ich heiße Josefine. Aber alle sagen Josi zu mir.«
»Das klingt schön. Mit y, ie oder nur mit i?«
»Nur mit i.«
»Und immer schon Josi, nie Tschosi?«
»Immer Josi.«
»Auch als Mädchen nicht? Mädchen geben sich gern englische Namen.«
»Immer Josi.«
Weiß er das nicht? Warum weiß er das nicht? Hat ihm denn Tomas gar nichts von mir erzählt? Wäre wenig weitsichtig, wenn er beabsichtigte, das Puzzle neu zu ordnen. Und wenn sich tatsächlich am Ende ein harmonisches Bild ergäbe – ich mit dem da, Tomas mit dessen Frau, der schönen, jungen, umgänglichen, an Sport interessierten, lustigen, die im Bett besser ist als ich? Viermal sonnenbraune Haut, viermal blumenbuntes Gewand, die Vision eines gemeinsamen Urlaubs fuhr in ihr hoch wie eine bunt besprühte Mauer, der fröhlichste Teil im Berlin des Kalten Krieges. Wie werde ich in einer Stunde, in einem Tag, in zehn Tagen, in einem Jahr an diesen Augenblick denken?
Edgar sagte: »Ich würde gern Du sagen.«
»Meinetwegen«, antwortete sie.
»Josi«, sagte er, aber sie sagte nicht: Edgar.
Und endlich sprach er es aus. Langsam, weil es behutsam klingen sollte. Überdeutlich, damit weder nachgefragt noch definiert werden musste: »Tomas und ich. Tomas und ich. Wir haben eine homosexuelle Beziehung. Sie dauert seit einem Jahr.«
»Das glaube ich nicht«, sagte Josi. Und glaubte es wirklich nicht, und sah sich bestätigt durch die Festigkeit ihrer Stimme. Meine Stimme glaubt es nicht, also glaube ich es auch nicht.
»Es ist so«, sagte Edgar. Sein Blick hielt stand.
Er glaubt, was er glaubt, ich glaube, was ich glaube. Sie weinte, und weil sonst niemand da war außer Edgar und er aufstand und sie in die Arme nahm, weinte sie an seiner Schulter.
Irgendwann schlich Tomas zur Tür herein. Sagte, man solle es nicht übertreiben. Da trat sie zurück, drei Schritte, vier, bis die beiden vor den Tränenschleiern ihrer Augen zu einer Masse wurden. Rechteckig, mit unruhigen Linien.
Irgendwann schrie Tomas: »Wir sind Menschen und keine Gegenstände, du brauchst mit uns nicht so zu reden!«
Und er schrie weiter: »Das Leben ist komplizierter, als man es haben will! Leider, meine Liebe! Leider! Leider! Leider, meine Liebe!«
Da lief sie bereits über die Markward Stiege hinunter. Lief zur U 4, fuhr bis zur Pilgramgasse. Sie hatte den beiden eine Predigt gehalten, das wusste sie, aber sie erinnerte sich an kein einziges Wort.
3
Sie war aus ihrem gemeinsamen Haus in Hütteldorf geflüchtet. Ohne zu wissen wohin. Zwanzig Jahre war dort am Hang zum Lainzer Tiergarten ihr Zuhause gewesen. Erst gemietet, dann besessen. »Mit der Nase am Unerschwinglichen.« So hatten sie dazu gesagt, durchaus glücklich in ihrer gemeinsamen finanziellen Verantwortungslosigkeit. Wie eine Schlafwandlerin war sie über die Markward Stiege hinunter zur U4 gelaufen, war ohne Ticket in die U-Bahn gestiegen und bis zur Station Pilgramgasse gefahren. Sie hatte nur ihre Handtasche bei sich gehabt und die rotschwarze Filzjacke, in der sie wie ein Krampus aussah. Sie hob beim Bankomat vierhundert Euro ab. Drehte sich ratlos im Kreis. Die Fünfzigeuronoten wie ein Spielkartenblatt in der Hand. Als zahle sie öffentlich Gewinne aus. Steckte das Geld in die Tasche, atmete tief in die hohlen Hände, weil Gefahr bestand, dass sie gleich zu hyperventilieren beginnen würde. Die Narben an ihrer Brust spannten. Ihr wurde übel und für einen Moment schwarz vor den Augen.
Das Hotel Ananas lag gegenüber der U-Bahn-Station. Es gehöre der Gewerkschaft, hatte ein Kollege in der Psychiatrie einmal behauptet. Es heiße so, weil die Arbeiterführer die Streikkasse in der Karibik verjubelt hatten.
Sie nahm ein Zimmer auf unbestimmte Zeit.
Auf dem Kopfpolster lag eine Praline. Sie zupfte das Goldpapier weg, die Schokolade mit der Mandel in der Mitte hatte einen Graustich. Sie warf sie in die Toilette. Sah zu, wie sie unterging.
Sie legte sich aufs Bett, blieb eine Stunde oder zwei auf dem Rücken liegen.
Ich werde Tomas anrufen und ihm sagen, wo ich bin, dachte sie, sonst verständigt er die Polizei, weil er sich keine Schuld aufladen will, falls ich mich aufhänge, zum Beispiel mit der lindgrünen Vorhangschnur.
Sie brachte es nicht über sich, den Hörer abzunehmen. Sie wischte sich mit einem nassen Handtuch das Gesicht und die Arme ab und ging nach unten. Inzwischen stand eine Frau bei der Rezeption.
»Würden Sie eine Nummer für mich wählen?«
»Funktioniert der Apparat in Ihrem Zimmer nicht?«
Es war Josi nicht möglich, ein weiteres Wort zu sagen. Die Frau sah sie mitleidig an und schenkte ihr ein Wertkartenhandy. Ein Tourist aus China habe es liegen lassen.
Sie war in der Ananas verschollen, lehnte tagelang am Kissen, die Federdecke auf Brust, Bauch, Beinen, neben sich über die andere Hälfte des Doppelbettes die Anzeigenseiten des Kurier, des Standard, der Presse gebreitet. Telefonierte. Oder sie saß unten in der Halle am Computer. Studierte die Internetseiten des Bazar und diverser Makler. Schrieb Tomas ein Mail. Darin erklärte sie ihm, dass jedes Unglück eine Chance in sich berge, dass die Vorstellung, ein neues Leben zu beginnen, nicht weil man will, sondern weil man muss, aufregender sei, als wenn man nur will, und dass sie sich jung fühle. Diesem Unsinn ließ sie nur noch unpersönliche Abwicklungsmails folgen. Sie konnte an nichts anderes denken als an Liebe, Liebe, es war ekelhaft.
Sie verließ das Hotel selten. Wenn, dann spazierte sie zum Naschmarkt, frühstückte in einem türkischen Café Fladenbrot, Gurken, Tomaten und Milchkaffee. Kaufte Obst ein. Walnüsse fürs Hirn. Dörrpflaumen für die Verdauung. Oliven. Grüne Wasabinüsse. Schwarze Schokolade. Red Bull. Und Ananas, um wenigstens einen Witz in ihr Leben zu bringen.
An die Tapete des Hotelzimmers heftete sie mit Stecknadeln Bilder, die sie aus Zeitschriften ausschnitt, kunterbunt, was ihr gefiel: Vulkanausbrüche in der Südsee, junge Affen in den Armen ihrer Mütter, ein Mongolenkind, eine Zeichnung von Picasso, Schneesturm über North Dakota. Manchmal lud sie sich selbst zu einem Festessen ein: feinsten Käse vom Pöhl am Naschmarkt, Fiocco Salami, Serranoschinken, in Öl eingelegte Zucchini, Melanzani und Artischocken, getrocknete Tomaten und Kirschkapern, dazu Olivenbrot und eine Flasche Barolo. Sie streifte den Überzug vom zweiten Kopfkissen, breitete ihn über das Tischchen. Aß von einem Teller, den sie vom Frühstücksbuffet mitgenommen hatte, trank aus dem Zahnputzbecher und prostete der Deckenlampe zu.
Noch ein zweites persönliches Mail schrieb sie an Tomas, in der Nacht vor dem Scheidungstermin: »Ich habe mir ein Messer gekauft. Ich komm euch besuchen. Ich kastriere dich. Sollst auch etwas weggeschnitten bekommen. Ich bin dazu fähig, du kennst mich.«
Tomas holte sie vom Hotel ab. Er klopfte an die Zimmertür. Sie saß auf dem Bett, angezogen, überschminkt, noch in Strümpfen.
»Tomas«, sagte sie, »zieh mir die Stiefel an und schnür sie mir zu.«
Er ging vor ihr auf die Knie und nahm ihren linken Fuß in den Griff, wortlos.
Vielleicht hat er mein Mail gar nicht gelesen, dachte sie. Vielleicht hatte es Edgar gelesen und augenblicklich gelöscht. Wahrscheinlich hatte es Tomas doch gelesen und sich gedacht, eine solche Meldung steht ihr zu.
»Du solltest dich noch einmal im Spiegel kontrollieren«, sagte er, spuckte seinen Zahnreinigungskaugummi in den Plastiksack des hoteleigenen Papierkorbs. »Du siehst etwas grell aus. Bei diesem schlechten Licht kannst du dich auf nichts verlassen.«
»Wen sollte das stören?«, sagte sie.
Zweites Kapitel
1
Als wäre sie nach einer Naturkatastrophe umgesiedelt worden, saß sie in ihrer neuen Wohnung in der Piaristengasse im achten Bezirk. Zwischen Schachteln saß sie.
Am frühen Morgen hatte ihr der Vormieter den Wohnungsschlüssel übergeben, ein müder trauriger Mann. Die Wohnung sei bis auf einen Kamelhaarmantel leer geräumt, hatte er gesagt. Viel mehr nicht.
Die Kartons waren beschriftet. Was in der Liste oben geschrieben stand, lag auch in der Schachtel oben. Edgars Schrift, schätzte sie. Man sorgte sich um die Verlorene. Sie selbst hätte blind alles hineingestopft, wie es ihr in die Hände gekommen wäre, Pullover und Strumpfhosen zu Büchern und dem Zahnputzbecher, einen rechten Schuh zu ihrer Stresemannjacke, den linken in eine andere Schachtel zwischen CDs und Parfüm.
Sie sprach es aus, hoffte auf Trost durch antiseptisches Selbstmitleid: »Ich bin verloren und verlassen.«
Damit war alles gesagt. Der Refrain eines Schlagertextes, treffender als jeder Satz aus der Züricher Schopenhauerausgabe, deren oberer Rand aus einer der Schachteln schaute.
Sie stellte je drei Kartons aufeinander, schob sie zu einem U zusammen und spannte ein Leintuch darüber. Sie legte sich in dieses Zelt, hüllte sich in den Kamelhaarmantel. Es war April, aber kalt wie im November. Sie hatte vergessen, rechtzeitig während der Geschäftszeiten das Gaswerk anzurufen. Das Telefon war nicht angemeldet und ihr Wertkartenhandy leer. Ein Paar Wollsocken streifte sie über die Hände, weil sie ihre Handschuhe nicht fand. Ein mildes Wüstenlicht schimmerte durch das Leintuch und erinnerte sie an eine Filmszene, in der ein Archäologe seine Assistentin an sich reißt, um sie zu küssen, um sie herum objets trouvés einer untergegangenen Welt, und eine Liebessehnsucht befiel sie, so sensationell, dass sie weinte, wie sie als Kind geweint hatte, wenn es dunkel wurde und alle schon weggegangen waren.
Laut sagte sie: »Dabei hätte ich so viel zu geben!«
Sie war erschüttert. Ihre Stimme klang so klein. Und keine Spur von Ironie. Die war doch ihr Markenzeichen gewesen.
»Aber«, rief sie, als säße draußen vor dem Zelt eine Jury, »imitieren und parodieren kann ich noch, das verlernt man nicht!« Und sie sang mit der Stimme ihres Vaters: »Mamatschi, schenk mir doch ein Pferdchen, ein Pferdchen wär mein Paradies!«
Die Luft wurde knapp. Josi hob das Leintuch ein wenig in die Höhe und blickte auf die verstaubten Fenster, die ohne Vorhänge waren. Schön wäre jetzt ein Flieger am Himmel, in der Sonne oben glitzernd, einen weißen Strich hinter sich her ziehend wie Kreide über eine Tafel.
Aus einer der Schachteln nahm sie die Kissen, deren Überzüge sie vor Jahren in Istanbul in einem Supermarkt gekauft hatte. Zwanzig Stück. Jedes aus schimmernder Seide, rot, safrangelb, gold, lila und nachtblau, mit Goldfäden bestickt und an den Rändern mit glitzernden Metallscheibchen versehen, jedes Kissen nicht größer als ein Band vom Großen Brockhaus. Auf den beiden Sofas im Wohnzimmer in ihrem Haus in Hütteldorf waren sie zum bewunderten exotischen Schmuck geworden. Nun sollten sie die Innenwelt ihres Zeltes umrahmen. Eines schob sie sich unter die Hüfte, eines unter die Schulter, ein drittes zwischen ihre Schläfe und die Züricher Schopenhauer Ausgabe. Sie hatte in einem Geo-Heft, das im Warteraum des Pavillon 24 auslag, einen Artikel über einen afrikanischen Stamm gelesen, darin wurde berichtet, dass die Männer in der Nacht auf dem gebürsteten Boden schlafen, statt eines Kopfkissens eine Kopfstütze aus Holz. Ihre Möbel würden erst in ein paar Tagen geliefert werden. Edgar hatte sie im Ananas angerufen und angefleht, sie solle noch so lange im Hotel bleiben, bis die Umzugsfirma die Sachen in die Wohnung gebracht hätte. Seine weinerliche Stimme hatte sie gerührt – gegen ihren empörten Willen.
Sie roch am Ärmel des Mantels, bemerkte einen Fleck. Sie spuckte darauf. Rieb daran. Roch daran. Jod? Fernet? Um den Fleck herauszuschneiden, hätte sie nach der Nagelschere in ihrer Handtasche suchen müssen, dabei wären ihr allerdings die Socken an den Händen im Weg gewesen. Auf dem Etikett des Mantels stand: 100 % Kamelhaar. Sie griff in seine Tasche und fischte einen Zwanzig-Schilling-Schein heraus. Und einen Zettel fand sie.
Sie schlüpfte unter dem Leintuch durch nach draußen. Sie schaltete das Licht an. Weit oben hing eine Hunderter Birne.
Auf dem Zettel stand: »Mein süßes Lieb, besorge mir in der Apotheke: Ulcogant.«
Wie lange schon gab es den Schilling nicht mehr? Hatte das die Frau des Vormieters geschrieben? Die Schrift sprach von so weit her, dass es ihr schwer fiel, sich die Hand warm und durchblutet vorzustellen. Dieses überaus glückliche Leben, als es noch den Schilling gab! Die Sonne schien, man ging zur Alten Donau, schwamm nicht, kaufte sich ein Eis, zahlte mit Schilling, dachte an den Tod als den Tod der anderen. Oder als sie mit Tomas in Istanbul war. Das süße schlechte Gewissen, weil sie die Kinder bei Bekannten abgestellt hatten. Ein gemeinsamer Freund aus Studientagen sei verstorben, sie müssten zur Beerdigung und anschließend ein paar Tage bei seiner Frau bleiben. So einen Freund gab es nicht. Als sie im Mittelgang des Flugzeugs dicht hintereinander standen, um zu ihren Plätzen zu gelangen, Josi vor Tomas, hatte sie nach hinten gegriffen und ihre Hände auf seine Schenkel gelegt. Er hatte sich zu ihr niedergebeugt. Einmal hatte sie Tomas im Bett den Rücken zerkratzt. Um zu testen, ob es ihr dann schneller kommt. Und ob es ihm schneller kommt und vielleicht heftiger. Sie erinnerte sich nicht mehr an das Ergebnis.
Josi knipste alle Schalter an, die sie fand. Das Licht tat ihr gut. Es war nicht so erbarmungslos, wie sie befürchtet hatte. Sie betrat die Küche, öffnete die Kästen, zog die Schubladen heraus. Der Vormieter hatte seine Teesammlung vergessen. Zwei Regale waren voll mit Dosen und Tüten, Earl Grey, Darjeeling, grüner, roter, schwarzer, gelber Tee, mit Mango aromatisiert und mit Vanille, mit Mandarine, Veilchen, Ingwer, Jasmin. Josi öffnete das Backrohr und zog ein Backblech heraus, schüttete Tee darauf und zündete ihn mit dem Gasanzünder an. Die trockenen Blätter glühten und rauchten und dufteten. Sie stellte das Blech auf den Herd und sah zu.
Sie richtete ihre Augen nach oben und sagte zur Deckenlampe: »Das Glück, meine Liebe, wenn es überhaupt kommt, kommt nur einmal oder zweimal …«
Irgendwann hatte sie Tomas erzählt, dass sie als Kind von einem Zornteufel besessen war. Dass sie sich vor Zorn das Gesicht zerkratzt hatte. Das war an einem Muttertag gewesen. Tomas hatte gefragt, was er tun müsse, um sie einmal so zu erleben. Sie habe, hatte sie ihm erzählt und war stolz gewesen, das Tischtuch unter dem gedeckten Tisch weggezogen. Wir holen einen Teufelsaustreiber, habe ihr Vater ausgerufen. »Warum nicht bei mir! Warum nicht einmal bei mir!«, hatte Tomas gefleht, und als er bei anderer Gelegenheit mit Josis Vater am Telefon sprach, den alten Mann tatsächlich gefragt. »He, stimmt das? Dass sie so durchdrehen kann, deine Kleine? Darum studiert sie Psychologie? Siehst du, wär ich nie draufgekommen. Und was muss man tun, damit sie so durchdreht? Ich will’s aber wissen. Ich bin ihr Mann, ich habe ein Anrecht darauf.« Dieses Telefonat hatte Josi ihrem Mann lange nicht verziehen. Es wäre ein Anlass für einen Wutausbruch gewesen. Aber so einen kann man ja nicht wollen. Er kommt oder er kommt nicht.
Er war auch nicht gekommen, nachdem das Unglück zweimal zugeschlagen hatte.
Sie trug das rauchende Backblech durch die Wohnung, von dem Zimmer, das ihr Schlafzimmer werden sollte, in das Zimmer, in dem ihr Zelt stand (das sie das »Zimmer ohne Namen« nennen wollte), durch den Flur mit dem charmanten Knick, der in Wahrheit der Grund gewesen war, warum sie sich für diese Wohnung entschieden hatte. (Ein weiterer Grund war der Boden in der Küche, der aus großen, glänzenden schwarzen und weißen Kacheln bestand, die wie ein Schachbrett angeordnet waren.) Zuletzt legte sie das Blech in die Badewanne und spülte die Asche mit kaltem Wasser in den Gulli. Es gab keine Möglichkeit, Wasser heiß zu machen. Für eine Wärmeflasche zum Beispiel.
Dann lag sie wieder in ihrem Zelt, den Zettel mit dem süßen Lieb zusammengeknüllt in ihrer Hand und kämpfte gegen die volle Blase, bis sie durch das geschlossene Fenster vom Hof herauf das Kübelschlagen der Müllabfuhr hörte und den Kotzgeruch der leeren Red-Bull-Dose roch, die umgekippt war und mit ihrer Öffnung knapp auf ihre Nase zielte.
2
Über die Josefstädterstraße spazierte sie in Richtung Innenstadt. Sie dachte nicht darüber nach, dass diese Gegend von nun an ihr Revier war. Unerwartet stand das Café Eiles vor ihr, leicht angeschlagen wie das Schild, auf dem der berühmte Milchrahmstrudel mit Bild und Euro 4,60 angepriesen wurde. Hier war sie während ihrer Zeit als Turnusärztin öfter gewesen; wenn sie einen halben Tag frei gehabt hatte und durch die Stadt flaniert war oder sich einen alten Film im Bellaria Kino hinter dem Volkstheater angesehen hatte. Sie war glücklich gewesen. (Ein Mann geht durch die Wand mit Heinz Rühmann, Fahrraddiebe von Vittorio de Sica oder Das doppelte Lottchen mit Erich Kästner als Erzählstimme – wenn sich die beiden im Schankgarten als Geschwister erkannten, musste sie weinen.)
Sie sah ihr Spiegelbild in der Fensterscheibe. In dem zart gestreiften Anzug eher ein Mann als eine Frau. Entweder eine Frau nach fünfzig oder ein Mann vor fünfzig. Mund rot, Augen und Brauen schwarz. Gesicht weiß. Ein wenig mehr Schminke, und man hätte es ein Clownsgesicht nennen dürfen. Giulietta Masina in Fellinis La Strada. Sie zupfte sich die Haare in die Höhe und zur Seite. Schnitt Grimassen.
Oder Laurie Anderson in den achtziger und neunziger Jahren des vergangenen Jahrhunderts. Wie sah Laurie Anderson heute aus? O Superman war die eleganteste Nummer, die es je in die Charts geschafft hatte. Solche Reduziertheit im Stil hatte Josi immer angestrebt, ohne sich allerdings im Klaren zu sein, zu welchem Ziel. Eine Künstlerin hatte sie nie werden wollen. Aber vielleicht eine Frau, die in den Kaffeehäusern auftaucht, sich umblickt und alle verstummen lässt. Nach der eines Tages ein Anzug benannt wird wie der Stresemann nach Gustav Stresemann. »Sie betrat das Café, knöpfte die Jacke ihres Bartok auf …« Oder so ähnlich.
Könnte ein Leben als Spaßmacher ein Ausweg sein? Bot der Clown eine Lebensform, in der ihre Unglücke nicht nur Platz hätten, sondern sogar attraktiv wären? Wer sich sein Leben als Film oder Song vorstellen kann, der ist noch nicht verloren. Den Anzug hatte sie sich vor einem Jahr machen lassen. Bei einem Schneider namens Brunelli in den Tuchlauben im Ersten Bezirk. Er hatte sie lange angesehen, leberbraune Haut um die Augen, war schließlich nach nebenan gegangen und mit einem Ballen zurückgekehrt. »Nehmen Sie diesen Stoff«, hatte er gesagt, »das gibt einen klassischen Stresemann, er macht sie ein bisschen glücklich, das können Sie brauchen.« Sie hatte damals nicht gewusst, dass er Recht hatte. Jetzt wusste sie es.
Aber warum hatte sie sich überhaupt einen Anzug machen lassen, einen Herrenanzug? Niemals zuvor war sie bei einem Schneider gewesen. Eines Morgens hatte sie an sich hinuntergeblickt und gedacht: Das bist du nicht, das bist du nicht mehr, in deinen Röcken und Jeans siehst du verkleidet aus. Eine Idee hatte sich in ihrem Kopf festgesetzt: Ich will mich kleiden wie ein eleganter Herr. Aber warum? Warum dieser Gedanke und bereits vor einem Jahr? Sie hatte den Stresemann nur einmal bisher getragen: gleich, nachdem sie ihn abgeholt hatte, für eine knappe Stunde, zum Einkaufen im Supermarkt. Tomas hatte ihn nie gesehen. Damals war die Hose sehr knapp gewesen. Jetzt warf der Bund Falten, sie hatte zwei neue Löcher in den Gürtel bohren müssen.