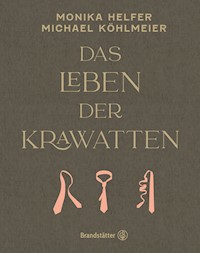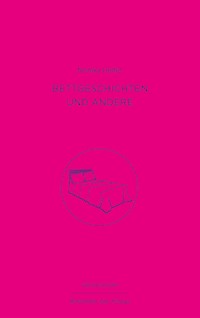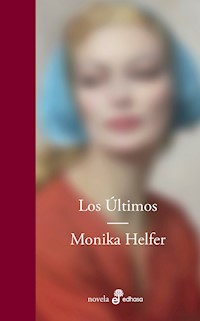Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Haymon Verlag
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Die Kinderdorf-Mutter, die ihre vier Schützlinge Mama nennen; der Junge aus dem Flüchtlingslager in Damaskus, dem die Jeansjacke aus dem Rot-Kreuz-Sack ein Zuhause wird; die kleine Kamira, die im Jeep auf Lampedusa neben dem Heiligen Vater sitzen darf; der Lastwagenfahrer, der unversehens in eine Familie gerät und Schluss macht mit dem Alleinsein; oder das Mädchen Fila, das dem sterbenden Herrn Montebello die Hand halten soll - sie alle bieten den Widrigkeiten des Lebens mutig die Stirn und zeigen, wie man daran wachsen kann. Fein und präzise webt Monika Helfer ihre berührenden Geschichten, die von sensiblen Zeichnungen von Lorenz Helfer begleitet werden. Mit viel Gespür für die leisen Töne des Zwischenmenschlichen erzählt die Autorin vom ersten Glück und dem letzten Atemzug, von fremden Müttern und neuen Leben, von ungebrochener Hoffnung und der rettenden Kraft der Zuwendung.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 87
Veröffentlichungsjahr: 2014
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Monika Helfer
Diesmal geht es
gut aus
Geschichten
Mit Zeichnungen von Lorenz Helfer
Sie kauen Kiesel,
sie liegen auf dem Bauche
vor kleinen runden Sachen;
sie beten Alles an, was nicht umfällt.
Friedrich Nietzsche
Glück
Wie klingt dieses Wort? Könnte so eine Waschmaschine heißen? Ein Hund? Glück ist, was wir wollen, und wenn man uns fragt, ob wir schon einmal glücklich waren, nicken wir zuerst, dann aber können wir uns nicht entscheiden, von welcher Glückssituation wir erzählen sollen.
»Also Glück«, sagt Andrea, sie ist nicht mehr jung, »Glück«, dann lacht sie und zeigt ihre schiefen Zähne. Sie hat Strahlen von Lachfalten in den Augenwinkeln. »Mein erstes Glück«, sagt sie, »hatte ich mit achtzehn. Es gab dann nämlich weitere Glücks, jedes für sich anders, dann, wenn ich mich geliebt fühlte, das war zwei Mal. Selber war ich nur unglücklich in Männer verliebt, die ich nicht haben konnte, weil sie verheiratet waren oder mich nicht beachteten. Zwei Mal also fühlte ich mich geborgen bei einem Mann, einer davon hat mich geheiratet. Ich bin zufrieden, weil er mich liebt. Er hat ein Nachsehen mit mir, wenn mir Speisen nicht gelingen, sagt dann sogar, dass sie ihm schmecken, ist eben ein guter Mensch. Ich bin mit achtzehn von der Kinderdorffamilie weggezogen, war bereits als Baby dorthingebracht worden, weil meine Eltern mich nicht wollten. Zum Glück habe ich daran keine Erinnerung. Im Kinderdorf bin ich mit vier Geschwistern aufgewachsen. Wir waren gemeinsam mit der fremden Mutter eine Familie. Ich sehe sie nur arbeitend, am Herd, im Garten, an der Nähmaschine. Sie war nicht gerecht und liebte ein Mädchen besonders, das leider nicht ich war. Aber es war o.k. Mit meinen zwei fremden Brüdern verstehe ich mich heute noch gut. Sie hatten lange Zeit keine Frauen, weil sie traumatisiert waren. So sagten sie dazu, wenn ich sie deswegen hänselte. Sie brachten mir ihre Wäsche zum Waschen. Sie trainierten mit Gewichten und schwitzten viel. Meiner fremden Mutter kaufe ich zu Weihnachten Orchideen, immer noch, sie ist heute eine alte Frau, geht so sorgsam damit um und hat inzwischen über dreißig Pflanzen. Wenn Besuch kommt, sagt sie, dass die Orchideen ein Geschenk von der dankbaren Andrea sind.
Mein erstes Glück«, sagt Andrea, »wahrscheinlich das reinste Glück, war der erste Waschgang meiner ersten Waschmaschine, von meinem Eigentum. Sie war gefüllt mit meiner weißen Unterwäsche. Ich hatte mich auf meinem Schlafkissen davorgesetzt und das Drehen, Spülen, Schleudern, Endschleudern betrachtet. Ich war so stolz. Als der Waschgang fertig war, habe ich die weißen Stücke genommen und sie auf die Wäscheleine in meiner Küche gehängt.
Später wusch ich die verschwitzten Sachen meiner fremden Brüder, ich tat das mit Freude. Wir saßen in der Küche, redeten von früher und rauchten. Es war total gemütlich.«
Die Kinder von Cighid
Cighid heißt ein Dorf in Rumänien und dort stand ein Waisenhaus. Ich habe darüber eine Dokumentation gesehen, die mich erschüttert hat. Die Waisenkinder sind inzwischen erwachsen und werden gut betreut. Sie können nicht lesen, nicht schreiben, wissen erst jetzt, was Musik ist; dass Musik dazu da ist, um sie zu hören, um sich zu ihr zu drehen, sich zu drehen und mitzusingen.
Die jungen Männer und Frauen schauen in die Kamera; einige können sich schwer artikulieren, andere bringen einen Satz nicht ohne Weinen zu Ende. Über die Stimmen sieht man Bilder ihrer Kindheit eingeblendet. Da sitzen Kinder in einem dunklen Raum auf einer bloßen Matratze, halb verhungert, zwanzig Kinder, eng aneinandergedrängt, wie Schweine bei einem verantwortungslosen Bauern. Die Kinder, die sich am Körper und auf dem Kopf kratzen, sind nackt. Sie sind halb erfroren. Es ist kalt in diesem Raum. Eine Frau kommt und teilt Essen aus, dunkle Patzen, wie Erde, direkt in die offenen Kinderhände. Die Kinder schlecken und schaben mit ihren Milchzähnen daran. Die Matratze ist feucht von Urin. Man sieht den abscheulichen Geruch.
Die Frauen und Männer wissen nicht, wie alt sie sind. Keiner hat es aufgeschrieben. Irgendwann waren sie im Heim abgegeben worden. Fragt man ehemalige Pfleger, so können sie sich an nichts erinnern, lediglich daran, dass die Kinder nur zu zweit gewesen waren oder zu dritt, dass sie selbst keine Zeit hatten für die Betreuung, kein Geld, und außerdem seien die Kinder ja nicht bei Trost gewesen. »Bei Trost« soll heißen, dass sie nicht funktionierten, wie man es von Kindern gewohnt ist. Verhaltensgestört. Nicht sprechen, nicht weinen, nicht singen. Woher weiß man, ob sich die Kinder bei normaler Pflege nicht normal entwickelt hätten? Wer hat sie denn untersucht? Wer hat die Gutachten erstellt? Nur weil sie Grimassen schneiden, darf man sie doch nicht einfach zuordnen: »Ihr da, auf die schlechte Seite!«
Eine Frau mit kurzen schwarzen Haaren und lebhaftem Ausdruck wünscht sich ein Kind. »Ich wünsche mir ein Kind«, sagt sie stockend in die Kamera, »und ich will, dass meine Mutter sieht, dass ich ein Kind habe, und ich will, dass sie sieht, wie ich das Kind küsse, weil ich es liebe.« Sie will auch einen Mann, sagt sie und lächelt einen Schüchternen an, der mit den Schultern zuckt. Sie geht zu ihm hin und drückt sich an ihn. »Der soll mein Mann sein«, sagt sie in die Kamera. Aber mit dem Kind sei es schwierig. »So oft schon probiert«, sagt sie, »ich weiß, wie es geht, aber es ging nicht, so oft schon probiert, auch schon mit einem anderen Mann.« Kann sie denn kein Kind haben, weil sie so lange gequält worden ist? Weil alles in ihr eine Wunde ist?
Man wird sich um sie kümmern. Wer ist »man«? Die vielen gepflegten Herzen, die es nicht mitansehen können, wenn Unrecht geschieht? Ein »man« würde genügen, eines, das kompetent ist. Das sich intensiv um diese Frau bemüht, sie medizinisch versorgt, bis sie ganz gelassen sein kann.
»Es geht ihnen jetzt allen gut«, sagt der Heimleiter, der von dem Haus mit den sauberen Zimmern und den sauberen Betten und der sauberen Bettwäsche.
Wenn es möglich ist, dass auf schlechtem Grund ein gutes Haus steht.
Könnte Anton sein
Mein Enkel Anton ist vier Jahre alt und sieht aus wie das Roma-Kind auf dem Titelblatt der Schweizer Zeitung Weltwoche. Gleich breite Stirn, Haare wie ein Fell, kohlschwarze Augen.
Anton besitzt eine Spielzeugpistole. Seine Mama wollte natürlich nicht, dass er eine besitzt, aber dann hat ihm ein Onkel eben so ein Ding mitgebracht, und als ich auf Besuch komme, an der Tür meiner Tochter läute, springt Anton heraus und zielt mit seiner Spielzeugpistole auf mich. Gerade wie der Roma-Bub auf dem Cover der Zeitung.
Meine Tochter sagt: »Er will, was alle wollen, die Pistole hat er aber nicht von mir.«
Untertitelt ist der Artikel in der Weltwoche mit »Die Roma kommen: Raubzüge in die Schweiz«.
Was geht in einem Journalisten vor, der sich so ein Bild aussucht? Hat er keine Kinder?
Im Standard habe ich gelesen, dass der Bub kein Schweizer Roma-Kind ist. Der italienische Fotograf Livio Mancini hat ihn auf einer Müllhalde am Rand der kosovarischen Stadt Gjakova fotografiert. Der Bub zielt wie Anton mit der Pistole. Wer weiß, ob der Kleine überhaupt noch lebt, wenn man bedenkt, unter welchen Umständen die Roma-Kinder existieren. Ihre Eltern sind arbeitslos, bekommen keine Sozialhilfe und ernähren sich von Luft. Die Roma werden fünfunddreißig Jahre alt, wenige mehr.
Roma-Banden, so heißt es, missbrauchen ihre Kinder für kriminelle Zwecke. Nämlich um Geld zu verdienen. So wie die Kinder bei uns im Werbefernsehen? Zum Beispiel, wenn für Marmelade mit halbnackten Lolitas geworben wird? Ist doch fantasievoll, oder?
Nur ein Schnappschuss, dieses Bild von dem Roma-Buben. Wegen Verhetzung wurde die Weltwoche geklagt.
Ich frage Sie: Was würden Sie tun, wären Sie arbeitslos, ohne finanzielle staatliche Zuwendungen? Kämen Sie auf die Idee, ihre Hand aufzuhalten?
»Niemals«, höre ich, »niemals, wir haben unseren Stolz!«
Sie würden sagen: »Sie sind so frech, diese Zigeuner, kennen kein Pardon, verfolgen einen, wenn man als harmloser Urlauber einfach nur die Sehenswürdigkeiten anschauen will.«
»Mir«, sagt einer, »ist Folgendes passiert: Zwei Roma-Mädchen ziehen ihre Pullover über den Kopf und zeigen ihre blanken Brüste her. Gleichzeitig rufen sie um Hilfe: Vergewaltiger, Vergewaltiger!«
Das Bild des Roma-Buben liegt auf meinem Schreibtisch. Ich überlege, ob ich es in mein Tatsachen-Buch einkleben soll, ich müsste es zusammenschneiden, das will ich aber nicht. Ich lasse es neben meinem Computer liegen.
Anton zielt mit der Pistole auf mich und sagt: »Hände hoch oder ich schieße.«
Aber es ist ja nur seine Spielzeugpistole.
Mama, Mama
Zwei Männer um die fünfzig treffen einander auf dem Markt. Sie haben ein Thema – Mama, der eine, Mama, der andere.
»Ja«, sagt der eine, »seit sie gestorben ist, geht alles schief.«
»Du sagst es«, sagt der andere, »alles geht den Bach hinunter. Sie war sechsundneunzig, als ich sie auf dem Küchenboden gefunden habe. Ich habe gezittert, konnte kaum telefonieren. Sie war noch nicht ganz tot. Sofort ins Krankenhaus, da sagten sie, man kann nichts mehr machen, und haben sie wieder nach Hause gefahren.«
»Weil es sich nicht mehr rentiert«, sagt der eine. »Meine war vierundneunzig, und wenn sie hundert geworden wäre, hätte ich mich nicht weniger gegrämt. Sie lag im Bett und sagte, ihre Schwester rufe nach ihr, und ich sage noch, die kann dich gar nicht rufen, die ist vor zwanzig Jahren gestorben. Eben, antwortet sie, von oben ruft sie nach mir, und bald wird es aus sein. Ich hab sie noch aus dem Bett gehoben, hab versucht, mit ihr ans Fenster zu gehen, damit sie den Boskop-Apfelbaum sehen kann mit seinen braunen Äpfeln, die hat sie so gern gehabt. Wir haben es aber nicht bis zum Fenster geschafft. Sie ist bald darauf eingeschlafen, und alles habe ich machen müssen, niemand hat sich zuständig gefühlt, meine Schwester nicht, niemand.«
»Wie bei mir«, sagte der andere, »alles selber, das ganze Leid, und dann, als sie gestorben war, hatte ich eine himmeltraurige Angst, ins Schlafzimmer zu gehen, weil da drinnen war ja der Tod.«
»Ja, da war der Tod, und glaube mir, es war friedlich im Schlafzimmer, als ob die Schwester sie einfach fortgeführt hätte, durch die Decke hinauf. Die Verstorbenen müssen ja keine Löcher schlagen, die kommen überall durch.«
»Und jetzt«, sagte der andere, »bei jedem abgerissenen Knopf fehlt sie mir, bei jedem Fleck, ich finde die Gallseife nicht, das nämlich hat sie mir beigebracht, Gallseife auf den Fleck, über Nacht einwirken lassen und weg ist der Fleck.«
»Und ich, ich will mir nicht einmal mehr die Haare waschen, seit sie tot ist, weil sie mir mit ihren knochigen Fingern ja nicht mehr durchfahren wird. Was für ein Elend!«
»Betest du?«, fragte der andere.