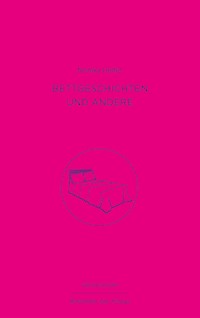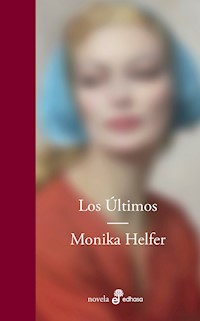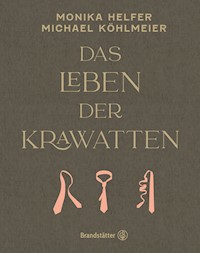
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Brandstätter Verlag
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
War die Krawatte früher nicht aus der täglichen Garderobe wegzudenken, fristet sie heute häufig ein vereinsamtes Dasein in Schränken und wird nur noch zu Hochzeiten oder Begräbnissen hervorgeholt. Und dennoch ist eine jede Krawatte ein Zeuge: der Persönlichkeit seines Trägers oder seiner Trägerin, der Zeit, der sie entstammt, von Erlebtem und Erlittenem. Die Bestsellerautor*innen Monika Helfer und Michael Köhlmeier, beides meisterhafte Erzähler, lassen sich von den Krawatten aus der einmaligen Sammlung von Gerald Matt inspirieren und erzählen deren Geschichten – so elegant, vielfältig und skurril wie dieses i-Tüpfelchen der Bekleidung selbst. Mit einem Nachwort von Gerald Matt zur Kulturgeschichte der Krawatte.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 164
Veröffentlichungsjahr: 2022
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Das Leben der Krawatten
vonMonika HelferundMichael Köhlmeier
Inhalt
Die Geschichte von Hank Hammer
Der Mann mit der Narbe
Die Geschichte von Joseph Weiss, alias Joe White
Marlen Salomon (Name geändert), 42, Beamtin in einer Behõrde in Bregenz, erzählt
Susanne S. – Auf den Anrufbeantworter von Ursula M. gesprochen:
Die Geschichte der 27
Die Geschichte von Karl S., genannt „der Schlips“
Jõrg Fausers Hawaiihemd
Die gelbe mit den braunen und roten Querstreifen
Der Bär aus Tschita
Die Geschichte der Helena Krantz
Der kleine General
Der Traum der Analytikerin
Warten Sie!
Ein großes F
Aller Augen warten auf dich
Der Wolf
Petites choses
Die Fieberblase
Nachwort von Gerald Matt
Literatur und Quellen
Die Autor*innen
1
Die Geschichte von Hank Hammer
Am 12. Mai 1932 veröffentlichte die New Yorker Lokalzeitung Staten Island Advance einen Artikel, der bereits am nächsten Tag in der Herald Tribune, eine Woche später in der Cleveland Penny Press, im Chicago Examiner und im Boston American wörtlich und in voller Länge abgedruckt wurde. Der Verfasser war Samuel Irving Newhouse, der Eigentümer und Herausgeber jener Zeitung. Das war ungewöhnlich. Zwei Jahre zuvor war es das letzte und bis dahin einzige Mal geschehen, nämlich als Calvin Coolidge von Herbert Hoover als Präsident der Vereinigten Staaten von Amerika abgelöst worden war und gewisse Kreise befürchteten, nun werde der Staat eine massive Schuldenpolitik betreiben und die Steuern erhöhen. S. I. Newhouse sah nach eigenen Angaben das „Phänomen Zeitung“– er besaß ein gutes Dutzend – ausschließlich unter einem Aspekt, nämlich um damit Geld zu verdienen. Was in seinen Zeitungen stand, interessierte ihn wenig, solange die Auflagen stimmten. Das brachte ihm den Ruf ein, ein toleranter und liberaler Mann zu sein. Nur wenn ihn etwas über alle Maßen empörte oder wenn er in irgendeiner Sache eine Meinung vertrat, die krass von der Linie des Blattes abwich, setzte er sich an die Schreibmaschine. Mit seinem wirklichen Namen allerdings unterschieb er nicht, er dachte sich sprechende Pseudonyme aus. Den Artikel über Herbert Hoover hatte er mit Franklin Geldzahler unterzeichnet; unter seinen zweiten Artikel setzte er den Namen „Hank Hammer“. Die Überschrift lautete: A strong plea for the death penalty – „Ein kräftiges Plädoyer für die Todesstrafe“. Darin forderte er, dass allein die Zugehörigkeit zu einer kriminellen Vereinigung mit dem elektrischen Stuhl bestraft werden solle, und zwar auch dann, wenn der Betreffende noch keine gesetzeswidrige Tat begangen habe.
S. I. Newhouse war in der Redaktion und unter seinen Freunden berüchtigt für seine – gelinge gesagt – merkwürdigen Vergleiche. In dem Artikel schrieb er:
„Es gibt Hemden, bei denen hat sich der Schneider gedacht, sie werden mit Krawatten getragen, und es gibt Hemden, die ohne Krawatten getragen werden. Allerdings macht sich der Schneider nicht die Mühe, einen entsprechenden Hinweis auf den Rücken des Hemdes zu sticken. Er vertraut darauf, dass der Käufer das selber weiß und erkennt. Ebenso geht die Natur vor. Sie erschafft manche Menschen als Verbrecher und vertraut darauf, dass die anderen sie als solche erkennen und sie ausmerzen. Sie tätowiert einem Al Capone nicht auf den Wanst: Warning, I‘m a bastard! Und schreibt auch nicht auf den Rücken irgendeines kleinen Jimmy: Achtung, aus mir wird irgendwann ein Dreckschwein! Nein, diesen Job müssen wir schon selbst erledigen. Darum sage ich: Wer Mitglied in der Cosa Nostra oder in der Murder, Inc. ist, der gibt bekannt, dass er ein Dreckschwein ist oder früher oder später ein Dreckschwein sein wird. Also – weg mit ihm!“
Einen Monat später, am 14. Juni, wurde vor dem Polizei-Hauptquartier in Little Italy in einem abgestellten Packard die Leiche eines Mannes gefunden. Aus den Papieren, die er bei sich trug, ging hervor, dass er Hank Hammer hieß. Recherchen ergaben, dass er in Brooklyn gemeldet war und als Elektriker in der City Hall gearbeitet hatte. Bei der Obduktion fand man in seiner Luftröhre eine Krawatte, sie war ihm in den Hals gestopft worden. An ihr klebte ein Zettel, darauf stand: I‘m a bastard.
Hiram „Hank“ Hammer hatte mit der Sache nichts zu tun, absolut nichts. Sein Name war der „richtige“ falsche – oder „falsche“ richtige. Der Anschlag hatte Samuel Irving Newhouse gegolten.
Newhouse schickte einen Reporter mit einem Blumenstrauß zu der Witwe. Er solle sie behandeln wie die Gattin eines Helden. Die Beerdigungskosten übernehme der Staten Island Advance. Sie dürfe sich zudem ein Küchengerät aussuchen, Vorschlag: einen der neuen mannshohen Kühlschränke. Mrs. Hammer erzählte in dem Interview, wie sie und ihr Mann sich kennengelernt hatten.
„Mein erster Mann und ich, lange waren wir nicht zusammen. Lassen Sie mich nachrechnen – sechs Jahre. Im Guten und im Schlechten. Ich hatte bereits drei Kinder und dachte mir, ich finde keinen mehr, nachdem er mich verlassen hatte. Mein Sohn, der Eliezer, damals war er fünf Jahre alt, der rannte irgendwann seinem Ball hinterher, über die Straße rannte er und wäre beinahe von einem Auto überrollt worden. Der Fahrer konnte zum Glück noch bremsen. Er brachte mir das Kind ins Haus. Er stellte sich mir vor:
‚Ich heiße Hiram Hammer, aber alle sagen Hank zu mir, jedenfalls alle meine Freunde.‘
‚Das klingt sehr gut‘, sagte ich.
‚Wollen Sie die Bremsspur sehen?‘, fragte er.
Hank blieb bis zum Abend, wir tranken Limonade, er wollte keinen Alkohol. Er hat nie Alkohol getrunken. Er beugte sich zu meinen Zwillingsmädchen und machte eine Grimasse. Da weinten sie, obwohl er es gut gemeint hatte. Er war ein Guter. Ein Jahr später wurde er mein zweiter Mann und ein guter Vater für meine Kinder.
Jetzt, da er tot ist, weiß ich nicht, ob ich noch einen dritten finden will.“
Das Interview und ein Bild des Ehepaars Rosie und Hiram Hammer wurden auf der Titelseite der Sonntagsausgabe von Staten Island Advance abgedruckt.
Bei der Beerdigung trug Eliezer Hammer, der Stiefsohn von Hank Hammer, 14 Jahre alt, die gleiche Krawatte wie die, mit der sein Stiefvater ermordet worden war. Mit Tusche hatte er quer darübergeschrieben: I‘m a bastard too.
Bei der Konferenz von Teheran vom 28. November bis zum 1. Dezember 1943 trafen sich zum ersten Mal Josef Stalin, der US-Präsident Franklin D. Roosevelt und Winston Churchill. Im Unterschied zu Stalin und Churchill, die zum Fototermin in Uniform erschienen, trug Roosevelt einen dunkelblauen Anzug und eine Krawatte – die von manchen Journalisten dem Anlass entsprechend als zu fröhlich kritisiert wurde, so von Amy Campbell vom britischen Evening Standard: „A gallows rope would be better.“
Marta Becket betreibt in Death Valley Junction ein kleines Opernhaus, 15 Menschen passen in den Raum, 20 Einwohner zählt die Siedlung in der Mojave-Wüste an der Kreuzung der California State Route 190 und der California State Route 127 nahe des Death-Valley-Nationalparks. Mrs. Becket war als Kind von einer Gruppe junger Shoshonen gerettet worden, als sie ein Rudel ausgehungerter Koyoten umzingelte. Die Buben erschossen ein halbes Dutzend der Tiere mit ihren Pfeilen. Als Dank ließ Marta Becket später diese Krawatte sticken. Pfeil, Bogen und Zielscheibe sollten an ihre Rettung erinnern. Die Krawatte verkauft sie neben anderen Accessoires im Foyer ihrer Oper. Den Erlös verteilt sie unter den Shoshonenkindern.
2
Der Mann mit der Narbe
Ich schleppte die Tasche zum Busbahnhof, ließ mich auf die Bank fallen und atmete aus. Ein Mann setzte sich neben mich, Hut tief in die Stirn gezogen, ein großer, steifer Hut. Er sah aus wie Udo Lindenberg. Ein bisschen Wildwest-Eleganz. Eine Jacke trug er, dunkelblau, die äußeren Brusttaschen geschlitzt mit gestickten Dreiecken an den Enden, golden. Cowboystiefel, zweifarbig, Schlangenleder. Und eine Krawatte – die würde ich, wenn sie mir gehörte, in einem Bilderrahmen an die Wand hängen und behaupten, Andy Warhol habe dieses Objekt gestaltet. Wer sollte mir das Gegenteil beweisen? Ich würde Warhols Signatur fälschen. Das konnte ich schon in der Schule gut, Schriften fälschen, nie ist mir jemand draufgekommen, jede Entschuldigung habe ich gefälscht, mein Vater sagte, unterschreib du, ich bin zu faul. Gilt es bereits als Fälschung, also als kriminell, wenn man in der eigenen Wohnung an die eigene Wand ein Bild hängt und darunter mit der eigenen Hand und dem eigenen Bleistift einen fremden Namen setzt?
„Pardon“, sagte der Mann, „stört es Sie, wenn ich Sie anspreche?“
„Bitte“, antwortete ich, „dann wird uns die kleine Reise kurzweiliger.“
Er stützte sich auf einen Stock, die Stufen in den Bus machten ihm Mühe. Der Stock hatte einen Knauf aus Silber, der stellte einen Adlerkopf dar.
„Wie Sie sehen“, sagte der Mann, „bin ich ein Krüppel.“
„Man ist doch kein Krüppel“, sagte ich und zog meine Stiefel aus, „nur weil man einen Stock benützt, da wäre die Welt ja voller Krüppel.“
„Ist sie doch auch“, sagte er. „Sie sehen meiner ehemaligen Lebensgefährtin ähnlich“, sprach er weiter, „dieselbe Lebhaftigkeit! Gut, dass die Reise so kurz ist, sonst bestünde Gefahr, dass ich mich in Sie verliebe.“
„Ehemalige?“, fragte ich.
Darauf ging er nicht ein. Seine Stimme sei sein Beruf, er sei Synchronsprecher.
„Synchronsprecher!“, rief ich aus. „Und welchem Schauspieler haben Sie Ihre Stimme gegeben?“
„Sylvester Stallone. Aber wenn ich ehrlich bin … die Wahrheit ist ein bisschen kleiner. Es gibt eine Stelle, da schreit Rambo auf. Und da war der eigentliche Synchronsprecher nicht im Studio, Thomas Danneberg musste an diesem Nachmittag zur Zahnreinigung. Und ich war zufällig da. Da habe eben ich geschrien … Ein Schrei ist ein Schrei … Mein gegenwärtiges Problem lautet allerdings anders: Ich vergesse viel. Mehr als den Schrei hätte ich mir nicht gemerkt. Ich wurde am Odeonsplatz in München von einem Raser überfahren, ein Jahr lag ich im Koma. Gleich werden Sie mich nach meinem Nahtoderlebnis fragen. Ja, so ähnlich, wie alle sagen: ein Tunnel, eine Schneise im Eis, dann Licht. Als ich wieder unter den Lebenden war, torkelte ich und dachte, man wird denken, ich sei betrunken. Was ich zugegeben nicht selten bin.“
Der Mann zog den Hut und zeigte mir seine Narbe. Ich stellte mir vor, wie die Ärzte erst in seinen Kopf geschnitten und dann wieder zugenäht hatten.
„Ja, meine Lebensgefährtin. Sie hatte Zwillinge, zwei Mädchen, eines war das Aschenputtel, das andere die Diva, jeder Pickel ein Weltuntergang. Ihre Mutter hatte eine tolle Figur. Love is blind. Darf ich weitererzählen?“
„Bitte!“
„Ich war ein lediges Kind, kam in ein Heim, meine Mutter heiratete einen guten Mann, der mich adoptierte und der beste Vater war. What you deserve is what you get. Ich kannte wichtige Menschen, weil mein Stiefvater wichtige Menschen kannte. Zum Beispiel Salvador Dalí. Den kannte er.“
„So, wie Sie Silvester Stallone kennen?“
„Mein Stiefvater hat ihm deutsche Witze auf Französisch erzählt, über die sonst keiner gelacht hat, Dalí aber hat gelacht und gesagt, das sei ähnlich, wie wenn er spanische Witze auf Französisch erzähle, da lache auch kein Franzose, die Deutschen aber lachen. Die Welt sei eben komisch. Einmal haben wir Dalí in Katalonien, in Portlligat, besucht. Dort hatte er sein aus ehemaligen Fischerhütten labyrinthartig zusammengefügtes Haus.
Das habe ich mir gemerkt, sonst vergesse ich alles, so etwas merke ich mir, ich vergesse meine Schuhgröße, aber so etwas merke ich mir. Damals wohnte er noch nicht im nahegelegenen Schloss von Púbol, das er für seine Muse und Frau Gala erworben hatte. Im Schloss waren wir nicht, sondern nur im Haus. Was ich für ein nobler kleiner Herr sei, sagte er zu mir. Ich war zehn. Man hatte mich extra für den Besuch fein in Schale geschmissen. Anzug und Krawatte. Eine glatte graue Krawatte, dazu ein schwarzes Hemd und grau-schwarze zweifarbige Schuhe und graue Handschuhe. Wie einer von der Mafia. Ein Mafiakiller. Das gefiel dem Dalí. Er selber trug ein Unterhemd und eine weite Hose mit einem Strick anstatt einem Gürtel, und er war barfuß, ein kleiner Mann, und völlig verdreckt, mit Farbe, meine ich, sogar das Gesicht und der Schädel. Ich kann mir nicht vorstellen, dass der je seine Fingernägel saubergekriegt hat. Er hat mich gefragt, ob ich ihm erlaube, meine Krawatte zu bemalen. Ich musste sie gar nicht abnehmen. Er setzte sich vor mich hin wie vor eine Staffelei. Gemalt hat er aber nicht, gezeichnet hat er. Somit besitze ich einen echten Dalí. Ich habe ihn allerdings nie um den Hals getragen. Das geht ja nicht. Wenn da einer hinter den Bildern von Dalí her ist, solche gibt es ja, die schneiden dir den Hals ab. Das brauche ich nicht.“
Ich sagte: „Darf ich raten?“
„Was wollen Sie raten?“
„Was Sie mit der Dalíkrawatte gemacht haben.“
„Ich habe sie in einen Rahmen gegeben und an die Wand gehängt. Niemand glaubt mir, dass die Bemalung von Dalí stammt. Alle meinen, ich selber hätte sie bemalt, als Kind. Das ist mir recht. Ich liebe die Musik, singe aber nicht. Ich vergesse so viel. Habe ich Ihnen schon erzählt, dass ich Zwillinge aufgezogen habe, zwei Mädchen, das eine ein Aschenputtel? Sie hat einen Koch geheiratet. Das andere Mädchen, die Diva, wollte Model werden. Ich weiß nicht, was mit ihr ist. Wir treffen uns nicht mehr. Seit zehn Jahren habe ich keinen Kontakt mehr mit der gut gebauten Frau, die Ihnen so ähnlich sieht. Habe ich das alles schon gesagt? Ich sammle Krawatten, seit Dalí sammle ich Krawatten. Ich habe ja gesehen, wie Sie meine Krawatte angeschaut haben. Die gefällt Ihnen, hab ich recht? Es ist kein Dalí, aber. Aber. Ich sage: aber. Das kann viel heißen. Ich sage Ihnen aber nicht, was es heißt. Ein Spatz in der Hand ist besser als eine Taube auf dem Dach. Und Sie? Sie sind die Taube, und auf dem Dach ganz dicht bei Ihnen sitzt Ihr Liebhaber. Hab ich recht?“
„Ich schreibe, was ich sehe und höre“, sagte ich. „Auf Fotos sehe ich nur die Menschen. Ja, die Natur liebe ich auch. Ich rieche die modrige Erde und liebe den Stamm der Buche.“
Der Bus hielt. Zwei Polizisten kontrollierten die Ausweise. Ein kleines türkisches Mädchen spielte mit einem Tablet und lärmte dabei, ihre Brüder ohrfeigten einander, einer den anderen, einer den anderen, in einem Rhythmus. Tumult, wo man hinsah, das Leben eben.
3
Die Geschichte von Joseph Weiss, alias Joe White
Während des Zweiten Weltkriegs wurde in einigen Städten an der Ostküste der USA eine Befragung unter Immigranten durchgeführt, vor allem unter Menschen, die aus Deutschland und den von den Nazis besetzten Gebieten gekommen waren, zum Beispiel aus jenen Teilen Polens, die als Generalgouvernement bezeichnet wurden und dem Reichsminister Hans Frank unterstellt waren. Eine der Fragen lautete: „Haben Sie Heimweh?“ Man würde meinen, es gab nichts, wonach sich diese Menschen noch sehnen konnten, was sie vermissen konnten, was ihnen an dem Land und den Leuten dort drüben lieb sein konnte. Interessant ist, dass jedoch gerade sie unter Heimweh litten, nämlich stärker als jene Einwanderer, die von den Nazis wenig oder gar nichts befürchten mussten und aus anderen Gründen ihre Heimat verlassen hatten – also jene, die unter ihrer Heimat nicht gelitten hatten, die schöne Erinnerungen hatten, vielleicht sogar nur schöne Erinnerungen.
Heimweh ist ein Gefühl, das keine Sprache findet. Die Worte des Heimwehs sind die schlaflosen Nächte, die Seufzer am helllichten Tag mitten in einer bequemen Unterhaltung oder im Kino während eines heiteren Films. Wer an Heimweg leidet, leidet meistens auch an Einsamkeit. Er kann sich nicht ausdrücken. Er fühlt sich, als wäre er der letzte Mensch auf der Welt, der seine Sprache spricht. Er möchte, dass sein Schmerz bemerkt wird, aber er kann sich nicht bemerkbar machen. Er will in die Welt hinausrufen: Seht mich, ich liebe! Aber er verwischt die Tränen und verhustet die Seufzer. Warum? Weil er seine Liebe nicht begründen kann. Weil niemand seine Liebe verstehen würde. Was, würde man ihm entgegnen, die dort drüben, die liebst du? Die dir deine Liebsten genommen haben, ausgerechnet die liebst du? Das Land, in dem du dich nicht frei bewegen durftest, das liebst du? Ja, müsste er antworten, ich liebe. Aber – wer die Niedertracht liebt, ist der nicht selbst niederträchtig? Was tun? Schweigen.
Joseph Weiss emigrierte bereits im Frühjahr 1933 in die USA. Er gehörte zur Familie Weiss, die in Coburg in der Spitalgasse ein Schuhgeschäft betrieb, das erste der Stadt, das sich von den besten Schuhmachern des Landes beliefern ließ. Am 1. April 1933 wurde das Geschäft zerstört, die Tür mit Brettern zugenagelt, darauf wurde mit Kreide geschrieben: „Wer bei Juden kauft, ist selbst ein Schwein.“ Joseph Weiss war damals im Anfang seiner Zwanziger, er hatte Chemie studieren wollen, es war aber zu befürchten, dass er an keiner Universität in Deutschland zugelassen würde. Im Unterschied zu seinen Brüdern und Schwestern sowie seinen Cousins, die alle in der Schuhbranche arbeiteten, gut verdienten und auf Expansion hofften, machte er sich keine Illusionen, was das Leben der Juden in Hitlers Drittem Reich betraf. Er riet davon ab, das Geschäft wieder aufzubauen, er riet zur Flucht. Er lieh sich Geld von der Familie und fuhr mit dem Dampfer nach New York. Und zog weiter nach Chicago. Dort gab es eine starke deutsche Community. Die meisten waren schon vor langer Zeit ausgewandert, sie waren nicht vor den Nazis geflohen, viele unter ihnen waren sogar begeisterte Anhänger der nationalsozialistischen Ideologie. Ein jüdischer Flüchtling wäre nicht freundlich aufgenommen worden. Also gab sich Josef Weiss als Geschäftsmann aus, der sich für Politik nicht interessierte.
Manchmal steht der Zufall an einer Kreuzung, und er schubst den Wanderer auf einen Weg, den er niemals hatte gehen wollen. Eines Abends saß Josef Weiss – der sich inzwischen Joe White nannte – in einer Bar am Lincoln Square in Little Germany, da sprach ihn ein Mann an. Joe – Joseph – war vorsichtig, Freunde hatten ihm geraten, jedem gegenüber misstrauisch zu sein. Wenn er den Eindruck habe, jemand wolle ihn aushorchen, solle er auf gar keinen Fall die Wahrheit sagen. Irgendwann während des Gesprächs fragte der Fremde, in welcher Branche Joe tätig sei. Tatsächlich hatte Joseph bei einem Schuhmacher Arbeit gefunden, auch ihn hatte er belogen, hatte so getan, als wüsste er über Schuhe nicht Bescheid, war von dem guten Mann für einen Probemonat genommen worden und hatte, weil er sich so geschickt anstellte, schließlich einen Vertrag bekommen. Er war gewohnt zu lügen und antwortete dem Mann in der Bar spontan: „Krawatten.“
Dieser Mann war kein Böser, kein Spitzel der amerikanischen Nazis, kein Agent der Einwohnerbehörde. Er war – Zufall! – ein Schneider, ein besonderer Schneider, nämlich einer, der sich auf die Herstellung von Krawatten spezialisiert hatte. Sein Name war Michael Fromm. Wie auch immer – die beiden freundeten sich an, Joe kündigte seinen Vertrag bei dem Schuhmacher und stieg als Partner ins Krawattengeschäft ein. – Und er hatte eine Idee!
Er hatte Heimweh und eine Idee.
Wie bringt man die Sprachlosigkeit zum Sprechen? Durch ein Bild. Die Firma Fromm & White stellte ein halbes Dutzend Stickerinnen ein, die bestickten je nach Wunsch die Krawatten der Kunden – alles Immigranten – mit den Wahrzeichen ihrer Heimatstadt. Da waren der Hamburger Michel darunter, das Wiener Riesenrad, der Kölner Dom, der Löwe an der Einfahrt zum Hafen von Lindau, die Silhouetten von Dresden oder Salzburg, die Prager Burg und die Große Synagoge von Vilnius. Den Prototyp bestickte sich Joseph Weiss, alias Joe White, selbst: die Veste Coburg. Er war kein geschickter Zeichner und auch kein geschickter Sticker, aber die Kunden verstanden, was er meinte. Sie meinten das Gleiche. Manche ließen private Motive sticken, eine Widmung an einen Freund, Kinder bei ihren Wintervergnügungen, das geliebte Kinderfahrrad, ein Porträt des geliebten verstorbenen Rauhaardackels. Fromm & White machte gute Geschäfte. Den Männern, die nicht so gut weinen konnten wie ihre Frauen und auch nicht so ergiebig seufzen wie diese, war eine Möglichkeit gegeben, ihr Heimweh, das ihnen die Kehle zugeschnürte, kundzutun: Sie banden sich von nun an ein Stück der Heimat um ihren Hals.