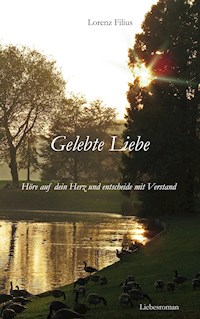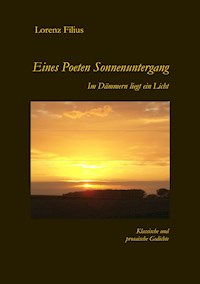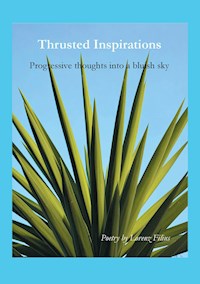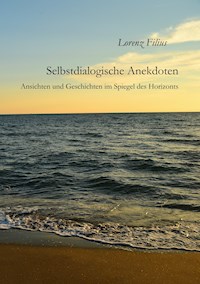Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Books on Demand
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Ob Fragen aus dem Inneren, ob Fragen in das Äußere, ob Fragen durch den Hausverstand, ob Fragen an Geschichten oder Fragen um die Sinnlichkeit, sie alle zeigen die Facetten des Bewusstseins, welches sich einer Wahrhaftigkeit inmitten solcher Individualitätsvielfalt kaum mehr gewiss sein kann. Wie lange festigen wir uns jedoch darin jeweils nur für uns, wenn wir in reiner Interpretation die Blickrichtung verschroben enden lassen, quer zu unzählbaren, anderen Geistern? Im Gegensatz zur objektiven Sachlichkeit, die zeitlich alles für ein jedes und für einen jeden richtig stellt, hat Poesie die Kraft zu mehr: Die Macht, von einer inspirierten Einzelfrage über Möglichkeiten anstatt Deutungen auf wiederum ein großes Ganzes hinzuweisen, ohne ihm Gestalt aus Missverständnis aufzudrängen.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 186
Veröffentlichungsjahr: 2019
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
… Ideen springen aus dem Kopf wie viele kleine Regentropfen oder Sonnenstrahlen aus den Wettern der Gedanken. Die Welt um uns herum pumpt dabei durchs Gemüt ein Klima des Verständnisses davon: Mal schwebt es um uns warm und blau vor Glück mitsamt der Sinnlichkeit, mal harrt es kalt und klar besonnen aus, sowie es uns dazwischen - öfter als wir selbst empfinden - milchig fad und lau in Abwägung der besten Sicht belässt. Wir leben darin das Bewusstsein einerseits aus unserm jeweiligen Ego in der Annahme, es sei so übergreifend individuell beschieden, dass die subjektiven Unterschiede lediglich an etwas Übereinkunft mangeln, um zu einem großen Ganzen zu gelangen; auf der andern Seite sind wir damit in uns selbst noch um so weiter weg von alledem in Einigkeit.
Aber gerade dieses Eine hat es sicherlich viel umfangreicher in sich, so dass jede kleingeistige Wetterfühligkeit dazwischen letzten Endes nur als immer gleicher Spielball individuelle Seiten wechselt, uns im massig guten Glauben lassend, die Großwetterlage eines übergreifenden Bewusstseins auszuloten. Außerordentlich passiv ergibt sich damit jede Deutung im Verlangen, das Verständnis zu empfangen. Auch die Reflexion von Mensch zu Mensch und Mensch zu Sache trifft auf uns zurück, erzwingt Verhältnisse - und manchmal, da erschlägt sie uns mit ignorantem Donnerschlag zur Ruhe nach dem Sturme. Festgefahren halten wir uns schließlich an den Objektivitätsmajoritäten fest und auf, anstatt ein wenig mehr besonnen Regentropfen Licht zu schenken oder Sonnenstrahlen schattig anzuregen. Erst dann gewinnt, was wir erfahren, auch Bewegung über Interpretationsklischees hinaus, dem gänzlich Ungedachten aktiv etwas Zeit einräumend …
Inhalt
Fragen aus dem Inneren
Fragen in das Äußere
Fragen durch den Hausverstand
Fragen an Geschichten
Fragen um die Sinnlichkeit
Fragen aus dem Inneren
Fragen aus dem Inneren
Momentverewigung
Menschlich wach
Mitreißend
Traumtänzer
Gefüllter Hut
Anspruchsgrau
Im Alter junggesellt
Offen neu
Hinter vorgehaltener Hand
Glaube, Hoffnung, Liebe
Platz an meiner Sonne
Über tiefen Tagen
Rastlos
Hatz des Schmerzes
Nehmen ohne Geben
Tabula rasa
Vom Schmerz beschränkt
Kein Stolperleid
Auf der Kippe
Ich bin da
Letzte Sehnsucht
Flüsterfisch
Gesichter der Lüge
Überm queren Bein
Mundtot
Mein kleiner Traum
Benommen schlau
Herzschlag vor dem Schicksal
Horizontreiter
Rückführung
Liegen in Erinnerung
Heimgetrieben
Ich liebe
Gelebter Kindertraum
Ins Reine
Kaum besuchtes Land
Inspirationshyperbel
Ich glaube
Kleines schwarzes Loch
Vulkanausbruch der Träume
Treiben unterm Himmelszelt
Figur Und Fakt
Nach allem
Transplantiert
Drei Wege
Wo führt der Wind uns hin
Hingeschleppte Sehnsucht
Die eine letzte Liebe
Alter Mut
Freistrampeln
Hinterhofsehnsucht
Schwarz auf weiß
Holzkopf
Herbstmüdigkeit
Duft der Zeit
Fenster an der Wand
Blaues Licht
Abgesondert frei
Schweinehund im Käfig
Wolkenstrang
Was ist der Gewinn
Im Schluck Kaffee
Der Silben Spur
Stadtangst
Gute Wünsche
Flucht nach vorn
Koma
Verlier den Strang
Etwas in mir
Gefühlslandschaft
Kleinstes Licht
Entlang an Mauern
Das Ende aller Muse
Allem zugewandt
Wille
Sternenlichtvergänglichkeit
Schau dem Abend in die Tränen
Wächter der Bedrängnis
Weckt mich nicht
Träumt weiter, ihr Ideen
Bewusstseinspfad
Wahrheit ohne Licht
Erklart
Am Fenster
Geduld der Zeit
Gut oder Böse
Blind ersehnt
Rundherum
Verratener Traum
Verschwunden um ein Haar
Viel zu wenig, zu viel Sinn
Gedankenpalindrom
Gewissen
Verblichenes
Warum es so war
Die Stille gleitet
Mein wildes Herz
Nicht mehr spüren
Mit wem nur ich mich teile
Enge der Gewissheit
Leergefegt
Losgelöst verbleibend
Endlich dort
Momentverewigung
So, wie der Tag
die Nacht im Stich
des Morgens lässt,
erwärmt er sich
im schicksalhaften Weltennest
für Kreatur
und Zeitertrag.
So, wie die Nacht
den Abend führt
aus Dämmerung,
wird sie gespürt
in der Momentverewigung
geprägter Spur
zur Morgenmacht.
So, wie Schwarz-Weiß
von Farben zehrt,
erfüllt es nichts,
was es nicht nährt;
es wird - und bleibt im Fluss des Lichts;
ein Zwinkern nur
auf kein Geheiß.
Menschlich wach
Noch einmal triumphiert in Scharen
über alte Eitelkeit;
solang mit ihr die Träume waren,
war sie zweifellos bereit.
Noch einmal schaut in das Vermächtnis,
wehrt euch nicht, es frisst kein Brot;
belasst es dabei im Gedächtnis,
lebt vorbei am trägen Tod.
Noch einmal findet euch im Schlafe,
und dann erhebt euch nach und nach;
verlasst getrost das Rudel Schafe,
im Wolfspelz nicht,
doch menschlich wach.
Mitreißend
Und wenn die Tiefe
uns erst alles nimmt,
damit sie unserm Abgrund
Tür und Tore öffnet, dann
entkommen wir der Ungeduld;
was lang auch schliefe,
von da an alles stimmt,
wir fürchten keinen Sauhund,
reißen mit, von Mann zu Mann,
vernichtend uns und alle Schuld.
Traumtänzer
Auf dem straffen Drahtseil der Verzweiflung fliehen Träume gerne die Balance
lassen sich zur Seite fallen durch den tiefenlosen Abgrund
in beschwichtigende Arme ihresgleichen
denn da unten ist es weich
so überherzlich warm
mit sich
allein
im Stich
lässt sie der Charme
umringt alsbald vom Reich
dem nur die Eitelkeiten sinnlos weichen
um als zwangsrealitätsentgeistert neu vom Stumpfsinn unrund
Tritt für Tritt den Halt versuchend zu verlieren auf der Linie dünner Chance
Gefüllter Hut
Nun hat sich doch mein Hut
mit viel gefüllt,
und gut,
hab nicht gebrüllt,
nur Wut,
da’s fad umhüllt
die Glut.
Ich ziehe ihn und fort,
belass’ der Zeit
den Ort;
und niemand schreit
mein Wort
in sein Geleit
nach dort.
Anspruchsgrau
Ich pflücke Blümchen zum Gedicht,
was Einfacheres gibt es nicht,
denn Blumen sind so populär,
Entschuldigung, dies Wort ist schwer,
ich meinte ‘Blumen kennt ein jeder Wicht’.
Ich sing ein Liedchen, trallala,
die lange Weile klingt so klar,
so köstlich trällert es dahin,
nur manchmal liegt ein Tiefpass drin,
ach je, ein Un-Ton ist doch immer da.
Ich schreib Geschichtchen um das Herz,
zum abgrundtiefen Seelenschmerz,
der Rote Faden ist voll Blut,
das Pathos leidenschaftlich gut,
erklärt sich ganz von selbst, kein Grund zur Wut.
Ich schweb auf Wölkchen meiner Kunst,
wenn sie kein Anspruchsgrau verhunzt,
wenn nichts und niemand das verstört,
was sich von ganz allein erklärt,
dann schweben viele mit durch leichten Dunst.
Im Alter junggesellt
Geselle mich gar jung dazu,
in ungehemmter Seelenruh’
zu allem, was Verklemmung wehrt;
ich friedlich tu
nichts umgekehrt.
Denn zügig hab ich einst gefreit
um eingeteilte Zweisamkeit
mit vollmündig versproch’nem Los;
war kaum gescheit,
im Hals ein Klos.
Gelernt blieb Konsequenz nicht aus,
gefühlt am eignen Leib, ein Graus,
das Blaue war noch wundersam;
ich war zuhaus’
am langen Arm.
Die trübe Sicht trug Früchte ein,
Bohei ließ ratlos Kraut gedeih’n,
geknospt für blumig welken Duft:
Ich schieß hinein,
und mach mir Luft.
Offen neu
Weit,
gen Himmel über Nord
befindet sich mein letztes Los;
muss zieh’n,
nein, eher wirklich fort,
die Kleinheit
endlich
übergroß.
Nie
ist nichts mit mir gescheh’n,
der Wege Umstand fing mich ein;
versteh’
gefällt vom Wohlergeh’n,
geheim nun
offen
neu zu sein.
Hinter vorgehaltener Hand
Doch tief in mir, noch tiefer, als ein Argwohn ahnt,
ein Geist in meinem Abgrund hängt;
verflucht des Lächelns Eisbergs Spitze
hinter vorgehalt’ner Hand
und stockt.
Es brennt die Zier, die sich den Weg darüber bahnt,
zu meinem feigen Schweigschlund drängt;
versucht, zu trotzen dieser Hitze,
klebt mein Rücken an der Wand,
verbockt.
Glaube – Hoffnung - Liebe
Warum soll ich hoffen,
wenn der Herr doch ohnehin gewinnt;
warum soll ich glauben,
was schon offenbarte Fakten sind;
was verbirgt die Liebe,
wenn angeblich nie ihr Blut gerinnt?
Nein, ich will nur wissen,
was ich an die Fragen bind’.
Denn ich bin ganz offen,
diese Leere sucht mich friedlich heim;
kann mir gar nichts rauben,
und erzwingt auch keinen Götterreim;
geistig guten Trieben
geht kein Ungewissen auf den Leim.
Ich bin ausgerissen,
wachse weiter ohne Keim.
Platz an meiner Sonne
Am Platz an meiner Sonne in belassenem Idyll,
da lag ich in der Wonne aus unendlichem Gefühl.
Hab ich dort je mich dem gestellt,
was mir erzählte ach so viel
und mich hineinzog in die Welt?
Am Platz an meiner Sonne in verlassenem Idyll,
da lag ich in der Wonne aus unendlichem Gefühl.
Über tiefen Tagen
So wie nie
erzählt sich dort
die Stadt zu mir herauf,
in meinen Turm
des Argwohns
sich verirrend.
Fantasie
ist hier mein Hort,
erschwert der Zeit den Lauf,
in Sinnes Sturm
die Neugierde
umflirrend.
Mann und Maus
in Einzelblut,
alsbald im Los verklumpt,
schrei’n in mein Nest
durch Stummheit
ihrer Fragen.
Haus um Haus
verschluckt den Mut,
scheint herzlos ausgepumpt;
ich halt mich fest
weit über
tiefen Tagen.
Rastlos
Ich bin der Wanderer,
der sucht, der schmachtet
und nicht finden will
inmitten seiner Ungeduld;
der eine,
den kein Widersinn
in seinem Sinn ersetzen mag.
Ich bin der Wachende,
der sich erachtet
zwischen laut und still,
bewegt von Daseinsgrund und -schuld,
alleine,
nur im Lustgewinn
am Abend ohne jeden Tag.
Ich bin kein anderer,
als wer sich findet,
einmal jetzt und hier,
um alles, was der Geist begehrt,
ums Leben
und den einen Tod,
in Sehnsucht nach Vereinigung.
Ich bin der Lachende,
der hell erblindet,
tränend hofft, wofür -
der Philosoph, den nur belehrt
das Streben
aus der höchsten Not
zur Unwissensbereinigung.
Hatz des Schmerzes
Oh Schmerz,
so treu wie du gekommen und gegangen
all die Zeit,
so wusste ich um deinen Platz,
war dort ergeben, dort befreit.
Mein Herz
war hin- und hergerissen und befangen
ohne Mut,
zu widersteh’n dem Zank der Hatz;
ließ sie mir Zeit, tat sie mir gut.
Verlor’n,
ich sehe keinen Zorn durchs Trügen scheinen
ohne Pein,
wo bist du hin, oh Schmerz, ich such;
versprengt zuletzt ins Knochenbein.
Gebor’n
in neuer - doch mit Wahrheit nicht zu einen -
Lebenslust;
entrinnen werd ich nicht dem Fluch,
denn du, mein Schmerz, kehrst wieder, weil du musst.
Nehmen ohne Geben
Grabschgeschwätzigkeit
durchbricht mit Wollustkrallen
die gespannte Kreismembran
des Nehmens und des Gebens.
„Gib!
Dann stirb
an meinem Anteil
eures zwangsvertrauten Lebens!“
Lange weilt die Zeit
in aller Wohlgefallen,
still, treudoof vertan
im Warten auf Gesundung.
„Lieb’,
verdirb
in meinem Unheil,
Leichen fleddernd eure Rundung!“
Tabula rasa
Weit hinten laufen meine Blicke
still zusammen;
und Wogen, die ich überbrücke,
löschen Flammen;
hier glätten alte Ufer friedlich
Sand aus Flüssen,
dort liegt die Zukunft unerbittlich
mir zu Füßen.
Vom Schmerz beschränkt
Es hemmt der Schmerz
in meinem Kopf die Kraft,
Synapsen zu vereinen,
ihre tief versprengten Funken
in ein Feuer neuen Lebens
einzutunken.
Verpulster Saft
aus dem verklumpten Herz
bewegt den Strang vergebens
in Umhüllung von Gebeinen.
Ein kleiner Kuss
empfindungslosen Glücks
verliert sich wie ein Zanken
zwischen Höllenfahrt und Wunder,
macht den Teufelskreis der Ohnmacht
täglich runder.
Nur hinterrücks
erleb ich, was ich muss;
den Willen schmäht die Eintracht
der Gewissheit hinter Schranken.
Stolperleid
Da lieg’ ich nun
mit mir,
viel sich’rer, als ein Albtraum glaubt,
die Ferse der Vergangenheit
noch im Gesicht.
Sie löst sich
schmatzend aus dem
Widersinn;
den Zukunftsstreit
betritt sie nicht.
Doch das Profil,
bleibt mir,
- denn sonst wär’s seiner Spur beraubt -,
verstärkt in Unbefangenheit,
in Wahrheits Licht.
Ich frag mich -
geb’ mich meinen
Schatten hin;
kein Stolperleid
vertritt die Pflicht.
Auf der Kippe
Durch mein Blinzeln dringt ein Licht,
zerrt mein Schicksal in den Bann;
eh’ es auseinander bricht,
glaube ich zu sehr daran.
Folge ich dem Ungemach,
löst der Geist Strukturen ab,
stellt infrage mich - mir nach:
Wohin führt, was ich nicht hab?
Bald verewigt in der Trance,
bleibt mir kaum Entscheidungskraft,
fließe über die Balance,
aus der Zeit vom Raum gerafft.
Da! Ein Stoß zieht mich zurück,
rüttelt meinen Leichtsinn auf;
auf der Kippe steht mein Glück,
ein Moment liegt fühlend drauf.
Ich bin da
Ich bin da, hurra! War ich jemals anders wo?
Ja, jedoch nur wahr.
Morgenspur im Sand.
Mittags wirft sich auf der Strand.
Abends Hand in Hand.
Lange Weile droht. Kurzgeschlossen Sinn erlischt.
Weile, langer Tod.
Letzte Sehnsucht
Meine Sehnsucht nur nach Taubheit
findet keinerlei Gehör,
ist so stark, dass ich’s beschwör;
euer Tag ist meine Unzeit.
Meine Sehnsucht nach den Schatten
schlägt sich nieder auf dem Licht;
finde eine Nische nicht,
frei von licht-gebeugten Ratten.
Meine Sehnsucht nach dem Schweigen
legt sich niemand in den Mund;
tun Verwunderung nur kund,
jene, die sich taub mir zeigen.
Flüsterfisch
Kein Weg zum Heil,
nur Wasser hin zum Licht;
der Himmel steil,
die Schatten sind es nicht.
Ich scheu den Schritt,
zu weit versinkt er bald;
doch geh’ ich mit,
dann treibe ich im Halt.
Vom Ufer fort
verlässt die Schwere mich;
verlier kein Wort,
vertrau’ dem Flüsterfisch.
Gesichter der Lüge
Solang ich Gesichter der Lüge betrachte,
im Nachhinein aller Verschleierungstaktik,
erkenne ich darin dann kaum noch die menschliche Ader
der garstigsten Verschlagenheit.
Gesichter gewöhnen mitunter den Glauben
an jede Verwicklung,
verflachen aus festem Profil
ihrer dreisten Beschläge.
Ich kann nicht mehr sehen,
wie ich sie einst sah,
und suche in reulosen Mienen
das Spiel mit den Schmerzen,
den Stich in die Herzen,
der Arglist zu dienen;
das reimt sich für wahr,
doch will mir entgehen.
Die Wahrheit ist Schleiern zwar auch nicht zu rauben
in ihrer Zerstück’lung,
doch nimmt dies Gedanken so viel;
das Entsinnen macht träge.
Erst wenn ich Gesichter der Lüge verachte,
ernüchtert, im rückwärtig fälschlichen Hinblick,
wird jedwede Maske im Lichte der Selbstachtung fader
auf ungeschminkter Wirklichkeit.
Überm queren Bein
Was lässt mich laufen
nun,
da ich im Rückenwind des Jahres
keinen Grund zu gehen spüre?
Zieht es so an mir vorbei,
lässt es mich stehen,
sehen
in Entgegenkommendes allein?
Ob Scherbenhaufen
ruh’n,
ob Glück um Breite eines Haares -
was ich momentan berühre,
nicht gefangen, noch nicht frei,
droht zu vergehen;
Flehen
bindet mich und jagt das Sein.
Mag nichts erkaufen,
tun;
um Himmels Willen und um Wahres
winden sich die Herzensschwüre
hin zum trivialen Brei;
den Kopf verdrehen
Wehen
meines Bauches überm queren Bein.
Mundtot
Da ward es leer
in einer Stille großer Not;
ein Mündermeer
verstarb an breit gestreutem Schrot;
die Kugeln, klein,
bewirkten mehr als ein Geschoß,
und insgeheim
das Blut vorbei am Leben floss.
Die Hüllen, schlaff,
vergingen sich fortan an Luft;
der Atem, straff,
hat keine Düfte mehr gesucht;
nur der Geruch
von animierter Pumperei
mischt diesem Fluch
synthetisch Nährstoff bei.
Mein kleiner Traum
Mein kleiner Traum,
da bist du ja,
vom Wust der Wahrheit schon zerzaust;
nur streicheln lässt du dich noch nicht,
mein kleiner Traum … ich bin ja da.
Schon wachst du auf,
du staunst mir zu,
und glaubst mir kaum, was du erbaust,
schau hin, so offenbar und schlicht,
ja, ja, wach auf … in meiner Ruh’.
Benommen schlau
Wir sind benommen schlau,
was immer auch geschieht,
im Weinglas so zur Schau,
lasst singen uns ein Lied.
Und alle johlen mit
zu unserm dummen Durst,
sie halten kleckernd Schritt,
jetzt geht es um die Wurst.
Wer wird der erste sein,
vom leeren Glase voll,
zu schauen dämlich drein,
zu fragen, was das soll?
Es bleibt beim leeren Blick,
kein Stein im Brett dabei,
doch ich zieh mich zurück,
und hau das Glas entzwei.
Herzschlag vor dem Schicksal
Ist es eine Träne
oder ist es Angstes Schweiß?
Seen, die ich wähne,
sind nur Spiegel, höllisch heiß.
Führen meine Blicke
in die Irre aus der Welt?
Längst sind die Geschicke
überwuchernd vorbestellt.
Ist es nur ein Zwinkern,
oder schließt sich schon mein Lid?
Wohl den letzten Trinkern,
denn sie seh’n nicht, was geschieht.
Würd sie gern beneiden,
doch ich kann noch nicht umhin,
feig’ zu steh’n zum Leiden,
um nicht Konsequenz zu zieh’n.
Ist es noch ein Herzschlag,
oder schlägt das Schicksal zu?
Endlich ich den Schmerz frag,
nicht die sturmentwöhnte Ruh’.
Nur die Antwort zählt nun
in der aller letzten Glut:
Machen oder ‘nichts tun’
ohne Qual der Wahl tut gut.
Horizontreiter
Ich laufe die Wege
durch Geistes Gehege
und suche an Grenzen
den Schnitt zu Tendenzen.
Ein Horizontreiter
will mir sie erweitern;
doch kaum, dass ich’s wage,
erfühl ich die Klage:
Gerat’ ich ins Wanken
beim Brechen der Schranken?
Beherrscht mich der Reiter
dahinter nur weiter?
Ich lasse ihn schwinden,
muss ohne ihn finden,
und reiß’ nicht an Grenzen:
Sie suchen Tendenzen.
Rückführung
In Tiefen meiner Urgewalt
versinkt ein langer Schmerz,
gewinnt in alter Welt Gestalt,
sprengt Ketten um mein Herz.
Da war ich lange schon vermisst,
verschollen durch die Zeit;
und was von mir dort übrig ist,
der Mut, zu seh’n befreit.
Die Bilder leiten mein Gespür,
die Stille weicht dem Wind,
er trägt die Stimmen zu mir her,
die alt-vertraut mir sind.
Gesichter folgen ihrem Ruf,
betrachten meinen Traum,
dann bin ich, wo’s mich einst erschuf,
in zeitverlor’nem Raum.
Ich leb’s noch einmal drum herum,
zu weit darf ich nicht geh’n;
doch lässt mich das Kontinuum
ein Teil von ihm versteh’n.
Nun muss ich fort, das Leben wacht,
kennt Gnade nicht vorm Sein,
wohin es mich seitdem verbracht,
lässt’s mich erneut allein.
Liegen in Erinnerung
Ich liege in Erinnerung
verklärter Augenblicke
durch das jugendliche Laub.
Zu einer flüsternden Musik
lässt dort hindurch der milde Frühlingswind
die Lichter tanzen;
lupft die Blätter hier und da
und spielt mit meinem blinzelnden Gesicht. -
Den Winter ahne ich noch nicht,
und auch kein Sommer reift das Kind;
vergönnt verliebte Unbeschwertheit jungen Pflanzen.
Ach wär doch alles dies ein Teil davon,
woran ich nunmehr glaub.
Die Gänsehaut lässt mich gescheh’n;
nicht wuchern müssen Sinne
in mein heimliches Gefühl.
Ein Wasser nur in meiner Näh’;
es gluckst um mich herum Vergessenheit
in weichen Tönen.
Finde mich darin geeint,
behutsam im genossenen Moment.
Ist jemand da, der mich hier kennt?
Ich bin alleine mit der Zeit,
doch darf ich weiter mich nicht mehr daran gewöhnen,
denn alles Losgelassene kehrt heim
da ich es lassen will.
Heimgetrieben
Ich vermisse
den Weg,
den ich hier her gestolpert;
die Straße,
die mich hier her verschlagen;
das Meer,
das mich an Land gespült;
die Ufer,
die mich zum Schwimmen verführt.
Ich genieße
den Gang,
der wieder heimwärts holpert;
das Laufen,
das ruft, mich selbst zu tragen;
den Strom,
der meine Sinne kühlt;
das Land,
das mich mit Heimat berührt.
Ich liebe
Nun liebe ich,
ich liebe, ja;
hab’ ein Gefühl dafür erhascht,
bin selbst darüber überrascht,
nun liebe ich,
ich spür’ es klar.
Ich geb’ mich hin,
ich gebe mehr,
geb’ alles, was das Herz begehrt,
das Hirn nicht länger sich mehr wehrt,
ich geb’ mich hin,
und beinah’ her.
Ich fühl’ mich frei,
ich fühle Lust,
reich’ an die Ewigkeit heran,
was doch die Liebe alles kann,
ich fühl’ mich frei,
so einerlei.
Ich fürchte mich,
ich fürcht’ um mich,
nicht Gnade kennt der Lauf der Zeit,
nur Galgenfrist Verlorenheit,
ich fürchte mich,
ich liebe mich.
Gelebter Kindertraum
Nun zieht
ein neuer Wind
durch die Erinnerung.
Nein,
ich gebe sie nicht her,
so schmerzlich
sie mich auch verlässt.
Und flieht
ein altes Kind
in die Bekümmerung,
ja,
dann will es wahrlich mehr;
und herzlich
hält es daran fest.
Es träumt
von kleiner Welt,
um sie zum Meer zu führ’n;
ja,
da liegt die wahre Kraft,
ergeben
jedem Lebensraum.
Doch schäumt
dazwischen Geld,
ich kann es zu sehr spür’n:
Nein,
ich hab’ es nicht geschafft,
zu leben
meinen Kindertraum.
Ins Reine
Meine Augen fühlen sich
geborgen ob des Lichtes;
meine Seele schüttelt mich -
im Nachgedanken bricht es.
War die Mühe es so wert,
die neue Welt zu suchen?
Lichterspiele unbeschwert,
die Schatten lassen fluchen.
War im Norden nicht zuhaus’,
doch immerhin alleine;
und der Süden lacht mich aus:
Komm nicht mit mir ins Reine.
Alle Wege führen fort,
nur bleibt mir die Gesinnung
als der wahre, kleine Ort
der letzten Landgewinnung.
Kaum besuchtes Land
Ich treibe hin, ein kleiner Punkt,
zu schauen um die ganze Welt,
dem Blick sich nichts entgegenstellt,
nur ab und zu ins Meer getunkt.
Vom Tanz der Wellen weit umringt,
das Boot spielt mit der Leichtigkeit,
ein Spritzer Übermut, befreit,
mich lockend in mein Kleinod springt.
Ich folge ihm, soweit ich kann,
und reich’ dem Wasser meine Hand,
durchstreif’ sein unbezwung’nes Land,
doch bleib zurück im Dasein dann.
Nun reit’ ich auf dem Schicksal fort,
es lässt mir meinen Frieden hier,
bewandern darf ich sein Revier,
verlassend nie von Ort zu Ort.
Inspirationshyperbel
Unendlich weit,
unendlich tief,
vom Höhenflug hinfort geführt,
erscheint die Ferne nah berührt;
zu sehr bereit,
weil etwas rief.
Geschwindigkeit
den Fall vergisst,
im Schwung verbeugt sich das Vergeh’n,
als würd’ von selbst es sich versteh’n;
fühlt sich befreit,
weil’s schnell nur ist.
Der Anfang, wach,
das Ende wacht,
und findet keinen letzten Schlaf,
zu funktional, im Schlussstrich brav;
der Weg liegt brach,
in Zeit verbracht.
Ich glaube
Ich glaube, dass es regnen wird,
ich glaube an die Zeit danach,
ich glaub’, was ständig mir passiert,
die Sonne scheint das Schicksal brach.
Ich glaube, dass kein Gott mich braucht,
ich glaube an Verdammnis nicht,
ich glaub’ ans Glück, weil’s schnell verraucht,
und was noch bleibt, mit Zweifeln bricht.
Ich glaube übers weite Land,
ich glaube tief ins Meer hinein,
ich glaub’, es ist nichts unbekannt,
mir fehlt es nur, dabei zu sein.
Ich glaube an Beständigkeit,
ich glaube ihrer lieben Not;
ich glaub’ solang’s mich nicht enzweit,
zu wissen, bis der Glaube droht.
Kleines schwarzes Loch
Schaue ich genauer hin,
tiefer als in einen Traum,
lässt das Licht die Formen flieh’n,
mein Gesichtsfeld zerrt am Raum.
Keine Richtung scheint mehr treu,
in Spiralen fort von mir,
das Vergang’ne wird stets neu,
noch ist meine Mitte hier.
Drumherum verlier ich Halt,
doch die Schwäche fällt dort ab,
langsam wird mein Atem kalt,
fast das Letzte, was ich hab.
Schon verdreht sich mein Gefühl,
der Verstand ist längst hinweg;
kurz bevor’s mich schlucken will,
blas’ ich’s schwarze Loch vom Fleck.
Vulkanausbruch der Träume
Im Vulkanausbruch
verquerer Schicksalsträume
bebt die Schlummererde
unter meinem Schlaf nach vorn ...
... Lavas Leichentuch,
zu kaltem Schweiß der Schäume,
dass ich warm nicht werde,
wühlt mich auf, so altgebor’n ......
...... Gras wächst über mich,
aus Katzengold getrieben,
weht den Tag durch Winde,
hebt verbrannte Schätze nicht ...
... friere innerlich,
der Stein ist warm geblieben
unter schwarzer Rinde,
schluckt zur Nacht mein Augenlicht.
Treiben unterm Himmelszelt
Will frei sein wie ein Tanz im Wind,
der nicht auf schwere Schritte sinnt;
will fliegen wie die Melodie,
nicht singen, nur versteh’n wie sie.
Will treiben unterm Himmelszelt,
das Fragen nicht nach Richtung stellt;
will finden, was mir längst genügt
und Bodenständigkeit nicht trügt.
Figur und Fakt
Am Abend
kriecht aus der Erinnerung
das Lebenslicht in meinen Augenblick,
zerstreut ihn in Gedanken,
die über den Moment hinaus
die Zukunft mit Vergangenheit verknüpfen.
Niemand findet sich darin,
nur ich,
Figuren Fakten unterstellend.
Die Nacht kehrt ein,
verzweifelt nicht
an mir allein;
sie ist das Pathos im Verstehen,
im Vergehen aller Zwänge
gleichberechtigender Sicht.
Der Traum betrifft
nur mich,
mit Fakten,
die Figuren überwältigen.
Am Morgen
wird dies alles eins;
ich bleib darin
verborgen,
Figur und Fakt zugleich,
und kriechend in Erinnerung.
Nach allem
Nach allem bleib ich was ich bin