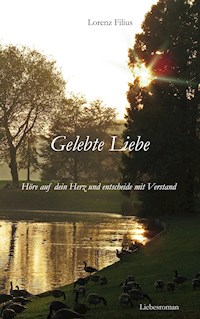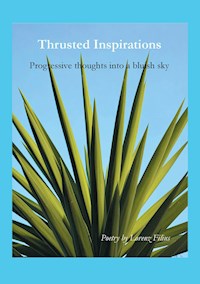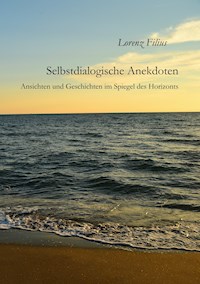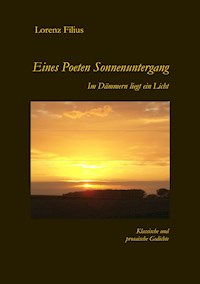
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Books on Demand
- Kategorie: Poesie und Drama
- Sprache: Deutsch
- Veröffentlichungsjahr: 2019
Das Leben hält sich nicht mit Kleinigkeiten auf, und doch hält sich's daran fest und lässt der Sonne ihren Lauf ... ... denn die Summe dieser kleinen Mosaiksteine des Lebens stellt unser Gegenüber dar, an welchem wir reflektieren. Wir sehen uns selbst dabei im Zentrum allen Seins. Bestehend aus Gedanken, Geschichten und Einzelschicksalen, die uns nur beiläufig tangieren, schwirren diese kleinen Puzzlesteine durch Sekunden unserer Aufmerksamkeit, um danach unbeachtet durch den Tag zu fliehen - ohne Wirkung? Oft im Sonnenuntergang erleben wir den Schnitt, der uns ein Licht aufgehen lässt und der den einen oder anderen Gedankengang zu Tage fördert, nur um uns zu sagen, dass nicht alles einfach so nur ist. Gedanken aus dem Licht der Dämmerung sind die Texte in diesem Buch; mal philosophiert, romantisiert oder als Anekdote des Lebens eingefangen.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 115
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Inhaltsverzeichnis
Alltagsphilosophisches
Geschichten
Liebe und Romantik
Kindergeschichten
Alltagsphilosophisches
Alltagsphilosophisches
Mein Leben,
Schlaf und Schicksal,
Wahrheitslichter,
Nachtdemenz,
Traumverbannung,
Verschmähtes Herz,
Persönliches Leben,
Des Poeten Wahrheit,
Gestapelte Höhlen,
Ehre des Abends,
Da liegt ein Mensch,
Neulust,
Aus dem Rahmen,
Überwunden,
Philosophen,
Geistiges Dilemma,
Winteraktionismus,
Reifer Tropf,
Cockpit,
Kopf und Stein,
Ich will mehr,
Suizid der Lüge,
Zeitverkauf,
Löcher im Morgen,
Der letzte Sog,
Versuch(ung
),
Rechenschaft,
Kraftvolle Leere,
Widerspenstig,
Aus der Tür,
Allgegenwärtige Träume,
Unverstand,
Ungeschriebenes Leben,
Der kleine Tod,
Optimist – Pessimist,
Verschmachtete Träume,
Lebensuhr,
Blüten des Lebens,
Entbindung,
Magische Jahre,
Brückenbau,
Treiben lassen,
Durchhalteparolen,
Nachbilder,
Vorahnungen,
Übersatt und fehl ernährt,
Poesieventil,
Glückssekunden,
Nichtoffenbarung,
Assoziationen,
Einfalt,
Gesicht zu wahren,
Angst zurück zu bleiben,
Zu laut,
Verlustangst,
Gesagter Unrat,
Halbe Tage,
Forsche und Lahme,
Scherben der Eitelkeit,
Neue Lenker,
Missgunst,
Ich sterb’ immer gleich,
Überhitzung,
Neue Welten,
Ein Buch,
Ablenkung,
Hier – Dort – Dahinter,
Weltgesichter,
Mein Leben
Ich kann nicht diese Lieder singen,
welche auf mir reiten, und kann nicht
diese Lächeln lachen, welche mich
bestreiten.
Ich kann nicht diese Worte sprechen,
die mir nicht gehören, und nicht
die Blicke dorthin lenken, wo sie
keinen stören.
Ich kann nicht diese Töne fühlen,
die mir nichts bedeuten, und nicht
mit bloßem Daumendrehen
meine Zeit vergeuden.
Ich kann nicht hinter Gittern
leben, die ich mir nicht baute,
und meinen Kreis nach denen richten,
denen ich nie traute.
Drum singe ich die Lieder, die ein
Lachen an mich schmiegen,
und spreche neue Worte, die die
Augen nicht belügen.
Ich höre dann das Echo, das mir
meine Zeit erweitert,
und breche auf die Stäbe,
zu erfahr’n, was mich befreit hat.
Schlaf und Schicksal
Ein Herz rast durch die Nacht,
entfernt von Welt und Wirklichkeit,
zerfallen auf die Macht,
die ungern feilscht um seine Zeit.
So unbekannt die Not,
so wichtig fühlt sie sich doch ein,
denn wenn sie uns bedroht,
erfährt man, was es heißt, zu sein.
Vom Blau des Lichts umringt,
erpocht ein jeder Schlag sich Glück,
das Spiel um Hoffnung bringt
es um und oftmals auch zurück.
Die Nacht verstreicht den Schein,
ein Gähnen schreckt sich zu ihm auf,
das Licht hört auf zu schrei’n,
der Schlaf fährt fort im Schicksalslauf.
Das Blaulicht in der
Nacht macht kurz
bewusst, was morgens
keine Sorge macht.
* * *
Wahrheitslichter
Wird es Licht aus der Erscheinung,
sieht man seinen Schatten nicht,
man erspart sich die Verneinung,
die die Wahrheit bringt ans Licht.
Fällt die Wahrheit aus den Lichtern,
sammelt man die Scherben auf,
Riss in Mosaikgesichtern
zeigt den Wirklichkeitsverlauf.
Nachtdemenz
Ich blicke durch den Staub der Stadt,
der sich dort ausgebreitet hat,
wo manches andere Gesicht,
das kam und kommt, den Blick zerbricht.
Es brummt Gewohnheit unter mir,
sie fährt tagtäglich durchs Revier
und transportiert die Leiber fort,
wohin, weiß kein Bestimmungsort.
Wer kommt und geht, der ist nicht frei,
wer schwarz fährt, sorgt für Einerlei,
mein Gähnen schließt sich mit der Tür,
den Blick nach draußen ich entführ‘.
Ich leg die Hände in den Schoß,
was hier nichts sagt, ist dort nicht los,
das Schweigen ist nicht Höflichkeit,
nur von zu Haus nach hier entzweit.
Mir kommt es vor, dass alles klebt,
was von der Hand ins Dasein lebt,
und auch ich selbst verliere nur
die Fahrtrichtung an meine Spur.
Am letzten Haltepunkt entweicht
mein Tag, der nicht zum Ende reicht,
verlässt die Lupe des Moments,
fährt weiter in die Nachtdemenz.
Die Müdigkeit der
Stadt einen Spiegel in
den Menschen hat.
Traumverbannung
Die Nacht hat’s mir gesagt und mich ganz
unverhofft ins Glück geschickt.
Der Unverstand der Grübelei ist mir
mit einem Mal entrückt.
Gerührt von meiner Einsicht
hat ein Schauer sich in mir gelöst.
Der Atem dieses Augenblicks hat Seufzen
in den Traum geflößt.
Es deckt ihn zu, schickt ihn nicht weg
und lässt ihn schlafen durch die Zeit,
wohl wissend, dass er tief in mir
als Sehnsucht weiter fort gedeiht.
Doch wach ich auf, erklärt der Tag,
dass auch die Nacht zuweilen lügt,
wenn sie der Sehnsucht sich verschreibt
und mich ihr Sternenhimmel trügt.
Dann liegt er da und wird entblößt
durch Farben aus der Gegenwart,
sein Dunkel mich erneut ergreift,
weil’s nicht mehr ist mit Nacht gepaart.
Verschmähendes Herz
Ach flöße doch mein Herz hinab
zum Abgrund meiner Lieder,
es fände, was ich mir nie gab,
den Seelenfrieden wieder.
So weint es nur in Melodien
und kann sie nicht verstehen,
so oft sie schon im Leid gedieh’n,
nicht eins wird so vergehen.
Ich hebe auf ein jedes Los,
mir selbst geschenkt aus Worten
und lege sie mir in den Schoß,
doch nur, um sie zu horten.
Darüber noch das Hoffen pocht,
ich würd’ es gerne tragen,
es läuft beständig vor mir fort,
um nicht den Schoß zu fragen.
Dort halt’ ich meine Perlen fest,
mein Herz sucht nur den Goldstaub,
vielleicht sich’s einst verlocken lässt,
zu schätzen, was ich aufklaub’.
Was man hat, muss
man erst finden, wenn
das Herz beginnt zu
schwinden.
Persönliches Leben
Es gibt kein Recht, sich auszuruh’n,
weil uns das Leben nicht erzwingt,
wer lebt, der muss auch etwas tun,
sonst bleibt er immer nur ein Kind.
Nimmst du das Leben ernst, dann sieh
‚sozial sein’ als ein Spiel darin,
das nur aus einem Grund gedieh,
weil jemand hortete Gewinn.
Dort gibt und nimmt ein jeder das,
was ihm Bequemlichkeit verschafft,
im Nehmen liegt fast immer Spaß,
das Geben kostet eigne Kraft.
Und nimmst du nur aus einer Pflicht,
weil diese dir natürlich scheint,
versteh’n die anderen dich nicht,
das Leben hat’s nicht gut gemeint.
Vergibst du dich, wird auch nichts draus,
kein Mitleid schürt das letzte Hemd,
dies zieht dir schon der Anspruch aus,
der meist den Träger gar nicht kennt.
Und selbst ein faires Hin und Her
nicht immer nur im Rahmen bleibt,
denn Recht hat schließlich immer der,
der weiß, wie man’s mit Regeln treibt.
So spiele oder lass es sein,
das Risiko bleibt immer stur,
nicht gut und auch nicht sehr gemein,
persönlich ist das Leben nur.
Des Poeten Wahrheit
Die Zeit bestimmt,
woraus sich der Poet besinnt,
erfragend sich aus dem Verstand:
die Dinge leben wortgewandt.
Das Nackte spricht,
verkleiden möchte er es nicht,
in Kleidung hüllen aber schon,
verdient sonst kaum der Lyrik Lohn.
So nimmt er Maß,
und sind die Bilder noch zu blass,
enthebt er sie aus ihrer Welt
mit Farben, die sein Fühlen wählt.
Von dort nach hier,
verblümte Kunst fällt zu Papier,
ein jedes ist ein Unikat,
Moment aus Licht, das Freiheit hat.
Die Wahrheit wird
auf diese Weise ausprobiert,
doch maßt sich Wirklichkeit nicht an;
nur dann man Versen glauben kann.
Gestapelte Höhlen
Moderne Lebenskünstler wohnen
in gestapelten Höhlen
und malen ihr Leben
in stetiges Nölen.
In Galerien gleicher Demut
sind verewigt Skulpturen
der Domestizierung
entmenschlichter Spuren.
Die Lust zur Künstlichkeit erfanden
nach Epochen aus Kriegen
die Gründer der Freiheit,
um Kunst zu besiegen.
Sie selber blieben lieber Spießer
der geopferten Träume
und halten die Stellung
im Schatten der Räume.
Und neue Kunst, zu überleben,
ohne Platz zu verschwenden,
entwickelt die Bürde
aus Würde in Wänden.
Aus Kunst wird Kampf im Künstlerdasein
um Kultur in den Gruften
mit Leihartefakten,
für die sie nicht schuften.
Moderne Lebenskünstler hausten,
werden Forscher einst sagen,
in Höhlen des Krieges
aus besseren Tagen.
Wohnungstürme
schirmen ab, was der
Fuß der Erde gab.
Ehre des Abends
Die Stimmung der Nacht ist am Morgen des Regens
ein alberner Traum aus verschlungenem Wein.
Gebettete Wunder der Welt eines Abends
bezweifeln den Zauber und halten sich klein.
Aus dunkler Belichtung euphorischer Stunden
entschwanden die Blicke in endlose Nacht,
und selig verweilten sie tief in der Zukunft,
in finsteren Weiten kein Horizont wacht.
Ich klage durch Tropfen aus Pein hinter Scheiben,
warum ich verstand, was sich nun nicht erklärt:
Geschwätz einer Sehnsucht, mich selbst zu verlassen,
ernüchtert vom Rauschen die Hoffnung verwehrt.
Wie lang muss mein Zaudern das Zuckerbrot essen,
um Peitschen des Morgens als Sinn zu versteh’n?
Vermächtnis der Antwort im Abgrund der Seele
will niemals dem Balsam der Nächte entgeh’n.
Noch einmal bezahl ich die Zeche des Tages
mit Blüten aus meinem erpressenden Tun;
und glaube wahrhaftig, die Ehre des Abends
lässt morgen die Zweifel am Sonnenschein ruh’n.
Da liegt ein Mensch
Da liegt ein Mensch im Winkel meines Auges,
und wie ein Sandkorn quält er mich, zu reiben,
doch er bleibt liegen und beginnt zu brennen,
will mir die Tränen in die Augen treiben.
Ich schließ sie zu und lass die Sonne wärmen,
es heilt das Glück die Pein, die ich nicht habe,
doch das, was brennt, verbeißt sich immer tiefer,
auf dass mein Kopf sich an den Schmerzen labe.
Ein Blick voran, dort seh’ ich meine Freiheit,
der ich nicht glaub, weil sie mich zwingt, zu suchen,
und auch das Weh vergibt nicht meine Mühen,
nicht mich, nur dies beginn ich, zu verfluchen.
Ich lenk mich ab, Phantome zu verscheuchen,
und finde viel, das ungeahnt die Zeit frisst,
ein Wimpernschlag aus Zufall des Gewissens
entdeckt im Eck, was immer noch ein Dorn ist.
Am Scheideweg, wo Harren wird zum Unsinn,
die letzte Chance, zu heilen meine Schmerzen;
geh ich vorbei, verbrennt daran die Seele,
doch hab ich Mut, verbinden sie die Herzen.
Warum braucht das
Helfen Mut? Weil es
einem etwas tut.
Neulust
Aufgerieben hatte
verwirkte Neulust
Zeit genug,
Legitimität zu suchen.
Doch strebte sie allein
nach dem Gefühl,
nicht in den Tag
hineinzufluchen.
Schoss übers Ziel hinaus,
ließ Meilensteine
achtlos liegen;
fand sich begnadet,
ganz ohne sie
davonzufliegen.
Im Höhenflug
zerschellten
neue Horizonte
in Weiten, wo noch nie
die Zukunft wohnte.
Verblasster Sturzflug
bald verschollen
in Räumen
ohne Wollen.
Aufgerieben ...
Abgetrieben.
Aus dem Rahmen
Flache, hingeschmierte Bilder
sind die Opfer von Beschwerden,
weil die Rahmen, die sie schmücken,
nicht durchs Klecksen weiter werden.
Augen sind schon längst verdorben
durch das allzu nahe Gieren,
doch so schwinden alle Grenzen
zwangsentschärfter Wunschtraumschlieren.
Tief im Auge des Betrachters
Größe, die das Hirn erfindet,
mit Gewöhnung an den Glauben
Ziel des Blickes Hoffnung schwindet.
Ein erneutes Distanzieren
wird nur selten jemand wagen,
denn mit ausgeholtem Abstand
kann die Kunst den Künstler schlagen.
Und der Blick stößt durch die Fasern
seiner farbverdorb’nen Leinwand,
fällt so weiter aus dem Rahmen,
den er für sein Bild zu eng fand.
Wenn Selbstgefälligkeiten
ihren Horizont erweitern,
dann sprengen sie den
Rahmen, ohne andre zu
erheitern.
Überwunden
Nein, es ist nicht überwunden,
nein, es ist nicht ungescheh’n,
hab so lange mich geschunden,
um ein Ende abzuseh’n.
Jenen Stürmen meiner Mühen
und den Wirbeln ihrer Wut,
konnte ich kaum Kraft entziehen,
Ausgesetztheit nahm mir Mut.
Mitgerissen wurden Wahrheit,
Lügen, Träume und ein Lied,
dessen Harmonie und Klarheit
schnell im Sog des Lärms verschied.
Wie ein Wunder stürzte Frieden
über Ängstlichkeit herein,
schlafend oder gar verschieden,
doch die Ruhe trog der Schein.
Denn nach Suchen tief im Schmerze
lebte ich in Dunkelheit,
einem Auge, dessen Schwärze
bald erneut den Sturm befreit.
Die trügerische Sicherheit im Auge des Orkans
verbirgt, was er hat längst befreit, als Fortsetzung
des Plans.
Philosophen
Der Abend schenkt dem Philosophen
Weite für die Lebensstrophen,
denn die Tageslichter schmieren
Farben, die den Geist verwirren.
Die Nächte decken auf die Schatten,
Dunkelheit kann viel verraten,
wenn Konturen nichts umreißen,
kann der Geist sich daraus speisen.
Der Denker findet kleine Lichter,
hört Geräusche, sieht Gesichter,
die am Tag gefangen scheinen
und um ihre Freiheit weinen.
Gedanken sind die ersten Worte,
suchen wahrheitliche Orte,
und vom Schutz des Traums umgeben
lernen sie, zu überleben.
Das Züngeln neuer Morgenflammen
kann die Nachtgedanken bannen,
doch wenn Väter sie behüten,
treiben sie in Kindern Blüten.
Geistiges Dilemma
Im Knäuel
verflochtener Informationen
entstehen geradlinige Quintessenzen,
welche in Sinne und Gelenke fließen,
Emotionen erheben und verderben,
das Wissen bereichern und zerschießen.
Gehandelt
entraubt das Verhandelte
den willigen Werkzeugen die Souveränität,
entflieht in mentale Knoten,
beschwert mit den Fronten der Wahrheit,
um neue Befehle auszuloten.
Ein Bote,
beflügelt von Neugier,
auf Wegen von Fragen zu Fragen,
doch Antworten niemals genügen,
denn das, was nicht denkt, kann nur leben,
in Unschuld die Herrscher belügen.
Gefährten
der Schwäche vernebeln das Sein,
doch das klagende Rennen geht weiter,
ein Wettlauf der Angst mit der Zeit;
verklungener Herzschlag geopferter Körper
bleibt unbeeindruckt vom geistigen Leid.
Der Geist nutzt als Werkzeug
das Fleisch, doch dieses macht
jenen mit Irrtümern reich.
Winteraktionismus
Ich habe die Gefühle in den Schnee gestarrt,
dort haben sie im Frost des Willens ausgeharrt,
den Winterschlaf der Welt verneint in meiner Hast,
Entschlüsse ungeboren viel zu früh gefasst.
Verstrickt in eine Ansicht, die ich nie besaß
verschwand des Sommers Glaube hinterm Fensterglas,
hinaus, ich wollte fort, doch etwas hielt mich auf,
ich ließ dem Zank von Tun und Ruhen seinen Lauf.
Ich hab gedacht, ich hab geflucht, doch nie geweint,
denn Tränengründe waren mit dem Schnee vereint,
Kalküle kurzen Atems haben unbedacht
das Spüren wahren Denkens um sein Recht gebracht.
Erwacht aus meiner Trance klagt mich das Frühjahr an:
Was hast du deiner Müdigkeit nur angetan?
Die Emotionen aufgetaut, sie sind enttäuscht,
dass ihrem Wunsch kein Tatendrang entgegenfleucht.
Es folgt der Winterlethargie die Frühjahrsmüdigkeit,
so wach und müde wie noch nie, zu keiner Tat bereit,
Entschlüsse, die die Kraft mir raubten, sind verpufft,
weil ich die Kraft nicht spüren kann, die nach mir ruft.
Reifer Tropf
Manchmal tanz ich in der Pubertät,
wenn sie mir in meinen Sinn gerät,
pfeife auf verbohrte Zukunftsspur,
hau mein Lachen in die Reifekur.
Klopf auf Schultern, die ich nie gekannt,
geh’ gemütlich, wo ich sonst gerannt,