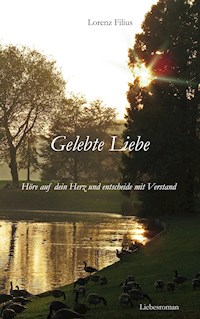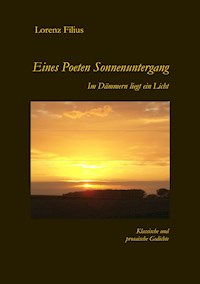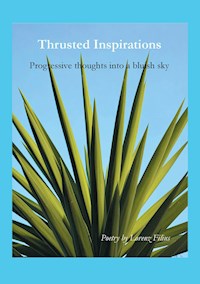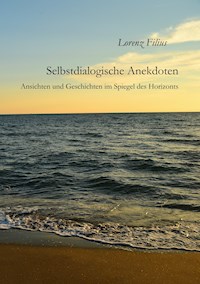7,49 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Books on Demand
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Alle Anstrengungen des erfolglosen Hobbyautors Sebastian schlagen fehl, auf dem Büchermarkt Fuß zu fassen. Da lernt er in Stockholm die englische Theaterschauspielerin Wanda kennen. Sebastian ist fasziniert von der distinguierten Erscheinung seiner Bekanntschaft, und dies umso mehr, als sie ein gemeinsames literarisches Interesse eint. Bei einem Besuch in London, wo Wanda Sebastian zu einem Verlagsangebot verhelfen will, kommen sich beide nur langsam näher, denn nach und nach erhält Sebastian Einblicke in Wandas Leben und ihre schicksalhafte Vergangenheit. Zudem stellt sich das Verlagsangebot als Enttäuschung heraus. Blind vor Erfolgssucht findet sich der von Ehrgeiz gebeutelte Autor bald auf der Gratwanderung zwischen seinen Gefühlen für Wanda und einer zweifelhaften Karriere in einer ebenso zweifelhaften Literaturfabrik. Und während ihm die Zusammenhänge allmählich klar werden, muss Sebastian miterleben, wie Wanda ein weiterer Schicksalsschlag ereilt.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 451
Veröffentlichungsjahr: 2021
Ähnliche
Inhaltsverzeichnis
Ein seltsamer Fund
Verlockende Angebote
Vertrauen
Wermutstropfen
Gewonnen und Zerronnen
Verjagte Geschichten
Epilog
Wenn die Zukunft offen ist, …
… gibt es keinen Grund, vor der Vergangenheit zu kapitulieren.
I. Ein seltsamer Fund
„Mach doch mal Schluss für heute, Sebastian“, meinte Marcus, der immer mal wieder an meiner Zimmertür klopfte, um sich neugierig nach meinen Fortschritten zu erkundigen.
„Ja gleich, nur noch diesen Absatz“, antwortete ich, versunken in den Text, den ich auf den Bildschirm schrieb.
Es ging mir leicht von der Hand, und deswegen konnte ich nie aufhören, wenn ich einmal angefangen hatte. Man musste mich schon von außen stoppen. Marcus und Lena schafften es manchmal nur schwer, mich zu etwas anderem zu bewegen, fort von dem, was mir eigentlich am meisten Spaß machte und auch heute noch macht - dem Schreiben. Aber irgendwie hatten die beiden immer gute Ideen, etwas zu dritt zu unternehmen, so dass ich mich denn auch gerne von ihnen ablenken ließ. Sie waren meine Zimmernachbarn in einer etwas ungewöhnlichen Wohngemeinschaft in der Stockholmer Innenstadt. Ungewöhnlich deswegen, weil wir alle aus anderen Ländern stammten – eine internationale Gruppe sozusagen. Lena kam aus Norwegen, war noch Studentin der Medizin und mit ihren 23 Jahren recht übermütig, was aber immer für frischen Wind auf unserer Etage sorgte. Langweilig wurde es mit ihr nie. Marcus war ein echter Texaner und arbeitete bei einem schwedischen Forstunternehmen als Landschaftsplaner. Und ich, ja ich komme aus Deutschland und bin als Letzter, wenn auch mit meinen 35 Jahren als Ältester zu dieser Gruppe gestoßen. Unsere Wohngemeinschaft war ein eingespieltes Team, sowohl was unsere gemeinschaftliche Organisation anbetraf als auch unsere Freizeitgestaltung. Diese fand vorwiegend am Wochenende statt, während unter der Woche jeder eher so seiner eigenen Wege ging. Klagen konnte ich über mein Leben eigentlich nicht. Nach Schweden hatte es mich verschlagen, als vor einigen Jahren zwei unangenehme Dinge gleichzeitig mein Leben veränderten: die Trennung von meiner langjährigen schwedischen Freundin Sonja in Deutschland und der Verlust meines dortigen Arbeitsplatzes; eine ideale Voraussetzung, ein ganz neues Leben zu beginnen, fand ich damals. Und über einen Tipp von Sonjas Freunden aus Schweden bin ich dann in Stockholm gelandet, weil die Universitätsbibliothek dort zu diesem Zeitpunkt gerade einen deutschsprachigen Mitarbeiter suchte.
Ich bin Bibliothekar und … Schriftsteller, jedenfalls bezeichne ich mich so, und heute mag ich Letzteres mehr denn je; nicht etwa, weil mich die Schreiberei früher nicht zufriedenstellte, sondern weil sich der Sinn dieser Arbeit für mich im Laufe der Zeit gewandelt hat, mit bedingt durch die damaligen Ereignisse. Leben konnte ich davon nie, gestern nicht und heute nicht. Aber ich habe gelernt, es zu akzeptieren. Ich bin zweisprachig aufgewachsen. Mein Vater ist Deutscher und meine Mutter Amerikanerin. Beide waren Deutsch- und Englischlehrer an einem Gymnasium, und so ist es kaum verwunderlich, dass ich frühzeitig an das Lesen und Schreiben in beiden Sprachen herangeführt wurde. Ich fand schnell Gefallen daran und entdeckte bald die Welt der Bücher für mich. Das war auch gleichzeitig das Tor zu meiner Phantasie. Davon besaß ich mehr als genug. Dies bescheinigten mir zumindest meine Eltern und Lehrer immer amüsiert, wenn ich ihnen voller Inbrunst von Geschichten aus der Schule und von Freunden berichtete, die nie und nimmer wahr sein konnten; manchmal glaubte ich sogar selbst daran. Irgendwann erzählte ich dann keine solchen Abenteuer mehr, sondern begann meine Wünsche, Träume und Ideen schriftlich festzuhalten. Und eines Tages entstand daraus ein erster kleiner Roman. Dieser gefiel nicht nur mir, sondern fand auch einen gewissen Anklang bei meinen Eltern und Freunden. Das war sozusagen der Initialfunke für mein zukünftiges Hobby. Was ich schreibe? Romane – Romane und Gedichte in deutscher und teilweise auch englischer Sprache. Mittlerweile füllen meine Abhandlungen immerhin zwei Regalbretter, allerdings wohl eher bei mir in Form von verstaubten Manuskriptordnern als bei meinen potentiellen Lesern in Buchausgaben.
Bibliothekar war ich nicht immer. Ich habe studiert, aber nicht wie man erwarten könnte, Germanistik oder Literaturwissenschaft, nein, etwas völlig Artfremdes zog mich nach der Schule in den Bann: die Physik. Das war mein zweites Steckenpferd und dazu bis zum Abitur mein bestes Schulfach. Die Überlegung, gerade in dieser komplexen Disziplin ein Studium aufzunehmen, kam nicht unbedingt aus der Überzeugung, sondern zum großen Teil aus der Annahme, dass ich damit später bessere Chancen auf dem Arbeitsmarkt haben würde. Mit meiner Literatur könne ich mich auch privat beschäftigen, dachte ich mir. Aber das Studium ging nur schleppend voran, und vor allem die Mathematik bereitete mir zusehends Schwierigkeiten. Ich entwickelte mehr und mehr eine Abneigung gegen mein gewähltes Fach. Vielleicht hätte ich die Prüfung nach den ersten vier Semestern durchaus schaffen können, wenn ich mich mehr in das Lernen und die Vorbereitungen gestürzt hätte. Aber stattdessen zog ich es vor, dem nachzugehen, was mich vom Herzen her viel mehr interessierte: dem Lesen und Schreiben von Geschichten. Und anstatt Vorlesungen und Seminare zu besuchen, fand ich es viel angenehmer, diese Zeit auf der Universitätswiese zu verbringen und mich in meine Gedankenwelt hineinzuphilosophieren. Gewappnet mit Block und Stift, verfasste ich dort oft seitenweise prosaische Texte und Lyrik; zum Leidwesen meiner Eltern, die das Studium schließlich finanzierten. Ich dachte nicht an die Realität der Zukunft. Stattdessen phantasierte ich, wohl aus meiner Frustration heraus, vom großen Erfolg als Schriftsteller, welcher sich gedanklich so schön auf die lange Bank schieben ließ. Es kam, was abzusehen war – ich brach den Studiengang ab. Eigentlich taten dies meine Eltern, die weder gewillt waren, meine Luftschlösser zu finanzieren, noch einen zweiten Versuch an der Universität abzuwarten. Ich musste und wollte endlich mein eigenes Geld verdienen. Es wurde höchste Zeit für eine solide Ausbildung. Zwischenzeitlich hatte ich mich mit einem Aushilfsjob in der Universitätsbibliothek über Wasser gehalten. Dort bekam ich dann wenig später die Möglichkeit mich zum Bibliothekarassistenten ausbilden zu lassen. Meine Zeit in Deutschland neigte sich dann aber, wie schon erwähnt, nach mehreren Jahren dem Ende zu, und ich trat meine Arbeit an einer kleinen Stockholmer Bücherei an.
So bewegte ich mich tagsüber zwischen dem, was ich vor allem abends und an den Wochenenden selbst verfasste, Büchern. Diese Arbeit machte mir immer Spaß, weil sie ja auch irgendwie mit meinem Hobby zu tun hatte, wenngleich es mehr eine Verwaltungstätigkeit als literarische Beschäftigung war. Manchmal aber habe ich sie gehasst, und es gab Tage, an denen ich die Bücherei am liebsten gemieden hätte wie der Teufel das Weihwasser. Es waren jene Tage, die mir wieder einmal vor Augen führten, dass ich das, was andere geschafft hatten, dokumentiert durch ihre Werke in den Regalen der Bibliothek, wohl nie zustande bringen würde. Ja, ich wurde oft richtig neidisch, wenn ich mir alle die bekannten Autoren betrachtete, die sich dort einreihten, in Werke, die teilweise weltweit gelesen wurden und werden. Besonders ernüchternd waren dabei jene Momente, in denen mein Traum, ein erfolgreicher Autor zu werden, schwarz auf weiß zerstört wurde, wenn ich wieder einmal eine Verlagsabsage erhalten hatte. Ich schickte den unterschiedlichsten Verlagshäusern regelmäßig Manuskripte zu. Um meine Chancen zu erhöhen, von einem Verlag angenommen zu werden, fasste ich meine Romane teilweise zweisprachig ab, um auch im englischsprachigen Ausland mein Glück versuchen zu können. Danach wartete ich oft wochenlang, nicht selten ganze Monate, auf eine Antwort. Dabei spielte sich abends, wenn ich von der Arbeit nach Hause kam, immer das gleiche, fast magische Ritual vor meinem Briefkasten ab. Ich stand davor und hoffte inständig auf einen kleinen Briefumschlag eines Verlagshauses als Antwort. Meist jedoch, wenn ich den Kasten öffnete, befand sich entweder gar nichts darin, oder eben das Übliche. Früher oder später kam aber dann immer der Moment, bei welchem mich das Aufschließen der kleinen Tür auf den Boden der Tatsachen zurück holte. Da war er wieder, der große, dicke Umschlag, der mir wie ein Bumerang in die Erwartung schlug und welchen ich allzu gut kannte.
An solchen Abenden war mit mir nicht mehr sehr viel anzufangen. Meine zwei Mitbewohner hatten dann ihre liebe Mühe, mich aufzurichten, was mir besonders für Lena leid tat, denn sie war stets sehr bemüht um mich. Kein Wunder, sie war mein größter Fan. Sie liebte besonders meine Gedichte. Sie seien so gefühlvoll, wie sie meinte. Manchmal saß sie stundenlang am Wochenende bei mir und lauschte dem, was ich fabriziert hatte. Das baute mich auf und spornte mich an, weiterzumachen. Wenn ich leicht beschwingt nach solch einem lyrischen Nachmittag einen Spaziergang durch die Stockholmer Innenstadt machte, konnte ich neuen Mut fassen und der Hoffnung Nahrung gegeben, dass mich irgendwann ein kleiner Brief eines Verlages erreichen würde, mit den erlösenden Worten: ‚Wir freuen uns, Ihnen mitteilen zu können …’. Die Realität holte mich selbstredend zum Wochenbeginn erneut ein, wenn Alltag und Broterwerb das Leben bestimmten und meine Lieblingstätigkeit in den Hintergrund rücken ließ; wenn auch Lena keine Zeit hatte, sich mit meiner Literatur zu befassen und die dicken Umschläge weiter ihr Unwesen in meinem Briefkasten trieben. Ich fragte mich, ob es nicht doch auch ein wenig Mitleid meiner Zimmernachbarin war, obwohl mich meine Texte selbst eigentlich schon überzeugten. War es nicht dennoch eine reine Zeitverschwendung, Geschichten zu schreiben, die letztendlich keiner lesen wollte, Gedichte zu verfassen, die zwar nett anzusehen und zu rezitieren waren, jedoch nicht zu einer breiten Veröffentlichung taugten? Sollte ich nicht lieber meine Seele von Illusionen befreien, indem ich nach getaner Arbeit einfach das täte, was meine WG Nachbarn auch taten – nämlich Freizeit machen, mit Beschäftigungen, die mir wirklich einen Ausgleich brächten? Und genau das war es ja; die Schreiberei brachte mir den Ausgleich, aber immer nur bis zu einem Punkt: dem Punkt, wo ich gewahr wurde, dass ich mehr wollte als diesen Ausgleich. So wurde daraus Zug um Zug ein Zwang und ein Krampf. Aus der Lust, das zu tun, was ich tat, entstand der Frust, nicht das zu erreichen, was ich wollte. Ein Teufelskreis; je mehr ich an mich glaubte, desto niederschmetternder waren die Misserfolge und desto größer der verzweifelte Versuch, es wieder zu probieren.
Auf diese Weise sammelten sich allerhand Manuskripte und lyrische Texte an, bis zu dem Tag, an welchem Lena eine Idee hatte. Sie wurde im Internet auf einen Verlag aufmerksam, welcher anbot, gegen eine geringe Gebühr selbst verfasste und korrigierte Manuskripte in gedruckte Bücher zu verwandeln und auf den Markt zu bringen. Es handelte sich um einen sogenannten Print on Demand Service. Sogar eine richtige ISBN für mein eigenes Werk sollte ich erhalten. Euphorisch las ich mir das Angebot mehrmals durch und konnte nichts Schlechtes dabei finden. Ja, das war die Chance, bildete ich mir ein, und auch Lena fand, dass es nicht schaden könne, es zumindest einmal auszuprobieren. Nach den ganzen illusionären Aufs und realen Abs der letzten Zeit schien dies endlich ein Streif am Horizont. Das, was ich mir erträumte, konnte nun wirklich wahr werden, nämlich endlich ein Buch herauszubringen. Material hatte ich genug und so wagte ich den Veröffentlichungsschritt mit einem Roman, der mir selbst sehr am Herzen lag. Es war eine Gefühlsgeschichte, nicht kitschig oder unnatürlich, aber eben doch sehr emotional. Ich mochte diesen Roman deswegen so sehr, weil er Lena besonders gut gefiel und sie wirklich weinen musste, als sie ihn las. Und da sie ansonsten eine eher nüchterne Person war, die auch bedingt durch ihre Studienwahl sehr rational dachte, war ihr Empfinden über die Geschichte ein gewisser Qualitätsmaßstab für mich. Dieses Buch, mein erstes, hat auch heute noch einen besonderen Platz in meiner Bibliothek; nicht etwa, weil es ein Bestseller geworden wäre, sondern, weil es den Ausdruck dessen widerspiegelt, was ich damals beinahe aufgegeben hätte für etwas scheinbar Wertvolleres.
Ich machte mich also gewissenhaft ans Werk, denn das, was viele andere lesen sollten, musste zwar nicht perfekt sein, sollte aber auch nicht den Anschein einer Amateurhaftigkeit aufweisen. Nein, ich nahm dieses Vorhaben ernst. Zwei Wochen lang korrigierten wir an dem Manuskript herum. Bis es endlich so aussah, wie es dann später in Druck ging, vergingen so manche lange Abende mit Diskussionen, Passagenänderungen und auch … ja, man kann sagen, kleinen Reibereien. Herzblut steckte darin, nicht nur meines, sondern auch das von Lena. Es wäre natürlich möglich gewesen, einen professionellen Lektor zu engagieren, aber dazu fehlte mir zum einen das Geld, und zum anderen hatte ich Angst, dass mein Werk hinterher nicht mehr so aussehen könnte, wie ich es mir vorstellte. Der zweite Grund war zugegebener Maßen eher vorgeschoben, um mich nicht darüber ärgern zu müssen, mir keinen Lektor leisten zu können. Dann war er da, der Augenblick, wo ich mein selbst erstelltes, sehr schlichtes Buchcover und mein Manuskript per Internet zum Verlag schickte. Und mit dem letzten Klick zur Auftragsbestätigung war es geschafft: ich hatte mein erstes Buch veröffentlicht.
Der Stolz war mir ins Gesicht geschrieben, und Lena freute sich mit mir. Sie wollte gleich als erste ein handsigniertes Exemplar haben. Allerdings nahm die anfängliche Euphorie langsam aber sicher wieder ab, denn mit der Veröffentlichung alleine war es nicht getan. Als das Buch dann offiziell erschien, war es in fast allen Buchläden bestellbar, und auch in Internetbuchhandlungen konnte man es erwerben. Es wurde aber nur gedruckt, wenn es auch bestellt wurde und war deswegen nie in Bücherregalen von Buchgeschäften zu finden. Die Verkaufszahlen blieben zunächst gänzlich aus, und warum? Ganz einfach, ich hatte mir nie Gedanken darüber gemacht, wie ich dieses Buch vermarkten sollte. Ich war so mit dem Schreiben an sich beschäftigt, dass ich mich mit Marketingstrategien nicht befasst hatte. Dieser wichtige Punkt war natürlich für die unschlagbar niedrige Veröffentlichungsgebühr nicht zu haben. Und da lag letztendlich der Hase im Pfeffer begraben. Wie sollte ich mein Buch an den Leser bringen? Das, was die großen Verlage für ihre Autoren an Werbemaßnahmen bewerkstelligten, stand aus Kostengründen für mich absolut nicht zur Disposition. Kleine Maßnahmen, sehr kleine, konnten wenigstens im Laufe eines Jahres die Gebühren der Veröffentlichung wieder ausgleichen. Mund zu Mund Propaganda, Flyer und selbst gedruckte Werbeaushänge hier und da in der Stadt hinterließen kaum eine Wirkung. Immerhin, neben einigen Exemplaren, die ich selbst gekauft hatte, erwarben vor allem Personen im Bekanntenkreis hier und da ein Buch.
So stand ich denn nach einiger Zeit wieder an dem Punkt, wo sich die Euphorie langsam zur Ernüchterung entwickelte. Ich hatte es mittlerweile aufgegeben, meine Manuskripte an Verlage zu schicken, vor allem, als mir Lena berichtete, dass sie von einer bekannten Buchhändlerin erfahren hatte, dass jährlich von tausenden eingesandten Manuskripten bei Verlagen nur einige wenige überhaupt in die nähere Auswahl zur Aufnahme in deren Programm kämen. Ich war also, was mein schriftstellerisches Wirken betraf, immer noch das, was ich war, ein mehr oder weniger erfolgloser Autor für den Heimgebrauch. Immerhin hatte mich diese Erfahrung etwas von den Illusionen befreit und mein Schreiben wurde entkrampfter. Aber in meinem Inneren werkelte immer noch der heimliche, unerhörte Wunsch, es irgendwann einmal zu schaffen; wie eine Flamme, die fast erloschen ist und doch bei entsprechender Nahrungszufuhr zu züngeln beginnt, um das Feuer einer Leidenschaft zu entfachen; einer Leidenschaft die im falschen Luftzug droht selbst zu verbrennen.
„Wie ist es, Bastian?“ Marcus stellte sich neben mich und blickte desinteressiert auf meinen Bildschirm. „Lena und ich wollten eine Kleinigkeit essen gehen, hast du Lust mitzukommen?“
„Ja, mein Magen könnte auch etwas vertragen“, riss ich mich endlich los, klappte mein Notebook zu und schloss mich den beiden an. Wir wohnten in Östermalm, einem Stadtteil im Herzen von Stockholm, in einer gemütlichen Dachgeschosswohnung. Obwohl dies eine der besseren Wohngegenden im Innenstadtbereich war und die Mieten entsprechend hoch, konnten wir uns diesen Luxus leisten, da unsere Gehälter zusammen eben dazu ausreichten.
„Galerian?“, schlug Lena vergnügt vor, als wir das Haus verließen.
„Ich brauche heute Abend ein richtiges Steak“, grummelte Marcus, „morgen früh muss ich wieder hart ran; also von mir aus ins Steakhaus im Galerian.“
Da auch Lena und ich einen ziemlich herzhaften Hunger hatten, einigten wir uns auf das Steakhaus. Dieses lag in einer großen mit Glaskuppel überdachten Einkaufsgalerie in Mitten des Stadtzentrums. Diese Art Einkaufszentrum mit allen möglichen Fachgeschäften, kleineren Kaufhäusern und gastronomischen Lokalitäten unter einem Dach ist sehr häufig in Skandinavien zu finden. So kann sich das öffentliche Leben auch in den kalten, langen Wintern ohne zu frieren entfalten. Ich mochte Stockholms Galeria sehr, nicht nur wegen der Auswahl, sondern auch wegen des Flairs, welches schon alleine durch das natürliche Licht der Glasüberdachung vorhanden war. Wir ließen uns in dem gemütlichen Gasthaus nieder und gaben unsere Bestellungen auf.
„Na, was macht die Kunst?“, fragte Marcus mich mit einem leicht ironischen Gesicht.
Er schien mein Hobby eher nicht ernst zu nehmen und verstand es, mich damit aufzuziehen. Allerdings meinte er es nie böse, sondern wohl mehr realistisch. Wer den Schaden hat, dachte ich mir, und Lena knuffte ihren bärigen Nachbarn heftig in die Seite.
„Hör auf, Marcus. Du musst ja nicht gerade in seiner Wunde herumstochern.“
„Lass gut sein“, antwortete ich, „es gibt ja auch wirklich wichtigere Dinge im Leben als das.“
„Nur, dass du dir diesen Satz selber nicht so recht zu glauben scheinst.“, meinte Marcus nun mehr besorgt als ironisch. „Mal im Ernst“, fuhr er fort, „ich kenne ja deine Geschichten nicht so gut und das Schöngeistige ist eh nicht so mein Metier“, dabei ließ er grinsend seinen Trizeps spielen, „aber glaubst du nicht, du steigerst dich in eine Idee hinein, die wirklich fernab jeglicher Realität liegt?“
„Ich sehe es ja realistisch, eigentlich, aber irgendetwas in mir treibt den Gedanken trotzdem voran, verstehst du?“
„Nee“, entgegnete er, und man sah ihm sein Unverständnis an, „ich weiß, was ich brauche, und weiß auch was ich dafür tun muss, und das im erreichbaren Maße. Du aber scheinst dir einzubilden, etwas haben zu müssen, was du gar nicht brauchst. Schau, du hast einen feinen Job, eine coole Wohnung und nette Kumpels“, dabei zeigte er auf Lena und sich, „mach dir mit deinem Hobby doch keinen Zwang; was kommt, das kommt, und der Rest wird sich zeigen. Wichtig ist …“, er wurde durch die Kellnerin unterbrochen, die unsere Menüteller brachte, „ … das zum Beispiel!“. Marcus rieb sich seinen Bauch und war mit einem Mal bei einem ganz anderen Thema.
„Ich glaube nicht, dass es so einfach ist, wie du sagst Marcus“, erklärte Lena. „Du magst dich ja mit deinem Leben, so wie es ist, zufrieden geben, aber du hast ja auch deine Ziele erreicht. Und das, was Sebastian schreibt, kann sich durchaus sehen lassen.“ Sie zwinkerte mir Mut machend zu. „Es muss ja nicht gleich ein Bestseller werden, aber den Sprung in die Buchläden zu schaffen, das wäre doch schon mal eine schöne Sache.“
Ich lächelte und winkte ab.
„Nein ehrlich“, philosophierte Lena weiter, „auch wenn es nicht für einen Regalplatz im Buchgeschäft reicht, alleine das Ziel zu haben, bedeutet etwas. Denn nur mit einem Ziel vor Augen kannst du deinen Weg sinnvoll gehen. Und die Erfahrungen alleine schon, die du auf diesem Wege machst, werden dich irgendwie weiterbringen, das ist immer so im Leben. Wer erreicht schon alle seine Ziele? Der Weg ist wichtig, Sebastian, der Weg.“
Lena war manchmal richtig enthusiastisch, und ich hätte ihr gerne geglaubt. Sicher, ohne mein Erfolgsziel vor Augen würde ich wahrscheinlich nicht so viel zu Papier bringen, wie ich es tat. Denn der Hintergedanke, es vielleicht als Schriftsteller irgendwann in Zukunft mehr oder weniger zu etwas zu bringen, trieb mich zu diesem Zeitpunkt mehr voran als meine persönliche Freude am Schreiben. Marcus konnte Lenas Argumenten nicht viel abgewinnen.
„Aber es will eben keiner lesen“, gab er mit vollem Mund zu bedenken. „Warum schreibst du etwas, wenn es dafür keinen Markt zu geben scheint? Wenn deine Schreiberei ein Weg zu einem Ziel sein soll, welches du wahrscheinlich sowieso nicht erreichst, warum dann das Ganze? Ich gehe nur Wege, die mich auch an mein Ziel bringen, meistens jedenfalls. Alles andere ist reine Zeitverschwendung; nutzloses Umherirren, und ehe man sich umschaut, wird man alt und hat vom Leben nichts gehabt. Ich gebe dir einen Tipp Bastian: Genieße das Leben und suche nichts, was es nicht gibt, jedenfalls nicht für dich.“
„Ich tue es ja auch für mich, weil es mir Spaß macht und ich weiß, dass es nicht schlecht ist. Und ich werde nicht aufgeben“, wurde ich nun trotziger, je mehr Marcus mich auf die offensichtlichen Realitäten hinwies.
Manchmal wusste ich nicht, ob er das alles ernst meinte oder ob er mich einfach nur provozieren wollte. Diese ignorante und vernichtende Art, mir meine nicht vorhandenen Erfolgschancen unter die Nase zu reiben, machte mich wütend; wahrscheinlich mehr auf mich als auf Marcus. Das Gefühl, dass sich dabei in mir entwickelte, zehrte stärker an meinem Ego als Absagen von Verlagen. Das war immer so; jedes Mal, wenn ich mit meinen Gedanken alleine war, malte ich mir die Zukunft so aus, wie ich sie gerne gehabt hätte. Dann hatte ich auch keine Probleme mit meinen unerfüllten Wünschen. War das vielleicht Selbstbetrug? Aber immer, wenn mir jemand ganz objektiv und nüchtern seine Meinung – und die war allzu oft sehr einhellig – zu verstehen gab, blockierte ich innerlich. Ja, man kann es als eine Art Torschlusspanik beschreiben, die sich dann in mir breit machte; die Panik, dass alles, was ich geschaffen hatte, letztendlich für andere nur von geringer Bedeutung sein könnte, auch wenn es mich selbst weiter brachte. Warum nur stellte ich den positiven Hobbycharakter meiner Schreiberei so in den Schatten und wollte mich permanent an einem Erfolg jenseits meiner persönlichen Freude an der Sache messen?
Lena schaute an mir vorbei auf ein Filmplakat, welches am Eingang des Restaurants hing und schlug vor, den Abend zu dritt im Kino ausklingen zu lassen, bei einem der neuesten Actionfilme. Obwohl sie literarisch eine romantische Ader hatte, mochte sie solche Streifen, wenn sie mit guten Schauspielern besetzt waren, und Marcus war dafür ohnehin immer zu haben.
„Nee, danach ist mir heute nicht. Ich werde noch ein wenig mit dem Boot raus fahren“, erwiderte ich, als wir das Steakhaus verließen.
Als sich unsere Wege an diesem Abend trennten nahm mich Lena noch kurz beiseite und meinte: „Sebastian, Kopf hoch, ich weiß, dass du was kannst, und andere würden es auch so sehen, wenn sie es lesen würden. Also tu dir selbst den Gefallen, und schreib bitte weiter, du hast da ein Händchen für. Du würdest es später bereuen, es nicht getan zu haben, und zwar mehr als du jetzt vermutest.“
„Warum meinst du das?“
„Weil du der Typ bist, der so denkt. Glaube mir, ich habe dich ein wenig kennen gelernt, als ich deine Geschichten gelesen habe“, flüsterte Lena mir mit einem wohlwollenden Lächeln zu, „ich mag deine Romane. Und nun geh’ und denk dir was Feines aus.“
Sie klopfte mir auf die Schulter und wusste genau, warum ich noch eine kleine Bootstour machen wollte.
Mein Ziel war der Strandvägen, die große Straße in Stockholms Innenstadt, welche parallel zum einlaufenden Mälarsee liegt. Hier hatte ich ein kleines, ziemlich altes Motorboot festgemacht. Das hatte ich ein Jahr zuvor billig von einem schrulligen Inselbewohner abgekauft und mit viel Eigenarbeit restauriert. Es hatte so seine Macken; insbesondere das Anlassen des Motors war oft ein Geduldsspiel. Aber es besaß ein richtiges Steuerrad mit einer Sitzbank davor und kleinen Fensterchen um die winzige Kajüte. Es machte Spaß, damit zwischen den Schäreninseln herumzukreuzen, wenngleich ich es auch nicht wagte, allzu weit hinauszufahren. Hinter meinem Sitz hatte ich mir eine einfache Matratze ausgelegt, die die Geburtsstätte so mancher meiner Geschichten war. Auch an diesem Abend, Ende September, zog es mich genau dorthin, um hinaus zu schippern, irgendwo anzulegen, mich dann gemütlich in eine Decke eingewickelt auf meinem Lager im Boot niederzulassen und über neue Ideen zum Schreiben nachzudenken. Ich wollte die Zeit nutzen. Die Tage wurden allmählich kürzer, und gemütlich waren solche Bootsausflüge sowieso nur an sonnigen Tagen; und auch dann war eine Decke Pflicht, denn der Wind fegte teilweise unangenehm kalt über das Wasser.
Ich beeilte mich. Ich wollte noch vor Sonnenuntergang draußen sein, um diesen eben vom Boot aus mitten auf dem Mälarsee beobachten zu können. Der Motor meines Bötchens leistete unerwartet wenig Widerstand, und schon befand ich mich mit anderen abendlichen Ausschwärmern auf dem Weg zu dem, was die Schweden als ein ‚svenska lycka’, ‚ein schwedisches Glück’ bezeichnen, einer simplen Tour hinaus in die Schärenwelt. Irgendwo zwischen Lidingö, einer östlich von Stockholm vorgelagerten Insel und Nacka, einem weiteren Stadtteil der schwedischen Hauptstadt, legte ich meine kleine Nussschale an einer mitten auf dem Wasser herausragenden Felsgruppe an. Ich machte mein Boot fest, schaltete das Positionslicht ein und begab mich mit Blickrichtung Westen unter meine Decke. Dann nahm ich meinen Spiralblock und einen Bleistift heraus und lag so eine Weile sinnierend auf meiner kleinen, gemütlichen Wasserschaukel. Rechts- und linksseitig passierten unterschiedliche Boote Stadt ein- und auswärts meinen Liegeplatz. Vom Ruderboot über kleine Motorflitzer und Ausflugsdampfer bis hin zu den großen Fähren zwischen Stockholm und Helsinki war so permanent Leben auf dem Wasser. Vor allem bei den größeren Schiffen musste ich mich oft festhalten, denn die Bugwelle schaukelte mich in meiner Nussschale doch ganz schön hin und her. Aber das störte mich alles nicht. Es gehörte zum Flair des Schärenlebens einfach dazu. Ich blickte in den goldenen Sonnenuntergang, der sich über der Stadt anschickte, die typische abendliche Herbststimmung einzuläuten. Er ließ das Wasser feurig rot schillern. In der Ferne verklangen allmählich letzte Fetzen der Musik auf den Ausflugs- und Touristendampfern, und je später es wurde, desto ruhiger kreuzten nur noch vereinzelte Abendschwärmer an mir vorbei. Das war die richtige Stimmung für mich, um meinem Ideenfluss freien Lauf zu lassen. Die Wirkung dieser Momente war ein wenig ambivalent; zum einen strahlte die Atmosphäre Gemütlichkeit aus, und zum anderen konnte sie auch etwas auf das Gemüt drücken. Letzteres empfand ich nicht unbedingt als deprimierend oder traurig, melancholisch. Nein, im Gegenteil, es spornte meinen Gedankenfluss für meine Geschichten erst richtig an. Wie mit einer Apfelsine, die man ausdrückt, und die so ihre fruchtige Essenz preisgibt, verhielt es sich mit meiner Stimmung. Wenn sie melancholisch bedrückt war, kam die Essenz meiner Ideen am besten zum Vorschein, und ich hielt sie sofort schriftlich fest, um sie ja nicht wieder zu vergessen. Richtige Hochgefühle entwickelten sich dabei manchmal in mir, wenn meine Erzählungen und Beschreibungen auf diese Weise Formen annahmen. Ich empfand Freunde und Stolz gepaart mit der Wunschahnung, dass das, was ich schriftstellerisch entwickelte, andere Menschen doch wirklich interessieren müsste. Einen Fehler beging ich dabei wohl des Öfteren. Ich dachte immer, so, wie sich die Szenen meiner Romane in meinem Kopf abspielten, mit all den persönlichen Empfindungen, die ich dabei hatte, müssten sie sich automatisch auch in den Köpfen meiner Leser ausbreiten, mit den gleichen Gefühlen und Assoziationen. Und je mehr ich mich in meine Protagonisten hineinversetzte, umso mehr war ich der Meinung, diese Vorstellungen auf die imaginären Leser meiner Geschichten übertragen zu können. Eine subjektive Beurteilung der Qualität meiner Arbeit war das sicherlich, aber ich war und bin heute noch der Überzeugung, dass Geschichten erst dann leben, wenn der Schreiber sie miterlebt hat, auch wenn die, die sie einmal lesen sollten, ein anderes Empfinden dabei haben könnten.
Ich machte auch an diesem Abend wieder viele Notizen zu einem meiner neuen Romane und war ganz versunken in meine Kritzeleien. Zusätzlich schrieb ich noch zwei kleine Gedichte, was ich als eine Art Ausgleich zum Romanschreiben ansah und was mir irgendwie lag. Erst als die Boje auf der Felsgruppe anfing, ihr Leuchtfeuer über das Wasser zu schicken, realisierte ich, wie spät es schon war. Ich weiß heute nicht mehr, warum mir die Idee in den Sinn kam, ausgerechnet an dem Abend, anstatt nach Hause zu schippern, noch einen Abstecher zur Insel Granholmen zu machen, auf welcher ich eine kleine Sommerhütte besaß. Diese hatte ich ein Jahr zuvor zusammen mit Marcus dort aus Holz gebaut. Dorthin zog ich mich ganz gerne zurück, um zu schreiben oder einfach nur alleine zu sein. Wahrscheinlich war mir an jenem Abend eben aus letztem Grunde danach, und so fuhr ich weiter hinaus, an Lidingö vorbei. Dort, wo sich der Strom in verschiedene Richtungen kreuzte und das Wasser weiter wurde, lag die kleine Insel. Sie war vielleicht zwei Kilometer lang und 500 Meter breit an ihrer weitesten Stelle. Kaum jemand wohnte da, und wenn, dann nur in den Ferien, wenn andere Hüttenbesitzer sich dort ebenfalls tummelten. Das größte Ereignis auf dieser Insel war das jährliche Mittsommerfest im Juni. Dann trafen sich die meisten Feriengäste, um gemeinsam den höchsten Sonnenstand zu feiern. Es war immer ein buntes, lautes Treiben, und die Kinder tanzten um die Mitsommerstange, während die Erwachsenen ausgelassen feierten. Ansonsten war dort nicht viel los, und nach Ende der großen Sommerferien war die Insel, wie so viele ihrer Art, ausgestorben. Nur vereinzelte Insulaner, die ganzjährig dort wohnten, hielten die Wacht. Das Alltagsleben spielte sich dann wieder in der Stadt ab. Auf diesem Eiland war ich wirklich für mich. Meine Hütte lag außerdem am nördlichsten Zipfel der Insel, also relativ weit ab von den restlichen Ferienhäuschen. Ich angelte oft, las, schrieb und vor allem dachte ich viel nach; über das, was das Leben mir wohl noch so bringen würde.
Ich steuerte mein kleines Boot vorsichtig über den immer dunkler werdenden Mälarsee. Nebel bildete sich langsam, der an Dichte und Feuchte zunahm. Damit hatte ich um diese Jahreszeit noch nicht gerechnet, und ich bereute, nun soweit hinausgefahren zu sein. Gespensterhaft sahen die Lichter der mir entgegenkommenden Schiffe aus. Zum Glück begegnete mir kein Fährschiff oder sonstiges größeres Boot, vor welchen ich immer einen mächtigen Respekt hatte. Als ich gerade überlegte, nicht doch umzukehren, tauchte vor mir aber schon schemenhaft Granholmen auf. Ich beschloss also, nicht unter diesen Bedingungen den weiten Weg zurück anzutreten. Ich hatte sowieso Urlaub und meine Hütte war für Übernachtungen eingerichtet. Langsam glitt ich bis zu dem kleinen Steg am Ufer, von wo aus es nur ein paar Schritte zum Waldrand waren, wo meine Unterkunft stand. Als ich mich meiner Anlegestelle näherte, fiel mir auf, dass dort bereits ein kleines Bötchen festgemacht hatte. Es war kleiner als meins, ganz einfach und lediglich mit einem lenkbaren Backbordmotor ausgestattet. Nicht sehr fachmännisch angeseilt sah es aus, wie es dort doch recht lose hin- und her schaukelte. Das Boot hatte ich hier noch nie gesehen. Es war marineblau und stammte offensichtlich von einem Bootsverleih auf Lidingö, wie mich der Schriftzug an der Seite erkennen ließ. Hier hatte niemand so eine Nussschale und erst recht nicht ausgeliehen. Seltsam, dachte ich, vielleicht war ja das eigene Boot eines der Hüttenbesitzer defekt, und er musste sich vorübergehend ein anderes ausleihen. Ich war auf der Hut, denn immer wieder hörte man von Dieben, die gerne mal die Runde machten und Ferienhäuser heimsuchten, um nach brauchbaren Gütern zu stöbern. Wäre nicht das erste mal, dass jemand sein insulares Kleinod verwüstet und geplündert vorfände. Und dort in den Weiten der Schären war es schwierig, die Diebe wieder ausfindig zu machen. Andererseits war es ebenso problematisch, von da aus Hilfe zu holen, wenn es bei der Begegnung mit einem solchen Eindringling einmal zum Äußersten kommen sollte. Ich war auf alles gefasst. Leise legte ich auf der anderen Seite des Steges an. Es war mittlerweile sehr dunkel, und nur die Lichter der Stadt in der Ferne und einige Bojenlampen auf der See wiesen den Weg zurück in die Zivilisation.
Langsam lief ich über die schmale Anlegestelle und hatte zugegebener Maßen ein ungutes Gefühl im Bauch. Dieses verstärkte sich noch, als ich den Pfad hinauf zu meiner Hütte stieg und in dem einzigen Fenster des Häuschens ein bläuliches Licht schimmern sah. Das Licht kannte ich. Es musste meine kleine Campinglampe sein, die dort leuchtete. Ich nahm intuitiv einen stärkeren Ast zur Hand, der am Wegesrand lag, um mich wehren zu können, wenn ich es müsste. In der anderen Hand hielt ich meine LED Taschenlampe, die ein sehr helles Licht erzeugen konnte. Vorsichtig näherte ich mich dem Eingang. Kurz bevor ich eintreten wollte, nachdem ich allen Mut zusammen genommen und den Ast präventiv erhoben hatte, knackte es laut unter meinem Schuh; ein weiteres Astholz. Ich zuckte, blieb stehen und schaute zum Fenster. Das Licht war erloschen. Sollte ich eintreten? Ich riss mich zusammen, schaltete die Taschenlampe ein, drückte mit einem Mal beherzt die Klinke herunter und stieß mit dem Fuß die Tür weit auf. Im Türrahmen stehend rief ich mehr angstvoll als drohend mit meinem erhobenen Ast: „Ist da wer? Bleiben Sie wo sie sind!“ Dabei leuchtete ich wild im Raum umher, um den Eindringling ausfindig zu machen. Es regte sich nichts. Der Lichtstrahl fiel auf meine Bettstelle und ich sah die Umrisse einer Gestalt unter meiner Decke kauern. Ich verharrte weiter im Türrahmen, leuchtete starr auf das Bett und rief laut und bestimmt: „Kommen Sie da raus, ich bin bewaffnet! Los jetzt“, hoffend, dass der Eindringling nicht plötzlich auf mich losginge und nicht gar selbst eine Waffe dabei hätte. Zögernd senkte sich die Decke, und ein kleines Gesicht schaute, ebenso ängstlich wie das meine, hervor. Als sie vom Lichtkegel meiner Lampe geblendet wurde, hielt die Person, die dort verharrte, schützend ihre Hand vor die Augen. Ich senkte die Lampe und den Ast. Denn das, was dort saß, schien alles andere als bedrohlich. Erstaunt über diese Überraschung legte ich sofort das Holz zur Seite und schaltete die auf dem Nachttisch stehende Campinglampe wieder ein, um einen besseren Überblick zu erhalten. Ich schloss die Hüttentür und wandte mich nun der Person zu, die sehr kleinlaut auf meinem Bett saß und mich mit großen Augen erwartungsvoll anschaute. Es war eine Frau, ca. 30 Jahre alt, schwarzes, schulterlanges, gewelltes Haar und ebenso schwarze Augen in einem Gesicht mit leicht südländischem Einschlag.
„Em, also, … wie kommen Sie denn hier her und was machen Sie hier überhaupt?“, fragte ich sie, als ich auf einem Hocker vor ihr Platz nahm. Ich war erleichtert über die offensichtliche Harmlosigkeit meines Gastes. Sie antwortete leise auf Englisch und zwar nicht gebrochen; sie war wahrscheinlich Engländerin oder Amerikanerin.
„Hi, …. ich … ich bin hier gestrandet und kam nicht mehr weg.“ Leicht verunsichert wischte sie sich Haarsträhnen aus ihrem Gesicht, ohne eine Mine zu verziehen, aber in ihren Augen sah ich, dass ihr nicht ganz wohl bei der Sache gewesen sein musste.
„Nun haben Sie mal keine Angst, ich bin der Besitzer dieser kleinen Hütte hier, ja …“, ich trocknete verlegen meine durch das feuchte Holz verschmutzten Hände an meinem Hemd ab und reichte der Frau die Hand, „Sebastian, Sebastian Livius“.
Vorsichtig erwiderte sie meinen Handschlag: „Wanda Collin“
Bei dem Versuch, sich etwas besser zurechtzusetzen, verzerrte sich ihr Gesicht schmerzlich.
„Tut Ihnen was weh? Ist Ihnen etwas zugestoßen? Das kleine Boot von Svens Bootverleih da unten, ist das Ihres?“
Sie nickte stumm und sah mich an, als wenn sie immer noch nicht so recht wüsste, ob ich es eher gut oder schlecht mit ihr meinen würde. Dann schob sich am Ende des Bettes unter der Decke langsam ein kleiner Fuß hervor, und ich erkannte sofort die Ursache für Wandas schmerzverzerrten Ausdruck. Eine leichte Schwellung am Knöchel war zu sehen.
„Oh Mann“, rief ich erstaunt, „können Sie das überhaupt noch bewegen?“
Sie nickte wieder: „Ja, bewegen schon, aber kaum auftreten … ist dort drüben an der Lichtung passiert.“
„Wollten Sie die Insel erkunden?“, versuchte ich sie etwas aufzumuntern.
„Na ja, zunächst nicht, aber dann ging der Motor aus, und ich schaffte es gerade noch so bis an die Anlegestelle. Und da wollte ich Hilfe holen, aber hier scheint kein Mensch zu leben. Nach einigem Suchen und Rufen hab ich es dann aufgegeben. Ich wollte noch einmal runter zum Bötchen laufen um selbst zu probieren, das Ding wieder in Gang zu setzen, bevor es zu dunkel werden würde. Dabei bin ich da hinten fürchterlich umgeknickt“, wieder verzerrte sich ihr Gesicht etwas, „scheint kräftig verstaucht zu sein.“
„Oder vielleicht schlimmer“, mutmaßte ich, „ich bin kein Arzt, aber das sollten wir auf jeden Fall kühlen.“
Langsam taute die junge Frau etwas mehr auf. „Es war schon sehr dunkel, und neblig wurde es auch; da wusste ich mir einfach nicht anders zu helfen.“
„Wie sind Sie denn hier hereingekommen“, nickte ich verständnisvoll, „die Tür war doch abgeschlossen, soweit ich mich erinnere.“
„Mit dem Schlüssel da“, sie zeigte auf den Türschlüssel, der auf dem Tisch neben einem aufgeschlagenen Buch lag, „der war unter der Türmatte“.
„Und woher wussten Sie das?“
„Das sind Schlüssel doch meistens, oder?“ Wanda versuchte ein wenig zu lächeln.
„Ja, ja, das sind sie. Stimmt“, und ich amüsierte mich über ihren Witz, der auf einmal aus ihren Augen hervor schien, ohne dass sie dabei wesentlich ihr Gesicht verzog.
Seltsam, dachte ich in diesem Moment, solch ausdrucksvolle Augen in einer relativ starren Mimik; aber vielleicht täuschte ich mich auch, und nur der schwache, blaue Schein der Campinglampe lies mich das so empfinden.
„Jedenfalls müssen wir etwas gegen die Schwellung tun, je früher desto besser.“
Wanda schaute mich fragend an.
„Wissen Sie was? Ich nehme eins meiner Handtücher dort aus dem Regal und tränke es unten im eiskalten Mälarsee. Das wickeln wir dann darum, OK?“
„Ja, ist vielleicht eine gute Idee“, kam es dankbar zurück und im gleichen Augenblick wieder etwas verunsichert, „aber Sie kommen wieder ja?“
„Klar doch, und dann mache ich uns etwas zu Essen“, ich zeigte auf die Feuerstelle, „ist zwar Dosenfutter, aber macht satt.“
Ich lief hinunter zum Wasser. Der Nebel war so dicht, dass man fast die Hand vor Augen nicht mehr sehen konnte. Eine Überfahrt in einem unserer Boote wäre sehr gefährlich gewesen. Ich schaute mir kurz Wandas Nussschale an und merkte sofort, warum sie ihren Motor nicht mehr starten konnte; der Sprit war alle. Auf einen vollen Tank hatte man bei Svens Bootsverleih wohl nicht geachtet. Nachdem ich das nur lose angeleinte Schiffchen richtig befestigt hatte, kehrte ich mit dem nassen Handtuch zurück zur Hütte, wo Wanda sich etwas bequemer auf dem Bett zurechtgesetzt hatte. Vorsichtig wickelte ich ihren Knöchel feucht ein, in der Hoffnung, dass die Kühlung den Schmerz und die Schwellung etwas lindern würde.
„Meinen Sie, wir kommen heute Nacht noch fort von hier“, fragte sie mich.
„Schwierig, mein Mobiltelefon hat kein Netz in dieser verlassenen Gegend. Wir könnten natürlich versuchen, jemanden mit meinem Funkgerät unten im Boot anzurufen, aber um diese Zeit?“ Ich schaute auf die Uhr, die langsam auf halb elf zuging. Selbst möchte ich Sie nicht durch diese Suppe da draußen fahren. Wo kommen Sie denn überhaupt her?“
Wandas Augen schauten mich an, als ob sie fieberhaft überprüfen würden, ob sie mir vertrauen könnte, aber dann meinte sie: „Von drüben, von Lidingö, ich wohne da in einem kleinen Hotel direkt an der Bootsanlegestelle für Touristen. Ich war mit dem schaukeligen blauen Ding noch viel weiter draußen, eben“, erzählte sie schon fast etwas stolz, „hab es aber nur bis hierher zurück geschafft.“
„Knapp vorbei ist auch daneben“, scherzte ich, „aber wie Sie wollen, ich kann es mit dem Funkgerät versuchen. Ein Hotelbett ist für Sie und ihre Verletzung in jedem Fall bequemer als das hier.“
Wanda dachte kurz nach, schaute mich selbstbewusst an, presste ihre Lippen zusammen und wackelte mit dem Kopf.
„Von mir aus geht das mal so, ist eben ein Abenteuerurlaub mit Hindernissen, aber Sie hatten doch sicher nicht vor, hier zu übernachten oder?“
Ich merkte, wie sie etwas fröstelte in ihrer für meine Begriffe zu dünnen Jacke für die Jahreszeit auf dem Wasser und reichte ihr eine weitere Decke.
„Bei dem Nebel ist es in der Tat das Sicherste hier auf den Morgen zu warten“, erklärte ich ihr, „bleiben Sie mal hier. Ich mache jetzt den Kamin an, uns was zu essen, und dann können Sie ruhig auf dem Bett da übernachten. Ich gehe nach nebenan in den Schuppen, dort liegt noch eine meiner Matratzen rum. Haben Sie Durst?“
„Ein wenig schon.“ Sie schielte verstohlen auf meine Wasserflasche, die ich vom Boot mitgebracht hatte.
„Hier bitte trinken Sie, ich koche mir einen Tee mit dem Brunnenwasser von draußen.“
„Und Sie?“, Wanda nahm zögernd die noch halbvolle Flasche entgegen, „möchten Sie nicht?“
„Tee reicht mir.“
Ich lief noch einmal zum Brunnen vor der Tür, um mir eine Tasse voll Wasser zu schöpfen. Als ich zurück kam, saß Wanda sichtlich entspannter da. Die Flasche war leer.
„Die Seeluft macht durstig stimmt’s?“
„Richtig, aber jetzt geht es besser. Auch die Schmerzen im Fuß lassen etwas nach, zumindest solange ich ihn nicht bewege.“
Ich lächelte sie an, und sie bemühte sich zu erwidern, was ihre Augen zwar verrieten, ihrem distinguierten Gesicht aber nicht so ganz gelang. Ich nahm es nicht persönlich, schließlich war ich ein völlig Fremder für sie. Als es langsam wärmer in unserer Behausung wurde, und ich uns über dem Kamin zwei Dosen Erbsensuppe aufgewärmt hatte, saßen wir still beisammen und sättigten uns. Wanda musste schon länger nichts mehr gegessen haben, denn sie wollte gar nicht mehr aufhören das Zeug in sich hinein zu löffeln. Ich lächelte sie ab und zu an, um sie aufzumuntern, etwas zu erzählen. Aber sie ließ sich nicht irritieren und aß stumm vor sich hin. Nachdem sie ihren letzten Kunststoffteller leer gegessen hatte und ich den meinen ebenso, wollte ich, ohne nachzudenken, den Teller noch genüsslich leer lecken.
Da hielt ich inne, sah Wanda verlegen an und meinte mit rotem Kopf: „Oh, sorry, das ist nicht gerade Ladylike.“
Sie kicherte und antwortete: „Ist schon gut, fühlen Sie sich wie zu Hause.“ Etwas schüchtern griente sie vor sich hin. „Danke jedenfalls“, wurde sie dann wieder ernster, „ich finde das sehr nett, wie Sie mich hier aufnehmen. Und es macht Ihnen auch wirklich nichts aus, wenn ich hier die Nacht verbringe?“
„Nein, machen Sie sich darüber keine Gedanken. So … also … ich werde dann mal nach nebenan gehen und mich dort niederlassen. Und morgen fahren wir gemeinsam nach Lidingö.“
„Das möchte ich aber nicht, da drüben ist es doch sicher kalt, nein, … unter den Umständen … nein das geht wirklich nicht.“
„Aber ich kann doch nicht hier mit Ihnen in einem Raum …“
„Warum denn nicht, ich habe Ihnen schließlich die Unannehmlichkeit gemacht.“
„Schon, aber Sie kennen mich doch gar nicht.“
„Wenn ich ehrlich sein soll, ich fürchte mich ein wenig alleine. Bitte, tun Sie mir den Gefallen, und legen Sie sich Ihr Lager hier aus, hm?“
„Meinetwegen“, ließ ich mich überreden und holte die Matratze aus dem wirklich sehr klammen und kühlen Nachbarraum.“
Wanda wickelte sich in ihre Decke ein, und nur noch ihr Kopf schaute neugierig umher. Ich machte das Feuer im Kamin etwas kleiner, löschte die Campinglampe und legte mich auf meine Lagerstätte auf der gegenüberliegenden Seite des Bettes. Es wurde still. Außer dem leisen Knistern und Knacken des allmählich dahinschwindenden Feuers war nichts zu hören. Schemenhaft zuckten die Gegenstände in dem kleinen Raum im Rhythmus des letzten Flammenscheins. Vor allem die Bücherregale, die ich dort montiert hatte, warfen einen geisterhaften Schatten durch die Gegend. Ich nahm an, dass mein unerwarteter Gast wohl schon eingeschlafen wäre und träumte langsam vor mich hin, überlegend, woher Wanda käme. Besonders gesprächig war sie nicht, und das war ich von den Skandinaviern ja auch nicht anders gewohnt, aber trotzdem war sie mir gleich irgendwie sympathisch. Obwohl ich ihre Persönlichkeit zu diesem Zeitpunkt überhaupt nicht einschätzen konnte, ahnte ich bereits, dass sie eine Person sein musste, die nicht einfach strukturiert war. Von ihrem Gesichtsausdruck konnte man das freilich kaum ablesen, denn der erschien mir sehr nüchtern und neutral. Aber Wandas Augen sagten mir schon von Anfang an, dass mehr in ihr steckte, als ihr Äußeres preiszugeben vermochte.
Kurz bevor ich selber wegnickte, fing sie auf einmal an zu sprechen, scheinbar hellwach:
„Lesen Sie gerne?“
„Was? Achja, sicher doch, ich lese sehr gerne. Warum?“
„Na, Ihre gut gefüllten Regale dort …“
„Ach so, ja klar, ich bin hier oft alleine, und neben dem Angeln kann ich mich sehr gut da draußen am Wasser mit einem Buch entspannen … im Sommer, wenn es warm ist.“
„Hm“, bestätigte sie, „ich lese auch sehr gerne, komme aber in letzter Zeit kaum noch dazu; erst jetzt im Urlaub konnte ich wieder damit anfangen.“
„Wenn man daran interessiert ist, hat man dazu doch immer mal Zeit oder?“
„Interesse alleine genügt nicht, man muss auch die Muße haben. Sonst kann man’s gleich lassen.“
„Da haben Sie allerdings recht, deswegen zieht es mich ja auch regelmäßig hierher.“
„Durfte ich mir dieses nehmen? Ich habe es mir einfach dort aus dem Regal gezogen.“
„Was meinen Sie?“
„Dieses Buch da auf dem Tisch; ich habe darin ein wenig gelesen.“
Ich schaute auf das Buch, was mir schon bei meinem Eintreffen dort liegend aufgefallen war. Ich war der Autor. Es war mein erster Roman, den ich unter Pseudonym veröffentlicht hatte; jener Roman, der mich von Himmel hoch jauchzend zu Tode betrübt werden ließ, als ich bemerkte, dass er sich so gut wie nicht verkaufte.
„Und, hat es Ihnen gefallen?“, wollte ich von Wanda wissen. „Haben Sie alles verstanden? Es ist ja in Deutsch.“
„Von dem Autor habe ich noch nie etwas gehört. Aber er schreibt schön. Sein Stil gefällt mir, und ich bin gerade an einer interessanten Stelle stehen geblieben, kurz bevor Sie eintraten. So ziemlich alles habe ich verstanden. Einige Sachen nicht. Aber ich war ganz gut in Deutsch. Deutsche Texte machen mir im Allgemeinen keine Probleme. Und Sie als Schwede scheinen es ja auch ganz gut zu können.“
„Ach ja, ich bin nicht von hier“, räumte ich das Missverständnis aus der Welt, „ich komme aus Deutschland und Deutsch ist meine Muttersprache.“
„Oh, und ich dachte ich habe es mit einem waschechten Inselschweden zu tun“, witzelte sie regungslos unter ihrer Decke, „ich komme aus England, London … mache hier ein paar Tage Urlaub … muss auch mal sein.“
„Soll ich Ihnen noch etwas daraus vorlesen?“
„Ja!“, Wanda drehte ihren Kopf und schaute mich an, „wenn Sie möchten, gerne.“
Ich nahm den Roman mit dem Titel ‚Träume hinter dem Horizont’ und die Campinglampe zu mir, legte mich auf die Seite und begann zu lesen. Und am Ende des zweiten Kapitels, es war nun weit nach Mitternacht, fielen mir selbst die Augen fast zu. Ich legte das Buch fort und schaute in Wandas Gesicht. Ihre Augen waren geschlossen, und leise seufzend drehte sie sich um: „Schön, sehr schön.“
II. Verlockende Angebote
Durch das Knarren der Hüttentür schreckte ich hoch. Ich schaute, langsam wacher werdend umher und erinnerte mich sofort, dass ich ja einen Gast hatte. Das Bett, auf welchem dieser die Nacht verbracht hatte, war leer. Wanda musste nach draußen gegangen sein. Die Nacht war kurz und der Morgen recht kalt. Nur selten nächtigte ich bei solchen Temperaturverhältnissen auf meinem Inseldomizil. Aber es kam hier und da sogar im Winter vor, wenn ich mich einmal absolut zurückziehen wollte. Ich schaute am Fenster auf das Thermometer: fünf Grad um sieben Uhr morgens und ein klarer Himmel ließen einen sonnigen Herbsttag versprechen. Das hob meine Laune. Sie wird sich doch wohl nicht sang- und klanglos davongemacht haben, kam es mir kurz in den Sinn. Dann sah ich aber einen mir unbekannten Rucksack neben dem Bett liegen. Das musste ihrer gewesen sein. Also ging ich nach draußen, um nach ihr zu forschen. Lange suchen musste ich nicht, denn sie saß am Brunnen und versuchte sich etwas frisch zu machen. Sie war gerade dabei, ihren verunglückten Fuß zu begutachten, als sie meine Schritte bemerkte und zu mir aufsah.
„Guten Morgen Miss Collin, gut geschlafen?“
„Oh, hallo, ja danke, besser als erwartet; und gefroren habe ich auch nicht, dank Ihrer warmen Decken. Und Sie, war es für Sie erträglich?“
„Ja, ja, kein Problem, kann ich Ihnen irgendwie helfen?“
„Nein, es geht schon“, murmelte sie vor sich hin schauend, „ich kann ganz gut wieder auftreten und werde mich gleich wohl auf den Weg nach drüben machen. Ich brauche unbedingt was Frisches zum Anziehen.“
Sie rümpfte etwas ihre Nase, als sie an sich hinunterschaute und ihre Kleidung betrachtete, mit der sie den letzten Tag und die ganze Nacht verbracht hatte.
„Klar doch, kann ich verstehen“, sagte ich etwas verunsichert und vielleicht auch enttäuscht darüber, dass mein Besuch so schnell wieder verschwinden wollte, „aber vielleicht noch auf einen Kaffee oder so“, versuchte ich ihren plötzlichen Aufbruchswunsch etwas zu bremsen.
Sie warf ihre Haare in den Nacken und schaute mich an.
„Sie sind echt nett. Wissen Sie was? Ich würde Sie gerne zum Frühstück im Hotel auf Lidingö einladen. Was halten Sie davon?“
Nun betrachtete ich mich verunsichert selbst, und verlegen wenn auch innerlich geschmeichelt antwortete ich: „So? Ich müsste mich auch erst mal frisch machen, glaube ich.“
„Dann tun Sie das doch, und wir treffen uns, sagen wir gegen 11 Uhr zu einem Brunch in meinem Hotel.“
„Oder woanders?“, schlug ich ihr spontan vor.
„Warum nicht?“, sie zuckte mit den Schultern und ein flüchtiges Lächeln überflog ihre Lippen, „aber ich lade Sie ein.“
„Also gut, dann treffen wir uns gegen 11 drüben an der Anlegestelle, ich weiß nämlich ein ganz nettes Plätzchen hier auf den Schären, haben Sie Lust?“
„Schären? Das klingt nach einer weiteren Bootstour“, meinte Wanda und versuchte sich die etwas zerzausten Haare zurechtzumachen.
„Lassen Sie sich einfach überraschen. Warten Sie, ich hole schnell Ihre Sachen, dann setzen wir über.“
Ich lief zurück zur Hütte, nahm Wandas Rucksack, verschloss alles, und ging wieder zu ihr. Sie wartete bereits am Bootssteg auf mich. Ich befestigte ihre kleine Nussschale an meinem Boot und half ihr einzusteigen, denn ich bemerkte, dass sie noch ein wenig humpelte. Wanda nahm neben mir Platz, während ich bei herrlichem Wetter und einem tollen Ausblick über den Mälarsee langsam zur gegenüber liegenden Insel Lidingö schipperte, das geliehene Boot am Schlepptau. Sie schloss die Augen und hielt genüsslich ihr Gesicht in den Wind. Zum ersten Mal konnte ich mir ihr Antlitz richtig betrachten, denn in der Nacht, bei schemenhaftem Licht, sah es ganz anders aus als nun. Die Züge ihres Gesichtes waren sehr ebenmäßig, und es war ziemlich hellhäutig. Ihre eher dünnen Lippen zogen eine feine Linie unterhalb ihrer Stupsnase. Es sah niedlich aus, wenn vereinzelt Haarsträhnen um dieses kleine Gesicht wirbelten. Ihre Haare waren pechschwarz und ebenso ihre Augen, die sie plötzlich aufschlug, als wenn sie gespürt hätte, dass ich sie beobachte.
„Ist was?“, schaute sie mich an.
„Nein, nein“, ich sah konzentriert auf das Wasser vor mir und spürte die Röte, die mir ins Gesicht stieg, „so, nun sind wir gleich da“, versuchte ich verlegen abzulenken.
Wanda sah mich von der Seite an und meinte dann spontan: „Übrigens, Sie können mich gerne Wanda nennen.“ Sie bot mir das Du an.
„Da sage ich nicht nein“, erwiderte ich, „und du mich Sebastian, oder einfach nur Bastian; ist kürzer.“
Sie nickte und schaute still vor sich hin.
„Ich muss das noch mit Svens Bootsverleih klären“, fiel es ihr plötzlich ein, „bezahlt habe ich ihn ja schon.“
Sie sagte das, als wenn sie insgeheim gehofft hätte, ich könnte ihr diesen Gang abnehmen, da es ihr vielleicht unangenehm oder gar peinlich war, dort über ihr Missgeschick zu berichten. Ich schmunzelte und bot ihr an, das für sie zu erledigen. Eine kleine Erleichterung breitete sich in ihrem Gesicht aus. Als wir den Anlegeplatz erreicht hatten, gab sie mir, recht förmlich, wie ich fand, die Hand zum Abschied und bedankte sich noch einmal ebenso förmlich, ohne noch viel zu sagen. Danach humpelte sie das kurze Stück bis zu ihrem Hotel. Ich nahm den Weg zur anderen Seite, um bei Sven, dem Bootsverleiher vorbeizuschauen. Ich teilte diesem kurz mit, was sich zugetragen hatte, und damit war das Thema auch für den unkomplizierten Insulaner erledigt.
Auf der Rückfahrt nach Hause beschäftigten mich gedanklich vor allem drei Dinge: Zum einen sah ich die ganze Zeit Wandas Gesicht vor mir. Was war damit? Etwas verschlossen, nicht sehr mimikreich, überlegte ich mir; und das passte irgendwie zu ihrer Art sich mitzuteilen. Entweder, sie war eine recht spröde Natur, oder sie war einfach nur schüchtern, oder sie verbarg etwas in sich, was sie absolut nicht nach außen kehren wollte. Nur ihre Augen, und das fand ich besonders interessant, spiegelten ab und an das wieder, was ich in ihren Äußerungen, sie bewegend, suchte. Das zweite, was mich in diesem Zusammenhang beschäftigte, war die Tatsache, dass seit dem vergangenen Abend zum ersten Mal die Gedanken an meinen schriftstellerischen Erfolg oder Misserfolg in den Hintergrund traten. Sonst war das nicht so, auch nicht bei außergewöhnlichen Erlebnissen. Immer hatte ich dieses Thema im Kopf, was mich nur allzu oft von anderen Dingen ablenkte. Aber diesmal war es anders. Scheinbar war mir die Begegnung mit Wanda unbewusst wichtiger, als ich es mir zugeben wollte; und das nach nur wenigen Stunden und obwohl sie noch gar nicht viel von sich preisgegeben hatte. Und der dritte Punkt, der mich innerlich erfreute, waren Wandas letzte Worte, kurz bevor sie einschlief: ‚Schön, sehr schön’ hatte sie gesagt, was sich auf den Text bezog, den ich ihr aus meinem Buch vorlas. Denn positive Rückmeldungen bekam ich ja sonst kaum, außer von Lena. Umso angenehmer war es, dies einmal von einer fremden Person zu hören. Es machte mich etwas stolz, ja, das kann man so sagen. Vielleicht war es gerade auch dies, was sie mir so sympathisch machte. Hoffentlich würde sie wirklich an unserem verabredeten Treffpunkt warten.
Zuhause angekommen, kam mir Lena auf der Treppe zu unserer Wohnung entgegen.
„Hej Bastian, lass mich raten, auf der Hütte übernachtet?“
Ich nickte noch ganz in Gedanken versunken.
„Und ist dir was Neues eingefallen?“
„Das auch, aber ich habe …“
Lena ließ mich nicht zu Ende reden.
„Du, ich muss schnell weg zur Uni, bin spät dran. Erzähl es mir heute Abend, ja? Also, ich muss. Und während sie die Treppe hinunter hastete, rief sie noch hinter mir her: „Frühstück steht auf dem Tisch und ein Brief von deiner Ex liegt da auch.“ Die Haustür fiel hinter ihr zu.
Meine Ex, damit meinte sie Sonja. Was die wohl wollte. Sie meldete sich, obwohl wir eindeutig getrennte Wege gingen, immer mal wieder, um vor allem von sich zu erzählen und mir schlaue Tipps zu geben, was ich denn mit meinem Leben anfangen sollte und müsste. Sonja war eine echte Karrierefrau, die mit schöngeistigen Dingen nicht viel am Hut hatte. Ja, sie las auch gerne, aber vor allem Businessjournale, emanzipierte Frauenzeitschriften und Ähnliches. Sie belegte an diversen Instituten immer wieder neue Karriereseminare und war stets unterwegs. Sie arbeitete im Management irgendeiner großen Dienstleistungsfirma und war, na ja, irgendwie darauf fixiert, intensiv und bewusst zu leben, wie sie immer sagte. Zeit sei Geld. Sie konnte nie einfach nur mal einen Nachmittag gemütlich zu Hause verbringen und die Seele baumeln lassen. So ist es nicht verwunderlich, dass sie meine Schreibereien eher als einen Zeitluxus betrachtete, den sie sich nicht leisten könne, zumal dieser Luxus ja wohl kaum einen Nutzen