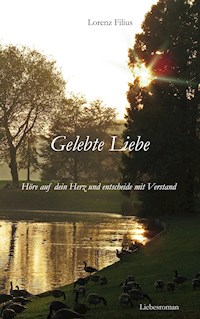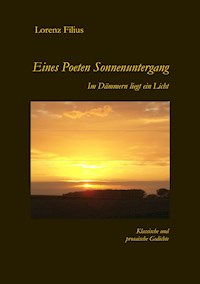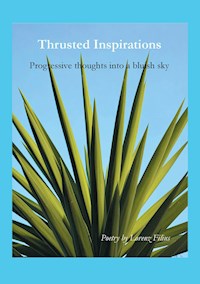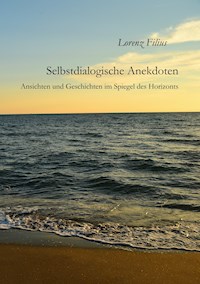Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Books on Demand
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
'Ganz woanders neu anfangen', denkt sich der erfolglose Julius, welcher sich nicht länger von seiner Freundin aushalten lassen möchte. Während die junge Pharmazeutin kein Problem damit hat, die Rolle als Geldverdienerin zu übernehmen, fühlt sich der Gelegenheitsjobber mit mittelmäßigem akademischen Abschluss zusehends unwohl in seiner häuslichen Haut. Zudem werden seine Zukunftsträumereien neuerdings durch seltsame anonyme Briefe aus dem hohen Norden angespornt. Nach einem Richtungsstreit mit seiner Freundin lässt Julius schließlich die heimatlichen Bande hinter sich und versucht sein Glück in Norwegen - ein Wagnis, das ihn unerwarteter Weise mehr emotional als beruflich fordern soll.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 375
Veröffentlichungsjahr: 2021
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Der Autor:
Lorenz Filius, geb. 1965, wuchs in der Eifel auf und studierte Erziehungswissenschaften, Psychologie und Philosophie. Nach seinem Studium arbeitete er als Dozent in der Erwachsenenbildung. Seit 1997 lebte er aus beruflichen Gründen jeweils mehrere Jahre in Stockholm, Brüssel, Oslo und Rom. Zurzeit wohnt er in Mecklenburg-Vorpommern an der Ostsee.
… Ich träume, auf einem dieser Schiffe mitfahren zu können, und ich freue mich immer riesig. Ich schaue gespannt über die Reling auf das Wasser vor mir und bin in stetiger Erwartung auf das Auftauchen von Land, einem fremden Land. Dann plötzlich … da … ja, ich kann es erkennen, es kommt auf mich zu. Ich sehe Uferabschnitte, den Strand, die ersten Gebäudesilhouetten und dann, ja dann realisiere ich, dass es meine Heimat ist, die da auftaucht …
Inhalt
Konflikte
Auf der Suche nach Malin
Freundschaft
Licht und Schatten
Entscheidungen
Konflikte
Die Wolken hingen wie große schwere Felsbrocken am Himmel, und es regnete schon den ganzen Morgen unaufhörlich; eher typisch für einen beginnenden Herbst als für einen Frühlingstag. Ich war an diesem Montag auf dem Weg zu meiner Arbeitsagentur, um wahrscheinlich wieder einmal zu erfahren, dass keine Stelle für mich in Aussicht sei. Germanisten haben es eben schwer. Meine Freundin Wiebke war schon auf der Arbeit. Sie war Pharmazeutin und arbeitete in einer Apotheke in der Stadt. Auch sie wäre vielleicht ohne Lohn und Brot gewesen; da die Apotheke aber ihren Eltern gehörte, war für sie nach dem Studium der Arbeitsplatz so gut wie sicher. Aus dieser Position heraus ließ sich dann auch einfach von ihrer Seite aus argumentieren. Ich müsse mich mehr bemühen und dürfe den Kopf nicht hängen lassen, sagte sie immer, wenn ich ohne nennenswerte Ergebnisse von meiner Arbeitsvermittlerin nach Hause kam. Irgendetwas würde sich schon finden. Ich weiß, dass Wiebke es gut meinte, aber sie brauchte sich ja auch nicht stundenlang in die Warteschlange zu setzen, um unverrichteter Dinge wieder zurückzukehren. Ganz unverrichtet vielleicht nicht, denn ich wollte in keinem Falle mein Geld nur vom Staat beziehen. Also nahm ich verschiedene Jobs an, die mir als Alternative bei solchen Vermittlungsversuchen angeboten wurden. Ich war gespannt, was es dieses Mal sein würde, hoffentlich nicht wieder Lagerarbeiten am Hafen.
Der Bus hielt am ZOB, der zentralen Haltestelle in der Cuxhavener Innenstadt. Als ich ausstieg, hatte es aufgehört zu regnen, und ich konnte wenigstens trockenen Fußes zur Arbeitsagentur laufen. Nummer ziehen und Geduld war nun angesagt. Ich setzte mich in die Reihe der dort Wartenden und schaute auf die Nummernanzeige über der Eingangstüre des Ganges. 322 stand da, und ich hatte 387. Das konnte also noch etwas dauern. Neben mir saß ein älterer Mann, der in einer der abgegriffenen Zeitungen herumblätterte, die dort auslagen. Stellenannoncen durchforstete er. Auf einer Seite konnte ich eine große Werbeanzeige erkennen: Arbeiten im Ausland - Ihre Chance. Das müsste man eigentlich auch mal ins Auge fassen, so dachte ich mir, dann käme ich mal ein bisschen herum - und würde dabei noch Geld verdienen. Ärzte, Facharbeiter und Ingenieure dringend gesucht, hieß es. Von Geisteswissenschaftlern mit mittelmäßigem Examen war nicht die Rede. Ich seufzte. Nummer 343 war nun an der Reihe. Ich wartete weiter. Mein Telefon klingelte. Es war Wiebke, die mich fragte, ob wir uns zum Essen an der Alten Liebe, einem Leuchtfeuer aus früheren Zeiten, treffen wollten. Käme darauf an, wie lange ich in der Arbeitsvermittlung noch ausharren müsse, erklärte ich ihr, ich würde sie dann zurückrufen, wenn ich fertig wäre. Es dauerte noch eine Weile, aber dann war ich endlich an der Reihe.
„Guten Tag Herr Meinhard“, begrüßte mich die Sachbearbeiterin, deren Namen ich mir nie merken konnte, weil er ziemlich unaussprechlich und dazu noch ein Doppelname war.
„Hallo“, floskelte ich teils gelangweilt, teils genervt durch die lange Warterei.
„Nehmen Sie doch bitte Platz.“
Ich setzte mich und wartete, bis die freundliche Dame hinter ihrem Schreibtisch meine Akte herausgesucht hatte.
„Also, viel Neues habe ich leider nicht für Ihr Fachgebiet“, vertröstete sie mich wie üblich, „vielleicht sollten Sie es mal bundesweit versuchen.“
„Ja, vielleicht sollte ich das.“
„Ich kann Ihnen im Moment auch wieder nur eine Aushilfstätigkeit anbieten, hier in unserer Kurverwaltung.“
„Hm, scheint zumindest ein angenehmerer Job zu sein als die Lagerarbeiten von letzter Woche.“
„Ja, würde ich auch so sehen. Die suchen jetzt zur Vorsaison am Strand Aufsichtspersonal für mindestens zwei Monate. Sie müssten da in so einem Häuschen sitzen und einen Strandabschnitt beobachten. Wäre das was für Sie?“
„Tja, wird wohl.“
„Gut, dann sage ich der Verwaltung Bescheid, dass Sie da mal vorbeischauen.“
„Werde ich tun, gleich heute Nachmittag; ich wohne da ja in der Nähe.“
„Also, Herr Meinhard, dann alles Gute und bis zum nächsten Mal.“
„Ja, danke, auf Wiedersehen.“
Ich verließ das Büro. Nur fünf Minuten hatte mein Besuch dort gedauert, um diese Information zu erhalten. Und dafür hatte ich zwei Stunden gewartet. Ich fragte mich, wie lange diese Jobberei noch andauern würde und ob ich mich wirklich mal ganz woanders im Lande bewerben sollte. Das bedeutete aber eine Trennung von Wiebke, und das wollten ich und vor allem sie auf keinen Fall. Wir waren bereits über fünf Jahre zusammen, und wir liebten uns, dachte ich jedenfalls. Auch wenn Wiebke meine berufliche Situation mitbelastete, wäre sie nicht damit einverstanden gewesen, wegen eines Jobs eine Trennungsbeziehung zu führen. Deswegen kam mir zwar die Überlegung, wegzuziehen schon öfter, ich habe sie aber aus besagtem Grunde nie in Angriff genommen.
Ich machte mich auf den Rückweg und rief von unterwegs aus meine Freundin an, um ihr zu sagen, dass ich gegen halb eins an der Alten Liebe auf sie warten würde. Sie war pünktlich.
„Hallo Schatz“, begrüßte sie mich.
„Hallo Süße, wartest du schon lange?“
„Nein. Na, warst du erfolgreich?
„Erfolgreich … wie immer.“
„Also wieder nichts.“
„Zum Überwasserhalten langt es wohl; ein Aufsichtsjob am Strand.“
„Na, irgendwann findet auch mal ein blindes Huhn ein Korn.“
„Vielleicht. Wollen wir dort drüben eine Seemannsmahlzeit essen?“
„Ja gut, gehen wir.“
Ich kehrte mit Wiebke in ein kleines Restaurant ein, welches immer sehr schmackhafte Fischgerichte anbot, die für unseren Geldbeutel erträglich waren. Wir begaben uns zum Tresen und bestellten beide die Seemannsmahlzeit, ein leckeres Menü, genauer, Dorsch mit Pommes und Salat. Danach setzten wir uns nach draußen, da sich der Himmel mehr und mehr aufhellte und die Sonne hervor schien.
Während wir auf unsere Bestellung warteten und auf das Watt hinaussahen, fragte mich Wiebke: „Na, hast du es dir noch mal überlegt?“
„Was soll ich überlegt haben?“
„Ja, du weißt schon, wovon wir doch seit Wochen sprechen.“
„Ach ja, nein, also ich meine, ich habe noch nicht weiter darüber nachgedacht.“
„Warum sträubst du dich denn so? Wir haben uns doch lieb, und das ist ja wohl das Wichtigste, um zu heiraten, oder?“
„Wichtig ist es schon, aber es reicht doch nicht aus“, erwiderte ich, „es muss auch das Wirtschaftliche stimmen, weißt du? Und solange ich keine richtige Arbeit habe … nee, ich weiß nicht.“
„Aber Julius, ich habe immerhin einen guten Job bei meinen Eltern im Geschäft; das reicht dicke für uns beide. Und da kannst du dir genug Zeit lassen, bis du etwas Richtiges gefunden hast.“
Ich schaute überlegend in die Weite der Nordsee und war so gar nicht von Wiebkes Vorschlag überzeugt. Sie war ein echt typisches blondes Nordlicht mit großen blauen Augen, meistens fröhlich, optimistisch, und sie wusste, mich immer wieder zu erheitern, wenn ich mal, vor allem wegen meiner beruflichen Problematik, frustriert war. Sie war für mich eigentlich die ideale Partnerin. Trotzdem fand ich es nicht richtig, sie zu heiraten, bevor ich nicht einen anständigen Job hatte. Vor allem wegen ihrer Eltern hatte ich so meine Probleme damit, denn die wollten ihre Tochter am liebsten mit einem erfolgreichen und selbstbewussten Mann zusammen sehen. Sie hatten so nichts gegen mich, aber immer, wenn ich einmal zu einem Sonntagskaffee bei ihnen eingeladen war, ließen sie mich schon spüren, dass Wiebkes Partnerwahl in ihren Augen eher unglücklich war. Das führte auch oft zu Reibereien zwischen ihr und ihren Eltern.
„Lass uns noch etwas damit warten, ja?“, bat ich Wiebke.
Sie verzog ihre Mundwinkel zu einem leicht enttäuschten Gesichtsausdruck und meinte: „Also, ich werde jetzt nicht mehr damit anfangen. Ist mir zu blöd. Wenn du dir dazu eine abschließende Meinung gebildet hast, kannst du ja auf mich zukommen; aber verstehe bitte, dass ich auch nicht ewig warten will.“
„Komm in meinen Arm“, beschwichtigte ich sie, „ich habe dich doch lieb.“
Mehr oder weniger versöhnlich ließ sie sich umarmen. Unser Essen kam und wir stärkten uns. Danach liefen wir zum Strand, um noch etwas zu spazieren. Hand in Hand schlenderten wir an der Bucht von Grimmershörn entlang.
„Sag mal“, begann ich wieder, „was würdest du sagen, wenn ich irgendwo im Ausland eine Stelle suchen würde und du mit mir mitkämst.“
„Blöde Idee, ich werde doch meine Arbeit hier nicht aufgeben, damit du eventuell da irgendwo Arbeit bekommst. Überlege einmal, ich werde später die Apotheke meines Vaters übernehmen. Soll ich mir das etwa durch die Lappen gehen lassen? Nein, also bei allem Verständnis, aber ins Ausland bekommst du mich nicht, höchstens zu einem Urlaub. Und glaube bloß nicht, selbst wenn du da einen Job gefunden haben solltest, dass das Leben dort leichter sein würde. Ich glaube eher, das Gegenteil wäre der Fall. … Nein, davon halte ich überhaupt nichts.“
Diese Reaktion von Wiebke hätte ich mir eigentlich denken können, denn sie war eine eingefleischte Cuxhavenerin und hatte dort ihre festen Wurzeln; Freunde, Kollegen aus ihrem Sportverein, wo sie leidenschaftlich gerne hinging, um Damenfußball zu spielen und natürlich ihre Eltern. Ich hingegen war schon an den unterschiedlichsten Orten in Deutschland. Auch wenn meine Heimat das Rheinland war, war ich nicht so versessen darauf, mich in meinem Heimatland derart zu verfestigen wie meine Freundin; vielleicht auch deswegen nicht, weil ich lange keinen so großen Bekanntenkreis hatte wie sie.
Wiebkes Mittagspause war um, und so gingen wir langsam zurück zur Alten Liebe, von wo aus sie wieder in die Apotheke lief und ich mich auf den Weg nach Hause machte. Wir wohnten zusammen in einer Zweizimmerwohnung im Stadtteil Döse, ziemlich nah am Strand, und vom Balkon unserer Dachgeschosswohnung hatte man einen prima Ausblick auf die Nordsee. Als ich unseren Wohnblock erreichte, quoll der Briefkasten mal wieder mit Werbeprospekten und anderem Unsinn über, so dass ich jedes Mal meine Mühe hatte, die Briefpost dazwischen herauszusortieren. Rechnungen, ein Brief vom Arbeitsamt und einer ohne Absender waren diesmal dabei. Ich lief nach oben, legte die Post auf die Dielenkommode und machte mir erst einmal einen Kaffee. Dann machte ich es mir mit dem Kaffee und der Post auf dem Sofa gemütlich. Bis zu meinem Vorstellungstermin in der Kurverwaltung hatte ich noch eine Stunde Zeit. Telefon- und Stadtwerkrechnung legte ich beiseite. Die Überweisungen würde ich bei meinem nächsten Gang zur Post machen. Der Brief vom Arbeitsamt enthielt nur eine Mitteilung über irgendwelche Leistungen, die mir zuständen oder auch nicht, jedenfalls nichts Spannendes. Einzig interessant schien der Brief ohne Absender. Wahrscheinlich ein Irrläufer, denn die Briefmarke kam aus Norwegen, und von dort erwartete ich nun wahrhaftig keine Post. Ich öffnete den Umschlag und zog ein handschriftlich verfasstes Blatt Papier heraus; auf Norwegisch. Ich betrachtete den Zettel genauer und meinte erkennen zu können, dass es sich wohl um eine weibliche Handschrift handeln musste. Eine schöne geschwungene Schrift war es. Aber das nutzte mir auch nichts, denn ich konnte kein Wort von dem entziffern, was da stand. Nur meinen Namen erkannte ich am Anfang des Briefes, was sicher bedeutete, dass der Brief wirklich an mich gerichtet sein musste. Einzig den Schluss des Textes und den offensichtlichen Namen der Verfasserin konnte ich entschlüsseln. Die letzte Zeile hieß bestimmt ‚viele Grüße’ oder so etwas ähnliches, und unterschrieben war das Ganze von einer gewissen Malin. Das war auch schon alles, was ich dem Papier zunächst entlocken konnte. Ich betrachtete mir noch einmal den Umschlag, aber da standen sie korrekt; meine Anschrift und mein Name. Sehr seltsam, überlegte ich, und ich grübelte nach, wer von meinen ehemaligen Schul- oder Studienkameradinnen so hieß und sich vielleicht nun einmal aus Norwegen bei mir melden würde. Aber ich kannte nie jemanden mit Namen Malin, da war ich mir sicher.
Die Zeit schritt voran, und ich musste mich auf den Weg zu meinem Vorstellungsgespräch in der Kurverwaltung machen. Ich legte den Brief zu der anderen Post auf den Wohnzimmertisch und machte mich auf den Weg. Der stellvertretende Personalchef der Verwaltung empfing mich freundlich und fragte mich gleich, ob ich denn überhaupt Lust zu diesem Job hätte, was ich bejahte. Es war eine kurze und knappe Vorstellung, und der Chef beschrieb mir mein Aufgabenfeld. Im Stadtteil Duhnen sollte ich in einem Wärterhäuschen sitzen, den dortigen Strandabschnitt beobachten und im Falle von Auffälligkeiten den Sicherheitskräften Bescheid sagen. Da die Bezahlung stimmte und diese Arbeit mal etwas leichter zu sein schien als die Schufterei der letzten Wochen, willigte ich ein. Schon am nächsten Tag sollte es losgehen.
Am Abend kam Wiebke nach Hause und sah den Brief aus Norwegen auf dem Tisch liegen. Neugierig schnappte sie sich ihn, bevor ich ihn an mich nehmen konnte und versuchte verwundert, die Sprache zu entziffern.
„Wer schreibt dir den so etwas?“, wollte sie wissen.
„Ich weiß auch nicht, der lag heute zusammen mit der anderen Post im Kasten.“
„Das ist ne Frau, das sieht man an der Schrift.“
„Und an dem Namen unten“, ergänzte ich.
„Malin, hm, kenne ich nicht, vielleicht eine Bekannte aus der Schulzeit?“
„Nein, kommt nicht in Frage, hab ich schon alles überlegt.“
„Du warst doch im letzten Jahr mit verschiedenen Touristengruppen unterwegs zur Insel Neuwerk, du weißt schon, als du als Wattführer gejobbt hast. Vielleicht hast du da eine besonders beeindruckt, und die schreibt dir jetzt.“
„Nee, nee, da waren keine Norweger dabei. Und wenn auch, woher sollte sie meine Adresse haben?“
„Dann fällt mir auch nichts ein. Oder hast du etwa noch irgendeine Freundin, von der ich nichts weiß?“
„Sehr witzig, du weißt, dass ich dich liebe.“
Wiebke verschwand im Bad. Ich kochte derweil ein Abendessen. Ich wusste, dass sie das sehr schätzte, wenn sie abends nach Hause kam und sich nicht mehr um die Zubereitung des Essens kümmern musste. Es war ihr nicht wichtig, was ich kochte, sondern dass ich mir die Mühe für sie und mich machte. So konnte sie sich einfach nach der Arbeit entspannen. Wie ich so vor mich hin rührte, überlegte ich, ob ich nicht doch langsam auf ihren Heiratswunsch eingehen sollte. Sie und ich gingen allmählich auf die Mitte 30 zu, und da konnte ich ihr ihren Wunsch, zu heiraten, eigentlich nicht mehr lange abschlagen. Noch bevor ich den Gedanken zu Ende führen konnte, stürmte Wiebke mit nassen Haaren aus dem Bad, hielt ihre Nase in meine Töpfe und schaute mich mit erwartungsvollen Augen an.
„Bratkartoffeln mit Frikadellen und Gurkensalat“, murmelte ich vor mich hin.
„Oh, lecker, etwas deftiges, danach ist mir jetzt“, antwortete sie und setzte sich hungrig an den Tisch.
„Bin gleich soweit“, meldete ich und wendete noch einmal die Frikadellen. Dann tischte ich auf, und wir saßen gemütlich wie immer in unserer Essecke und plauderten über den Tag. Wiebke erzählte mir allerhand Geschichten aus der Apotheke, und ich fand es nie langweilig, da es immer wieder neue Begebenheiten mit Kunden und Patienten waren. Ich liebte es, wenn sie so da saß und ihrem Erzählfluss freien Lauf ließ. Ich hatte meist nicht soviel zu berichten, da ich ja mehr oder weniger für die Hausarbeit zuständig war und nur dann und wann einen vorübergehenden Job hatte. Ich war mir sicher, wenn ich mich außerhalb unserer Stadt bewerben würde, eine feste Anstellung zu finden. Aber dafür war Wiebke nicht zu haben. Sie hing sehr an mir und wollte mich täglich sehen. Ihr mache es nichts aus, wenn sie arbeiten gehe und mich dafür immer in ihrer Nähe habe, versicherte sie mir andauernd. Das konnte ich einerseits gut verstehen, aber für mich persönlich war das nur schwer zu akzeptieren.
Am nächsten Tag begann meine Arbeit als Strandwärter, und bevor ich mit dem Drahtesel zum Duhner Strand fuhr, besorgte ich mir in der Stadt noch ein deutsch-norwegisches Wörterbuch. Ich war zu neugierig, was wohl in dem anonymen Brief vom Vortag stehen würde. Da vormittags vor allem die Sportler und Rentner unterwegs waren, konnte ich es mir leicht erlauben, in meinem Wärterhäuschen ab und zu einmal den Blick vom Strand weg zu wenden, um mich der Übersetzung des Briefes zu widmen. Ich setzte mir einen Kaffee auf, den ich in dem kleinen spärlich ausgestatteten Büro noch fand und machte es mir an meinem Schreibtischchen vor dem Fenster mit Strand- und Meerblick gemütlich, so gut es ging. Die Flut hatte eingesetzt, und es wehte ein leichter Wind bei strahlendem Sonnenschein. Ich begab mich an die Arbeit. Wort für Wort wollte ich übersetzen. Anfangs machte das Nachschlagen jedes einzelnen Wortes recht viel Mühe, aber mit der Zeit wiederholten sich viele Wörter, und so kam ich dann auch Zeile für Zeile schneller voran. Zwischendurch machte ich immer mal wieder eine Pause, um mich meiner eigentlichen Tätigkeit zu widmen und die Augen entspannt über das Meer wandern zu lassen. In der Ferne sah ich die Schiffe, die einliefen oder aus dem Hafenbecken heraus kamen. Am Strand war alles ruhig. Nur wenige Spaziergänger waren da, und die benahmen sich anständig. Ich schlürfte an meiner Kaffeetasse und übersetzte wieder einige Zeilen. Dann allmählich trat der Inhalt des Briefes für mich mehr oder weniger verständlich zu Tage. Aus den übersetzten Wörtern ließ sich der Satzbau ganz gut erahnen und am Ende, nach ca. einer Stunde, wusste ich ungefähr über den Inhalt Bescheid.
Eine junge Frau Namens Malin schrieb diesen Brief wahrscheinlich mit der Absicht an einen Unbekannten, um sich einfach nur mitzuteilen. Warum, war mir zunächst unklar, weil das, was sie schrieb, eigentlich nur eine Momentaufnahme aus ihrem Leben gewesen zu sein schien, wenn auch eine beschauliche und für den Leser durchaus angenehme. Kurz zusammengefasst schrieb sie in diesem Brief etwa folgendes:
Hallo lieber Unbekannter,
ich nenne dich einfach Julius, wenn du nichts dagegen hast. Ich heiße Malin, sitze hier am Strand, schaue auf das Wasser und male. Ich zeichne die Schiffe, die im Osloer Hafen ein- und auslaufen. Das tue ich sehr oft, und es ist sozusagen eine meiner Hauptbeschäftigungen, denen ich nachgehe. Wenn ich hier sitze, kann ich mich gut auf meine Gedanken konzentrieren und über das nachdenken, was mich beschäftigt. Ich frage mich, wo wohl all die auslaufenden Schiffe hinfahren, wenn sie aus meinem Sichtfeld verschwunden sind. Oft überlege ich mir dann, wie es wäre, wenn ich auf einem von ihnen mitreisen könnte. Was würde ich zu sehen bekommen? Das Meer, andere Länder, andere Städte? Nicht auszudenken, welche Möglichkeiten darin lägen, einfach solch eine Reise zu unternehmen. Und damit mir das in Erinnerung bleibt, was ich mir so denke, zeichne ich es auf. Vielleicht sollte ich dir bei meinem nächsten Brief eins meiner Bilder mitschicken, damit du siehst, wie ich mir jene Welt vorstelle, wohin diese Schiffe fahren. Mein Onkel sagt immer, ich sei eine Träumerin. Vielleicht bin ich das auch, und doch finde ich, dass nur wer noch Träume hat, auch Ziele verfolgen kann. Per, so heißt er, meint es nicht böse, aber er ist nun mal ein typischer Insulaner in seiner kleinen Welt hier. Er fährt nur ab und zu nach Oslo, um besondere Dinge einzukaufen. Die Häufigkeit solcher Überfahrten auf das Festland im Jahr kann man an zwei Händen abzählen. Gewohnt hat er zeitlebens auf seiner Insel, wie ich im Übrigen auch, jedenfalls seitdem ich 12 Jahre alt war oder so. Genau weiß ich das auch nicht mehr. Ich lebe nämlich bei ihm. Er ist Uhrmacher und hat eine kleine Werkstatt am anderen Ende unseres Eilandes. Soweit ich kann, unterstütze ich ihn in seinem täglichen Leben. Er bringt mich jeden Tag hierher, zu meinem Lieblingsstrandabschnitt und holt mich nach ein paar Stunden wieder ab. Bei seiner nächsten Überfahrt will er mich vielleicht mitnehmen. Oh, da kommt schon wieder so ein Pott; den habe ich hier ja noch nie gesehen, mächtig groß. Das Wetter ist momentan so schön hier, da könnte ich noch viel länger da sitzen und auf das Plätschern der Wellen lauschen. Weißt du, es geht jetzt langsam auf den Sommer zu, und die Tage hier sind dann, wenn die Sonne scheint, sehr lang - und wenn man abends hier am Ufer weilt, kann man fast unendlich lange in die helle Weite blicken und sich überlegen, wo es dort hingehen könnte.
Da kommt Per, er holt mich nun hier ab, und wir werden nach Hause gehen. Machs gut Julius, bis zum nächsten Brief,
Malin.
Das was da stand, berührte mich eigentümlich und in zweierlei Hinsicht. Zum einen war das, was diese Malin schrieb, wohl Ausdruck ihrer Wünsche und Träume, und zum anderen klang das alles irgendwie einsam, als wenn sie ziemlich alleine ihre Zeit verlebte und vorwiegend am Strand ihrer Insel anzutreffen sei. Sehr seltsam kam mir das Ganze vor; und warum erzählte sie das einem wildfremden Menschen? Ich beschloss, erst einmal den Brief bei Seite zu legen und ihm weiter keine Bedeutung zukommen zu lassen. Vielleicht war es ja nur ein einmaliger Vorfall und die Verfasserin würde nie wieder etwas von sich hören lassen. Möglicherweise hatte sie einfach nur einmal eine verrückte Idee, und es war ihr mittlerweile vielleicht peinlich, einem Unbekannten ihre Geschichte mitzuteilen. Aber neugierig war ich nun schon, ob sie sich wirklich noch einmal melden würde. Auch die Gedanken, die sie beschäftigten, interessierten mich, da ich selber oft am Döser Strand entlang lief zur alten Kugelbake, dem Wahrzeichen Cuxhavens, um von da auf das Meer zu schauen und mir vorzustellen, wie es denn wäre, das alles einmal hinter mir zu lassen und mein Glück irgendwo anders auf der Welt zu suchen. Das war ein stiller, geheimer Gedanke von mir, über den ich mit Wiebke nie sprach, weil sie es nicht verstehen und mich, genau wie Malins Onkel seine Nichte, wahrscheinlich einen Träumer nennen würde, um dann zur Tagesordnung überzugehen.
Ich wurde in meinen Gedanken unterbrochen, als es an der Tür klopfte und ich den unerwarteten Besucher hereinbat. Es war meine Freundin.
„Was machst du denn hier?“, fragte ich sie.
„Hi, Schatz. Papa hat mich heute Mittag früher fort gelassen. Wann kannst du Mittag machen?“
„Eigentlich noch nicht, ein Stündchen muss ich hier noch sitzen, von 9 bis 12 war ausgemacht.“
„Ach so, schade, darf ich denn solange hier bleiben?“
„Ja, ich glaube, die von der Verwaltung werden nichts dagegen haben. Setze dich doch da auf den Hocker. … Übrigens, ich habe mal so zum Spaß grob den Brief aus Norwegen übersetzt, willst du ihn sehen?“
„Ja, gib mal her.“
Ich reichte Wiebke meinen Übersetzungsversuch, und sie las sich den Text durch.
„Komisch, wem soll das was bringen?“, fragte sie in ihrer typisch nüchternen Art, die sie manchmal schlagartig an den Tag legte.
„Keine Ahnung, aber es interessiert mich schon, was dahinter stecken könnte.“
„Was soll denn daran interessant sein, wenn jemand über seine Erlebnisse am Strand philosophiert und den Sermon dann wildfremden Leuten zukommen lässt?“
„Ich frage mich nur, wo die Verfasserin meine Adresse her haben könnte. Ein deutsches Adress- oder Telefonbuch wird es bestimmt nicht so oft in Norwegen geben“, spekulierte ich.
„Komm, vergiss es“, meinte Wiebke ihr Desinteresse zeigend und reichte mir den Zettel zurück, „du solltest dir nicht unnötige Arbeit mit der Übersetzung machen. Reine Zeitverschwendung, glaube ich.“
„Ich weiß nicht, ich könnte mir vorstellen, dass die Person vielleicht doch einen realen Grund hatte, diesen Brief zu verfassen; und wenn man ihr Glauben schenken darf, werden noch weitere folgen.“
„Und wenn schon, schau lieber aus dem Fenster nach draußen und sieh zu, dass da unten nichts passiert“, ermahnte Wiebke mich und wies auf den Strand, wo gerade zwei Jugendliche anfingen, sich zu prügeln. Ich öffnete das Fenster und rief den beiden Streithähnen zu, den Blödsinn bleiben zu lassen, worauf hin sich diese davon trollten.
„Aber jetzt mal im Ernst“, fing ich wieder von vorne an, „wie kann man wohl ihre Adresse herausbekommen?“ Mich beschäftigte die Sache mehr und mehr.“
„Och, jetzt steigere dich doch nicht so da rein; das wirst du kaum jemals herausfinden, wenn sie, sofern es sich wirklich um eine ‚Sie’ handelt, sie dir nicht mitteilt. Jetzt schmeiß den Quatsch weg, und lass uns über Wichtigeres reden, zum Beispiel, was wir am Wochenende unternehmen wollen; es soll nämlich ein schönes Frühsommerwetter geben. Ich hätte Lust zu einer Fahrradtour. Wir könnten auch noch Corinna und Fabian fragen, ob sie mit uns kommen. Was meinst du?“
„Können wir nicht mal was alleine machen?“
„Machen wir doch so oft, komm, sei kein Frosch.“
„Ich überlege es mir“, antwortete ich, immer noch an den Brief denkend.
Es klopfte. Das war meine Ablösung, die am Mittag die Wache übernahm. Ich übergab meinen Platz und sagte dem studentisch aussehenden Typen, dass es keine Besonderheiten gegeben hätte. Danach spazierte ich mit Wiebke zurück über den Deichweg nach Döse.
„Papa fragte mich übrigens, wann wir uns endlich verloben“, fing Wiebke erneut mit dem alt bekannten Thema an.
„Ich denke, der sieht unsere Beziehung mit Argwohn.“
„Ja, ein bisschen vielleicht, aber er sagte mir, dass ich ja schließlich mit dir glücklich werden müsse. Er hat schon verlauten lassen, dass er und Mama sich eigentlich freuen würden, wenn wir endlich mal Nägel mit Köpfen machten.“
Oh nein, dachte ich mir, jetzt ginge der Druck auch schon von Seiten ihrer Eltern los. Ich ging nicht weiter darauf ein und brachte Wiebke zurück zu ihrer Apotheke. Ihren Eltern wollte ich eigentlich nicht begegnen, und ich wollte Wiebke mit der Ausrede, dass ich noch in die Stadt müsse, schnell am Geschäftseingang abliefern; da kam aber auch schon ihr Vater heraus.
„Ach hallo Julius“, begrüßte er mich väterlich. Er war ein kleiner etwas schmächtiger Mann mit Glatze und Hornbrille; eigentlich sehr nett, aber er sah immer so aus wie ein Spinnentier mit seinen fast schon grazilen Extremitäten. Irgendwie fiel es mir immer schwer, ihn ernst zu nehmen, vielleicht auch deshalb, weil ich seinen Vorbehalt gegen Wiebkes und meine Beziehung kannte.
„Wollen Sie eine Tasse Tee mit meiner Frau und mir trinken? Meine Tochter übernimmt solange. Ja, Wiebke, machst du das?“, fragte er freundlich dreinschauend.
„Ist gut Papa. Komm Julius, Mama ist drüben in der Küche“, forderte mich meine Freundin auf, ihr ins Haus zu folgen, als wenn ihr diese Einladung ganz recht gekommen wäre.
Etwas widerwillig ließ ich mich von ihr durch den Verkaufsraum in den Eingangsbereich der danebenliegenden Wohnung schieben. Dort saß ihre Mutter Hermine am Küchentisch und hieß mich willkommen.
„Setz dich doch hierher zu uns; Gustav, kommst Du auch?“ Sie schaute fragend nach hinten zu ihrem Mann, der sich mit dem Teeservice und einer Kanne Ostfriesentee an unseren Tisch gesellte. Ich schaute verdutzt zu Wiebke, die sich, als sie mich sozusagen ihren Eltern übergeben hatte, ihren Kittel überstreifte und in die Apotheke absetzte. Was sollte das werden, fragte ich mich. Eine Vernehmung? Sonst luden die beiden mich doch auch nicht so aus heiterem Himmel zu Tee und Gebäck ein. Ich war gespannt, was kommen würde und versuchte, eine vernünftige Sitzhaltung auf der ziemlich unbequemen Eckbank mit dem beige-braunen Blumenmuster in der Küche einzunehmen.
„Geht es dir gut?“, fragte mich Gustav.
„Ja, doch, ich meine, es gibt bei mir momentan keine Besonderheiten.“ Ich blickte erwartend in die Runde. Als Hermine mir ebenfalls Tee eingeschenkt hatte, herrschte eine verklemmte Ruhe im Raum. Wiebkes Eltern rührten stumm vor sich hinschauend in ihren Teetassen herum. Ich saß da und sah die beiden abwechselnd fragend an. Dann mit einem Mal begannen sie fast simultan zu reden.
„Julius, wir …“ Sie schauten sich an, dann ließ Hermine ihrem Mann den Vortritt: „Also, was wir dir sagen möchten, ist, dass wir eigentlich nichts gegen dich haben.“
„Und uneigentlich?“
„Ja“, fuhr Gustav fort, „du bist nun schon so lange mit Wiebke zusammen, und uns ist auch nicht entgangen, dass das zwischen euch wohl was Ernstes zu sein scheint.“
Ich beäugte die beiden kritisch, wartend auf einen Clou, denn der lag irgendwie in der Luft.
„Und?“, fragte ich weiter.
„Also wir, ich meine Hermine und ich, haben uns gedacht, dass es vielleicht gut wäre, wenn ihr zwei dann doch mal heiraten würdet.“
„Ich em …“, wollte ich beginnen, mich dazu zu äußern, aber da fiel Hermine schon ein:
„Ich weiß, das kommt von unserer Seite vielleicht jetzt etwas plötzlich, aber wir haben mit Wiebke gesprochen, und sie hat uns quasi, ja wie soll man sagen …“
„… überzeugt“, vervollständigte Wiebkes Vater, „sie hat uns von dir überzeugt.“
„So, hat sie das?“, fragte ich rhetorisch.
„Ja, du bist ja auch ein echt netter Kerl“, meinte Gustav und klopfte mir auf die Schulter.
„Wir haben uns das so gedacht …“, begann Hermine, umständlich auszuführen. Was sie dann sagte bekam ich nicht ganz mit, weil ich genervt und ungläubig zugleich nach nebenan in den Verkaufsraum zu Wiebke schielte, die mich beim Bedienen hinter ihrem Tresen unsicher lächelnd anschaute. Ich rollte mit den Augen, um ihr zu verstehen zu geben, dass mir das, was mir ihre Eltern da eröffneten, überhaupt nicht passte. Sie nickte mir aber ernsthaft energisch zu, als wollte sie mir sagen, dass ich mir zumindest alles anhören sollte, was ihre Eltern vorzuschlagen hätten. So machte ich gute Miene zum bösen Spiel und sah Hermine pseudointeressiert bei ihren Ausführungen zu. Dass sie, also die Eltern, die Kosten übernehmen wollten und alles mit ihrer Verwandtschaft zusammen organisieren würden, schlugen die beiden vor und dass wir, Wiebke und ich, dann nach der Hochzeit in ihrem Sommerhäuschen am Duhner Strand vorübergehend wohnen könnten. Das würde Kosten sparen und mehr Platz wäre da auch. Dafür könnte ich mich etwas ums Haus kümmern, sozusagen als Gegenleistung.
„Na, wie ist das?“, fragte Gustav mich mit erwartungsvollem Grinsen.
„Was wollen Sie hören?“, kam es von mir zurück, und in mir fing es an, leicht zu brodeln; weniger wegen der für mich ohnehin unakzeptablen Ideen als mehr wegen der Tatsache, dass Wiebke diese Unterhaltung mit ihren Eltern offensichtlich geplant hatte, ohne mich vorher zu informieren.
Ich trank meinen Tee aus und blickte augenscheinlich mit finsterem Gesichtsausdruck drein, denn Hermine fragte mich sogleich, was ich denn habe. Ich wollte aber nicht unhöflich werden, sondern erklärte den Zweien, dass ich darüber erst noch mal schlafen müsse, wohl wissend, dass sie sich diese Vorschläge aus dem Kopf schlagen könnten.
„Ja ich muss dann mal wieder“, meinte ich freundlich zu ihnen und bedankte mich für den Tee. Dann erhob ich mich und verließ die Küche in Richtung Verkaufsraum, wo Wiebke gerade einen älteren Herrn bediente. Ich ging an ihr vorbei, konnte aber wegen der Kundschaft nicht reden. So schaute ich sie beim Passieren nur mit verständnislos wackelndem Kopf an, bevor ich die Apotheke verließ. Draußen angekommen musste ich erst einmal durchatmen. Ich kam mir so richtig vereinnahmt vor; das hatten sie sich so gedacht, dass ich in ihre Familie einheirate und dann mehr oder weniger in unabsehbare Abhängigkeiten geraten würde. Nein, daran hatte ich kein Interesse. Was würde sich so auch für mich ändern? Beruflich ja bestimmt nichts; im Gegenteil, ich würde mich noch mehr an diesen Ort binden, als ich es ohnehin schon getan hatte. Richtig sauer war ich hingegen auf Wiebke, enttäuscht darüber, wie sie wohl hinter meinem Rücken versuchte, ihre Idee von unserer Hochzeit durchzudrücken. Ich hatte Verständnis für sie und ihre Wünsche, aber etwas in mir sagte mir, dass ich Wiebke hier nicht heiraten sollte, zumindest nicht im Moment. Vielleicht war ich auch einfach nur undankbar; boten mir Wiebkes Eltern doch so gesehen ein sicheres Leben an. Aber das würde bedeuten, in permanenter Abhängigkeit unser Leben so zu leben, wie es Wiebke vorschwebte, und ihren Eltern natürlich. Ich würde mir wie ein fünftes Rad am Wagen vorkommen in dieser Familie.
Gedankenverloren schlenderte ich zum Strand und blickte auf die sachten Wellen der Abendflut in Richtung Norden. Enttäuscht über Wiebkes Verhalten musste ich an die unbekannte Briefschreiberin denken und zog Parallelen. Sie schien, genauso wie ich, etwas zu suchen in ihrem Leben, wenn man dem Glauben schenken durfte, was sie schrieb. Je mehr ich darüber nachdachte, umso mehr wurde mir klar, dass ich in Cuxhaven keine besondere Zukunft haben würde, sowohl mit, als auch ohne Heirat; nur mit der ersteren Option hätte ich mich festgelegt. Das wollte ich auf keinen Fall. Ich überlegte mir, meine Fühler beruflich nun doch weiträumiger auszustrecken. Nach dem, wie Wiebke sich mir gegenüber verhalten hatte, sah ich nun keinen Grund mehr, dies nicht zu tun. Ich befürchtete, dass es an diesem Abend zu einem Konflikt zwischen uns kommen könnte; und da wären die Fronten auf jeden Fall verhärtet. Ich ging am Strand entlang nach Hause in Richtung Döse; ich wollte trotz meines Unmuts etwas kochen und Wiebke von mir aus an diesem Abend nicht mehr mit unserem Streitthema konfrontieren.
Im Briefkasten war dieses mal nur unauffällige Post für meine Freundin und nichts für mich, auch kein anonymer Brief, auf welchen ich insgeheim schon ein wenig gehofft hatte. War dies doch ein Kanal, zumindest gedanklich in eine fernere Welt einzutauchen. Ich fragte mich zum ersten Mal, seit ich mit Wiebke zusammen war, ob wir wirklich zusammen passten. Warum liebte sie mich eigentlich? Warum liebte ich sie?
Wir hatten uns vor Jahren in Köln kennengelernt, quasi auf der Straße. Sie war Studentin im Examen, und ich hatte zu dieser Zeit noch einen Job als wissenschaftliche Hilfskraft an der Uni. Wir prallten im wahrsten Sinne des Wortes an einer Straßenecke aufeinander. Wiebke, zu Fuß mit zwei schweren Plastiktüten vom Supermarkt kommend und ich, per Fahrrad auf dem Fußweg und viel zu schnell von der Uni nach Hause eilend. Ich fuhr mitten in eine ihrer Plastiktüten, was sie persönlich vor einer Verletzung schützte. Dafür verteilte sich der Tüteninhalt weiträumig auf der Straße. Wir waren beide wie gelähmt und sahen uns sekundenlang nur an. Ich erwartete nun ein Donnerwetter ihrerseits, welches aber ausblieb. Nüchtern meinte sie nur, dass das wohl ihr Abendessen gewesen sei. Ich war sofort mit schlechtem Gewissen bemüht um sie und bot ihr an, den Schaden zu ersetzen, indem ich für sie noch einmal diese Sachen einkaufen und sie ihr dann nach Hause bringen wollte. Das hatte sie wohl beeindruckt, und sie schlug mir im Gegenzug vor, sie einfach zum Essen einzuladen. Wir verstanden uns auf Anhieb. Es dauerte auch nicht lange, da waren wir beide zusammen. Wir wohnten zwar dort noch getrennt, aber zu dem Zeitpunkt, als Wiebke ihr Examen machte, erfuhr ich, dass mein Vertrag an der Uni in Kürze auslaufen würde. Damals war ich noch recht enthusiastisch und schrieb eine Neubewerbung nach der anderen, denen ebenso viele Absagen folgten. Da kam Wiebke auf die Idee, mit ihr in ihre Heimatstadt Cuxhaven zu ziehen; von dort könne ich genauso gut meine Bewerbungen schreiben, und wir könnten zusammen wohnen; auch finanziell bräuchte ich mir keine Gedanken zu machen, da sie ja eine Anstellung in der elterlichen Apotheke bekomme und ich so meinen beruflichen Werdegang in Ruhe und ohne Geldknappheit angehen könne. Ich folgte ihr also nach Cuxhaven und schlug gutgemeinte Ratschläge meiner Freunde, von denen es in Köln einige gab, in den Wind. „Was willst du denn da oben, da gehörst du doch gar nicht hin“, bekam ich zu hören, und: „Du hast doch hier deine Freunde und Familie, willst du das alles so abbrechen?“ Auch meine Jobchancen schätzten meine damaligen Freunde im Rheinland günstiger ein als im Hohen Norden, wie sie immer sagten. „Et es wie mem Dom, ne kölsche Jung jehört no Kölle.“ Aber Wiebke setzte sich durch, und ich ließ mich schließlich überreden, mit ihr zu kommen, da ich sie ja auch wirklich lieb hatte. Anfangs fand ich meine Zeit in Cuxhaven auch sehr angenehm; das Meer, das Watt, die langen Spaziergänge mit Wiebke am Strand entlang und das norddeutsche Gemüt hatten etwas Beruhigendes. Auch wenn die Mentalität der Nordlichter so gar nicht zur rheinischen Frohnatur zu passen schien, gewöhnte ich mich damals recht schnell an meine neue Lebenssituation. Wir mieteten uns eine kleine Wohnung im Stadtteil Döse, die nicht gerade die billigste Wohngegend war, aber dafür lag die Wohnanlage in unmittelbarer Nähe zum Strand. Mir war es trotzdem zu teuer, Wiebke jedoch bestand darauf, und außerdem würden ihre Eltern die Miete ja mit bezuschussen. Das war dann auch der erste ernstere Konflikt zwischen uns, da ich von Anfang an nicht in irgendeiner Abhängigkeit ihrer Verwandtschaft leben wollte. „Sieh es doch als Gehaltszugabe an“, meinte Wiebke, „und denke nicht weiter darüber nach.“ Das war aber nur der Beginn, denn ich hatte den Eindruck, dass ihre Eltern immer wieder versuchten, sich in unsere Beziehung einzumischen. Was anfangs als wohl gemeinte Hilfe gedacht war, äußerte sich mehr und mehr als Versuch, unser Leben mitzubestimmen. Ob es um die Planung der Ferien ging oder die Auswahl unserer Wohnungseinrichtung, immer waren Hermine und Gustav mit involviert; und zwar nicht Rat gebend, sondern fast schon bestimmend. Ich konterte dann immer, dass wir unser Leben eigentlich ganz gut selbständig im Griff hätten. Wiebke versuchte, in solchen Situationen zu vermitteln, hielt aber letztendlich zu mir, was mich ihren Eltern wohl nach und nach immer unsympathischer werden ließ. Auf der anderen Seite wollte deren Tochter diese auch nicht brüskieren und hatte so in der Vermittlerrolle eine unglückliche Stellung. Das wiederum führte zu Konflikten in unserer Beziehung. Jahrelang ging das gut so, weil unsere Gefühle für einander immer noch sehr stark waren; als dann das Thema mit der Heirat aufkam, war ich dem gegenüber grundsätzlich aufgeschlossen. Ich wollte mich aber beruflich zunächst festigen, bevor ich diesen Lebensweg einschlagen würde. Und da diesbezüglich in Cuxhaven für mich so gar nichts zu erreichen war, jedenfalls nicht mit Zukunft, knüpfte ich an eine Hochzeit mit Wiebke die Bedingung, dass wir uns nicht unbedingt auf ein Leben in ihrer Heimatstadt festlegen würden. Aber da war ich bei ihr an der falschen Adresse. Sie wollte auf keinen Fall ihre Familie und Freunde in ihrer Stadt verlassen. Das schwächte unsere Beziehung zusehends, entzweite sie jedoch nicht, da wir uns ansonsten emotional zu gut verstanden. Umso mehr war ich von ihr nach der letzten Aktion mit ihren Eltern enttäuscht. Meine Freundin hätte sich zumindest zusammen mit mir in diese Unterhaltung begeben können.
Es klingelte. Über meine Gedankengänge vergaß ich, die Fischstäbchen zu wenden, so dass sie nun recht angebrannt in der Pfanne schmurgelten. Ich öffnete das Küchenfenster und eilte zur Wohnungstür. Wiebke war von der Arbeit zurück.
„Hallo“, sagte sie kleinlaut und stahl sich an mir vorbei in die Diele, um ihre Jacke abzulegen.
„Hallo“, antwortete ich ebenfalls nüchtern, ohne sie zu küssen, wie ich es sonst jeden Abend tat, wenn sie nach Hause kam. Schmollend begab sie sich ins Bad, während ich versuchte, das Essen zu retten. Ich konnte ihr nicht wirklich lange böse sein. Als sie dann frisch geduscht an unserem Esstisch Platz nahm und auf die misslungenen Fischstäbchen schaute, fragte sie: „Ist das die Rache für heute Mittag?“
„Nein“, entgegnete ich leicht angesäuert, aber weniger wegen des mittäglichen Gespräches als mehr wegen des verdorbenen Essens.
„Bist du mir jetzt noch böse?“
„Nein, kann ich ja gar nicht lange“, zeigte ich mich versöhnlich. Sie stand auf, setzte sich auf meinen Schoß und legte mir ihren Arm um meine Schultern.
„Verstehst du mich denn wenigstens ein bisschen?“, fragte sie weiter.
„Ja, ich kann dich verstehen, aber warum muss das Ganze an diesen Ort gebunden sein? Ich meine, Deutschland ist überall schön, und es gibt mit Sicherheit tolle Gegenden, wo ich bessere Chancen hätte und du auch eine Stelle bekommen könntest. Mein Vorschlag zur Güte wäre, dass wir uns beide überall bewerben, und wenn wir zwei in einer Stadt eine Stelle bekommen, ziehen wir zusammen dort hin und müssten nicht getrennt voneinander wohnen. Es muss ja nicht unbedingt Köln sein.“
Wiebke schaute zu Boden, und ich merkte ihr an, dass sie nur schwerlich, ja eigentlich nicht bereit war, mir zuzustimmen.
„Aber was hast du nur dagegen, hier zu bleiben? Meine Eltern unterstützen uns doch gerne, ich bin ihre einzige Tochter, und Mama und Papa werden auch nicht jünger. Es sind nicht nur meine Freunde und die Verfestigung in meiner Heimat, die mich hier halten. Es sind vor allem meine Eltern und das Geschäft, welche ich nicht im Stich lassen möchte und kann. Papa hört bald auf, und Mama wird es alleine nicht schaffen. Früher oder später werde ich hier gebraucht werden. Und dann müssten wir wieder umziehen.“
Ich konnte mich schon in Wiebkes Lage versetzen, und so machte ich ihr denn einen zweiten Vorschlag, nämlich, mich in Hamburg oder Umgebung zu bewerben und eben nur alle paar Tage nach Hause zu kommen. Aber auch das lehnte sie kategorisch ab. Das käme einer Trennung ja fast schon gleich, und sie wolle mich unbedingt möglichst oft um sich herum haben. Ich befürchtete, dass wir so auf keinen Konsens kommen würden. Dementsprechend wortkarg verlief auch dieser Abend. Ich schaute fern, und Wiebke saß auf dem Sofa und blätterte in einem ihrer dicken Pharmaziebücher herum; scheinbar ziellos, denn in ihrem Gesicht konnte ich erkennen, wie unser Konflikt in ihr arbeitete.
Am nächsten Tag erlebte ich eine unangenehme Überraschung bei meinem neuen Job. Ich wollte gerade mein Räumchen betreten, da bog mein Chef um die Ecke und kam mit hochrotem Kopf auf mich zu.
„Haben Sie gestern die Kaffeemaschine benutzt?“, fragte er mich sichtlich genervt.
„Ja …“, erwiderte ich zögernd, „warum?“
„Das zeige ich Ihnen jetzt.“ Er schloss den Raum auf, bevor ich es tun konnte, und ich sah sofort den Grund seiner Verstimmung. Dort, wo ehemals die Kaffeemaschine ihren Platz hatte, befand sich nur noch ein undefinierbarer Kunststoffklumpen. Die Spültheke darunter war total verrußt und die Wand dahinter ebenso. „Beinahe wäre die ganze Bude abgefackelt“, erzürnte sich der Verwaltungsleiter, „Ihr Nachfolger versicherte mir, er hätte die Maschine nicht benutzt, aber auch nicht beachtet. Sie muss sich wohl nachts dann irgendwann überhitzt und angefangen haben zu schmoren. Ein Glück, dass die Sicherung herausgeflogen ist. Die Putzfrau hat dann heute Morgen das Malheur entdeckt.“
Ich überlegte fieberhaft, ob ich die Kaffeemaschine nicht abgestellt hatte. Aber ich war wohl zu sehr mit der Übersetzung des Briefes einerseits und mit Wiebke andererseits beschäftigt, so dass ich darüber bei der Übergabe vergessen hatte, das Ding abzuschalten.
„Tja“, sagte ich mit rotem Kopf, „ist wohl wirklich meine Schuld … tut mir Leid.“
„Sie werden verstehen, dass ich Sie unter diesen Umständen nicht als zuverlässiges Aufsichtspersonal behalten möchte“, meinte mein Chef knapp angebunden daraufhin.
„Aber wieso ...“
„Nein, tut mir wirklich leid, aber ich glaube, das hat keinen Zweck“, war sein sichtbar endgültiges und in meinen Augen nicht gerechtes Urteil. „Wenn Sie noch nicht einmal so etwas unter Kontrolle haben …“ Er schüttelte den Kopf und überreichte mir gleich einen Zettel für die Arbeitsagentur, damit diese mir weiter meine Lohnersatzbezüge auszahle. Unfair fand ich es, wie er mich behandelte, so etwas kann ja schließlich jedem einmal passieren, aber dieser Vorfall passte irgendwie in meine derzeitige Gemütslage.
Resigniert wanderte ich über den Deich und überlegte mir, was man mir als nächstes wieder anbieten würde. Ich hatte an diesem Mittag überhaupt keine Lust, Wiebke zu treffen. Das war seltsam, da wir uns sonst fast immer mittags sahen. Der Vorfall vom Vortag und ihre starre Haltung beeinflussten mich wohl noch nachhaltig. Ich würde später am Tage noch einmal zur Arbeitsvermittlung fahren, um mich umzuhören. Aber zunächst machte ich noch einen Abstecher nach Hause um nach der Post zu schauen und ertappte mich bei der Hoffnung, dass vielleicht ein Brief aus Norwegen dabei wäre. Ich traf den Postboten an unserem Haus an, und er begann gerade damit, die Kästen zu füllen.
„Warten Sie“, sagte er, „sind Sie Herr Meinhard?“
„Ja“, ich blieb erwartungsvoll stehen.
„Nee“, er stocherte in seinem Briefpaket, „nix dabei … oder doch hier, ohne Absender.“
Schnell riss ich den Umschlag an mich und rannte neugierig die Treppe hinauf zu unserer Wohnung. Die Tür öffnete sich wie von selber, denn Wiebke war überraschend zu Hause und hatte mich wohl erahnt.
„Hi, Schatz, komm rein, ich habe uns aus der Stadt etwas zu Essen mitgebracht“, empfing sie mich mit einer Umarmung. Sie war ausgesprochen gut aufgelegt und freundlich. „Papa hat mir für den Rest des Tages frei gegeben, so können wir doch gemeinsam den Nachmittag verbringen. Was hältst du von einer Radtour über den Deich in den Wernerwald?“
„Ja …“, erwiderte ich leicht überrumpelt, „warum nicht.“
Der Wernerwald ist ein ca. 300 Hektar großer künstlich angelegter Wald in Cuxhaven, in dem hauptsächlich Kiefern wachsen. Dort befindet sich das sogenannte Finkenmoor; ein See, der durch unterirdische Quellen entstanden ist. Viele Wege führen dort kreuz und quer hindurch, die sich hervorragend zum Wandern und Radeln eignen. Besonders eindrucksvoll ist der direkte Übergang vom Waldgebiet zur Nordseeküste. Ich sagte Wiebke, dass ich eigentlich noch zur Arbeitsagentur müsse und erzählte ihr von meinem unglücklichen Ende als Strandwart.
„Och, das tut mir leid“, kam sie äußerst liebevoll auf mich zu. Sie spürte irgendwie, dass ich einen Seelentrost brauchte, vielleicht befürchtete sie aber auch, dass durch diesen erneuten, wenn auch lappalienhaften Misserfolg mein Wille, den Ort zu verlassen, nur noch bestärkt würde. Umso mehr war sie um mich bemüht.
„Also gut, das hier kann ich auch morgen noch machen“, stimmte ich ihrem Vorhaben zu, und wies flüchtig auf den Brief in meiner Hand „wollen wir direkt nach dem Essen los?“