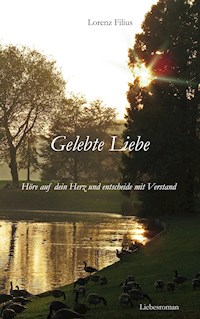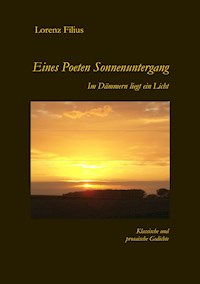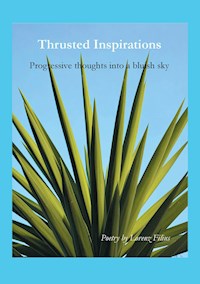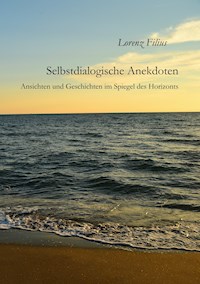Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Books on Demand
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Eigenbrötler Tobias ist alles andere als ein ausgeglichener Mensch. Hypernervös, zwischen ständigen Einbildungen, Befürchtungen und Verfolgungsvorstellungen einerseits und Erleichterungen andererseits emotional schwankend, jongliert er sich durch sein entscheidungsträges Singledasein. Seine generalisierte Angstbereitschaft setzt ihm dabei zuweilen seltsame Prioritäten. Als ein One-Night-Stand Tobias' Welt völlig aus den Fugen zu bringen droht, scheint das Schicksal noch einmal ein Einsehen mit ihm zu haben. Die kurzfristige Euphorie darüber stürzt ihn in eine fixe, jedoch halbherzige Idee, die völlig im Gegensatz zu seiner Lebensauffassung steht. Dabei verrennt er sich mehr und mehr in eine Entscheidung, die nicht einmal den von ihm favorisierten Ausweg des geringsten Widerstandes zu bieten scheint.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 377
Veröffentlichungsjahr: 2021
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Inhalt
Wochenendblues
Der Werktag von der Stange
Ein Ereignis mit Folgen
Wenn die Welt sich nicht mehr dreht
Eine fixe Idee
Zwischen Hoch und Tief
Der Sprung ins Leben
Nachtrag
Wochenendblues
Es war eines dieser langweiligen Sonntagvormittagserwachen. Die Decke, die mir bereits kurz nach dem Aufstehen drohte, auf den Kopf zu fallen, insistierte förmlich den Drang, meine vier Wände so früh wie möglich zu verlassen. Ein Marmeladenbrot im Stehen nebst einem Pott viel zu starken Kaffees - der erste von mindestens fünf am Tag - beschloss die Nacht, ohne den Morgen richtig zu beginnen. Der Genuss des sich anschließenden Zigarillos entlockte mir einen Seufzer der Gemütlichkeit, der genau so schnell verrauchte wie der Tabak, an welchem er hing. Ein Blick zur Uhr zeigte, dass die Zeit durch dieses kleine Glück nur unwesentlich vorangetrieben wurde.
Die Sonne schien, und ein angenehm kühler Septembertag sog meinen Blick durchs Fenster, als wenn er mir eine echte Alternative zum Verweilen in meiner Zweizimmerwohnung angeboten hätte. Alles war soweit gerichtet. Den Samstag hatte ich bereits damit verbracht, wieder einmal Ordnung in die Wohnung zu bringen. Ein Unterfangen, welches mich stark zufriedengestellt hatte. Wie oft hatte ich die Zimmer nun schon umgeräumt? Bestimmt dreimal in diesem Jahr. Viel mehr Möglichkeiten gab es eigentlich kaum mehr; und doch immer, wenn alle Möbel ihren optimalen Platz gehabt zu haben schienen, wurde ich der Anordnung nach ein paar Monaten erneut überdrüssig. Mal umziehen müsste man, dachte ich dann immer, um mich wenig später wieder in einer Samstags-Umräumaktion zu finden.
Ich zog meine leichte Jacke über und machte den üblichen Rundgang durch die Wohnung. Das ging stets relativ flott, wenn sie frisch aufgeräumt war, und so strengte mich das wiederholte Prüfen diverser Schalter, Armaturen und Fensterverriegelungen nicht so sehr an wie sonst. Immer mit der Idee im Kopf, während meiner Abwesenheit könne ein Brand ausgelöst oder die Wohnung Ziel eines Einbrechers werden, hakte ich penibel alle kritischen Punkte ab; Schalter, Geräte und Kerzen natürlich. Die Tür zu meinem Balkon war immer besonders zeitaufwendig, weil sie mit ihrem einfachen Schloss und dem unzuverlässigen Schnappmechanismus die schwächste Stelle der Wohnung darstellte. Über die Feuerleiter direkt daneben konnte man schnell bis zu mir in den zweiten Stock gelangen. Mein zusätzliches Steckschloss hatte ich in einer meiner letzten Umräumaktionen verlegt, mich jedoch nach und nach an sein Fehlen gewöhnt. Müsste mal ein neues kaufen, wo doch alles wieder so schön aussieht, überlegte ich kurz mit einem Kopfzucken; wäre doch eine Schande, wenn mein Reich gerade jetzt zerstört würde. Ach, da war es wieder, das Kopfzucken gegen jeden Willen. Aber im Anfangsstadium konnte ich es vielleicht noch in den Griff bekommen.
Ein Schatten durchflutete den Raum, der zugleich Wohn- und Schlafzimmer war. Ich blickte aus dem Fenster und sah leichte Wolkenfelder unter der Sonne herziehen. Na dann mal los, bevor es begänne, zu regnen und ich wieder einen Grund gefunden hätte, doch noch hinter dem Computer zu versacken. Ich versuchte, meinen Kopf ruhig zu halten. Schluss, spornte ich mich an, wenn du aus der Tür bist, lässt du es einfach. Beherzt schloss ich die Wohnungstür hinter mir und atmete tief durch, nachdem ich den Kohlgeruch aus der Nachbarwohnung von Frau Langhans im Treppenhaus passiert hatte und die Haustür hinter mir schwer und laut zufiel. So eine Tür müsste man an der Balkonseite haben, dachte ich kurz. Noch einen Zigarillo? Nein, den wollte ich mir lieber sparen für den Nachmittag; es würden sonst zu viele, und mir würde garantiert wieder schlecht werden - wie in der Woche zuvor.
Ich lief los, an den fahl gelben Mietshäusern der Bonner Luisenstraße entlang, wo ich vor Jahren eine günstige Zweizimmerwohnung ergattert hatte. Mein Job im Verwaltungsdienst als einfacher Bürogehilfe war zwar relativ sicher und warf für einen alleine auch nicht unbedingt einen Hungerlohn ab, allerdings widerstrebte es mir, den größten Teil meines bescheidenen Gehaltes für die Miete ausgeben zu müssen, da man das schöne Geld für viel interessantere Dinge anlegen konnte. - Für welche eigentlich? - Jedenfalls hatten diese Wohnungen klare Vorteile. Man war für sich und musste außer den Hausordnungsverpflichtungen keinerlei unerwünschte Bekanntschaften pflegen. Der Hausmeister kam im Falle eines Falles immer recht zuverlässig vorbei, und die Wohnungsbaugesellschaft hatte zumindest ein grobes Auge für Recht und Ordnung in der Siedlung. Nun ja, die Wohnungen waren etwas hellhörig; für mich, der nur in absoluter Stille ruhig einschlafen konnte, eigentlich ein klares Manko. Ich hatte im zweiten Stock die Wohnung in der Mitte und damit sozusagen alle anderen irgendwie um mich herum verteilt. Schon oft hatte ich mich über den linksseitig wohnenden Nachbarn geärgert, der es sich seit seinem Einzug ein Jahr zuvor zur Angewohnheit gemacht hatte, abends Musik über die Lautsprecher seines Fernsehers zu hören - ein dröhnendes Ding. Er benutzte ihn als Verstärker für seinen CD-Player, weil er keine Stereoanlage habe, wie er mir einmal erklärte, als ich mir nach wochenlang aufgestautem Mut ein Herz gefasst hatte, ihn darauf anzusprechen. Er gab sich zwar betroffen, und am folgenden Abend war es auch sehr ruhig, aber scheinbar war diese Betroffenheit im Laufe der Zeit überwunden. Sein Fernseher musste Wand an Wand mit meinem Schlafraum gestanden haben, wie ich schließlich mit einem Stethoskop herausfand - hatte ich mir mal gekauft. So lebte ich mehr oder weniger still leidend meine Abende weiter und ging seitdem nie mehr ohne Ohrenstöpsel zu Bett; auch wegen der anderen Geräusche von der Straße oder diverser Hausinstallationen meiner Mitbewohner. Das schien alles in der letzten Zeit zugenommen zu haben, und ich hatte schon die stärksten Gehörpfropfen, die es gab. Die übrigen Nachbarn um mich herum waren ansonsten sehr ruhig, lebten alleine und mussten wie ich früh raus. Das gab mir stets die Sicherheit, dass ich mich nicht auf unerwartete abendliche Störungen ihrerseits konzentrieren musste.
In der Nacht hatte es geregnet, und die Straße war noch glänzend nass. Das Licht der aufgehenden Sonne blendete mich im Spiegel der Nässe, und ich zog meine Sonnenbrille hervor, die ich immer in meiner vorbereiteten Jacke innen links verstaut hatte; rechts war das Portemonnaie und in den äußeren Taschen der Traubenzucker und das Kreislaufmittel. Ich neigte nämlich zu Unterzuckerungen - ein mieses, hilfloses Gefühl, welches ich unter keinen Umständen in der Öffentlichkeit erleiden mochte. Ich setzte die Brille auf. Ich hasste es, geblendet zu werden, das machte mich richtig aggressiv. Noch mehr ging es mir allerdings auf die Nerven, wenn die Brillengläser verschmutzt waren. Kein störender Punkt oder Fleck durfte sich auf dem Glas befinden. Das zwang mich immer, die Brille erst umständlich an meinem Jackensaum zu putzen. Ein Brillentuch fehlte immer in meiner vollgestopften Jacke, wahrscheinlich, weil ich keine Tasche mehr dafür übrig hatte. Ich war aufgerüstet und begab mich zum Bonner Talweg, der direkt ins Stadtzentrum führte. Allerdings bog ich, wie immer, in eine der abgehenden Seitenstraßen ein, um mich von dort aus durch die alteingesessene, gemütliche Wohngegend mit ihren großen Einfamilien- Reihen- und Patrizierhäusern entlang der Kastanienalleen stadteinwärts ziehen zu lassen. In diesem, etwas kleinbürgerlich, wohlbetuchteren Gebiet hatte ich über lange Jahre mein 12-Quadratmeter-Zimmer in einem der großen Gebäude unter dem Dach. 220 Mark kostete mich das damals monatlich; ein fast unschlagbarer Preis für eine Studentenbude nahe dem Stadtzentrum. Ich geriet wieder ins Schwärmen, als ich so für mich dort entlang eilte. Schon wieder war ich viel zu schnell unterwegs. Das war ich immer, wenn ich zu Fuß war, auch wenn ich mich nicht beeilen musste. Selbst wenn ich in Zeitnot war, schaffte ich es meistens, mich doch noch vor dem eigentlichen Termin vor Ort zu langweilen. Ein Schnellgeher war ich eben. Ich zwang mich, langsamer zu laufen; es sollte ja ein Spaziergang werden, und an diesem Sonntag erwartete mich nichts in der Stadt. Außerdem war ich erst wenige Hundert Meter unterwegs und musste etwas auf meine Herzfrequenz achten. In letzter Zeit hatte ich nämlich die Angewohnheit entwickelt, mich des Öfteren in eine Panikattacke hineinzusteigern. Bei meinem ersten Erlebnis dieser Art maß ich dem noch keine besondere Bedeutung bei. Als es sich aber danach in mehr oder weniger unregelmäßigen Abständen begann, zu wiederholen, wurde ich schon unruhig. Einen Grund konnte ich bis dahin nie herausfinden. Ich hasste jegliche Art solcher körperlichen Unzuverlässigkeiten und musste derartige Zustände unbedingt stabilisieren. Also glaubte ich, einen zu häufigen Konsum meines Kreislaufmittels als Ursache ausfindig gemacht zu haben in Verbindung mit meiner ewigen Hetzerei, der ich mich ausgesetzt sah. In der Tat schien das einen positiven Effekt zu haben. Ich nahm also das Mittel nicht mehr gleich bei jedem Anflug einer Körpersensation, sondern versuchte im Falle eines Falles dies durch eine erhöhte Dosis Traubenzucker auszugleichen; ich bildete mir zumindest teilweise erfolgreich ein, dass das wirke. An diesem Sonntag hatte ich noch nichts von dem Mittelchen genommen, meine Stimmung war relativ ausgeglichen, und so wäre es schade gewesen, das Vabanquespiel meiner Konstitution durch unnützes Eilen zu destabilisieren. Vielleicht könnte ich sogar meinen Standardgang - einmal bis zur Stadtmitte und zurück - bis in die Altstadt hinein ausdehnen; käme darauf an, was sich in mir so regen würde. Über meine Gedanken erreichte ich den Bonner Münsterplatz und war doch schon wieder am schwitzen, obwohl es eher kühl war. Jetzt nur nicht unnötig schlappmachen, überlegte ich mir und lenkte meine Aufmerksamkeit auf die neu eröffnete Apotheke neben dem Postamt. Die hatte nämlich zur Eröffnung Sonderangebote im Stadtanzeiger beworben, welche nur in einer begrenzten Stückzahl erhältlich waren. Ich hatte etwas ganz Besonderes ins Auge gefasst, was mir in meiner Sammlung noch gefehlt hatte. Ich suchte im Schaufenster herum, und da war es ausgestellt, dieses Blutdruckmessgerät für nur 109 Mark anstatt regulär 219. Klasse, dachte ich, und der Wille in mir wurde stärker, dieses Stück zu besitzen. Noch bevor ich zur Arbeit gehen würde am nächsten Tag, wollte ich mir das Gerät kaufen. Eigentlich sparte ich ja für einen Computerbildschirm, einen 15-Zoll-Farbmonitor, aber das tolle kleine Ding musste ich haben: ein prima Instrument zur Selbstbeobachtung.
„Hallo Tobias“, wurde ich plötzlich von hinten angesprochen. Ich drehte mich um und sah Simone hinter mir stehen, oder vielmehr im Laufschritt verharren.
„Ach, guten Morgen, schon wieder am Joggen?“ Ich versuchte, mein mich immer noch begleitendes Kopfzucken im Zaum zu halten.
„Klaro, hält mich total fit. Ich mache das jeden Tag, so eine halbe Stunde. Würde dir auch gut tun.“
Simone war eine ehemalige Kommilitonin an der Uni, hatte aber im Gegensatz zu mir ihr Studium abgeschlossen. Ich hatte die Hamburgerin im Grundstudium kennengelernt und war seitdem irgendwie an ihr kleben geblieben. Wir waren nicht zusammen, jedenfalls nie richtig, auch wenn meinerseits eine gewisse Zeit lang durchaus Interesse vorhanden war. Ich stand auf blonde, zierliche Mädels ihres Typs, aber seit sie mir irgendwann zu verstehen gegeben hatte, dass sie nicht auf Partnerschaften stehe und lieber ihr eigenes Ding mache, hatten sich meine wochenlangen Bemühungen erledigt. So gesehen hätten wir ganz gut zusammengepasst, wenn sich diese Vorliebe aufgrund ihrer Natur nicht eher abstoßend als anziehend herausgestellt hätte. Das war so die Zeit, als die Sache mit den Unterzuckerungen begann. Seitdem verband uns eine lockere Freundschaft - nichts Halbes und nichts Ganzes eben.
„Hast du was Bestimmtes vor?“, fragte Simone neugierig und schaute mir über die Schultern.
„Nö, ich guck nur so rum. Bisschen spazieren gehen.“
Simone atmete bewusst ein und aus, während sie auf der Stelle joggte, und ihre in der kühlen Luft sichtbaren Atemwölkchen strömten mir direkt ins Gesicht. Ich hielt instinktiv die Luft an und zog meinen Kopf etwas reserviert in den Nacken. Die Woche zuvor war sie stark erkältet gewesen, und vielleicht noch immer ein wenig ansteckend.
„Stinke ich?“, fragte sie mich in ihrer typisch direkten Art und musste kurz hüsteln.
„Nee, nee ich dachte nur …“
„Ach komm, sei nicht so empfindlich. Wollen wir zusammen Croissants essen und einen Kaffee trinken? Das Bäckerstübchen hat sonntags auf.“
„Joa, warum nicht“, willigte ich ein und trottete neben Simone, die immer noch im Laufmodus herum hopste, her.
„Du solltest einfach mehr Obst essen“, meinte sie, als wir uns zum Bäckerstübchen begaben, „und nicht immer diese Apothekenpillen kaufen. Teuer, und die Vitamine rutschen viel zu schnell und falsch dosiert durch den Körper. Obst ist auch gut für den Kreislauf und entschlackt.“
„Tja“, seufzte ich, „ja ich denke immer nie daran, wenn ich einkaufe, aber mit den Präparaten geht’s eigentlich ganz gut.“
„Du, ich nehme vielleicht doch lieber frisch gepressten Fruchtsaft, ist besser nach dem Laufen“, meinte sie selbstkritisch.“ Während Simone sich an einem Tisch in dem besagten Bistro niederließ, besorgte ich unseren Snack.
„Tasse oder Kännchen?“ wollte die Bedienung hinter dem Tresen wissen, als ich nach Kaffee fragte.
„Kleine Tasse mit Milch“, bestätigte ich und bekam eine Kanne. Ich hatte keine Lust, das Missverständnis aufzuklären, da ich hinter mir schon den Atem des nächsten Gastes förmlich in meinem Genick spürte. Ich zahlte leicht verärgert, nahm das Tablett und jonglierte zwischen den Tischen bis zu Simone, die sich natürlich ganz weit hinten in der Ecke einen Platz suchen musste. Aber da waren wir jedenfalls unter uns. Ich setzte mich ihr gegenüber.
„Nun schau doch nicht so grimmig“, bemerkte sie beschwichtigend, als ich unseren Tisch endlich erreicht hatte. „Hier tut dir doch keiner was.“
„Nee, aber ich kann es nicht ab, so bedrängt zu werden.“
„Sind alles nur Menschen wie du und ich.“
„Ja klar, aber dann sollen sie auch schön für sich bleiben, wie ich es auch tue.“
„Na, du hast ja eine Laune. Aber sag mal, hast du dir das noch einmal überlegt mit der Wiederaufnahme des Studiums?“, wollte Simone wissen.
„Ja, also ich glaube, das bringt nichts. Ich weiß nicht, ob mein Arbeitgeber da mitmacht. Und ein Fernstudium ist mir zu anstrengend. Außerdem, was hätte ich hinterher davon? Schau dich selbst an. Hast einen Einserabschluss und arbeitest im Möbelgeschäft als Auslagenaufbauerin. Ich hab keinen Bock, Zeit zu verschwenden und immer nur zu lernen, um danach wieder was lernen zu müssen.“
„Mensch Tobias, lass dich doch nicht so gehen.“
„Lasse ich gar nicht. Ich bin OK so. Alles soweit in festen Bahnen.“ Ich schlürfte an meinem Kaffee, der für meinen Geschmack viel zu stark war. Das Kännchen schaffte ich bestimmt nicht. Ich musste auf jeden Fall langsam trinken, damit mein Puls nicht unnötig anstieg.
„Also, ich weiß nicht“, fuhr Simone fort, „im Buchklub sehe ich dich auch nicht mehr. Keine Lust?“
„Jo, mal sehen, vielleicht demnächst mal wieder.“
Wir wurden unterbrochen, als jemand neben mich an unseren Tisch trat und mir die Sicht auf Simone mit einer vorgehaltenen Klingelbüchse versperrte. Dies führte zur Kollision mit meiner gerade erhobenen Kaffeetasse.
„Mensch!“, entfuhr es mir genervt, als ich versuchte den Schmerz der heißen Brühe auf meinem Oberschenkel zu überspielen. „Passen Sie doch auf“, ging ich die junge Dame an, die mich ebenso erschrocken mit ihrer Zahnspange im Gesicht anstarrte. Eigentlich war sie zu hübsch, um mich weiter über sie aufzuregen, aber ihre geschlossene Spange irritierte mich, wie sie mir so breit entgegen grinste; wohl mehr aus Verlegenheit als aus Frohsinn. Als das Mädchen dann auch nur ‚Tschuldigung’ sagte, anstatt näher auf das von ihr verursachte Malheur einzugehen, und gleich mit „Eine kleine Spende vielleicht für Power-Bene“ fortfuhr, interpretierte ich ihr Gesicht kurzschlussartig als unreif, dreist und aufdringlich.
„Jetzt packen Sie sich mit ihrer Dose und verschwinden Sie von unserem Tisch“, erwiderte ich angesäuert, vor allem über die Tatsache, dass ich nun wieder ein Teil mehr umständlich im Waschbecken zu waschen hatte, da ich keine Waschmaschine besaß. Ich war nie auf die Idee gekommen, mir eine zuzulegen. Dafür reichte mein Sparwille irgendwie nicht aus „Was soll eigentlich dieser Blödsinn mit Power-Bene? Pure Volksverdummung ist das“, begann ich, meiner eher persönlichen Wut Luft zu machen. Ich sah den albernen Aufdruck auf der Dose des Mädchens. Ein fetter kleiner Mann, der einem Strichmännchen eine dicke Fünf-Mark Münze entgegenhielt. „Das geht doch alles in die Geschäfte der Promis und Bonzen, die sich mit dieser Aktion schmücken. Gehen Sie lieber einmal ums Bonner Münster; da finden sie mindestens drei arme Schweine im Dreck hocken, die über den Tag nichts zu beißen haben.“
„Tobias, ist ja gut …“, stupste mich Simone unter dem Tisch mit ihrem Fuß an, „hast du sie noch alle?“ Auch die Gäste an den Nachbartischen schauten murmelnd um sich, um meinen Äußerungen dann aber weiter keine Beachtung zu schenken. Ja, ja, stopft ihr nur euren Kuchen in den Bauch des unkritischen Wohlstands, dachte ich mir. Die Spendensammlerin hatte inzwischen ihre Dose sinken lassen und versuchte, sich zu verteidigen.
„Die Obdachlosen vertrinken das doch eh alles, aber Powerbenefiz ist eine gute Sache. Sie sollten sich mal informieren …“ Dann kramte das Mädchen aus seiner Jacke eine Broschüre, die ich unwirsch ablehnte.
„Alles Klischee! Wer schickt Sie eigentlich? Ist das wieder so ein Schulprojekt zur Selbstbeweihräucherung? Das Geld kommt doch niemals an, wo es sollte … Die sollten sich lieber um ihre Bildungsprobleme …“
„Ach vergessen Sie es einfach“, meinte sie darauf hin nur noch und schob sich hinter mir zu meinem Nachbartisch. Die vier dort sitzenden Gäste warfen - nun erst recht, wie es mir schien - eifrig Münzen in die Dose.
Ich bekam einen roten Kopf, dessen Zucken wieder spürbar stärker wurde, und wusste selbst nicht, ob meine harsche Reaktion wirklich angebracht war und meine Vermutungen überhaupt stimmten, jedenfalls in diesem Fall. „Ob die mir jetzt was kann?“, fragte ich Simone unsicher.
„Nee, kann sie nicht …“, sie biss Kopf schüttelnd in ihr Croissant, „… aber du bist immer gleich so hart.“
„Ja, habe ich denn nicht Recht?“
„Keine Ahnung … mach nicht immer so einen Elefanten aus einer Mücke.“
„Aber mir etwas anhaben kann sie nicht, oder?“
„Stehst du nun zu dem, was du gesagt hast oder nicht?“
„Sicher, aber …“
„Ja, dann lass uns über etwas anderes reden … Frag mal deine Psychologin, die kann da vielleicht mehr zu sagen. Jedenfalls ist dein Verhalten manchmal eher behandlungsbedürftig als deine komischen Unterzuckerungen.“
Simone war nicht sonderlich politisch interessiert, obwohl ihr das in meinen Augen ganz gut getan hätte … so, wie sie mit ihrer Qualifikation verheizt wurde. Den Satz mit der Psychologin hätte sie sich aber sparen können, und so fühlte ich mich wieder einmal gänzlich unverstanden.
„So, ich will mal wieder“, wollte Simone langsam aufbrechen, „noch ein paar Kalorien abbauen; bis nach Beuel im leichten Trab. Vielleicht hast du ja Lust, morgen Abend zur Fachschaftsfete der Anglisten zu kommen, in der Aula des Hauptgebäudes.“
„Du gehst noch zu Uni-Feten?“
„Klar, die Leute von früher kennen mich ja noch.“
„Mich hat nach meinem Abgang außer dir kaum mehr jemand angerufen von denen. Was soll ich noch da?“
„Hm … vielleicht Interesse zeigen? Dann ruft dich auch mal wieder wer an … Also, vielleicht sehen wir uns ja da.“ Fort war sie und ließ mich mit meiner immer noch halb vollen Kanne Kaffee sitzen.
Auf dem Nachhauseweg ging ich noch einmal an der Apotheke vorbei, um mich erneut des günstigen Preises des begehrten Blutdruckmessgerätes zu vergewissern. Ein Highlight für den nächsten Tag. Ich hatte keine sonderliche Lust mehr, meinen Spaziergang noch weiter auszudehnen, zumal das Croissant einen gewissen Heißhunger in meinem Bauch erzeugte und der Kaffee seine Wirkung auf mein Herz nicht zu verfehlen schien. Nicht auszudenken, hätte ich das ganze Kännchen getrunken. Außerdem sah mein Hosenbein aus, als hätte ich hineingemacht. Zu meiner Psychologin sollte ich in der Tat mal wieder gehen, vielleicht hätte sie ja noch einen Tipp, bildete ich mir ein; na, ja bis nächsten Monat müsse das noch warten, denn die Krankenkasse übernahm die Kosten für eine Sitzung in meinem Falle nicht. Und in der Tat, ich führte die zeitweise Stabilisierung meiner Konstitution mehr auf meine eigene Einbildungskraft zurück als auf die Gespräche mit Frau Doktor, welche immerhin mit 150 Mark pro Sitzung gut zu Buche schlugen. Aber sie hörte immer so schön zu und stimmte mir vor allem hinsichtlich meiner Ansichten über die Welt zu … das heißt, sie widersprach zumindest nicht. Eigentlich hätte ich das auch alles umsonst haben können, wenn ich sie privat gekannt hätte. So viel älter als ich war sie ja kaum.
Hach ja, Frauen, kam es mir in den Sinn; immer so faszinierend - aus der Ferne -, und doch brachte ich es in meinem 30-jährigen Dasein nicht ein einziges Mal zustande, ein weibliches Wesen über die übliche Annäherungsphase hinaus an mich zu binden. Die waren aber auch alle seltsam verkorkst - die Studentinnen, die ich im Laufe der Zeit kennengelernt hatte. Woran das wohl lag? - Vielleicht an dem Bild, das ich mir über die ideale Frau so zurechtmachte. Nein, nein, von wegen Heimchen am Herd; sie sollte in meinen Augen schon emanzipiert sein, aber keine Emanze und kein Töchterchen, welches nach dem Seminar immer gleich nach Hause fuhr zu Papi. Alles, was dazwischen lag, war entweder mehr an gemeinsamen Vorbereitungen von Seminararbeiten interessiert - wenn ich es denn mal daheim für zwei gemütlich gemacht hatte - oder aber die Mädels waren bereits in festen Händen. Das Letztere erfuhr ich meist ganz nebenbei, wie einen Schlag in die Magengrube, wenn ich mir wieder einmal über Wochen der zaghaften Annäherung eingebildet hatte, dass das Zwinkern in den Augen meines Gegenübers mehr bedeute als die Aufmunterung, meine Gesundheitsprobleme nicht so ernst zu nehmen.
Beim Aufschließen der Haustür drang mir ein bereits durchgezogener Essensgeruch entgegen, der nur aus Frau Langhans’ Wohnung stammen konnte. Im Gegensatz zu sonst machte mir das dieses Mal - offensichtlich wegen meines erneuten unterzuckerungs-verdächtigen Heiß-Hungers - richtig Appetit. So verkniff ich mir meine Standardäußerung im Flur „Mann, die isst wieder das, was sie auf dem Kopf hat.“ Ich selbst brutzelte mir fast nur Tiefkühlprodukte am Wochenende, deren Vielfalt nach einer Weile den typischen, einfältigen Kartongeschmack hinterließ. Ich sollte mal die Marke wechseln. Unter der Woche aß ich ausschließlich in der Bürohauskantine oder der Mensa. Das war selbst für Nichtstudenten recht günstig, wenn auch stets mit unbequemer Ansteherei verbunden. Als ich die Wohnungstür erreichte, öffnete auch meine dortige Nachbarin ihre Tür, als ob sie schon auf mich gewartet hätte.
„Da war eben jemand für Sie, Herr Luderich. Eine Dame; sah so amtlich aus. Die wollte Sie unbedingt sprechen.“
„Aha“, drehte ich mich erschrocken zu ihr, „amtlich? Aber doch keine Polizei oder so was.“
„Nein, so nicht, mehr so offiziell mit schickem Kostüm. Sie will noch mal vorbeischauen, meinte sie.“
„Wie sah sie denn ansonsten aus?“ Mir fiel niemand ein, der mich sonntags hätte besuchen wollen können.
„Ja, so schwarze, mittellange Haare, schlank und so …“
„Seltsam“, meine Herzfrequenz begann sich zu beschleunigen, und ich spürte eine leichte aufkommende Paranoia in der Bauchgegend. Mein Heißhunger schwächte mich zusehends und meine gleichzeitige Appetitlosigkeit wuchs angesichts der simplen Nachricht meiner Nachbarin. Wer konnte am Sonntag etwas von mir wollen … außer … ja, natürlich: Das Mädchen mit der Klingelbüchse hatte mich sicher bei ihrer Chefin oder sonst wem verpetzt und auf mich angesetzt. Aber woher sollte sie wissen wo ich wohnte? Ich überlegte fieberhaft, ob ich in meiner Wut etwas wirklich Unrechtes geäußert haben könnte und bildete mir wahrhaftig ein, ich hätte.
„Was ist denn? Sie sehen auf einmal so blass aus“, meinte Frau Langhans zu mir, als ich begann, mich sichtlich unwohl zu fühlen. „Wollen Sie vielleicht etwas mit mir essen? Ich habe viel zu viel Kohlpüree gemacht.“
„Em … nee … ich möchte Ihnen keine Umstände machen“, stammelte ich, während ich zerfahren versuchte, das etwas hakelige Schloss meiner Wohnungstür zu öffnen. „Oder vielleicht doch … ja gerne“, entschied ich mich dann um und folgte der alten Dame in ihr Domizil. Konnte ich so vielleicht noch mehr über meinen unangekündigten Besuch in Erfahrung bringen.
Wenn ich eines wirklich hasste, dann waren es Unsicherheiten dieser Art. Ich mochte nicht, wenn jemand etwas von mir wollte und mich mit seinem unangemeldeten Anliegen erfolglos versuchte, zu erreichen und ich danach ausharren musste, bis die Person es erneut versuchen würde; erst recht nicht, wenn dies in meiner Wohnung stattfinden sollte. Meine vier Wände waren mir heilig. Schließlich hielt ich mich dort ja am liebsten auf. Jedes nicht erwartete Klingeln an der Haustür versetzte mich immer schon in eine eher gespannte Erwartungshaltung, gefolgt von einer riesigen Erleichterung, wenn sich der Grund als harmlos herausstellte - schon als Kind war das so. Mein Vater nannte mich immer Homo hystericus und meine Mutter Katastrophenheini, weil ich hinter den einfachsten Ereignissen des Tages gerne mal wilde Geschichten vermutete. Die Fantasie ging in der Tat oft mit mir durch. So auch dieses Mal, als ich bei Frau Langhans am Küchentisch saß und versuchte, ihr kräftig gezwiebeltes und scharfes Kohlpüree hinunterzubekommen.
„Schmeckt es Ihnen nicht?“, fragte die Rentnerin mit wohlwollendem Blick, als ich so eher lustlos in der trockenen Pampe herumstocherte.
„Doch, doch“, und ich schob mir schnell ein, zwei Bissen hinterher, „muss nur ein wenig mit der Verdauung aufpassen; die spielt bei mir schon mal etwas verrückt.“
„Ach das ist gerade dann gesund“, winkte sie ab. „Das macht alles frei und entschlackt … Obwohl … damals in Russland hatten wir einen Fall in der Familie von … von … ach wie heißt das noch, wenn der Bauch fast platzt?“
„Magendurchbruch?“, ergänzte ich.
„Ja, irgendwie so etwas. War eine meiner Großtanten. Jedenfalls ist die dran gestorben, weil sie zu viel Kohl gegessen hatte und das dann alles wieder aufbrach.“ Frau Langhans gestikulierte ihre kühne Geschichte recht plastisch mit den Händen aus, sodass es mir noch schwerer fiel, ihr Menü ganz zu verspeisen. Sie hatte des öfteren Geschichten dieser Art parat und erzählte diese besonders gerne spät abends, wenn sie vor ihrer Haustür treppauf oder -ablaufende Hausbewohner abfing; einfach, um ein wenig zu plappern. Das geschah meist, wenn ich schon versuchte, Schlaf zu finden, nachdem ich mich mit meinem Stethoskop vergewissert hatte, dass von der Wand zum anderen Nachbarn hin keine Ruhestörung zu erwarten war. Aber die Stimme von Frau Langhans hatte eine eigenartige Frequenz, die selbst durch die Wohnungstür und meine Ohrenstöpsel hindurchging. Die eher monologhaften Gespräche dauerten bestimmt kaum länger als vier, fünf Minuten, kamen mir aber in meinem Einschlafzwang wie eine halbe Ewigkeit vor, und meine Genervtheit löste nicht selten Schwitzattacken aus. Sie ist eine alte, einsame Frau, beruhigte ich mich dann aber immer, sie meint es nicht so …
Ich versuchte mich selbst von den in mir aufkommenden Rückschlüssen bezüglich Frau Langhans dramatischer Tischerzählung auf meine Verdauung abzulenken. „Sagen Sie mal, was die Frau betrifft, die mit mir sprechen wollte, können Sie die noch genauer beschreiben? Hat sie sonst irgendetwas erwähnt?“
„Nein, sie war nur sehr in Eile und murmelte etwas davon, dass sie Sie schon noch erwischen werde.“
„Aha? Erwischen. Hört sich sauer an“, erwiderte ich leise.
„Ach, warten Sie es doch einfach ab; die meldet sich bestimmt wieder.“
Da bin ich mir sicher, überlegte ich und steigerte mich mehr und mehr in einen Zusammenhang mit der Power-Bene Sammlerin hinein. „Frau Langhans, ich muss dann auch mal wieder rüber“, wollte ich mich schließlich verabschieden und meinte, einen leichten Druck in der Unterbauchgegend verspürt zu haben, „vielen Dank für das Essen. Ich werde Sie mal zum Kaffee rüber rufen - demnächst, wenn ich mehr Zeit habe.“
„Ja, ja, tun Sie das, wir sind ja hier oben nicht weit auseinander. Morgen kommt erst mal meine Nichte mit Anhang aus Kiew für ein paar Tage … also Herr Luderich, einen schönen Nachmittag noch.“
„Danke gleichfalls“, sagte ich, bemüht, zurückzulächeln. Soso, Besuch aus Kiew, ging es mir durch den Kopf, als ich meine Wohnungstür hinter mir schloss. So einsam ist die Frau ja gar nicht. Mit Anhang, hat sie gesagt; na, das lässt ja wieder auf unruhige Momente im Haus schließen. Ich spürte mein Kopfzucken wieder.
Schließlich war der Sonntagnachmittag angebrochen und ich wusste, wie so oft an Sonntagnachmittagen, auch nicht so recht, etwas mit mir anzufangen. Also versuchte ich, mich an der von mir neu geschaffenen Ordnung zu erfreuen und setzte mich sinnierend an mein Wohnzimmerfenster. Zigarillo, dachte ich, ja, eine gute Zeit dafür. Ich zündete mir genüsslich einen Glimmstängel an, öffnete das Fenster und saß für einen Moment recht glücklich da. Allerdings trübten diverse Unstimmigkeiten, oder eher gesagt, das, was ich für unstimmig erklärte, meine kurze Auszeit von der Freizeit. Erstmal schauen, was es mit dem Bauch auf sich hat. Der begann immer mehr, zu rumoren. Ein unbestimmtes Gefühl, das kaum lokalisierbar war. Es tat nicht richtig weh, aber es fühlte sich so gespannt von rechts oben nach links unten an. Ich griff in mein eher übersichtliches Buchregal, welches vorwiegend alte Wälzer aus dem Studium der Psychologie enthielt sowie die gebräuchlichsten Rechtsratgeber für alle Fälle des täglichen Lebens. Dort zog ich einen dicken Medizinwälzer heraus, den ich günstig in der Uni-Bücherei abgestaubt hatte. Nicht mehr ganz aktuell war der, aber für meine Leiden gerade richtig. Ansonsten las ich eher nicht so viel. Das Aktuelle vom Tage war ja immer schön auf den Videotexttafeln des ersten und zweiten TV-Programms zusammengefasst. Ich suchte im bereits sichtbar durchblätterten und abgenutzten Symptomindex des Buches nach dem komischen Symptom des Nachmittags. Dabei hatte ich wieder einmal den Eindruck, dass meine Anatomie doch etwas verschieden zu der gewöhnlichen sein musste. Wenn mich etwas plagte, konnte ich immer nie eine eindeutige Zuordnung in den Texten finden. Im Prinzip deuteten die Beschwerden immer auf alles hin, vom unwahrscheinlichsten Krebs angefangen - wovon ich zunächst einmal ausging, um ihn auszuschließen - über allerhand chronische Krankheiten bis dorthin, wo sich nach ergiebiger Selbstbeobachtung alle meine Diagnosen wiederfanden: Befindlichkeitsstörungen. Auf diese Weise durchlitt ich schon etliche lebensbedrohliche Krankheiten. Eigentlich hätte ich längst tot sein müssen - wenn es danach gegangen wäre. Dieses Mal hatte ich aber ganz klar Frau Langhans’ Püree in Verdacht. Was konnte dies wohl im schlimmsten Falle verursachen? Bevor ich meine doch mittlerweile als Bauchschmerz wahrnehmbare Symptomatik unter dem Kapitel ‚Akuter Bauch’ weiterverfolgen konnte, wurde ich durch das Schlagen einer unbekannten Autotür hochgeschreckt. Ich kannte das Geräusch der Autotüren vor meinem Wohnhaus allmählich. Aber dieses war nie dabei. Laut und energisch. Ich schnellte nach oben, stieß mir an der Fensterunterkante den Kopf und blickte leise fluchend hinaus auf die Straße. Gerade noch sah ich einen schwarzen Schopf unter dem Vordach der Haustür verschwinden. Nichts geschah. Die will zu mir, dachte ich, die will bestimmt zu mir. Noch immer nichts. Ich sah einen roten Ford Fiesta direkt vor der Haustür parken und auf dem Heck klebte ein Aufkleber - es war der Werbeaufkleber der Aktion Power-Bene zwischen einigen anderen lustigen Stickern, die man auf kleineren Autos manchmal so findet. Jetzt schlug das Herz mir bis zum Hals und verdrängte das Bauchkneifen gänzlich. Die ist gekommen, um mir den Marsch zu blasen, schoss es mir durch den Kopf, womöglich mit rechtlicher Handhabe. Am Steuer des Wagens saß noch jemand, sicher ein Kollege, den sie sich zur Verstärkung mitgebracht hatte. Endlich klingelte es an meiner Tür. Ich drückte ohne viel nachzudenken den Türöffner, trat aus der Wohnung und schaute gierig die Treppenflucht hinunter. Ich schluckte, als ich das laute Absatzklacken vernahm, hinter welchem sicherlich eine ziemlich resolute Frau folgen würde; eine, wie ich sie eher nicht mochte.
„Habe ich dich doch noch erwischt“, vernahm ich eine Stimme, die das Pochen meiner Herzfrequenz augenblicklich zu Boden sacken ließ - soweit, dass ich schon fast meinte, Kreislaufprobleme zu verspüren. Und das Gesicht, welches mir lächelnd auf dem letzten Treppenaufgang entgegenkam und meine Körpersensation wieder ins Lot brachte, war das der blonden Sekretärin Sabine aus meiner Büroabteilung. Sie hatte sich offensichtlich am Wochenende die Haare schwarz gefärbt. „Hallo Tobias, ich will dich gar nicht lange aufhalten.“ Sie stoppte auf halber Höhe der letzten Stufen und hielt mir eine Plastiktüte hin.
„Tust du nicht“, antwortete ich erleichtert und verlegen zugleich, „… ehm … willst du nicht reinkommen … so kurz … auf einen Kaffee?“
„Nee, du … mein Freund wartet unten. Wir fliegen jetzt gleich nach Antalya. Haben ein super Angebot im Reisebüro ergattert … alles inklusive. Bin für ne Woche weg. Wollte dir nur schnell noch meine aktuelle Statistik bringen; der Chef wollte sie am Montag haben. Hab sie übers Wochenende fertiggemacht.“
Ich nahm Sabine die Plastiktüte aus der Hand. „Ach so, ja, kann ich ihm geben.“
„Du warst dieses Jahr noch nicht groß weg, oder?“, fragte sie ganz aufgeregt in ihrer knallengen Jeans, hochhackigen Schuhen und einer betont bunten Urlaubsbluse, aus deren Brusttasche ganz lässig eine überdimensionierte Sonnenbrille ragte.
„Bin noch nicht dazu gekommen, in Urlaub zu gehen … irgendwie.“
„Na dann hol das bald mal nach. Chef sieht es ja nicht so gerne, wenn wir zu viele Freitage mit ins nächste Jahr nehmen.“
„Ja, ich weiß, der fragt mich auch schon laufend. Werd mich drum bemühen.“
„Hier, schau mal da rein. Da haben wir auch gebucht. Echt coole Angebote haben die.“ Sabine zog einen Reisekatalog aus der Tasche und drückte ihn mir schnell in die Hand. „Also bye bye, dann, bis in einer Woche.“
So hatte ich meine Kollegin noch nie gesehen. Im Büro erschien sie immer eher hausbacken wie ich auch. Die blonden Haare standen ihr besser, fand ich. Sie war übrigens eine von jenen Frauen, in welche ich mich vorübergehend verguckt hatte, damals als ich nach der Umschulung begann, in der Verwaltung zu arbeiten. Es kam aber erst gar nicht dazu, sie mir, zwecks näherem Kennenlernen, nach Hause einzuladen, weil sie zum einen lieber draußen mit mehreren Leuten etwas gemeinsam unternahm - was so gar nicht mein Fall war - und zum anderen ihren Freund ziemlich bald und ziemlich oft erwähnte. Musste ein echter Überflieger und Alleskönner gewesen sein, ihr Typ - eben ein Frauentyp. Dass Sabine etwas für Power-Bene übrig zu haben schien, überraschte mich weniger: Im Job ziemlich unscheinbar und privat die eher oberflächliche Gesellschaftsnudel - ein unkritischer Mensch eben. Wenn wir uns unterhielten, was meistens sporadisch im Büro der Fall war, dann immer nur über Urlaub, Schlagzeilen aus ihrem Käseblatt, welches sie ständig las, oder typische Sabinetipps. Das waren solche Tipps, wie ich mehr aus meinem Typ machen könne, was für mich aber nie zur Disposition stand. Einmal ließ ich mich von ihr zu einer modischen Frisur überreden, etwas Fesches, wie sie meinte und mir an irgendeinem Promi aus der Zeitung vorführte. Als ich den Friseur damals verließ, verwarf ich die Frisur - gekräuselte Löckchen über der Stirn mit gegeltem Stufenschnitt dahinter - gleich nach dem Verlassen des Salons im Spiegelbild des Schaufensters. Viel zu aufwendig und zeitraubend, um das jeden Tag erneut hinzubekommen. Außerdem hatte ich so lächerlich noch nie ausgesehen. Einen Jahrzehnte langen Seitenscheitel kann man eben nicht einfach so vergewaltigen. Das frisurtechnische Gebilde auf meinem Kopf fühlte sich für mich falsch an, und es wurde umgehend zu Hause mit Haarwäsche vollends vernichtet. Da meine gewohnte Frisur nun nicht mehr hinzubekommen war, kaufte ich mir ein Haarselbstschneideset. Damit stutzte ich mich seit dem sporadisch auf akzeptable 20 Millimeter. Sah besser aus - jedenfalls mit der Zeit - und sparte auf die Dauer Geld.
Ich seufzte und kehrte zurück in die Wohnung, immer noch mit meinem Zigarillostummel in der Hand, der ein kleines Loch in Sabines Tüte gebrannt hatte und gleich einen hässlichen schwarzen Fleck auf der Titelseite ihrer Arbeit hinterließ. Den Urlaubskatalog verfrachtete ich sofort in der neu eingerichteten Altpapierkiste in meinem Vorflur. Hatte ich selber im Keller aus alten Brettern gezimmert; sah prima aus, wie ich fand, und hatte so direkt eine Funktion. In den Urlaub fliegen, überlegte ich kurz, und dann auch noch auf den letzten Drücker - wie unpampuschig.
Unpampuschig war bei mir alles, was irgendwie mit Arbeit zusammenhing, um zu Bequemlichkeiten zu gelangen. Den Begriff hatte ich vor Jahren bei einem Studienkollegen aufgeschnappt, mit dem ich Wand an Wand in meinem Zimmerchen in der Goethestraße gewohnt hatte. Er dachte da ähnlich wie ich und prägte ursprünglich das Wort ‚pampuschig’ als Inbegriff für das geborgene Daheimsein in Pantoffeln oder Pampuschen. ‚Unpampuschig’ war eben das genaue Gegenteil davon. Sicher, vom Wegfliegen oder Verreisen träumte ich auch oft, aber wenn ich dann all die Berichte im Fernsehen sah über volle Züge, die Massen in den Abfertigungshallen der Flughäfen und die Abzocke bei diversen Pauschalreisen, verging mir die Lust, mir überhaupt darüber weiter den Kopf zu zerbrechen. Abgesehen davon schreckte mich alleine schon das längere Verlassen meiner gemütlichen Wohnung durch die damit verbundene Vorkehrung zu ihrer Absicherung ab. Ich würde keine ruhige Minute auf solch einer Reise haben in ständiger Angst, ob ich irgendetwas zu Hause vergessen haben könnte, abzuschalten oder zu arrangieren. Wenn man erst mal fort war, käme man so schnell ja nicht wieder, um einer nahenden Katastrophe noch Herr werden zu können. Nein, nein, das war alles für mich ein unerreichbarer, rein theoretischer Wille; zumal ich mich auch bei körperlichem Unwohlsein am besten zu Hause aufgehoben sah.
Die Bauchschmerzen waren auf einmal wie weggeblasen - im wahrsten Sinne des Wortes -, und ich konnte den Rest des Tages halbwegs ausgeglichen begehen. Ich saß noch lange an diesem Nachmittag in meinem Lieblingssessel und schaute über den Fernseher hinweg aus meinem großen Fenster durch die Kastanienbäume vor dem Haus in den Himmel. Das war für mich Erholung. Als es allmählich dämmerig wurde, verspürte ich nicht das Bedürfnis, Licht zu machen. Ich liebte diesen starken Kontrast nach dem Sonnenuntergang aus den langsam schwärzer werdenden Gegenstandssilhouetten um mich herum mit dem dunkelblauen, noch relativ hellen aber sonnenlosen Himmel im Fenster. Das war die richtige Atmosphäre, mir über die Welt und mich Gedanken zu machen, oft bei geöffnetem Fenster. Ja, ich ließ mich dabei sogar manchmal regelrecht auskühlen. So sehr versank ich in der Bequemlichkeit eines solchen Moments, dass ich einfach keine Lust hatte, das Fenster zu schließen. Ich genoss den Abend einmal ganz ohne Fernsehen und dachte an das tolle Messgerät, welches ich mir gleich am nächsten Morgen kaufen wollte.
Der Werktag von der Stange
Die Nacht fühlte sich kurz an, und ich hatte trotz meines beruhigenden Vorabends Schwierigkeiten, einzuschlafen, obwohl es ziemlich ruhig im Haus war. Ich erwachte sehr früh, so gegen fünf Uhr dreißig. Das war nicht ungewöhnlich, da ich meistens abends eher früh zu Bett ging. Ich befürchtete immer, am nächsten Tag nicht richtig ausgeschlafen zu haben und bildete mir ein, meine Müdigkeit würde im Laufe des Tages so stark werden, dass ich in Ohnmacht fallen könnte. Dies hatte natürlich über die Zeit hinweg eine entsprechende Erwartungshaltung in mir erzeugt, welche wiederum dazu führte, dass ich mich abends manchmal regelrecht zwang, einzuschlafen. Dies aber hielt mich eher noch länger wach - insbesondere, wenn der Geräuschpegel im Haus ein gewisses Maß überschritt. So war ich am folgenden Morgen oft gerädert, überlebte aber den Tag komischerweise ganz ohne den erwarteten Schwächezustand. Aber so extrem zeitig wie an diesem Morgen wachte ich nur auf, wenn ich etwas Besonderes vorhatte. Ich wollte mir ja dieses Messgerät aus der Apotheke holen. Das Geschäft öffnet um neun Uhr, überlegte ich, oder war es acht Uhr dreißig? Das verunsicherte mich; ich hatte über das Glück, dieses günstige Teil im Schaufenster erspäht zu haben, glatt vergessen, mir zu merken, wann die Apotheke aufmachte. Um neun Uhr müsste ich eigentlich schon auf der Arbeit sein, da wäre acht Uhr dreißig eine gute Öffnungszeit gewesen. Oder war es sogar acht Uhr? Jetzt brachte ich mich mit meinen Gedanken so durcheinander, dass ich unwahrscheinlich viel Zeit verbrauchte, um mich für den Tag zu richten. Käme ich zu spät zur Apotheke, hätte garantiert jemand vor mir das letzte Stück weggekauft. Wäre nicht das erste Mal gewesen. Es half nichts, um sicher zu gehen, musste ich vor acht Uhr dort sein. Den Bus in die Stadt konnte ich mir dann abschminken, denn der war um diese Urzeit proppenvoll mit Schülern und anderen Berufstätigen. Und ohne einen freien Sitzplatz würde mich an diesem Morgen bestimmt eine Panikattacke in dem dichten Gedränge da drin befallen - im Berufsverkehr allemal. Also musste ich zu Fuß gehen. Natürlich regnete es in Strömen und ich begann mich allmählich schwächer zu fühlen. Oha … der heutige Gang in die Stadt wird ein Kampf, dachte ich mir, mit Kreislaufmalessen, und wenn ich Pech habe, einer kräftigen Unterzuckerung. Kaffee ging an diesem Morgen nicht, dazu war ich schon zu sehr aufgeregt und matt zugleich und nicht in Genussstimmung. Nur ein lustloses Brot mit Käse schob ich mir rein. Käse schließt den Magen, hatte ich mal gelesen und daraus abgeleitet, dass ich dann nicht so schnell verdaue, wenn ich unterwegs bin. Zu meinem morgendlichen Toilettengang musste ich mich wie so oft zwingen. Denn das große Geschäft ging absolut nur zu Hause. „Mann! Reiß dich zusammen“, redete ich laut mit mir selbst, „du tust ja so, als ob du eine Klausur zu schreiben hättest.“ „Du hast gut reden“, sagte der andere in mir dann, ebenso hörbar.
Wo waren die zwei Morgenstunden nur geblieben? Ich musste jetzt das Haus verlassen und begab mich an die Absicherung meiner selbst: Alle Fenster zu, Geräte ausgeschaltet und die Stecker gezogen. Nach dem Zuziehen der Wohnungstür prägte ich mir noch genau die Schlüsseldrehung zum Abschließen selbiger ein. Dann lief ich los, mit dem Schirm kämpfend, denn ein für den Spätsommer ganz schön kalter Wind blies mir den Regen seitlich ins Gesicht. In so einer Situation Aktentasche, Schirm und mich selbst auszubalancieren, war gar nicht so einfach, zumal ich in Gedanken noch einmal durchgehen musste, ob ich wirklich das Haus so verlassen hatte, wie es sein sollte. Instinktiv tastete ich mit der Aktenmappe in der rechten Hand meine Jackentasche ab und erschrak. Wo war das Traubenzuckerröllchen? Wie ein verrücktes Huhn setzte ich die Mappe schnell auf den Bürgersteig und stocherte hektisch in der Jacke herum - ah - ein Glück. Das kleine Ding hatte sich unter den Hausschlüssel verkrümelt. Die Ampel wurde grün, und ich hastete über die Straße. Keine grüne Welle an diesem Morgen. Vor wirklich jeder Kreuzung kam ich vor Rot zu stehen. Ich traute mich nie, wenn es gerade gewechselt hatte, noch rüber zu laufen, im Gegensatz zu meinen Mitpassanten. So war ich stets der Letzte an der Kreuzung und hatte den Atem meiner Nachfolger immer im Genick, oder zumindest deren Gerüche - von Salami über Kaffee bis zum stechenden Bananenparfüm. Endlich erreichte ich den Münsterplatz. Es war Viertel vor acht, ich viel zu früh und die Geschäfte waren bis auf ein paar Bistros noch alle geschlossen. Natürlich auch die Apotheke. Das Öffnungsschild erwies mir dann schließlich die Ernüchterung: Geöffnet ab neun Uhr. Na prima. Eineinviertel Stunden warten, eine Zeit, um nichts mit sich anzufangen. Ich zählte noch einmal gewissenhaft, ob ich auch genug Geld eingesteckt hatte. Dann ließ ich mich im schon geöffnete Bäckerstübchen nieder und harrte dort fast eine Stunde mit einem Mettbrötchen und einer wieder zu starken Tasse Kaffee aus, um kurz vor neun dann festzustellen, dass ich zu Hause doch etwas vergessen hatte, nämlich Sabines Statistik. Aber zum Umkehren war es nun zu spät mit all den Prozeduren, die daran hingen. Außerdem wäre das zu schwitzig geworden - diese Hetze.
Zwischenzeitlich betraten teilweise alt bekannte Gesichter aus dem Studium den Laden, um sich einen Snack zu besorgen. Die sahen alle noch so jung und dynamisch aus, offensichtlich nicht ahnend, dass nach dem Studium nichts Besonderes auf sie warten würde. Ich studierte damals auf BAföG und nutzte diese Zeit auch voll aus - zum Leben. Das Studium selbst konnte ich damit nicht sehr flexibel gestalten, was etwaige Fächerwechsel anbetraf. Ich war fixiert auf meinen Studiengang, der mir ganz und gar nicht lag. Einen Wechsel hätte das Amt kaum mitgemacht. Ich hatte aber auch nie gefragt, als das Geld noch so schön regel - mäßig aufs Konto kam. Nicht viel, aber für mich alleine genug. Ich verreiste nicht, hatte keine teuren Hobbys und gab das Geld auch nicht für abendliche Geselligkeiten aus, aber dafür umso mehr für Dinge, die ich immer schon persönlich besitzen wollte - meine kleinen Heiligtümer, die sich so über die Semester angesammelt hatten und denen ich mehr Bedeutung beimaß als dem Fortkommen im Studium oder dem Treffen anderer Leute: Stereoanlage, Farbfernseher, ja sogar einen Videorekorder konnte ich mir einmal mit viel Feingefühl für die noch zu verbleibenden Essensausgaben und Zimmermiete erlauben. Auch war ich stolzer Besitzer eines einfachen 286-er-Computers, allerdings nur mit einem kleinen 14-Zoll Schwarz-Weiß-Schirm; mein Traum war ein 15-Zöller in Farbe, doch der war bis dahin immer unerschwinglich; davon träumte ich lange und hatte zumindest in der letzten Zeit die Disziplin aufgebracht, etwas Geld dafür auf die Seite zu legen. Immerhin, in jenen Tagen als Student führte meine kleine Luxusbude zu anerkennungsähnlichem Staunen bei jenen Kollegen, die ich selten mal zu Gast hatte. Sie kamen und gingen und studierten schließlich an mir vorbei. Nach Ablauf der Fristen für die in meinen Augen kaum zu schaffende Zwischenprüfung, blieb mir nur noch die Selbstfinanzierung. Ein Ding der Unmöglichkeit: Gleichzeitig studieren und arbeiten. Wie machten meine Kommilitonen das bloß? Viele von ihnen mussten nebenher arbeiten und schafften ihre Abschlüsse - für was auch immer. Jedenfalls rächte sich mein Studienabbruch dahingehend, dass ich in monatlichen Raten meine Besitz anhäufende Vergangenheit fortan zurückzuzahlen hatte. Das schmerzte mich umso mehr, wenn ich die neuesten Geräte in den Schaufenstern mit meinen zwischenzeitlich doch veralteten Kompromisskäufen von damals verglich. Viel Neues war aber nicht drin. Immerhin hatte ich Glück mit der kleinen Lehre zum Verwaltungsgehilfen in Bonn, die mir Simone nach langem Hin und Her aufs Auge drücken konnte.