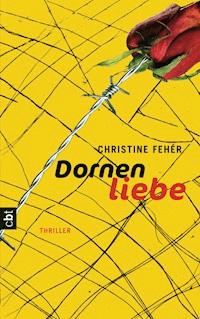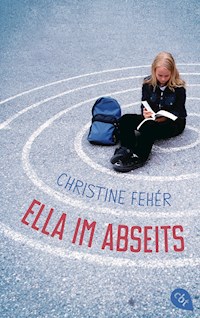6,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: cbt
- Kategorie: Für Kinder und Jugendliche
- Sprache: Deutsch
- Veröffentlichungsjahr: 2020
Ein existenzielles Thema, einfühlsam und packend erzählt
Für andere bedeutet der 16. Geburtstag den Mofa-Führerschein oder endlich legal Bier trinken zu dürfen — für Elena bedeutet er die langersehnte Möglichkeit, ihren Vater, den anonymen Samenspender, kennenzulernen. Dass diese Entscheidung nicht nur ihre Mütter in Unruhe versetzt, sondern auch Elenas Leben gehörig durcheinanderwirbelt, war ihr klar — und doch kommt alles anders als gedacht ...
In Deutschland gibt ca. 100.000 durch Samenspende gezeugte Kinder, aber die meisten von ihnen wissen nichts davon. Ähnlich wie adoptierte Kinder haben über 80% der aufgeklärten Spenderkinder ein Bedürfnis, ihren biologischen Vater kennenzulernen. Erst 2017 wurde im Bundestag ein eigenes Gesetz zur Regelung des Rechts auf Kenntnis der Abstammung verabschiedet, das Betroffenen jedoch nicht weit genug geht.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 322
Ähnliche
Dieses Buch ist ein Roman. Die Charaktere in dieser Geschichte sind reine Fiktion. Ähnlichkeiten mit lebenden oder verstorbenen Personen sind nicht beabsichtigt und rein zufällig.
Der Inhalt dieses E-Books ist urheberrechtlich geschützt und enthält technische Sicherungsmaßnahmen gegen unbefugte Nutzung. Die Entfernung dieser Sicherung sowie die Nutzung durch unbefugte Verarbeitung, Vervielfältigung, Verbreitung oder öffentliche Zugänglichmachung, insbesondere in elektronischer Form, ist untersagt und kann straf- und zivilrechtliche Sanktionen nach sich ziehen.
Sollte diese Publikation Links auf Webseiten Dritter enthalten, so übernehmen wir für deren Inhalte keine Haftung, da wir uns diese nicht zu eigen machen, sondern lediglich auf deren Stand zum Zeitpunkt der Erstveröffentlichung verweisen.
Originalausgabe April 2020
© 2020 cbj Kinder- und Jugendbuchverlag
in der Verlagsgruppe Random House GmbH,
Neumarkter Straße 28, 81673 München
Lektorat: Hjördis Fremgen
Umschlaggestaltung: Kathrin Schüler
unter Verwendung eines Motivs von Shutterstock Images UC
hf · Herstellung: AS
Satz: Buch-Werkstatt GmbH, Bad Aibling
ISBN 978-3-641-23946-6V001
www.cbj-verlag.de
Elena, 5 Jahre
»Da ist ein Brief zurückgekommen«, sagt Manu und hält einen Umschlag in der Hand.
»Unbekannt verzogen?«, fragt Conny.
Manu schüttelt den Kopf. »Es steht nur Papa drauf. Mit deinem Absenderaufkleber. Den muss sie dir aus der Schublade gemopst haben.«
»Schau mal rein«, sagt Conny.
Manu öffnet den Brief und holt ein schief zusammengefaltetes Blatt heraus.
»Elena hat unsere Familie gemalt«, sagt sie. »Sieh nur. Du und ich, in der Mitte sie. Und in der Hand hält sie eine Drachenschnur mit einem Mann dran.«
»Es beschäftigt sie«, sagt Conny. »Obwohl sie es längst weiß. Wir sind nun mal beide kein Vater.«
1
Mama sieht toll aus in ihrem Hochzeitskleid. Der weiße Satin schimmert in der Nachmittagssonne in unserem Berliner Hinterhof. Die Strahlen verfangen sich auch in ihrem Haar und lassen den Sekt in ihrem Glas golden aufleuchten, als sie sich zu mir umdreht und mir zuprostet. Ich weiß nicht, wer von uns beiden glücklicher lächelt – sie als Braut oder ich, weil ich seit heute endlich 16 bin. Unser Dauergrinsen wird höchstens noch von dem meiner Co-Mutter Manu übertroffen, mit der Mama seit zwei Stunden verheiratet ist.
Genau an meinem Geburtstag haben die beiden sich das Jawort gegeben. Für lesbische Paare ist Heiraten noch nicht lange erlaubt. Ich finde es süß von den beiden, dass sie an meinem Geburtstag geheiratet haben. Auf dem Standesamt im Rathaus Schöneberg haben sie ihre Ringe getauscht. Und als Manu als Zeichen unserer Verbundenheit als Familie auch mir einen Ring angesteckt hat, sind uns allen dreien die Tränen gekommen.
Manu, eigentlich Manuela, verkörpert mit ihrem fransigen Kurzhaarschnitt und dem ausrasierten Nacken sowie der eher maskulin wirkenden Kleidung das, was man eine Butch nennt, eine Lesbe, die wenig Wert darauf legt, typisch weibliche äußere Merkmale zu zeigen, sondern sich burschikoser gibt. Jetzt drückt sie einen Kuss auf Mamas Nacken, genau auf den kleinen Leberfleck, den man nur sieht, wenn sie den Kopf neigt und ihr blond gesträhnter, glatter Bob zur Seite fällt. Mama lacht und küsst sie zurück. Sie ist eine Femme, wie man die feminin wirkenden Lesben nennt, die man bezüglich Frisur und Klamotten nicht von einer heterosexuellen Frau unterscheiden kann.
Unsere heile Regenbogenwelt mitten in Berlin – ich hätte es schlechter treffen können. Die wenigsten Hetero-Eltern, die ich kenne, wirken noch so verknallt ineinander wie meine Mütter.
Gut, dass Fabienne da ist, meine beste Freundin, die sich so mit uns freut, aber immer cool bleibt und den Überblick behält. Sie flitzt umher und füllt bei den Gästen Sekt nach, ganz nach Wunsch pur oder mit Orangensaft. Auch ich könnte ein zweites Glas vertragen und bewege mich auf sie zu. Im Kopf spüre ich schon einen leichten Schwips, aber heute darf ich das, man wird nur einmal sechzehn. Alle im Hof sind ausgelassener Stimmung, reden und lachen durcheinander. Sicher hört man die vielen Stimmen bis in die oberen Etagen hinauf.
»Ich beneide dich so, Elena«, sagt Fabienne, die mir mit einem Tablett voller Gläser entgegeneilt. »Wenn meine Eltern Gäste haben, ist es immer so steif. Weiße Tischdecke, das gute Geschirr, gekünstelter Small Talk und eine völlig erschöpfte Mutter, wenn endlich alles vorbei ist. Du hast es so gut, dass es bei euch immer so relaxed ist!«
Deshalb ist Fabienne auch so oft bei uns, wie es geht. Wir kennen uns schon seit der 1. Klasse. Und obwohl ihre Familie vor ein paar Jahren nach Frohnau gezogen ist, einem Nobelbezirk am nördlichen Stadtrand Berlins, besuchen wir dasselbe Gymnasium in Friedenau, weil hier Spanisch als zweite Fremdsprache angeboten wird. Wir finden beide Spanisch viel cooler als Englisch. Ich nehme mir ein Glas, sie stellt das Tablett kurz auf einen der aufgebauten Biertische, dann stoßen wir an.
»Auf dich«, sagt sie und lächelt mir zu. Glücklich lassen wir unsere Blicke über das Brautpaar und die Gäste schweifen. »Was hast du eigentlich zum Geburtstag bekommen?«
»Einen Gutschein für die Renovierung meines Zimmers, mit tatkräftiger Hilfe beim Streichen und Umräumen. Eine größere Freude hätten Mama und Manu mir gar nicht machen können – mein Zimmer ist mir schon lange zu kindlich und zu chaotisch.«
»Wenn du willst, bin ich dabei«, sagt Fabienne. Dann jedoch rammt sie mir ihren Ellbogen in die Seite, so heftig, dass etwas Sekt auf mein Sommerkleid schwappt.
»Was sind denn das für Typen?«, raunt sie mir zu und deutet auf zwei Jungs, die soeben in den Hinterhof spaziert kommen. Sie sind etwas älter als wir. »Kennst du die?«
Ich schüttle den Kopf. Verwunderlich ist es nicht, dass hier auch Fremde auftauchen, denn dass hier gefeiert wird, hört man sicher durch das Tor bis auf die Straße. Außerdem ist bei unseren Hoffesten jeder willkommen, egal was gefeiert wird. Anders geht es auch nicht, wenn wir keinen Stress mit den Nachbarn haben wollen. Auch sie bringen Freunde mit. Meine beiden Mütter wollten gerade an ihrer Hochzeit eine Feier haben, die für jeden offen ist.
Ich liebe unsere Hoffeste, dieses Lockere, Entspannte daran. So ist es immer, wenn wir feiern, egal zu welchem Anlass.
Keiner muss sich aufbrezeln. Man kann kommen, wie man will, egal ob in Schlabberhosen und Korklatschen, schrill und punkig oder frisch aus dem Büro im steifen Kostüm, und ganz gleich welche Hautfarbe man hat oder woher man stammt.
Schwul, lesbisch, bi – bei uns ist alles erlaubt und normal. Fabienne hat recht wenn sie sagt, steif könne jeder und das sei einfach nur anstrengend.
Es helfen auch alle mit. Heute Vormittag, noch vor dem Gang zum Standesamt, haben Manu und ich unsere Balkonmöbel die vier Treppen von unserer Wohnung aus nach unten in den Hof geschleppt. Unten im Hof war Mama unterdessen dabei, Lampions in die Büsche und an den Zaun zu hängen, der den Mülltonnenbereich vom Garten trennt. Sie ist freie Hebamme und war erst heute Nacht von einer langwierigen Hausgeburt zurückgekehrt – zwei Wochen vor dem errechneten Geburtstermin der Mutter. Schon eilten Tina und Rashid, die unter uns wohnen herbei, schickten Mama weg und bauten Bierbänke und Tische auf. Mama sollte sich noch etwas ausruhen können. Ihr kleiner Sohn Dhani schrubbte währenddessen mit seinem Bobbycar über die Steinplatten.
Sobald wir nach der Trauung wieder zu Hause waren, kamen unablässig Leute, fast alle stellten etwas zu essen oder Getränke aufs Büfett, genau wie Mama und Manu es sich »statt Geschenken« gewünscht hatten.
Fabienne und ich beobachten die beiden Jungs aus dem Augenwinkel. Bestimmt denkt auch sie, dass es verdammt gut aussehende Typen sind. Doch deshalb sollen sie sich bloß nichts einbilden. Wir werden nicht gleich anfangen zu sabbern. Der eine fällt mir besonders auf: Seine Größe, bestimmt fast 1,90 Meter. Seine dunklen, etwas zu langen Haare, denen die schräg stehenden Sonnenstrahlen einen leichten Rotschimmer verleihen. Er fährt dauernd mit der Hand durch seine Locken und zerzaust sie dabei immer mehr. Seine leicht gebräunte Haut schon jetzt im Mai, die schön geschwungenen Lippen. Vor allem aber sein wilder, zorniger Blick aus dunkelgrauen Augen. Ein weites, schwarzes Shirt und verwaschene, am Knie eingerissene Jeans. Ein Junge wie ein hungriger Löwe, denke ich.
Fabienne scheint mehr den anderen zu fixieren. Mein Typ ist er nicht. Er trägt die Haare rasiert, nur am Oberkopf hat er seine dunkelblonden Locken stehen lassen und trägt weiße Jeans, dazu ein T-Shirt mit einem italienischen Protzlabel drauf. Viel zu gelackt für meinen Geschmack. In Sachen Jungs haben wir zum Glück schon immer unterschiedlich getickt.
Die beiden wirken wie Fremdkörper unter den anderen Leuten. Die meisten sind schon älter, viel alternatives Volk mit kleinen Kindern, Frauen in bunten Klamotten aus fernen Ländern, andere Lesben, Schwule, ein paar Flüchtlinge sowie Türken, die seit Generationen hier zu Hause sind, und das Hauswart-Ehepaar. Eine bunte Mischung, eine Mini-Abbildung der Gegend hier mitten in Berlin-Schöneberg, fast schon Kreuzberg. Die Jungs blicken sich um wie zwei Aliens, die mit einem Meteoriten in diese Szene gekracht sind. Aber so, wie sie sich gleich darauf zwei Bierflaschen schnappen und sich dann über das Büfett und den Grill hermachen, sehen sie nicht so aus, als ob sie gleich wieder gehen wollten.
Inzwischen beginnt es zu dämmern, fast alle haben schon ein wenig getrunken. Auch Fabienne und ich sitzen auf einer Bierbank und halten jede ein Glas Sommerbowle in der Hand. Malte, der Freund der Studentin aus der kleinen Wohnung neben uns, spielt Gitarre und singt »Galway Girl« von Ed Sheeran. Wer den Song kennt, singt mit, einschließlich mir. Einige Mütter und Väter tanzen mit ihren Kindern dazu im Kreis.
Der Junge, den ich insgeheim den Löwen nenne, setzt sich neben mich. Seine Haut duftet nach einem sportlichen Duschgel, doch mir entgeht nicht die Bierfahne aus seinem Mund. Also rücke ich ein Stück von ihm ab. Genauso macht es Fabienne bei dem anderen Typen, der sich neben sie gepflanzt hat.
»Was ist denn das für ein Öko-Fest?«, fragt der Löwe. »Habt ihr keine richtige Musik?«
»Du spinnst wohl«, kontert Fabienne. »Malte ist so ein toller Sänger.«
»Live-Musik ist richtige Musik«, sage ich. »Wenn ihr schlecht drauf seid, geht einfach wieder.«
»Ich hab nichts gesagt«, verteidigt sich der Junge neben Fabienne.
»Schon gut.« Der Löwe fährt sich mit den Fingern wieder durchs Haar. »Ein bisschen bleiben wir noch. Wenigstens sind nicht nur Hippies hier, sondern auch zwei hübsche Mädchen.«
»Ich fühle mich geehrt«, spotte ich und streiche meine Augenbrauen glatt, eine blöde Angewohnheit von mir. »Aber wir haben auch noch andere Eigenschaften.«
»War nur Spaß«, gibt er zurück. »Seid ihr schon lange hier?«
»Seit genau 16 Jahren«, antworte ich und sehe richtig, wie es in seinem Hirn rattert. Fabienne und ich sehen uns an und kichern. Meine Güte, steht der Typ auf dem Schlauch – und ist total schräg. Wie gehetzt er sich umsieht, als würde er gejagt oder gleich um sich schlagen. Dann wieder taucht er in meine Augen ein, als suche er etwas darin, voller Sehnsucht oder Verzweiflung. Das Gespräch zwischen uns vieren kommt nur schleppend in Gang. Mir ist das alles zu mysteriös, zu angespannt. Das hier ist nun mal Mamas und Manus Hochzeit und mein Sechzehnter, und ich habe nicht vor, mir von zwei Miesmachern die Laune verderben zu lassen.
»Wollt ihr euch Nachtisch holen?«, fragte ich den Löwen, um die Stimmung zu entkrampfen. »In den Schüsseln findet ihr bestimmt noch Mousse au Chocolat.«
»Ich hätte nichts gegen ein leckeres Dessert«, witzelt der andere und linst in Fabiennes Ausschnitt. Sie verdreht die Augen. Der Löwe steht auf und holt sich eine Dessertschüssel, sieht sich auf dem Büfett um und stellt die Schüssel wieder weg.
»Nur noch Obstsalat da«, mault er. Seine Stimme klingt tief und warm, sie passt gar nicht zu seiner nervösen, zornigen Ausstrahlung. »Bei euch ist alles so bio. Hab schon dieses ganze Grünkernzeugs kaum runterbekommen. Die albernen Väter da drüben sind sich für nichts zu schade, wie?« Er weist mit dem Kopf auf Rashid und unseren Nachbarn Nelson, die gerade ihren Kindern zeigen, wie man auf Stelzen läuft. Ich kapiere nicht, worüber er sich aufregt.
Fabienne zieht ein übertrieben mitleidiges Gesicht. »Armer Schatz«, sagt sie. »Hat dein Papi nicht mit dir gespielt, als du klein warst?«
Der Junge wirft ihr einen so düsteren Blick zu, dass sie ihre Miene sofort wieder auf normal stellt. Also Volltreffer. Er legt seinen Arm auf die Lehne hinter meinem Rücken und tickt mit den Fingern aufs Holz, seine Füße wippen hektisch auf und ab. Malte stimmt gerade »Wonderwall« von Oasis an, und jetzt trommelt mein Sitznachbar den Rhythmus dazu auf die Lehne in meinem Rücken, ganz exakt und konzentriert, aber ruhelos. Ich werde nicht schlau aus ihm. In diesem Moment kommt Manu vorbei und bietet den Jungs ein Bier an.
»Ihr amüsiert euch?«, fragt sie und zwinkert uns zu.
Fabienne wiegt zweifelnd ihren Kopf hin und her, ich zucke mit den Schultern und werfe ihr einen Blick zu, der sagt: Du glaubst hoffentlich nicht ernsthaft, dass wir diese Typen toll finden.
»Alles cool«, versichern die Jungs und nickten eifrig. Mein »Belagerer« hat aufgehört zu trommeln, nimmt seine Bierflasche in die Hand und setzt sie an die Lippen. Er schluckt gierig. Ich sehe die Bewegung der Sehnen an seinem Hals und die dunklen Haare, die noch dichter wirken, als er den Kopf nach hinten neigt, und wünsche mir, er wäre nicht so verdammt attraktiv. Zum Glück schaffe ich es, mir nichts anmerken zu lassen.
»Wo ist eigentlich der Bräutigam?«, will der Löwe wissen.
»Hat er seinen Hochzeitsanzug schon ausgezogen und sich unters Kaninchenfuttervolk gemischt?«
»Der Bräutigam ist die Frau, die euch das Bier gebracht hat, Manu, die Frau von meiner Mutter, meine Co-Mutter also. Nur für den Fall, dass du dich doch noch einkriegst und beiden vielleicht gratulieren möchtest.«
»Die Frau von deiner Mutter«, wiederholt der Löwe und sieht mich mit einer Mischung aus Spott und Verwunderung an. »Und was hast du ihm zur Hochzeit geschenkt, deinem weiblichen Vater? Einen Bohrhammer? Ein paar Männerunterhosen? Oder ’ne Packung Kondome?«
Er und sein Kumpel klatschen ab und wiehern vor Lachen.
»Und du? ’Ne Nummer zu groß gekauft?«, kontere ich.
Beide Jungs verfallen in Schnappatmung. Der Löwe steht auf, zuerst denke ich, er will abhauen, doch er bückt sich nur und sucht nach seinem Rucksack, aus dem er schließlich einen Bluetooth-Lautsprecher fischt. Schöne Hände hat er. Ich bemerke ein paar kupferfarbene Härchen auf dem Handgelenk sowie seine langen, sehnigen Finger mit kurzen, sorgfältig gefeilten Nägeln und könnte mich ohrfeigen, weil ich mir vorstelle, wie es sich wohl anfühlt, wenn sich diese Hand mit meiner verschränkt. Komisch, dass er mir noch nie aufgefallen ist, dabei wohnt er bestimmt hier im Kiez. Mit seinen wohlgeformten Fingern tippt er jetzt auf seinem Handy herum, bis plötzlich brüllend lauter Hip-Hop die friedliche Stimmung im Hof durchschlägt.
»Endlich mal Stimmung hier«, lacht er und steht auf, holt sich jetzt doch noch mal etwas zu essen und haut rein, als hätte er seit Tagen nichts bekommen. Der andere Junge tut es ihm gleich. Der Hausmeister eilt schimpfend auf uns zu und verlangt, dass »dieses unerträgliche Gestampfe aus Trump-Land« abgeschaltet wird, doch meine Mutter geht dazwischen.
»Lass doch«, beschwichtigt sie den Nachbarn. »Wer sagt denn, dass nur unser Musikgeschmack zählt? Gleiches Recht für alle.«
Als die Jungs satt sind, bemerke ich, dass ein wenig von der Wildheit und Wut aus den Augen des Löwen verschwunden ist. Vielleicht ist er aber auch nur wieder nüchtern, weil er jetzt was im Magen hat. Beide versuchen es nun auf die nette Tour, fragen nach unseren Namen, holen für Fabienne und mich Bowle mit extra vielen Eiswürfeln und versuchen erneut, mit uns ins Gespräch zu kommen. Irgendwann beginnt der Löwe, meinen Nacken zu kraulen und beugt sich vor, um mich zu küssen, doch ich schiebe ihn weg.
»Lass gut sein«, sage ich. »Ich glaube, mein Freund wäre ziemlich eifersüchtig, wenn er das hier sehen könnte, und das willst du nicht. Außerdem stinkst du nach Bier.«
»Dein Freund«, wiederholt er und zuckt zurück. »Und wo ist er jetzt, wenn ich fragen darf? Keinen Bock auf euren Emanzen-Haushalt, wie?«
»Du hast nichts kapiert«, erwidere ich. »Und übrigens …« Ich stehe auf und gehe hinüber zu einem runden Gartentisch, auf dem alle Gäste, die es nicht lassen konnten, doch ein paar Geschenke für Manu und Mama oder mich abgelegt haben. Auch mein Hochzeitsgeschenk für meine Mütter liegt darauf. Wir wollen doch damit angeben, hatte Mama heute Mittag gesagt.
»Das hier habe ich meinen weiblichen Eltern geschenkt.« Ich hebe eine zwei mal zwei Meter große Wolldecke aus lauter verschiedenen gehäkelten Patchwork-Quadraten an. Ein knappes Jahr habe ich dafür gebraucht. Sie wird die neue Tagesdecke für das Ehebett meiner Mütter. »Noch Fragen?«
Der Löwe verdreht die Augen. »Was für ein Weiber-Alarm«, stöhnt er und dreht sich zu seinem Kumpel um. »Komm, wir verziehen uns.«
2
In dieser Nacht schlafe ich schlecht. Die Bowle bewirkt, dass sich alles um mich herum zu drehen scheint, sobald ich die Augen schließe. Mein Kopf dröhnt und mein Magen rebelliert. Jetzt nur nicht übergeben!
Mir geht dieser Junge nicht aus dem Kopf. Der Zorn in seinen Augen, die Unruhe, die er ausstrahlte, seine dämlichen, frauenverachtenden Sprüche. Er schien gegen alles und jeden zu sein. Wie ein Pulverfass wirkte er. Ein falsches Wort und niemand hätte ihn mehr stoppen können. Trotzdem ist er lange geblieben, dicht an meiner Seite. Noch immer bin ich verwirrt, wenn ich daran zurückdenke, dass er mich küssen wollte. Sein tiefer, düsterer, fast bedrohlicher Blick, seine dichten Haare, die wild und doch gepflegt aussahen. Sein langer, fester Oberschenkel neben meinem, das knochige Knie, das aus seinen zerrissenen Jeans ragte, seine tiefe Stimme, der Arm hinter meiner Schulter und seine Hände, vor allem seine Hände. Ich werde nicht schlau aus ihm, so sehr ich auch grüble.
Erst jetzt fällt mir ein, dass ich nicht mal weiß, wie er heißt. Es hat mich nicht interessiert. Vielleicht weiß Fabienne den Namen des anderen. Ich glaube allerdings nicht, dass ich einen von beiden wiedersehen möchte.
Schon sein Spruch über Manu! Wie kann jemand, der so verflixt gut aussieht, so daneben sein? Er glaubt wohl nicht ernsthaft, so bei mir landen zu können. Welches Mädchen ist heute noch so bekloppt, sich auf einen Typen einzulassen, der Machosprüche ablässt und offenbar noch nie etwas von Toleranz gegenüber Homosexuellen gehört hat?
Niemals, schwöre ich mir, nie im Leben werde ich auf so einen hereinfallen. Manu und meine Mutter sind ein super Paar. Für mich ist das ganz normal mit den beiden. Ich kenne es ja nicht anders. Und sie ergänzen sich so gut. Mama ist diejenige, die an meinem Bett gesessen hat, wenn ich als Kind Fieber hatte, die mir Zöpfe in meine nassen Haare geflochten hat, wenn ich Locken wollte, und die mir gezeigt hat, wie man Apfelkuchen mit Gitter bäckt. Manu brachte mich zum Strahlen, wenn sie mich mit dem Motorrad zur Schule fuhr, mir Zaubertricks beibrachte und indem sie mir zeigte, womit man krumm eingeschlagene Nägel wieder aus der Wand zieht, ohne dass der Putz bröckelt. Nur meinen Hang zum Handarbeiten konnte keine von beiden jemals nachvollziehen. Mama fehlt dazu die Geduld und Manu werkelt lieber mit Holz und Metall.
»Da sieht man schneller ein Ergebnis«, sagt sie immer. »Meine Hände sind wohl zu derb für Stoffe, Fäden und Maschen.«
»Du hast die sensibelsten Hände der Welt«, antwortet Mama dann, »bis auf Elena natürlich.«
Ich bin das absolute Wunschkind meiner Mütter. Beide wollten mich und beide lieben mich. Und es hat keinen einzigen Tag gegeben, an dem ich Grund gehabt hätte, dies zu bezweifeln. Früher, wenn mich andere Kinder zu Hause besucht haben und fragten, wo mein Papa sei, habe ich einfach geantwortet: »Ich habe zwei Mamas«, und dann haben wir weitergespielt.
Natürlich habe ich auch einen Vater, aber gesehen habe ich ihn noch nie. Ich bin durch eine Samenspende gezeugt worden, vor knapp 17 Jahren – und trotz meiner Kopfschmerzen lache ich jetzt stumm in mich hinein. Denn wenn ich das dem Löwen erzählt hätte, wäre vermutlich sein gesamtes Weltbild in sich zusammengesunken. Ich weiß davon, solange ich zurückdenken kann, Mama und Manu haben nie ein Geheimnis daraus gemacht. Sie kennen den Spender nicht und haben nur gesagt, dass er Student gewesen sein soll.
»Die Samenspenden waren wohl seine Art, neben dem Studium zu jobben«, hat Mama irgendwann einmal lachend erzählt. Ich habe immer versucht, nicht allzu viel darüber nachzudenken.
Aber in dieser Nacht nach der Hochzeitsfeier, während ich stundenlang wach liege, ertappe ich mich, wie ich doch anfange zu grübeln. Wie es gewesen wäre, mit einem Vater aufzuwachsen, mit meinem Vater. Wie sich mein Charakter entwickelt hätte, wenn ein Mann mich gemeinsam mit Mama erzogen und beeinflusst hätte? Wie unser Alltag gewesen wäre, und ob ich andere Interessen und Hobbys hätte als Kunsthandwerk und ferne Länder. Ob es nicht auch eine Bereicherung wäre, auch zu Hause von männlichen Verhaltensweisen und Meinungen umgeben zu sein, so wie es bei Fabienne und meinen anderen Freundinnen der Fall ist. Und wie es gewesen wäre, wenn er heute zu meiner Geburtstagsfeier gekommen wäre. Was er mir geschenkt hätte … vielleicht eine tolle gemeinsame Vater-Tochter-Unternehmung. Ich bin die Einzige weit und breit, die in einer Regenbogenfamilie lebt, obwohl wir natürlich auch Männer in unserem Bekanntenkreis haben. Meinen Onkel Philipp, Mamas jüngeren Bruder, finde ich sogar ziemlich nett, aber er wohnt in Frankfurt, und ich sehe ihn höchstens einmal im Jahr. Ein Vaterersatz ist er also nicht.
Und ich frage mich, wie mein Vater wohl aussieht. Ob ich ihm ähnlich bin, denn von Mama habe ich zwar die Nasen- und Mundpartie geerbt, aber meine Augen sind hellbraun und ihre blau, auch die Form ist anders. Sie hat ganz eng zusammenstehende Augen. Die habe ich nicht. Dafür habe nur ich angewachsene Ohrläppchen, Mama und Manu haben freie. Ich komme nicht dran vorbei: Irgendwo auf dieser Welt läuft mein Vater herum, vielleicht lebt er sogar ganz in meiner Nähe, und wer weiß – womöglich bin ich ihm schon irgendwo über den Weg gelaufen, ohne es zu wissen.
Die Kopfschmerzen werden schlimmer, mein Hals fühlt sich rau und klebrig an. Sonst habe ich immer eine Flasche Wasser am Bett, heute Nacht habe ich vergessen, mir eine hinzustellen. Also stehe ich auf und gehe in die Küche. Im Dunkeln muss ich erst mehrere Mineralwasserflaschen im Kasten neben dem Kühlschrank anheben, bis ich eine volle gefunden habe. Ich trinke sie in einem Zug halb leer. Danach fühle ich mich etwas besser und gehe zur Toilette. Komische Vorstellung, hier im Bad könnte auch Rasierzeugs stehen, Männerdeo und After Shave. Das Gesicht eines Mannes im Spiegel. Vielleicht haben Mama und Manu ein Foto von ihm und es mir bisher nicht gezeigt, weil sie mit unserer Familie zufrieden sind, so wie sie ist, und nicht daran rühren wollten.
Nachdem ich mir die Hände gewaschen habe, horche ich in den Flur, erschrecke kurz, als ich eine Bewegung wahrnehme, aber das bin ich selber, eine blasse Gestalt mit zerzausten langen mittelblonden Haaren in unserem großen runden Badezimmerspiegel, den ich letztes Jahr im mediterranen Stil aus lauter blauen und verspiegelten Mosaiksteinen auf einer Gipsplatte zusammengesetzt habe.
Erst als ich sicher bin, dass alles still ist, schleiche ich ins Wohnzimmer, lehne die Tür an, schalte das Deckenlicht ein und öffne die untere Doppeltür des alten Bauernschranks, in dem unsere Fotos liegen. Sie knarrt leise. Die Alben lasse ich, wo sie sind, die habe ich mir schon oft angesehen. Auf vielen ist Fabienne mit drauf. Wir amüsieren uns oft darüber, wie wir als Kinder ausgesehen haben, mit bunten Kleidern und Zahnlücken. Bilder von mir als Baby mal auf Mamas, mal auf Manus Arm. Die beiden sehen noch so jung darauf aus, schon damals glücklich strahlend. Wir haben noch Schachteln mit unsortierten Bildern, Schnappschüssen, misslungenen Fotos, die trotzdem zu schade zum Wegwerfen sind. Bilder aus Manus Leben, bevor sie Mama kennengelernt hat, Kinderfotos von beiden und nicht zuletzt Mamas »Männerkiste« mit all ihren Verflossenen. Früher war sie mit Jungs zusammen und dachte, mit ihr stimme etwas nicht, weil sie den Sex mit ihnen nicht so sagenhaft fantastisch fand, wie ihre Freundinnen es immer von sich behaupteten. Nachdem sie bei ihren Eltern ausgezogen ist, hatte sie ein paar kurze Liebschaften mit Frauen. Und dann kam Manu.
Die Männerkiste. Vielleicht finde ich darin einen Hinweis. Ein Foto des Spenderstudenten, versteckt zwischen den Exfreunden. Ich versuche, kein Geräusch zu machen, als ich mich auf den Boden setze und wie in Zeitlupe alle Schachteln aus dem Schrank nehme und um mich herum verteile, bis ich ganz hinten endlich die Männerkiste zu fassen bekomme. Ich spüre mein Herz schneller schlagen, während ich den Deckel öffne. Vielleicht bin ich nur Sekunden davon entfernt, zum ersten Mal das Gesicht meines leiblichen Vaters zu sehen, sofern ich ihn erkenne. Sehr voll ist die Schachtel nicht – Mama war schließlich kein Luder. Vier oder fünf Typen waren es, die sie näher kannte vom Teenie-Alter an, bis sie endlich dazu stehen konnte, wer sie wirklich ist und was sie fühlt. Jungs aus ihrer Oberstufe, Freunde von Freunden, Medizinstudenten aus den Krankenhäusern, in denen sie ihre Praktika absolvierte, Urlaubslieben, keiner von ihnen war ihr jemals so wichtig wie Manu.
Einen kleinen Stapel Bilder nehme ich in die Hand und fächere sie auf wie Spielkarten. Auf vielen davon ist Mama mit drauf, es sind nur wenige Fotos von einzelnen Jungs darunter, die nicht auch auf anderen Bildern neben Mama wieder auftauchen. Trotzdem versuche ich, Ähnlichkeiten zwischen ihren Gesichtern und meinem zu entdecken.
Aus Mamas und Manus Schlafzimmer höre ich leises Husten und das Rascheln ihrer Bettdecken. Hastig lege ich die Fotos zurück und schiebe die Kiste wieder an ihren Platz zurück, versuche alles genau so einzuräumen, wie es vorher war. Dann schleiche ich zurück in mein Zimmer, schließe lautlos die Tür und krieche wieder unter meine Bettdecke, um weiterzugrübeln.
Ich habe lange nicht darüber nachgedacht, dass es diese Lücke, den blinden Fleck in meinem Leben gibt. Einen Menschen, von dem ich genauso abstamme, mit dem ich genetisch ebenso eng verwandt bin wie mit meiner Mutter. Ich glaube, ich kann mich erst als vollständig, als ganze Person empfinden, wenn ich weiß, wer er ist. Ich spüre: Jetzt hat es angefangen. Ich bin auf der Suche nach meinem Vater. Und ich werde nicht aufgeben, bis ich ihn gefunden habe.
Elena, 7 Jahre
Liber Papa,
wie get es dir? Mir get es gut. Ich bin 7 Jare alt.
In der Schule sitze ich neben Fabien. Fabien hat braune Hare.
Fabiens Papa hat auch braune Hare. Meine Hare sind blont.
Was für Hare hast du? File Grüse fon Elena.
3
Wir sind alle drei verkatert, als wir gegen Mittag am Frühstückstisch sitzen. Mama ist noch am besten drauf. Sie ist als Erste aufgestanden, hat Brötchen geholt und die Kaffeemaschine angeschmissen. Manu reibt sich Pfefferminzöl auf die Schläfen, trinkt Tee aus frischem Ingwer in kleinen Schlucken und spießt etwas Rührei auf ihre Gabel.
»Nimm ein paar Chiligurken«, sagt Mama zu ihr und öffnet das Glas mit einem Knacken. »Ansonsten hilft nur Schlaf oder frische Luft. Hast du übrigens heute Nacht deinen Zahnputzbecher im Wohnzimmerschrank gesucht statt im Bad?«
»Na hör mal«, knurrt Manu, »so besoffen war ich nun auch nicht. Wenn nicht kurz vor Mitternacht noch Liza mit ihrer selbst gemachten Sangria gekommen wäre, hätte ich gar keine Kopfschmerzen. Aber die war einfach zu gut, um nach einem Glas schon aufzuhören. Was ist denn mit dem Wohnzimmerschrank?«
»Die untere Tür stand offen, als ich aufgestanden bin«, antwortet Mama. »Vor dem Schlafengehen war sie noch zu. Also du warst es nicht?«
»Was sollte ich mitten in der Nacht im Wohnzimmer suchen? Vielleicht spukt es hier. Oder Elena schlafwandelt.«
Jetzt habe ich also den Ball. Verflixt, ich muss in meiner Eile vergessen haben, die Schranktür zu schließen, nachdem ich die vielen Fotoschachteln wieder eingeräumt habe. Mama sieht mich an und grinst ein wenig bemüht.
»Oder hat sich dein Verehrer von gestern Abend im Schrank versteckt?«
»Welcher Verehrer?«, gebe ich zurück. »Ich war das, aus Versehen. Ich wollte ein Foto von meinem Vater finden.«
Oops, das war die Flucht nach vorn. Aber warum auch nicht, die Zeit ist reif dafür.
»Von deinem was?« Mama starrt mich an. »Wieso denn so plötzlich, noch dazu mitten in der Nacht? Du weißt doch über alles Bescheid. Der Mann hat doch noch nie eine Rolle bei uns gespielt.«
»Und das ist auch gut so«, sagt Manu, die neben ihr sitzt, langt über den Tisch nach einer Serviette und hustet hinein. Bei meinen Worten hat sie sich fast an ihrem Kaffee verschluckt. »Uns braucht hier kein Kerl reinzureden.«
Ich starre zurück und kann es nicht glauben. Beide sitzen mir im Schulterschluss gegenüber und sind sich schon einig, bevor sie wissen, was ich überhaupt will.
»Habe ich gesagt, ich will zu ihm ziehen?«, brause ich auf. »Wo ist denn auf einmal eure Toleranz? Jede kleine Rotznase, die gestern Abend mitgefeiert hat, konnte ihren Papi vorweisen, und ich soll von meinem nicht mal ein Foto sehen? Ich will einfach nur wissen, ob ich ihm ähnlich bin und ob er ein guter Mensch ist! Ist das zu viel verlangt?«
»Du siehst Conny ähnlich.« Manu versucht zu grinsen. »Alles, was an ihr schön ist, ist es auch an dir.«
Ich verdrehe die Augen. »Sorry, Manu, aber jetzt geht es ausnahmsweise mal um mich und nicht um euch als Pärchen. Ihr habt euch das damals alles so ausgedacht und durchgezogen mit der Samenspende. Aber ich bin kein kleines Kind mehr. Ich will wissen, wer ich wirklich bin. Und dazu reicht es nicht, mit euch einen auf Happy Family zu machen. Irgendwo da draußen lebt mein Vater. Ist es so schwer zu verstehen, dass ich ihn wenigstens einmal sehen will?«
»Ist ja gut.« Manu stöhnt und knetet ihre Stirn. »Aber das wird ein riesiger Aufwand. Überleg dir gut, ob du dir das wirklich antun willst.«
»Irgendwann musste dieser Tag kommen«, seufzt Mama. »Du bist 16 geworden, da musst du uns nicht mal mehr um Erlaubnis fragen, um die Identität des Samenspenders von damals herauszufinden.«
»Wieso Erlaubnis? Habe ich euch erlaubt, so ein Geheimnis um meinen Vater zu machen? Woher wolltet ihr die ganze Zeit wissen, dass ich ihn nicht gern kennengelernt hätte?«
»Wie wollten dich nicht durcheinanderbringen«, sagt Manu. »Vielleicht war das ein Fehler, das gebe ich zu. Leider können wir die Zeit nicht zurückdrehen.«
»Habt ihr wirklich kein einziges Bild von ihm?«
Sie schüttelt den Kopf. »Wir haben damals nicht mal eines gesehen, geschweige denn mit nach Hause bekommen. Äußere Merkmale und Charakterzüge haben wir zwar mit der Samenbank abgesprochen, aber Fotos … Fehlanzeige. Tut mir leid.«
»Und wie er heißt, wisst ihr auch nicht?«
»Der Mann war damals noch ziemlich jung und wollte bestimmt nicht verpflichtet werden, Unterhalt zu zahlen«, sagt Manu.
»Darum geht es doch gar nicht.« Ich lasse mich in meinem Stuhl gegen die Rückenlehne fallen. »Aber dann gehen meine Chancen, ihn ausfindig zu machen, wohl gegen null.«
»Aber wieso brennst du auf einmal so darauf, deinen Spender zu finden?«, will Manu wissen. »Bisher warst du immer zufrieden mit unserer Familie, so wie sie ist.«
»Deinen Spender. Wie sich das anhört«, erwidere ich gereizt. »Immerhin habe ich von ihm die Hälfte meiner Gene geerbt.«
Unten an der Haustür klingelt es. Ich weiß schon, wer das ist. Meine Wurfzeitungen werden geliefert, die ich jeden Samstag hier im Kiez austrage. Die Hälfte von dem Geld, das ich damit verdiene, nehme ich als Taschengeldaufbesserung, die andere Hälfte spare ich. Im Internet habe ich zwar auch noch einen kleinen Shop, den ich mit Mama zusammen eingerichtet habe und in dem ich selbst genähte Handyhüllen und gehäkelte Accessoires verkaufe, aber wegen der Patchworkdecke bin ich schon lange nicht mehr dazu gekommen, neue Sachen einzustellen. Nach dem Abi möchte ich für ein Jahr ins Ausland gehen. Südafrika oder Indonesien sehen, andere Kulturen kennenlernen, Sprachen aufschnappen, Landschaften auf mich wirken lassen, von denen ich heute noch nicht mal ahne, dass es sie gibt. Darauf spare ich.
Der Wurfzeitungsjob nervt mich meistens, vor allem, weil ich vorher immer noch die Werbebeilagen einlegen muss, jede einzeln.
Aber heute habe ich Bock drauf. Durch die Straßen ziehen, von Haus zu Haus, den Kopf frei kriegen. Vielleicht sehe ich sogar meinen Vater, haha. Kann doch sein, dass er hier in der Gegend wohnt.
Ich springe auf und drücke auf den Summer. Nach oben schleppen muss ich die Zeitungen selbst, der Bote stellt sie nur im Treppenhaus ab. Aber erst mal setze ich mich wieder in die Küche. So schnell lasse ich nicht locker.
»Wer hat dir das überhaupt eingeredet?«, hakt Manu noch einmal zwischen zwei Schluck Kaffee nach. »Der seltsame Junge vielleicht, der gestern Abend nicht von deiner Seite gewichen ist?«
»Blödsinn. Der hat damit überhaupt nichts zu tun.« Ich spüre, dass ich rot werde, aber die beiden können ruhig denken, es sei nur vom Ärger, weil sie sich so verbohrt geben. Ja, er war der Auslöser durch seinen Spruch vom weiblichen Vater. Aber auf die Idee, mich für meinen genetischen Vater zu interessieren, wäre ich auch noch von selber gekommen.
»Dann weiß ich nicht, wozu das alles auf einmal gut sein soll«, sagt Manu. »16 Jahre lang sind wir drei bestens ohne Mann klargekommen. Wer weiß, was alles passiert, wenn du ihn erst kennenlernst. Es kann auch eine Enttäuschung für dich werden! Die würde ich dir gern ersparen.«
»Frag mich doch einmal, was ich will!«, brause ich auf.
»Vielleicht hast du von ihm dein impulsives Wesen.« Manu fixiert mich mit ihrem Blick. »Von Conny jedenfalls nicht.«
»Ich glaube, in Elenas Alter war ich nicht viel anders«, sagt Mama und lächelt uns beide mit starren Lippen an. An ihrem Hals haben sich rote Flecken gebildet. Dann, wieder an mich gewandt: »Wir wollen es dir nicht ausreden, Kleines. Aber so ein Schritt will gut überlegt sein. Du nimmst zu jemandem Kontakt auf, der mit uns gar nichts zu tun hat, der keine Vaterrolle übernehme wollte, sondern nur Menschen mit unerfülltem Kinderwunsch helfen. Sich etwas Geld dazuverdienen. Und klar, du trägst seine Gene in dir.«
»Ja eben! Und das nennst du nichts?« Ich springe wieder auf.
»Genau zur Hälfte stamme ich von ihm ab, genau wie von dir, Mama. Sorry Manu, aber so ist es nun mal. Und deshalb will ich wissen, wie er tickt. Wo er wohnt, wie er lebt, was er von Beruf ist und wofür er sich sonst noch interessiert. Vielleicht reicht mir das schon! Vielleicht will ich ihm nur einmal begegnen, damit er für mich kein Phantom bleibt. Einmal Hallo sagen, kurz quatschen und tschüss. Ich weiß echt nicht, weshalb ihr so ein Drama daraus macht.«
»Dein Recht kann dir natürlich keiner nehmen. Das wollen wir auch gar nicht«, betont Mama. »Wir dachten bloß, du wärst genauso happy mit unserer Regenbogenfamilie wie wir. Fehlt dir denn etwas bei uns?«
»Quatsch. Aber ich konnte mir das nicht aussuchen«, kontere ich. »Klar, ihr seid meine Familie und ich hab euch beide lieb. Aber mein Vater ist für mich nicht irgendwer, nur weil ich ihn noch nie gesehen habe.«
Ich lehne mich gegen den Türrahmen. Manu steht auf und wühlt in der Schublade unseres Küchenschranks, findet ein Röhrchen Brausetabletten gegen Schmerzen und löst zwei davon in Wasser auf. Ihre kurzen dunklen Haare stehen leicht fettig von ihrem Kopf ab, ihr kariertes Hemd hat sie schief geknöpft. Mama isst endlich ihr Brötchen weiter. Ich hole meins auch und schlinge es im Stehen hinunter. Erst jetzt merke ich, wie gut es mir tut, etwas in den Magen zu bekommen.
Als ich fertig bin, öffne ich die Tür zum Treppenhaus, renne nach unten und wuchte den ersten Stapel Wurfzeitungen hoch in die Wohnung. Sechs Beilagen sind einzusortieren, Möbelhäuser, Supermärkte, Discounter, ein Spielwarenriese. Eine Stunde wird es mindestens dauern, bis ich damit fertig bin, aber es gibt mehr Kohle, als wenn ich nur die leeren Zeitungen durch unseren Kiez schleppen würde. In meinem Zimmer werfe ich den ersten Stapel auf mein Bett und schneide die Banderole auf. Aus dem Flur höre ich Mama telefonieren, kurz darauf steckt sie ihren Kopf durch meine Tür.
»Ich muss ins Geburtshaus«, sagt sie. »Heute scheinen sich alle Babys verabredet zu haben, gleichzeitig auf die Welt zu kommen. Ich weiß nicht, wann ich zurück bin.« Sie kommt näher und drückt mich. »Ich versteh dich ja, Kleines. Wir reden später noch mal in Ruhe über alles, versprochen.« Dann geht sie, und ich setze mich auf mein Bett und fange mit dem Sortieren an.
Nach ein paar Minuten klopft Manu an und wartet, bis ich sie hereinbitte. Inzwischen schaut sie etwas muntererer aus der Wäsche als vorhin am Tisch.
»Ich beneide dich nicht um deinen Job«, sagt sie. »Wenn du willst, helfe ich dir. Genau wie dir ist mir heute nach etwas, wofür man kein Hirn braucht. Darf ich?«
Die meiste Zeit arbeiten wir schweigend, Hand in Hand und entwickeln stumm eine gemeinsame Routine. Daran würde jeder Außenstehende erkennen, dass wir zusammengehören. Ich schichte die Beilagen aufeinander und schiebe sie in die Mitte der Zeitungen, die Manu für mich aufhält und danach auf den rasch anwachsenden Stapel legt, von Mal zu Mal geht es schneller. Ab und zu versucht Manu, ein Gespräch mit mir anzufangen, locker und leicht, ich spüre genau, dass ihre Stimme unverkrampft klingen soll. Wir sind erst beim zweiten Stapel von fünf. Manu hat die restlichen vier nach oben geholt. Als Tischlerin ist sie Zupacken gewohnt. Ich bin noch nicht so weit, mich ganz versöhnlich zu zeigen.
»Hat es euch gestern gefallen?«, will sie wissen. »Fabienne, dir und den beiden Jungs?«
»Mit Fabienne ist es immer cool«, antworte ich. Als ob du wissen willst, was mit Jungs ist.
»Kennt ihr die zwei aus der Schule?«
»Die sind einfach aufgetaucht. Keine Ahnung, woher.« Hör auf zu bohren. BITTE.
»Der Dunkelhaarige stand ja mächtig auf dich. Scheint aber ein übler Macho zu sein.« Und wenn schon.
Nach einer halben Stunde haben wir erst knapp die Hälfte der Werbebeilagen geschafft, insgeheim fluche ich, weil ich gerade heute keinen Bock auf Manu habe, aber ohne sie würde ich doppelt so lange brauchen. Ich will endlich raus, damit ich in Ruhe meinen Gedanken nachhängen kann, ohne dass mich dauernd jemand vollquatscht.
»Nachher fahre ich noch zum Baumarkt«, versucht sie es weiter. »Wir wollen das Bad neu streichen und ein wenig umgestalten.« Sie blickt sich in meinem Zimmer um.
»Danach könnten wir gleich hier bei dir weitermachen, wenn du willst. Wie versprochen.« Von mir aus könnt ihr auch eine Hochzeitsreise machen. Ich komme hier schon klar oder gehe zu Fabienne.
»Mal sehen«, antworte ich knapp und blicke mich kurz um, ganz unrecht hat sie nicht. Die Poster von Schauspielern und Sängern habe ich längst abgenommen, weshalb mein Zimmer etwas chaotisch rüberkommt mit dem Nähmaschinentisch in der Mitte und dem Regal vor der vanillegelben Wand, das vor lauter Stoffen und Körben mit Wolle fast überquillt. An ihm lehnt eine Holzleiter, die ich mit einer Lichterkette aus blütenförmigen LEDs umwickelt habe. Vor dem Fenster wartet mein Schreibtisch darauf, dass ich Hausaufgaben mache, zuoberst liegt mein Laptop. Das Schönste im Zimmer ist die Deckenlampe. Den schlichten weißen Schirm habe ich mit unzähligen übrig gebliebenen bunten Knöpfen beklebt. Frisch renoviert würde alles viel einladender aussehen.