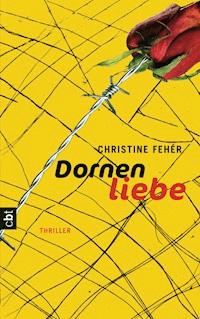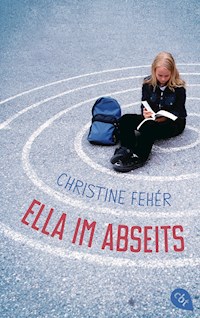8,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: cbj
- Kategorie: Für Kinder und Jugendliche
- Sprache: Deutsch
Ihre Liebe schmerzt – bis in den Tod
Zwölfte Klasse, Studienfahrt. Eine Schülerin fehlt, als alle am Frühstückstisch sitzen: die gerade 18 gewordene Valerie, der man nachsagt, zwischen ihr und dem Englisch-Referendar Corvin Schwarze sei was am Laufen. Da kommt die Polizei in den Raum: Valerie wurde schwer verletzt gefunden – jemand hat sie von einer Klippe gestürzt. Aber wer? War es ihr Ex-Freund Manuel, der nie über die Trennung hinwegkam? Ihre Freundin Alena, die ihr die Heimlichtuerei verübelt? Die Klassenlehrerin Frau Bollmann, die selbst in Corvin Schwarze verliebt war? Oder etwa Corvin selbst, der nicht akzeptieren wollte, dass Valerie Abstand von ihm suchte?
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 442
Veröffentlichungsjahr: 2011
Ähnliche
Christine Fehér
Schwarze Stunde
Christine Fehér
Schwarze
Stunde
Thriller
cbt ist der Jugendbuchverlag
in der Verlagsgruppe Random House
Gesetzt nach den Regeln der Rechtschreibreform
1. Auflage 2011
© 2011 cbt Verlag, München
Alle Rechte vorbehalten
Umschlagbild: Mauritius images/ Nora Frei
Umschlagkonzeption: init.büro für gestaltung, bielefeld
st · Herstellung: AnG
Satz: KompetenzCenter, Mönchengladbach
ISBN: 978-3-641-04527-2
www.cbt-jugendbuch.de
Wo ist eigentlich Valerie?«, fragt Frau Bollmann, die Englischlehrerin, morgens im Speisesaal, nachdem sie mit routiniertem Blick die Schülerzahl an allen Tischen überprüft hat. »Alena? Carla? Büsra? Hat sie verschlafen oder ist sie noch im Bad?«
Die Mädchen aus Valeries Zimmer heben die Schultern; Carla und Büsra löffeln ihre Cornflakes weiter, nur Alena reißt ihre Augen auf und blickt sich suchend im Raum um.
»Ich dachte, sie wäre längst hier«, äußert sie. »Sie war schon weg, als ich aufgewacht bin, deshalb dachte ich, sie hat vielleicht nicht gut geschlafen und ist früher aufgestanden als wir anderen aus dem Zimmer.«
»Merkwürdig.« Frau Bollmann runzelt die Stirn. »Was ist mit Ihnen, Manuel; wissen Sie auch nicht, wo sie steckt?«, fragt sie, an Valeries Freund gerichtet.
»Ich hab sie seit gestern Abend nicht mehr gesehen«, beteuert er. Seine Augen sind rot, er wirkt, als wäre er noch nicht ganz wach und außerdem verkatert, er greift sich an den Kopf. »Sie ist doch nicht mitgekommen, als die meisten von uns gestern noch mal weggegangen sind. Wissen Sie doch selber. Ich geh nachher mal gucken, jetzt brauche ich erst mal was zwischen die Kiemen.«
»Ja, Valerie sagte, sie sei müde«, erinnert sich die Lehrerin. »Aber das würde nur erklären, warum sie noch im Bett liegt. Sie sind ganz sicher, dass sie aufgestanden ist, Alena?«
»Wenn ich es doch sage!« Alena wirft die Hände in die Luft.
»Die anderen.« Frau Bollmann blickt von einem Tisch zum anderen, knetet ihre Finger, nestelt in ihrem Haar herum. »Irgendwo muss sie doch sein, hat niemand sie über den Flur gehen sehen? In den Waschraum, nach draußen, irgendwohin?«
Schweigen.
»Oleg, Patrick. Yuki und Fiona. Hat es Streit gegeben, könnte Valerie deshalb vielleicht abgehauen sein?«
»Ist längst alles beigelegt«, meint Oleg. Die Lehrerin sieht nicht, dass er Patrick unter dem Tisch auf den Fuß tritt. Er und die beiden angesprochenen Mädchen nicken. Frau Bollmann wendet sich ihrem Kollegen Corvin Schwarze zu.
»Dann du«, sagt sie. »Hat sie sich bei dir abgemeldet?«
Schwarze schüttelt den Kopf. Er sieht zur Tür, blickt aus dem Fenster, dreht sich nach hinten, Frau Bollmann bemerkt ein unruhiges Flackern in seinen Augen.
»Tja, dann bleibt uns nichts weiter übrig als abzuwarten«, beschließt sie, greift nach der Schüssel mit dem Rührei und nimmt sich eine Scheibe Toast aus dem Halter. Ihre Hände zittern leicht, als sie ihn mit Butter bestreicht. Wie ihr Kollege blickt sie immer wieder zur Tür. Die Schüler fangen an zu essen, die meisten schweigend, einige Jungen versuchen mit gedämpfter Stimme Witze zu reißen, ernten jedoch einen Blick von ihrer Lehrerin, der sie augenblicklich stoppt. Irgendetwas stimmt nicht, das spürt hier jeder.
»Ich glaube, sie kommt«, flüstert Alena plötzlich, und auch die anderen lauschen zur Tür. Vom Flur her dringen Schritte nach innen, gleich darauf steht Mr Lewis im Saal, der Herbergsvater, noch hagerer, noch hohlwangiger, als er ihnen allen gestern Abend erschienen war. Im Türrahmen bleibt er stehen und verbeugt sich leicht.
»Es ist mir außerordentlich unangenehm, Sie beim Frühstück stören zu müssen«, beteuert er. »Aber ich habe Besuch mitgebracht. Leider scheint es keine erfreulichen Nachrichten zu geben. Bitte sehr, entschuldigen Sie mich. Ich muss mich einen Augenblick lang ausruhen.« Er gibt die Tür frei. Zwei uniformierte Polizisten treten ein.
Die Schüler erstarren in der Bewegung, Löffel fallen in die Cornflakesschüsseln zurück, eine Kanne wird lauter als beabsichtigt auf den Tisch gestellt. Der Ältere von beiden ergreift das Wort.
»Guten Morgen«, beginnt er. »Ich komme ohne Umschweife zur Sache. Am Strand unter den Klippen von Beachy Head wurde ein Mädchen gefunden, ungefähr siebzehn bis zwanzig Jahre alt, regenfest gekleidet und schwer verletzt. Sie lag bereits seit Stunden dort, den ärztlichen Untersuchungen zufolge ist sie von der Steilküste gestürzt worden. Ein Jogger hat sie am frühen Morgen aufgespürt. Ist es möglich, dass sie in Ihre Klasse gehört?«
Alena steht auf, das Gesicht weiß. »Valerie«, stößt sie hervor und beginnt laut und hemmungslos zu weinen.
»Wo ist sie?«, brüllt Manuel und springt ebenfalls auf. »Das Schwein mache ich kalt, der meine Freundin auf dem Gewissen hat!«
Frau Bollmann sitzt regungslos auf ihrem Stuhl, starrt vor sich hin, greift nach der Hand ihres Kollegen, doch der entzieht sie ihr.
»Was ist mit Valerie?«, fragt er im Flüsterton. »Lebt sie noch? Bitte, sagen Sie mir, ob sie noch lebt!«
Der Polizist prüft ihn mit einem langen Blick.
»Als der Rettungswagen kam, war sie nicht ansprechbar, atmete aber noch schwach«, erklärt er. »Sie wurde auf dem schnellsten Weg in ein Krankenhaus gebracht. Mehr kann ich nicht sagen. Sie bleiben bitte alle hier«, betont er, als Manuel auf die Tür zusteuern will. »Im Moment können Sie dem Mädchen nicht helfen, außerdem brauchen wir Sie für unsere Ermittlungen.«
Manuel setzt sich wieder, flucht leise. Durch den Saal geht ein Raunen, Fiona und Yuki werfen einander Blicke zu, starren dann auf die Tischplatte. Einige Mädchen brechen in Tränen aus, die Jungen rutschen auf ihren Stühlen herum.
»Beginnen wir gleich mit dem Wichtigsten«, sagt der jüngere der Polizisten, er kann kaum älter sein als die beiden Lehrer. »Der Jogger, der sie fand, berichtete, das Mädchen habe ganz kurz die Augen geöffnet und etwas gesagt. Allerdings war es schwer zu verstehen und gleich darauf verlor sie erneut das Bewusstsein. Aber vielleicht können Sie uns sagen, was dieses Wort zu bedeuten hat.«
Herr Schwarze springt auf, stützt sich an der Tischplatte ab, neigt sich nach vorn.
»Was?«, keucht er. »Was hat sie gesagt?«
Der Polizist räuspert sich. Im Saal wird es so still, dass jeder seiner Atemzüge zu hören ist. Jeden Einzelnen blickt er an, die Schüler kommen sich vor, als wäre eine Kamera mit Superzoom auf sie gerichtet und würde jede ihrer Regungen registrieren. Manuels Zorn, Alenas Fassungslosigkeit, Yukis leeren Ausdruck in den Augen, Fionas Kopfschütteln, Olegs Kauen auf der Unterlippe, Frau Bollmanns in Falten gelegte Stirn, Schwarzes Blässe.
Der Polizist räuspert sich erneut.
»Es war ein Name«, sagt er …
1.
Zurück nach Hause, ich will noch nicht. Abgesehen vom Konzert habe ich fast nichts von England gesehen, aber leider reicht mein Geld nicht für mehr, außerdem ist dies das letzte Wochenende in den Sommerferien. Es war schon schwierig genug, meine Eltern zu bearbeiten, dass sie mich fliegen lassen, noch dazu allein. Aber zum Open-Air-Konzert von Black Hour wollte sonst niemand, und so schwer ist es schließlich nicht, mit siebzehn Jahren einen Flug zu buchen und sich übers Internet schon im Voraus ein Bett in einer Jugendherberge zu sichern. Der Weg zum Konzert war dann nur noch ein Kinderspiel.
In London ist es auch am Tag nach dem Konzert noch heiß. Auf dem Weg zum Flughafen Heathrow habe ich das Gefühl, der Asphalt gibt nach unter meinen Füßen, wellt sich unter der Sonnenglut, reflektiert in der Mittagshitze; trotz der leichten Sandalen glühen meine Füße. Seit zehn Tagen steht ein Azorenhoch über ganz Europa, ein Sommer, den man ausnutzen muss, unbedingt. Ich möchte noch bleiben, in einem Straßencafé etwas Kaltes trinken, auf eigene Faust die Stadt erkunden, flippige Mode kaufen, ausgefallenen Schmuck und Schuhe, die man zu Hause nicht an jeder Straßenecke sieht. Später vielleicht weiterreisen, die englische Südküste entlang bis nach Cornwall, wo ein beinahe mediterranes Klima herrschen soll. Selbst Palmen gedeihen dort und bieten einen Kontrast zu den jahrhundertealten Herrensitzen, die immer wieder als Schauplätze tiefgründiger Kriminalfilme mit zwielichtigen Charakteren dienen. Einsame Strände finden, im Atlantik baden, der trotz der Augusthitze nicht mehr als sechzehn oder siebzehn Grad haben wird; alles, was abkühlt, tut gut. Abends Fisch essen in einem der kleinen Dörfer, die sich in die Steilküste schmiegen, ein erfrischendes Bier in einem Pub trinken, meine Sprachkenntnisse anwenden und vertiefen, alles ausprobieren, es würde mir nichts ausmachen, allein zu sein. Im Gästezimmer einer grauhaarigen Landlady übernachten, auf durchgelegener Matratze und mit einer Steckdose für den Föhn, für den ich erst noch einen Adapter kaufen müsste.
Ganz in Gedanken summe ich meinen Lieblingssong von Black Hour vor mich hin, ich bin noch gar nicht richtig wieder bei mir, bin noch erfüllt von dieser Super-Band. Seit gestern Abend fühle ich eine noch tiefere Verbindung zu ihrer Musik als vorher; jede Textzeile, jeder Ton schien genau das auszudrücken, was ich selbst gerade fühlte und was eigentlich schon seit Jahren in mir brennt. Diese Sehnsucht nach Freiheit, nach Unabhängigkeit, aber auch nach einer tiefen Liebe, die das andere trotzdem nicht ausschließt. Diese Liebe muss es doch geben! Es kann nicht sein, dass immer nur eines von beidem möglich ist. Immer wieder haben die Songs von Black Hour davon erzählt, und da stand ich an diesem unglaublich lauen Sommerabend auf dem Open-Air-Konzertgelände und konnte es kaum glauben, dass diese vier Jungs aus Norwegen genau das in ihre Mikrofone hauchen und schreien und ihren Gitarren entlocken, was in mir vorgeht. Es war, als hätten sie nur für mich gespielt. Mein Innerstes in Rockmusik verwandelt. Wir verstehen dich, Valerie; halte durch, uns geht es genauso, wir träumen denselben Traum wie du, eines Tages wirst du finden, was du suchst.
Die U-Bahn hält am Flughafen und scheint die Reisenden auszukippen, mein Top klebt mir am Rücken, auf dem Bahnsteig steht die Luft genauso wie in der Bahn. Ich schwimme mit dem Strom in die Abfertigungshalle, suche an der Anzeigetafel nach der Flugnummer, finde den richtigen Schalter und stelle mich ans Ende der Warteschlange. Es hat keinen Sinn, weiter von England zu träumen, von einem längeren Urlaub hier, nächstes Jahr vielleicht, mit achtzehn, wenn ich selber Auto fahren kann. Jetzt muss ich nach Hause, in drei Tagen beginnt die Schule wieder; in diesem Jahr lagen unsere Sommerferien früh, wie so oft in Berlin. Im seitlichen Reißverschlussfach meiner Reisetasche finde ich mein Ticket und halte es bereit. Es dauert noch, bis ich an der Reihe bin, aber ich fühle mich sicherer, wenn ich schon vorher alles zur Hand habe.
Zurück nach Hause, back to school. Zur Schule, wo auch Manuel ist, mit dem ich zu Beginn der Ferien Schluss gemacht habe. Die Aussicht, ihn wiederzusehen, liegt mir schon jetzt wie ein unverdauter Fleischklops im Magen. Vor allem auf das Spießrutenlaufen bei den anderen habe ich keine Lust. Niemand hat verstanden, warum ich nicht mehr mit Manuel zusammen sein wollte, es nicht mehr konnte, in der Schule haben wir als Traumpaar gegolten. Aber ich hatte schon lange gewusst, dass es nicht mehr reichte. Ich wollte mich nicht mehr fremdbestimmen lassen, schon gar nicht von einem Jungen. Manuels ständiges besitzergreifendes Verhalten hatte für mich so wenig mit Liebe zu tun; einmal mehr hatte ich gespürt, dass es ihm überhaupt nicht um mich als Person ging, nicht um meine Bedürfnisse, sondern nur um ihn. Ich hatte ihm zur Verfügung zu stehen, egal, wie ich selber gerade drauf war, etwas anderes ließ er nicht gelten. Er bestimmte, was wir gemeinsam unternahmen, wen wir trafen, wohin wir gingen, ob wir bei mir übernachteten oder bei ihm oder ob jeder zu sich nach Hause ging.
Unser letzter gemeinsamer Nachmittag hatte mir dies noch einmal bestätigt.
Ich habe damals ab und zu auf einen kleinen Jungen aufgepasst, den zweijährigen Willy. Den Job hatte ich über einen Zettel am Schwarzen Brett im Supermarkt gefunden. Bisher war immer alles gut gegangen, ich mochte den Kleinen wirklich gern und auch mit seiner Mutter habe ich mich immer super verstanden. Aber an diesem einen verflixten Tag war Willy mit seinem Bobbycar an einer unebenen Stelle im gepflasterten Hof umgekippt und aufs Gesicht gefallen. Seine Lippe war aufgeplatzt und hatte geblutet, an Stirn und Wangen hatte er Schürfwunden erlitten, und eine dicke Beule an der Stirn war schneller zu einem ausgeprägten Horn angewachsen, als ich ihn auf den Arm nehmen und in die Wohnung tragen konnte. Willys Schreie hallten durchs ganze Treppenhaus, und obwohl ich die Blutungen schnell stillen und den Kleinen trösten konnte, machte ich mir Vorwürfe. Immerhin war das nur passiert, weil ich einen Moment lang nicht auf Willy geachtet, sondern eine SMS von Manuel beantwortet hatte. Als Willys Mutter von der Arbeit kam und ihn sah, warf sie mich sofort raus. Auf der Straße fing ich an zu heulen, weil ich mich so über mich selbst ärgerte, und hatte mich noch nicht ganz wieder beruhigt, als ich bei Manuel ankam.
Er sah meine Tränen und fragte, was los sei, doch als ich anfing, ihm alles zu erzählen, hörte er mir nicht zu, sondern fing gleich an, mir die Spaghettiträger von den Schultern zu streifen und mich zu küssen, Schultern, Hals, Brustansatz, er packte mich mit beiden Händen an den Hüften und drückte mich auf sein Bett.
»Laber mich nicht von diesem Zwerg voll, der ist völlig unwichtig«, hatte er gemurmelt und sich bereits am Reißverschluss meiner Jeans zu schaffen gemacht. Sein rechtes Knie auf meinem Oberschenkel hinderte mich daran, aufstehen zu können, sein linker Ellbogen bohrte sich schmerzhaft in meine Taille. »Jetzt bist du hier bei mir, das allein zählt, nicht dieser Winzling und seine verkorkste Alte. Du verschwendest da nur deine Zeit, das habe ich dir schon immer gesagt. Komm, mach dich locker, zieh dich aus, seit Stunden warte ich schon auf diesen Moment und dir wird es auch gut tun.«
»Mir ist nicht danach«, habe ich geantwortet, erst mal noch ruhig. »Merkst du das nicht?«
»Ich werde schon dafür sorgen, dass dir doch danach ist.« Manuel hörte nicht auf, versuchte seine Hand unter mein Top zu schieben, aber vor meinen Augen tauchte immer wieder Willys blutendes Gesicht auf, der wutverzerrte Mund seiner Mutter, ich konnte nicht so schnell umschalten. Ich schlief nicht gern mit Manuel, meist tat er mir weh, und wenn ich es ihm sagte, meinte er bloß, meine Wahrnehmung sei gestört, er wüsste, wie man ein Mädchen befriedigt. An diesem Nachmittag konnte ich nicht mehr darüber hinwegsehen und hoffen, dass ich irgendwann vielleicht noch Gefallen an seiner wenig einfühlsamen Art finden würde. Nicht, wenn ich in aufgelöster Stimmung zu ihm kam. Und schon gar nicht sofort.
»Komm schon«, hatte er noch einmal gesagt und so getan, als merkte er nicht, wie steif ich mich machte und dass ich das, was er unter Zärtlichkeiten verstand, nicht erwiderte. Er saugte sich an meinem Hals fest, zog mir die Hose herunter, versuchte sich auf mich zu schieben. »Ich halte es sonst nicht mehr aus. Du liebst mich doch, Valerie, du willst mich doch auch spüren. Du gehörst mir doch.«
Er machte mir Angst; nicht zum ersten Mal spürte ich, dass er sich nicht bremsen und mir damit gefährlich werden konnte. Ich mobilisierte meine letzten Kräfte, stieß ihn von mir und sprang auf.
»Weißt du was, Manuel – das hier halte ich nicht mehr aus!«, zischte ich. »Wie kann man so unsensibel sein, das ist widerlich. Ich will das nicht mehr. Es ist vorbei mit uns.«
Dann stürmte ich nach draußen. Feuchte, schwere Gewitterluft empfing mich auf der Straße und kurz darauf krachten auch schon die ersten Donner los. Sekunden später war ich völlig durchnässt, doch ich rannte die ganzen fünf Kilometer bis nach Hause, und wenn ich außer Puste war, blieb ich kurz stehen und legte den Kopf in den Nacken, um den Regen zu trinken. Mit jedem Schritt, der mich weiter von Manuel entfernte, spürte ich die Gewissheit, das Richtige getan zu haben. Endlich war ich frei, niemand würde mehr über mich, über meine Zeit, meinen Körper verfügen, über meine eigenen Sehnsüchte und Wünsche hinwegbrettern, nur um sich selbst irgendeine fragwürdige Art von Macht und Stärke zu beweisen. Endlich konnte ich tun und lassen, was ich wollte, auf mich selbst gestellt in den Tag hinein leben, wenn mir danach war, oder mich verabreden, wenn ich lieber mit anderen zusammen sein wollte! Niemanden mehr würde es geben, der mich als seinen Besitz ansah, der zu Beginn der Pausen schon vor der Tür des Raumes stand, in dem ich Unterricht hatte, um sofort nach dem Klingeln hereinzukommen, den Arm um meine Schulter zu legen und mich herumzuführen wie eine Trophäe, die er allen zeigen musste, und der am Ende des Schultages festlegte, was wir am Nachmittag oder Abend tun würden. Nie mehr würde Manuel die Möglichkeit dazu haben, denn ich hatte mich endlich von ihm befreit.
Seither war ich froh, keinen Freund zu haben, schon gar keinen aus der Schule, wo man sich viel zu oft sieht, und, was noch belastender ist: wo man einander nicht aus dem Weg gehen kann, nachdem es aus ist.
Zum Glück hat Manuel andere Leistungskurse als ich; trotzdem werden wir uns natürlich fast jeden Tag über den Weg laufen. Dabei hat es mir schon gereicht, was er in den Ferien abgezogen hat. Ständig schrieb er mir SMS, zuerst noch eher belanglose unter irgendwelchen Vorwänden, später wurde er aggressiver, unterstellte mir, mit anderen Jungs herumgemacht zu haben, nur weil einer seiner Freunde gesehen hatte, wie ich mich im Freibad mit jemandem unterhalten habe. Manchmal stand er stundenlang vor unserer Haustür und ließ den Motor seiner Kawasaki im Leerlauf tuckern, bis nicht nur ich, sondern auch meine Eltern und unsere Nachbarn fast wahnsinnig wurden. Statt mich in Ruhe zu lassen, klingelte er bei uns Sturm, bis mein Vater ihm mit der Polizei gedroht hat. Dass er mich mit einem solchen Verhalten erst recht abstößt, begreift er nicht. Mich hat die Bedrängnis durch ihn völlig fertiggemacht, denn nachdem mich die Mutter des kleinen Willy entlassen hatte, hatte ich mir für die Ferien einen Job in einem kleinen Café gesucht und kam abends oft todmüde nach Hause. Wenn ich dann auch noch vor der Aufgabe stand, Manuel loswerden und zugleich meine Eltern beschwichtigen zu müssen, hatte ich das Gefühl, verrückt zu werden.
Von meiner Freundin Alena erfuhr ich dann sogar, dass Manuel mit seinen Kumpels schlecht über mich redete; die verklemmte Valerie, eine Niete im Bett, nicht schade drum, nur um dann doch wieder anzurufen und mich zu beschimpfen, weil ich mit ihm Schluss gemacht habe.
Leider war mir Alena selbst auch keine echte Hilfe. Sie hat nicht verstanden, dass ich nach der unglücklichen Geschichte mit Manuel erst mal Zeit für mich brauchte, viel allein sein wollte, ich war innerlich wund, fühlte mich in jeder Hinsicht benutzt und ausgelaugt, wollte erst mal zur Ruhe kommen. Aber wenn nicht Manuel mir nachstellte, tat sie es, wollte mich pausenlos zu allen möglichen Aktivitäten mitschleppen, zum Zelten fahren, DVD-Abende veranstalten, tanzen gehen, bei mir übernachten. Jeden Tag rief sie an oder kam vorbei, immer mit einer anderen Idee, bis sie dann schließlich für zehn Tage mit ihrer älteren Schwester nach Kroatien in Urlaub fuhr. Dieses Wochenende kommt sie zurück, aber mir zieht sich der Magen zusammen bei dem Gedanken, gleich wieder so von ihr vereinnahmt zu werden. Dieser Trip nach London war wie eine Befreiung von allen Zwängen für mich. Ich will noch nicht zurück, ich will nicht, dass gleich wieder alle an mir zerren.
Jemand rempelt mich von hinten an und reißt mich aus meinen Gedanken, mindestens sieben Leute sind noch vor mir in der Schlange, irgendjemand muffelt aufdringlich nach Schweiß, aber ich dufte bestimmt auch nicht gerade nach Rosen in der stickigen Luft hier. Das neue Black Hour-Trägertop, das ich mir beim Konzert am Merchandising-Stand gekauft habe, muss zu Hause gleich in die Wäsche.
Black Hour. Diese Leidenschaft hat Manuel nie mit mir geteilt. Ihre melancholischen und doch so eindringlichen Songs, oft mit zarten Gitarrenklängen und einer wie von weit her wehenden Stimme beginnend, um dann anzusteigen … Hakon, der Sänger, versteht es wie kein anderer, mich mit seiner kraftvollen, verzweifelt heulenden oder flehend wispernden Stimme mitzureißen, mich wegfliegen zu lassen, bis ich eins bin mit der Musik, den melodischen Bassläufen und Gitarrenriffs. Jedes Mal ist es wie ein Rausch. Manuel hört am liebsten Hip-Hop, wie die meisten aus unserer Schule, die Jungs jedenfalls. Ich nehme es ihnen nicht übel. Black Hour ist keine Band, die die Charts stürmt, sondern eher ein Geheimtipp unter Liebhabern. Spezieller, etwas düsterer Independent Rock, kein Mainstream.
Meter für Meter schiebe ich meine Reisetasche mit dem Fuß voran; auf die Dauer ist sie doch schwer, auch wenn sie als Handgepäck durch die Kontrolle passt. Irgendwo spielt jemand Gitarre oder hat seinen Gettoblaster aufgedreht, um sich die Wartezeit zu vertreiben. Die Akkordfolge erinnert mich an meinen Lieblingssong von Black Hour, sie kommt doch nicht aus der Dose, jetzt höre ich es genau, muss unwillkürlich lächeln und drehe mich um. Ein paar Meter hinter mir sitzt ein junger Typ mit dunkelblonden Wuschelhaaren und im schwarzen Shirt, verwaschener Jeans und Chucks auf seinem Gepäck und vertreibt sich die Wartezeit mit Gitarrespielen. Gute Idee eigentlich. Er scheint ganz versunken, sein gesamter Körper geht mit dem Beat mit, den sein rechter Fuß als Rhythmus vorgibt, und unwillkürlich fange auch ich an, im Takt mitzuwippen. Jetzt hat er mich bemerkt und grinst mich an, ich kann gar nicht anders als zurückzugrinsen, sein Blick ist so frech, so unbekümmert, aber seine braunen Augen tauchen in meine, so intensiv, dass ich mich abwenden muss. Dennoch lausche ich weiter seinem Gitarrenspiel, jetzt verlässt er den Song von Black Hour, um mit einigen raffinierten Übergangsakkorden zu etwas Anderem, Unbekanntem überzuleiten, einer Eigenkomposition vielleicht, bestimmt schreibt er auch selber Songs. Ich schrecke wieder auf und sehe zu ihm hin, denn jetzt beginnt er zu singen, seine Stimme passt zu ihm, nicht zu tief, aber auch kein Tenor, er singt klar und gefühlvoll, nicht einmal besonders laut, wie für sich selbst und vielleicht für mich, denn er sieht mich immer noch an. Sonst scheint kaum jemand Notiz von ihm zu nehmen. Er singt über eine Liebe, die nicht sein darf und die trotzdem schön ist, unerfüllt, die Sehnsucht noch nährend in ihrer Aussichtslosigkeit.
I can’t
I don’t even want to
I never would
It only destroyed
But after all
I have seen you
You have touched me
Without even laying a finger on my skin
Dieser Text. Dieses Lied. Mir wird schwindlig, und nicht nur von der Hitze und dem Durst, der von meiner Kehle Besitz ergreift. Mir ist schwindlig vor Sehnsucht nach jemandem an meiner Seite, nach Übereinstimmung, nach gegenseitigem Verstehen ohne viele Worte. Vielleicht hätte ich Manuel noch eine Chance geben, in Ruhe mit ihm reden sollen, fährt es mir durch den Kopf. Ihm klar machen, was mich an unserem letzten Tag so gestört hat. Ihn nicht so schnell fallen lassen. Übereinstimmung suchen. Der Musiker auf dem Flughafen und ich lächeln uns wieder an, gleichzeitig taucht Manuels Gesicht vor mir auf, und in derselben Sekunde weiß ich, dass ich diese Übereinstimmung bei ihm nie hätte finden können.
Verstohlen beobachte ich den Typ weiter, mehr aus dem Augenwinkel, unwillkürlich streiche ich über meine glatten Haare, um sie ein wenig zu richten, einige Strähnen fühle ich von der Hitze im Nacken kleben. Er hat schöne Zähne, weiß, dicht beieinander stehend und gründlich gepflegt. Krampfhaft versuche ich, nicht sofort wieder zu ihm zu schauen, tue so, als suche ich etwas in meiner Tasche, meiner kleinen Lieblings- Umhängetasche aus hellbraunem Wildleder mit Fransen an der Unterseite, die mir Alena mal auf dem Flohmarkt geschenkt hat, weil sie meinte, die passe so gut zu mir. Immer wieder musste ich ihr damals bestätigen, wie gut mir die Tasche gefalle, und beinahe hätte mir diese Penetranz die Freude daran verdorben, aber die Tasche ist so schön, dass ich irgendwann einfach beschloss, mir die Freude nicht nehmen zu lassen.
Ich nehme mein Lipgloss heraus und fahre damit über meine Lippen; Dummchen, sage ich im Stillen zu mir selbst; kaum strahlt dich einer an und klimpert ein bisschen auf seiner Gitarre herum, legst du hier das typische Weibchenverhalten an den Tag; jetzt nur noch ein bisschen am Ausschnitt nesteln, und das Klischee ist perfekt. Hör auf damit.
Aber ich muss wieder hinsehen, sein Lächeln erwidern. Er ist wie ein Magnet.
»Junge Frau«, höre ich plötzlich den älteren Mann, der mich vorhin von hinten angerempelt hat. »Sie sind an der Reihe. Träumen können Sie auch noch über den Wolken.«
»Entschuldigung«, stoße ich hervor und trete nach vorn vor den Schalter, wo die Bodenstewardess mir das Ticket aus der Hand nimmt und einen Blick darauf wirft, ehe sie mir lächelnd die Bordkarte überreicht und einen guten Flug wünscht. Ehe ich durch die Sperre trete, drehe ich mich noch einmal nach dem jungen Musiker um; er hat aufgehört zu spielen und bückt sich, legt seine Gitarre in den Gitarrenkoffer, lässt die Schlösser zuschnappen. Als er sich wieder aufrichtet, zwinkert er mir zu, und dieses Zwinkern durchfährt mich wie ein Stromstoß, löst ein Glücksgefühl in mir aus, ein Gefühl von Befreiung, als würde jemand nach einer langen, dunklen Nacht das Fenster aufreißen und den ganzen Frühling auf einmal hineinlassen. Er sitzt im selben Flieger, denke ich, und kann nicht aufhören, vor mich hin zu grinsen. Er wohnt auch in Berlin.
Ich gehe durch die Passkontrolle, im Wartebereich ziehe ich mir einen Becher Orangensaft aus dem Automaten und suche mir einen Platz. Ein letztes Mal vor dem Abflug ziehe ich mein Handy aus der Tasche, um nach Nachrichten zu schauen, zögere, als ich sehe, dass eine SMS von Alena eingegangen ist. Eigentlich will ich noch nichts von ihr lesen, noch bin ich hier, allein mit mir selbst und all den Eindrücken, die noch so lebendig in mir sind, die ich ohnehin niemandem so vermitteln könnte, wie ich sie empfinde. Ich will nicht lesen, dass ich Alena heute noch anrufen oder gar treffen soll. Das kommt alles noch früh genug.
Dann öffne ich den virtuellen Briefumschlag doch. Vielleicht ist es dringend. Ich hätte es nicht tun sollen.
Kann kaum erwarten dich zu sehen, lese ich. Manuel dreht ziemlich am Rad. Vielleicht redest du doch noch mal mit ihm, ich glaube das braucht er.
Genervt stöhne ich auf, eine Antwort fällt mir nicht ein, diese SMS macht alles kaputt. Ich will mir nichts kaputt machen lassen, nicht jetzt, nicht so. Ich drücke die Ausschalttaste und stecke das Handy wieder ein.
2.
Der Aufruf zum Boarding. Ich drehe mich um, er ist wieder da, ist jetzt auch im Wartebereich angelangt, zwinkert mir wieder zu, als sich unsere Blicke treffen. Ich fühle mich, als könnte ich auf einem Sonnenstrahl reiten, greife mir unwillkürlich an den Hals, um nicht vor Glück zu schreien, schaue schnell wieder weg, halte meine Bordkarte für den Einstieg bereit, reihe mich in die Schlange zur Gangway ein. Ich glaube, er ist schon älter, zehn Jahre vielleicht oder sogar etwas mehr, trotzdem scheint er ähnliche Musik zu mögen wie ich. Ich bin ihm auch sympathisch, aber es geht nicht, es ist noch zu früh für neues Herzklopfen. Dabei pocht es schon wie ein Specht vor dem Nestbau im März.
Reihe 16, Platz A am Fenster. Bei diesem Wetter kann man die Welt von oben sehen, das liebe ich so am Fliegen, verfolge schon jetzt das Treiben auf dem Rollfeld. Als ich kleiner war, habe ich auf Flugreisen mit meinen Eltern immer die Swimmingpools in den Gärten unter mir gezählt, bis die Spielzeuglandschaft von den Wolken verschluckt wurde; heute lasse ich meist einfach meine Gedanken treiben. Zwischen den beiden Tagen in England und zu Hause liegt immer noch der Flug. Manuel dreht ziemlich am Rad. Ich will nicht an ihn denken. Sorgfältig schiebe ich meine Reisetasche in die Gepäckklappe und setze mich auf meinen Fensterplatz.
»Hallo, Black-Hour-Freundin«, tönt plötzlich eine fröhliche, klare Stimme über mir. Ich muss nicht aufschauen, um zu begreifen, zu wem sie gehört; natürlich tue ich es doch. Die Gitarre hat der Mann nicht mehr bei sich, natürlich hat er sie als Gepäckstück aufgeben müssen, er schiebt nur eine Umhängetasche aus abgeschabtem braunem Leder unter den Sitz neben meinem, dann setzt er sich hin. Neben mich. Ich glaube es nicht, er hat wirklich den Platz neben mir! Erst jetzt bemerke ich, dass sein T-Shirt den gleichen Aufdruck hat wie meines, der unauffällige, aber typische Schriftzug von Black Hour in Weiß auf schwarzem Jersey, die Tourdaten in Rot auf dem Rücken. Also war er auch beim Konzert. Vorhin muss seine Gitarre das Logo verdeckt haben oder es ist mir einfach nicht aufgefallen. Auf meinem Shirt hat er natürlich den Rückenaufdruck erkannt, vielleicht lange, bevor ich ihn überhaupt bemerkt habe.
»Das konnte ich mir nicht entgehen lassen«, antworte ich. »War sagenhaft, oder?«
Er nickt und fährt sich mit der Hand durch sein immer noch leicht zerzaust wirkendes Haar. Erst jetzt sehe ich, dass es sich am Ansatz schon ein klein wenig zu lichten beginnt, ganz leicht, man sieht es nur, wenn man ganz genau hinblickt, mir fällt es eher auf an der Art, wie er es zu verbergen versucht. Wie liebenswert; er müsste das nicht machen, er sieht ohnehin gut aus, und es ist wirklich nur minimal.
»Die Stimmung im Park, die Musik, das Wetter – alles war so perfekt«, schwärmt auch er und atmet tief durch im Genuss der Erinnerung. »Bist du ein Fan von Black Hour oder machst du auch selber Musik und wolltest die Einflüsse auf dich wirken lassen?«
»Das Wort Fan passtnicht zu mir«, gestehe ich etwas verlegen. Ich will nicht, dass er mich für einen Teenie hält, der sich in der ersten Reihe direkt vor der Bühne die Stimmbänder kaputt kreischt und die Wände im Kinderzimmer mit Posters tapeziert hat. »Ichliebe die Musik und die Texte. Manchmal habe ich das Gefühl, sie hätten beim Songschreiben direkt in meine Seele geschaut.«
»Das denkst du auch?« Eben hat er noch gelächelt, nun sieht er mich mit geweiteten Augen an, scheint mich erst jetzt richtig wahrzunehmen. Anders als vorher. Ernster. Aufmerksam.
»Ja.« Ich nicke. Warum ist mein Mund nur so trocken? »Sag bloß, du auch.«
Er öffnet seinen Mund, als wolle er etwas hinzufügen, lässt es jedoch, schüttelt ganz leicht den Kopf, als müsse er einen Gedanken verscheuchen.
Jetzt erkenne ich, dass seine Zähne doch nicht ganz makellos sind, der zweite linke Schneidezahn steht ein klein wenig schräg nach vorn, kein Zahnpastawerbungslächeln, nicht ganz perfekt. Unverwechselbar und dadurch noch attraktiver. Du hast keine Chance bei ihm, beschwöre ich mich im Stillen; sicher steht er auf Frauen in seinem Alter statt auf Mädchen, die nicht mal volljährig sind.
Er räuspert sich.
»Aber jetzt sag«, greift er den Faden erneut auf, seine Stimme klingt rau, bestimmt hat er genau so großen Durst wie ich. »Du spielst doch bestimmt auch ein Instrument. Oder lass mich raten: Du singst. Oder du schreibst Texte. Wenn du so genau zuhörst, dich mit den Texten deiner Lieblingsband beschäftigst, steckt bestimmt auch in dir etwas Kreatives.«
Ich schüttele den Kopf und winke ab. »Ich schreibe nur ab und zu ein paar Gedichte – man kann sie nicht mal so nennen. Es sind mehr Gedankenfetzen; alles Mögliche, was mir gerade so durch den Kopf geht. Also wirklich nichts Besonderes. Und manchmal singe ich; aber nur, wenn ich genau weiß, dass mir niemand zuhört. Auch nicht so toll, glaube ich. Aber ich liebe es einfach, ich drücke gern meine Stimmung in Musik aus.«
»Sag nie, dass es nicht gut ist, was du machst.« Er taucht seine Augen in meine. »Wenn die Worte aus deinem Inneren kommen, sind sie etwas Wertvolles. Und ich sage dir auch, dass du singen kannst, ohne dich je gehört zu haben.«
»Wie kannst du so sicher sein?«
»Du hast eine überaus angenehme Sprechstimme«, meint er. »Wer beim Reden gut klingt, tut es auch beim Singen. Das sind Dinge, die man nicht lernen kann, man hat sie oder man hat sie nicht. Natürlich kannst du deine Stimme noch ausbilden lassen, aber die Grundbegabung ist sicher da.«
Ich mache eine abwehrende Handbewegung, heftiger, als ich beabsichtigt habe, er ist so dicht neben mir, ganz nah, er macht mich nervös, in mir kribbelt alles, noch nie habe ich so etwas gefühlt, schon gar nicht neben einem Fremden.
»Aber du, mit deiner Gitarre vorhin«, werfe ich ein, um von mir abzulenken. »War der letzte Song von dir?«
Er lacht leise. »Ganz schön schmalzig, oder?«
»Überhaupt nicht!«, beeile ich mich zu versichern, verschlucke mich an meinem eigenen Speichel oder huste wegen der trockenen Luft, lehne mich zurück und versuche, meinen Atem wieder mit mir selbst in Einklang zu bringen. Er bückt sich nach seiner Tasche und fischt eine Tüte Eukalyptusbonbons heraus, reicht mir einen.
»Der ist auch gut gegen den Druck auf den Ohren«, meint er. »Es geht gleich los.«
Ich wickele das Bonbon aus und schiebe es mir in den Mund. »Ich fand deinen Song nicht schmalzig«, versichere ich erneut, »Diesen Vers, wo jemand einen anderen berührt hat, ohne ihn … oder sie …«
»Anzufassen.« Wieder ruhen seine Augen auf meinem Gesicht, von seinem Lachen sind unter seinen Augen vereinzelte erste Linien stehen geblieben, noch ganz fein und kaum wahrnehmbar, vorhin in der Abfertigungshalle habe ich sie noch nicht bemerkt.
»Genau. Das hat mich angesprochen, genauso empfinde ich auch.«
»Tatsächlich?« Er lässt seine Augen über mein Gesicht wandern, als ob er es behutsam abtastet, wirkt beinahe andächtig, als hätte er eine Kostbarkeit entdeckt, die er nun sorgfältig und liebevoll untersucht. So hat mich noch nie jemand angesehen, aber ich kann auch nicht aufhören, ihn anzusehen, kann mich nicht dagegen wehren. »Wir scheinen so einiges gemeinsam zu haben.«
»Total verrückt.« Aus meiner Kehle kommt nur ein Flüstern, ich will noch etwas hinzufügen, atme ein, fühle, wie sich mein Puls beschleunigt. So was passiert nur ganz, ganz selten, fährt es mir durch den Kopf; hier ist er also, so fangen Beziehungen an, die das ganze Leben verändern.
»Verrätst du mir, wie du heißt?«, fragt er, die Stimme einfühlsam, interessiert, nicht forschend oder bohrend, vielleicht ahnt er, was in mir vorgeht.
»Valerie«, sage ich und streife ihn mit einem flüchtigen Lächeln, ehe ich meinen Blick auf die Stewardess richte, die am Ende des Ganges mit sicherem Lächeln und geübten Bewegungen die Sicherheitsvorkehrungen der Maschine erklärt, während diese bereits langsam auf die Startbahn zurollt.
»Valerie«, wiederholt er und beginnt den gleichnamigen Song von Amy Winehouse zu singen, die Leute tun das immer, wenn ich mich vorstelle, aber bei ihm klingt es nicht albern, er will mich damit nicht aufziehen. Mit den flachen Händen schlägt er einen Beat dazu auf seine Oberschenkel, ist schon wieder versunken in der Musik, ich singe leise mit, dann lachen wir beide und er lässt seine Hände wieder sinken.
»Ein schöner Name«, bekundet er schließlich. »Ich bin Corvin.« Unwillkürlich löse ich meine Augen von der Stewardess und wende ihm mein Gesicht zu. Corvin. Den Namen habe ich noch nie gehört, aber er passt zu ihm, zu seinen warmen Augen, dem offenen Blick, zu seinem breiten, fröhlichen Lächeln. Als er sich anschnallt, fallen mir seine Hände auf, typische Gitarristenfinger, mit kurzen, sauber gefeilten Nägeln an der linken Hand und etwas längeren, aber ebenso gepflegten an der rechten, um optimal greifen und zupfen zu können. Bestimmt sind seine Hände immer warm.
Das Flugzeug hat die Startbahn erreicht und bleibt stehen, die Turbinen werden angeworfen und heulen auf. Ich liebe diesen Augenblick, in dem die Kraft der Maschine bereits zu spüren ist, den Moment, wenn die Schubkraft meinen Rücken in den Sitz drückt und das Flugzeug immer schneller wird, die erwartungsvollen Sekunden vor dem Abheben und dann dieses Gefühl, die Erde plötzlich unter sich zu sehen, zunächst noch schräg und in plötzlicher Stille ohne den Asphalt unter den Rädern. Das leichte Schwanken und die Neigung, wenn der Pilot eine Kurve fliegt. Gleich ist es so weit. Gleich.
Corvin räuspert sich.
»Goodbye, England«, sagt er. »Auf ein hoffentlich baldiges Wiedersehen.«
Wir heben ab; zuerst blicke ich nach draußen, doch als ich etwas nach hinten weiche, damit Corvin auch aus dem Fenster sehen kann, bemerke ich, dass sich seineFinger beim Start etwas verkrampft um die Armlehnen krallen, er scheint Flugangst zu haben. Sein Gesicht sieht jetzt selbst unter der leichten Sonnenbräune blass aus, auf seiner Stirn haben sich kleine Schweißperlen gebildet. Ich muss ihn ablenken, weiter mit ihm reden, vielleicht vergisst er dann seine Furcht.
»Reist du öfter nach England?«, frage ich also. »Oder bist du nur wegen Black Hour hergekommen?«
Corvin schließt die Augen und atmet tief durch, während sich das Flugzeug in einer leichten Linkskurve neigt. »Zwei Wochen war ich hier«, erzählt er. »Eine davon bin ich mit einem Mietwagen ein Stück die Südküste entlang gefahren, die zweite war ich in London, um an einem Musikworkshop teilzunehmen. England hat tolle unbekannte Bands; Light of The Roxy, Faith Failure, Steely Toes und so.«
»Steely Toes kenn ich auch«,bemerke ich erstaunt, denn diese Band ist bei uns noch unbekannter als Black Hour.
»Ehrlich?«, fragt er und sieht mich mit geweiteten Augen an, es funktioniert, sein Gesicht beginnt sich ein klein wenig zu entspannen. Zum Glück verläuft der Start ruhig, der Flieger gleitet sanft aufwärts, einige Passagiere schnallen sich schon ab, obwohl das Signal dazu noch nicht aufleuchtet. »Dabei sind sie außerhalb Englands kaum bekannt«, fährt Corvin fort. »Man muss schon ein wenig stöbern, um sie ausfindig zu machen, selbst im Internet. Aber der Leadgitarrist hat den Workshop geleitet, es war phantastisch, mit ihm zu arbeiten.«
»Vielleicht sollte ich doch mal anfangen, Gitarre zu lernen. Dann komme ich auch in den Genuss.«
»Mach das! Du hast bestimmt Talent. Noch toller sollen übrigens die unbekannten Bands in Los Angeles sein«, berichtet Corvin. »Ein Freund hat mir erzählt, er habe dort sagenhafte reine Frauencombos erlebt. Fast zu jeder berühmten Band gibt es Coverbands, und eben auch welche, in denen nur Frauen mitspielen. Die reißen unglaubliche Schlagzeug- und Gitarrensoli runter, da können wir uns hier nur verstecken.«
»L. A. muss sowieso grandios sein. Warst du jemals da?«
Corvin schüttelt den Kopf. »Das ist bisher noch ein Traum. Aber eines Tages werde ich ihn verwirklichen. Irgendwann, wenn alles drum herum stimmt.«
Was er damit wohl meint, überlege ich, will aber nicht weiterbohren. Nach Los Angeles – das wäre natürlich am Schönsten mit jemandem, der einem richtig nahe ist. Denke ich jedenfalls und frage mich zum ersten Mal, ob es in seinem Leben nicht jemanden gibt. Eine Frau. Sogar verheiratet könnte er schon sein, doch an seinen schönen Händen steckt kein Ring, der darauf hindeutet. Ich ertappe mich dabei, dass ich innerlich aufatme.
»Die Flugangst nimmst du in Kauf?«, frage ich weiter. »Über den großen Teich dauert es ja doch ein paar Stunden mehr.«
»Du hast mich erwischt«, lacht er. Dieses breite, fröhliche, ansteckende Lachen, diese offene, heitere Zuversicht und in nächsten Moment dieser tiefe, ruhige Blick, beides liegt bei ihm so nah beieinander. Keine distanzierte Höflichkeit, kein arrogantes Getue, nur weil er ein paar Jahre älter ist als ich. Corvin ist wie ein Freund, ich fühle mich einfach wohl an seiner Seite, obwohl wir uns gar nicht kennen.
»Die Flugangst überwinde ich schon«, fährt Corvin fort, jetzt wieder ernsthafter. »Das Leben ist zu kostbar, um nur das zu tun, worin man sich vollkommen sicher fühlt. Man muss auch mal was wagen.«
»Einfach mal ausbrechen«, füge ich hinzu, »und was ganz Verrücktes tun.«
Er lächelt verschmitzt. »Zum Beispiel?«
Mir fällt der duftende Sommerregen ein, der mich nach Hause begleitete, nachdem ich mit Manuel Schluss gemacht hatte. Das unbändige Freiheitsgefühl darin. In dem Moment hätte ich alles Mögliche angestellt. Trotzdem weiche ich aus, erzähle Corvin nichts davon.
»Dieser Trip zu Black Hour war schon Wahnsinn genug, weil ich den halben Sommer dafür gejobbt habe. Flug, Konzertkarte, Unterkunft … und dann ist es so schnell vorbeigegangen. Meine Eltern haben mich für verrückt erklärt.«
»Andere Mädchen hätten sich für das Geld Klamotten gekauft oder die Kohle ins Studium gesteckt. Aber du hast was erlebt. Ob du nun eine coole Jeans mehr oder weniger im Schrank liegen hast, spielt für dich doch sicher nicht halb so eine große Rolle.«
»Genau«, antworte ich und blicke verstohlen an mir herunter in der Hoffnung, dass ich ihm nicht zu einfallslos angezogen bin in meiner verblichenen Caprijeans, die ich zu dem Top vom Konzert trage.
»Das geht mir ganz genauso«, lacht er. »Du hast was gefühlt, Eindrücke mitgenommen, Erinnerungen gespeichert, die dir keiner mehr nehmen kann. Egal was passiert. Das ist es, was zählt.«
»Das hab ich mir auch gedacht. Ich bereue keine Sekunde.« Besonders diese hier nicht, füge ich in Gedanken hinzu; allein schon Corvin getroffen zu haben, war die ganze Mühe wert. Das Flugzeug ruckelt etwas, ich muss ihn ablenken, weiterreden.
»Erzähl mir mehr von dir«, fahre ich fort. »Hast du schon mal eine CD aufgenommen?«
»Nur so für mich, zu Hause«, antwortet er. Löst seine Hände, die sich schon wieder verkrampft hatten, beugt und streckt seine Finger. »Willst du was hören?« Er zieht einen MP3-Player aus seiner Hosentasche, stöpselt ein Paar Ohrhörer ein und reicht mir einen davon, ganz leicht berühren sich unsere Fingerspitzen dabei. Seine Hand ist warm, keiner von uns zuckt übereilt zurück, vielleicht nimmt auch er es wahr, das Besondere, diesen speziellen Zauber, der in unserer Begegnung liegt. Corvin beugt sich vor und lächelt ganz leicht, streicht mit dem kleinen Finger eine meiner Haarsträhnen zurück, um den Sitz des Ohrhörers zu überprüfen. Ich spüre seinen Atem auf meiner Wange, er riecht angenehm nach dem Eukalyptusbonbon, jetzt drückt er auf die Abspieltaste. Gleich darauf habe ich seine Stimme mitten in meinem Kopf, wie ein zärtliches Flüstern singt er zu mir, ohne Umwege dringen seine Worte und sein sanftes, sensibles Gitarrenspiel bis in mein Innerstes vor. Corvin blickt zur Seite, als ob es ihm peinlich ist, als fürchte er, bereits in meinem Gesichtsausdruck zu lesen, ob mir seine Musik gefällt. Aber da muss er sich keine Sorgen machen. Ich versuche auf den Text zu achten, der von Erinnerungen erzählt, von Sehnsucht, von Verletzlichkeit. Während ich weiter zuhöre, betrachte ich Corvin aus dem Augenwinkel, die schmalen, fast durchsichtigen Nasenflügel, die gut geformten Lippen, ich kann nicht anders, als mir diesen Mund beim Küssen vorzustellen, und schiebe den Gedanken doch wieder weit fort von mir. Nicht verlieben, sage ich mir, schon gar nicht so schnell, es wäre zu gefährlich, mich gleich wieder in dieses Gefühl fallen zu lassen, mich in einem Mann zu verlieren.
Rede noch mal mit Manuel, hat Alena geschrieben. Ich glaube, er braucht das. Vielleicht bin ich es ihm wirklich schuldig.
Unter gesenkten Wimpern wandern meine Augen weiter über Corvins Körper, während ich seiner Musik lausche. Er ist vielleicht einen knappen halben Kopf größer als ich und schlank, seine Knie in den ausgeblichenen Jeans stehen knochig hervor und die Oberarme unter dem Black Hour-Shirt wirken stark und sehnig, aber nicht zu muskulös. Mein Blick bleibt auf den Härchen auf seinen Unterarmen hängen, den bläulich schimmernden Adern, unwillkürlich stelle ich mir vor, darüber zu streichen.
Der nächste Song beginnt, erneut singt er von einer unerfüllten Liebe, ist es der Song, den Corvin vorhin auf dem Flughafen gesungen hat? Ich ertappe mich dabei, wie ich ihn mir mit einer Frau an seiner Seite vorstelle, irgendwo am Meer, die Arme um ihre Taille gelegt. Spüre Eifersucht in mir hochsteigen, vollkommen idiotisch, erst jetzt entdecke ich ein ausgeblichenes geflochtenes Lederband an seinem Handgelenk, vielleicht hat es ihm eine Frau geschenkt, eine, die er einmal sehr geliebt hat und nach der er in jedem seiner Lieder ruft, auch noch nach Jahren. Immerhin ist er allein nach England gereist und hat auch im Zusammenhang mit seinem geplanten USA-Trip von niemandem erzählt.
Hör auf, ermahne ich mich selbst, nachdem auch dieser Song verklungen ist, es geht dich nichts an, du kennst diesen Typen nicht mal, Valerie, er ist viel älter als du, und du weißt nichts über ihn, außer dass er dieselbe Musik mag wie du. Das muss gar nichts bedeuten. Davon abgesehen hat er sicher ganz andere Interessen, einen älteren Freundeskreis, Frauen und Männer, die abends französischen Rotwein trinken, Feinschmecker-Restaurants besuchen und über ganz andere Dinge reden als ich und die anderen Oberstufenschüler mit unserem Abistress, den Zukunftssorgen und unseren Partys, auf denen wir zu viele, viel zu süße Cocktails trinken, um uns wenigstens ab und zu von der Frage abzulenken, wie es nach dem Abitur und dem Führerschein weitergehen soll. Corvin hingegen hat bestimmt längst einen Beruf.
Das nächste Lied zeigt wieder Corvins fröhliche, unbekümmerte Seite, raffiniert hat er Elemente aus Funk und Soul einfließen lassen, tanzbar ist das. Doch danach folgt eine Ballade, die mich noch mehr mitreißt als alles, was ich vorher gehört habe. Er muss sie mit mehreren Tonspuren oder einer Band aufgenommen haben, der Stil ist rockiger, seine Stimme eindringlicher, kraftvoller, dann wieder beinahe flüsternd auf eine beschwörende Art, ein wenig düster. Ich spüre eine Gänsehaut über meinen Rücken kriechen. Was mag in ihm vorgegangen sein, als er dies geschrieben hat?
Starr ihn nicht so an, beschwöre ich mich selber, weil ich schon wieder beobachte, wie er sachte mit dem Fuß im Takt wippt. Ob er Erinnerungen nachhängt, die ihn dazu getrieben haben, diese Songs zu schreiben? Wenn es aus deinem Inneren kommt, ist es etwas Wertvolles, hat er gesagt, als ich meine paar Gedichte erwähnt habe. Dann gilt das auch für ihn. Es drängt mich, ihm irgendwie mitzuteilen, wie nah ich mich ihm fühle. Aber es ist besser, ich sage nichts.
3.
Das Flugzeug ruckelt leicht und sackt etwas ab, Corvin reißt die Augen auf, und ich sehe wieder besorgt zu ihm hin, unsere Augen tauchen erneut ineinander, bleiben so einige Wimpernschläge lang. Mein Puls klettert bis zur Halsschlagader hinauf, wo er hämmernd verharrt, ich sehe Corvins Hand ganz leicht zittern, möchte sie halten, seine Finger streicheln, tue es nicht. Er fühlt es auch, glaube ich; ganz sicher fühlt er auch, dass etwas zwischen uns ist.
»Es hat sich wieder beruhigt«, stellt er schließlich fest und atmet tief durch, fährt sich wieder mit der Hand durchs Haar. Legt seinen Kopf leicht in den Nacken und lacht, noch nicht wieder ganz frei, aber immerhin. »Eigentlich weiß ich, dass solche Turbulenzen normal sind. Aber jedes Mal bekomme ich dabei feuchte Hände.«
Feuchte Hände. Schöne Gitarrenfinger, nicht anstarren. Ich werfe einen Blick auf meine Armbanduhr.
»Mehr als die Hälfte haben wir geschafft«, sage ich, es soll beruhigend klingen, in meine Worte hinein läuft die Musik weiter, Corvin hat sie leise genug gestellt, dass wir trotzdem miteinander reden können.
»Schon?«, fragt er. »Ich habe gar nicht gemerkt, wie schnell die Zeit vergangen ist.«
»Ich auch nicht.«
»Es muss an dir liegen«, meint er. »Denn sonst flehe ich innerlich immer nur, dass das Flugzeug endlich landet und ich wieder Boden unter den Füßen habe. Und meistens sind solche Reisebekanntschaften ja eher oberflächlich. Man grüßt kurz, danach versinkt jeder hinter seiner Zeitung und das war’s. Mit dir ist es so, als wären wir von Anfang an zusammen gereist.«
»Finde ich auch«, bestätige ich und spüre ein seltsames Ziehen in der Brust, ein Flattern in der Magengegend, so fühlt es sich vielleicht an, wenn man sich gerade neu verknallt. Hat es Sinn, sich gegen dieses Gefühl zu wehren, das sich immer weiter in mir ausbreitet, einen Funkenregen auf mich niederprasseln lässt und durch das auf einmal alles, alles möglich erscheint?
Vielleicht wird er mich zum Schluss nach einem Wiedersehen fragen. Ich weiß nicht, ob ich das möchte, sehne mich danach, fürchte mich davor. Es war richtig gewesen, sich von Manuel zu trennen; das Gefühl, das Corvin in mir auslöst, zeigt mir nur allzu deutlich, wie weit ich mich innerlich bereits von ihm entfernt habe, sonst würde kein anderer solche Vulkane in mir entfachen.
»Was darf es bei Ihnen zu trinken sein?«, fragt die Stewardess, die sich mit ihrem Rollwagen langsam bis zu uns vorgearbeitet hat. Ich nehme meinen Ohrhörer heraus.
»Einen Tomatensaft, bitte«, bestelle ich.
»Für mich das Gleiche«, fügt Corvin hinzu.
»Und mit doppelt Pfeffer, bitte«, sagen wir beide wie aus einem Mund, müssen lachen, er knufft mich gegen den Arm, fast berühren sich unsere Köpfe, weil wir uns krümmen vor Kichern. Lächelnd reicht uns die Stewardess die kleinen Papiertüten zu den Bechern, beinahe synchron schütten wir unseren Pfeffer in den Saft.
»Prost«, lacht Corvin und stößt seinen Becher leicht gegen meinen. »Auf uns, die Black Hour- und Tomatensaftzwillinge.« Und da ist er plötzlich wieder, dieser fassungslose Blick von ihm, mit dem er mitten im Lachen innehält und mein Gesicht streichelt, als hätte er nie etwas Schöneres gesehen. Es ist so ein Wunder.
»Schon verrückt, diese Parallelen zwischen uns«, murmelt er. Ich kann nur nicken, mit meinem Strohhalm im Mund und die Augen ebenfalls auf ihn gerichtet, antworten kann ich nichts, ich glaube, wir wissen beide nicht, wie wir weitermachen sollen. Den Augenblick genießen, nicht gleich zu viel erwarten, nichts zerstören. Einander berühren, ohne uns anzufassen.
Das Flugzeug ruckelt erneut leicht, durch die Bewegung neigt er sich ganz leicht zu mir hinüber, auch ich kann meinen Blick nicht von ihm wenden. Jetzt könnte er mich küssen; in diesem Moment möchte ich nichts lieber als genau das. Corvins Lippen spüren. Aber durch die Erschütterung schreckt er auf, verschüttet ein wenig Tomatensaft auf sein Shirt, zum Glück ist es schwarz, da sieht man es nicht, dennoch versucht er den Fleck mit seiner Serviette aufzunehmen, aber das Material saugt nicht auf. Der Moment ist vorbei. Danach ist es nicht leicht, das Gespräch wieder in Gang zu bringen; Corvin verfolgt angespannt die Bewegungen des Flugzeugs. Die Musik, denke ich; über die Musik kriege ich ihn am besten zurück. Ich muss ihn ablenken.
»Warum schreibst du deine Texte auf Englisch und nicht auf Deutsch?«, frage ich ihn also. »Ich mach das bei meinen Gedichten auch. Vieles kann man auf Englisch treffender ausdrücken, finde ich. Und trotzdem bleibt eine gewisse Distanz, weil es eben nicht die Muttersprache ist. Ich habe weniger das Gefühl, zu viel von mir preiszugeben, als wenn ich auf Deutsch schreibe.«
»Genau!«, ruft er aus. »Das ist genau der Punkt. Bist du gut in Englisch? Warst du gut, meine ich, denn du studierst ja bestimmt schon?«
»Durch Songtexte habe ich mehr Englisch gelernt als in der Schule«, weiche ich aus. »Deshalb kaufe ich mir auch immer noch CDs, statt alles aus dem Netz zu ziehen. Ich lese einfach gerne die Texte in den Booklets mit.«
»Sehr lobenswert.« Corvin lacht erneut. »Immer am Ball bleiben, dann verlernst du die Sprache auch nicht.« Er trinkt seinen Saft aus. »Jetzt klinge ich schon wie ein Schulmeister, oder?«
»Schlimmer. Am besten, ich geh für ein Jahr in die USA, und wenn ich wiederkomme, kann ich besser Englisch als du.«
»Wehe!«, droht er, und ich weiß nicht, was er meint; kann nicht erraten, ob er nicht will, dass ich für ein Jahr verschwinde oder ihn mit meinen Englischkenntnissen überrunde. Jetzt klug sein, ermahne ich mich. Ich lasse es so stehen, bohre nicht nach. Will den Zauber zwischen uns erhalten. Es ist so schön mit ihm, fast unerträglich schön. Diese Zärtlichkeit in seinem Blick, dieses vertraute und doch schwebende Gefühl in mir; noch nie habe ich mich jemandem auf Anhieb so verbunden und doch so stark und frei gefühlt wie in seiner Nähe. Ich will ihn nicht gleich wieder vermissen, es hat keine Zukunft, ich werde ihm sowieso zu jung sein, gewiss gibt es Frauen in seinem Leben, mit denen ich nicht konkurrieren kann, weil ich noch kaum etwas vom Leben weiß im Vergleich zu ihm, und erst recht nicht von der Liebe, nach dem Fiasko mit Manuel. Also mache ich einfach weiter, plaudere mit ihm, lenke das Gespräch in eine andere Richtung, frage ihn nach Pubs und Clubs, die er in England besucht hat. Die Stewardess kommt erneut vorbei, sammelt die leeren Becher ein und fragt, ob jemand von uns eine Zeitung möchte, doch wir lehnen beide ab. Wir haben noch jeder einen der beiden Ohrhörer eingesteckt; nach Corvins eigenen Songs läuft nun andere Musik, ganz leise nur, wir reden weiter miteinander über alles, was uns gerade durch den Kopf geht. Ich spüre, dass wir beide jede Sekunde miteinander auskosten.
Der Pilot kündigt den Sinkflug an, in gut zwanzig Minuten werden wir bereits in Berlin landen. Frag mich nach meiner Handynummer, flehe ich stumm; oder nach der E-Mail-Adresse. Frag mich nicht. Frag mich. Nein, lieber nicht, wo soll das auch hinführen. Frag mich doch.
Beim Landeanflug bemerke ich erneut die Anspannung, die von Corvins Körper Besitz ergreift, ihn erstarren lässt.
»Schau mal, da unten«, versuche ich ihn abzulenken, er muss keine Angst haben, vielleicht kann ich ihm helfen, sie zu überwinden, gerade indem wir gemeinsam nach draußen schauen. »Wir sind schon über Berlin. Kannst du erkennen, welcher Bezirk das ist?«
Corvin schüttelt den Kopf, starrt krampfhaft geradeaus statt zum Fenster hin. Dieses Mal bin ich es, die in der Tasche etwas sucht, um es ihm zu geben, etwas zum Lutschen, finde aber nur Kaugummis.
»Lass mal«, bringt er mit einem etwas gequälten Lächeln hervor. »Nach einer Weile bekomme ich immer Brechreiz davon, und das kann ich jetzt am wenigsten gebrauchen. Es tut mir leid.«
»Es muss dir nicht leidtun«, antworte ich und lege meine Hand auf seinen Arm. »Jeder reagiert anders darauf. Auch wenn deine Zähne so aussehen, als würdest du den ganzen Tag Zahnpflegekaugummis kauen.«
Corvin ringt sich erneut ein Lächeln ab, schweigt jedoch. Bestimmt wünscht er sich einfach nur, dass dieser Flug vorbei ist, egal wer neben ihm sitzt.