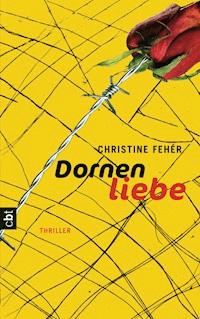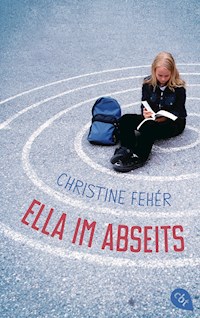7,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: cbt
- Kategorie: Für Kinder und Jugendliche
- Sprache: Deutsch
- Veröffentlichungsjahr: 2013
Zerbrecht nicht, was mich hält!
Und was, wenn Max einfach einen Schlussstrich ziehen wollte? Es allen zeigen: seinem Manager-Vater, der ihn nur nach Leistung beurteilte. Seiner unterkühlten Freundin Annika, die ihn ständig umkrempeln wollte. Seinem besten Freund Paul, der gleichzeitig sein stärkster Konkurrent war. Seinem Lehrer, der nur in Noten denkt. Seiner großen Liebe Delia, die ihn verlassen hat. Einfach abhauen. Ruhe haben. Ist es das, was Max wollte, als er sein Auto gegen den Baum steuerte? Oder stand er einfach unter Schock, weil er etwas herausgefunden hatte, das ihm den Boden wegzog? Max hat Freunde und Familie in Trauer gelähmt zurückgelassen. Stückchen für Stückchen müssen sie das Bild seines Lebens zusammensetzen, um die Antwort zu finden. Und jeder hat ein Puzzleteil Schuld hinzuzufügen …
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 580
Ähnliche
Christine Fehér
Dann mach ich
eben Schluss
Roman
1. Juni, 01:37 Uhr. Irgendwo auf einer Landstraße
»Da vorne, da ganz vorne rechts an der alten Eiche. Da steht einer und winkt, das muss der Mann sein, der uns angerufen hat. Fahr mal langsamer. Ja, gut so, halt an, schnell, egal wie. Warnblinker an, Dreieck hinstellen, Kegel aufstellen und raus. Blaulicht bleibt an.«
»Scheiße, das sieht nicht gut aus. Vorne auf der Fahrerseite ist alles Matsch. Wenn da mal überhaupt einer überlebt hat …«
»Beeilen wir uns. Ich glaube, auf dem Rücksitz bewegt sich einer. Den zuerst und den Insassen daneben, wenn es einen gibt.«
»Hiiiieeer, hierher, haaaaallooooo!«
»Haben Sie Erste Hilfe geleistet?«
»So gut ich konnte. Aber ich muss zugeben, meine Auffrischung des Kurses … rausziehen konnte ich die nicht. Alles verbogen, Türen und so.«
»Dann treten Sie beiseite, verdammt. Immer dasselbe.«
»Hallo, können Sie mich hören? Wir helfen Ihnen, bleiben Sie ganz ruhig. Ich versuche jetzt, die Tür zu öffnen.«
»Die Vitalfunktionen sind bei Ihnen beiden so weit in Ordnung. Ihre Namen?«
»Paul Fischer.«
»Annika Pietz.«
»Danke. Wir stabilisieren jetzt Ihre Halswirbelsäule mit einer Halskrause, dann fahren wir Sie beide zur Untersuchung ins Sankt-Joseph-Krankenhaus. Spüren Sie irgendwo Schmerzen?«
»In der Hüfte, ich konnte kaum noch sitzen, bis Sie endlich gekommen sind. Kann mich aber auch beim Sport verrenkt haben. Und ins Krankenhaus kann ich nicht, ich habe meinem Vater versprochen, morgen den Rasen zu mähen.«
»Schon gut. Sie stehen unter Schock, ich kenne das, da geht einem alles Mögliche durch den Kopf, eine ganz natürliche Reaktion. Und die junge Frau? Tut Ihnen etwas weh?«
»Ich krieg keine Luft. Das war alles nur ein Missverständnis, Paul und ich haben gar nicht … ich krieg keine Luft.«
»Ruf die Feuerwehr, Mark, wegen der beiden vorne. Die Tür scheint zu klemmen, dann müssen sie das Dach abschneiden und eine Ganzkörperstabilisierung vornehmen. Die Beifahrerin reagiert nicht. – Können Sie mir die Namen von Fahrer und Beifahrerin nennen, Frau Pietz?«
»Max Rothe. Maximilian. Und Natalie Rothe, seine Schwester. Ich weiß gar nicht, ob sie ihre Tasche aus dem Club mitgenommen hat, sonst könnte ich sie ihr morgen vorbeibringen. Ohne Schlüssel kommt sie ja zu Hause nicht rein, mitten in der Nacht. Es war alles ein Missverständnis, Max hat da was völlig in den falschen Hals gekriegt. Sie können Natalie fragen, sie hat ja gesehen, dass da nichts war. Sonst hätte sie uns bestimmt angemotzt, die nimmt kein Blatt vor den Mund. Aber sie hat nichts gesagt, also war da auch nichts. Und dann ist Max losgefahren.«
»Alles klar. Herr Fischer, wir heben Sie jetzt auf die Trage. Falls Ihnen dabei etwas wehtut, machen Sie sich keine Gedanken, es passiert nichts Schlimmes. Hast du die Beine, Christian? Ich nehm ihn an den Schultern.«
»Hab ich. Eins, zwei, drei!«
»Mein Kopf tut weh. Wo fahren wir hin?«
»Ins Sankt-Joseph-Krankenhaus. Machen Sie sich keine Sorgen, junge Frau. Ihre Eltern werden von dort aus verständigt. Ihr Freund Paul ist ebenfalls in besten Händen.«
»Und Max?«
»Die Feuerwehr ist jetzt vor Ort. Sie sollten nicht so viel grübeln.«
»Was ist mit Max? Ich habe Natalie stöhnen hören, aber was ist mit Max?«
»Es kümmern sich die richtigen Leute um ihn, wir sind ja mit zwei Wagen gekommen. – So, wir sind gleich da. Wir bringen sie in die Notaufnahme, dann verabschieden wir uns. Mein Kollege hat soeben einen Anruf für den nächsten Einsatz erhalten.«
»Sie sagen mir nicht die Wahrheit, oder? Was mit Max ist. Diese Rechtskurve, der Baum. Er war ganz still, als Sie gekommen sind. Hat sich nicht mal bewegt. Müssen Sie nicht Bewusstlose zuerst retten?«
»Im Gegenteil. – Wir sind da«, verkündet der Sanitäter. »Im Krankenhaus kann man Ihnen Genaueres sagen, sobald es Ergebnisse gibt. Denken Sie erst mal nur daran, selbst wieder gesund zu werden.«
Da stimmt was nicht, denkt Annika. Schwarze Sterne tanzen vor ihren Augen. Dann weiß sie nichts mehr.
Natalie Rothe, 16 Jahre, Maximilians Schwester
1.
Es ist eng zu dritt in Maximilians Zimmer, zu eng. Natalie ist froh, als es an der Tür klingelt und ihre Mutter sie bittet, hinzugehen, während sie selbst sich auf Max’ Bett setzt und mit der Hand über die Stirn reibt. Es ist so schwer, für alle, so schwer und wird nicht leichter, egal wie viel Zeit vergeht. Erst ein paar Wochen sind seit Max’ Tod vergangen. Der Vater hat eine leere Umzugskiste in die Mitte des Raumes gestellt und öffnet Max’ Kleiderschrank, irgendwann müssen sie anfangen, es hilft nichts, weiter so zu tun, als käme der Sohn jeden Moment zur Tür herein. Seine Frau hatte gesagt, es sei ihr noch zu früh.
Natalie geht durch den Flur zur Wohnungstür, drückt auf den Summer und lauscht, ob von unten jemand die Treppe hoch kommt oder nur Reklame in die Briefkästen im Eingangsbereich verteilt wird.
Es kommt jemand, junge Schritte, die glatt von Max stammen könnten. Aber Max kommt nicht, Max kommt nie mehr nach oben, nie mehr nach Hause, und bei diesem Gedanken schießen sofort wieder Tränen in Natalies Augen wie seit seinem Tod immer wieder. Ihr Blick fällt in den Spiegel an der Flurgarderobe, ich sehe aus wie ausgespuckt, denkt sie, die Augen erloschen; meine und Mamas sind mit denen von Max gleich mit erloschen. Es ist so schlimm, so schlimm. Es gibt keine Worte dafür und keine Gedanken, nur Fetzen davon, die immer wieder von selbst in einem zähen Brei kreisen, den sie kaum umrühren kann, sie kommt nicht weiter, es kommen immer nur Tränen. Aber jetzt nähern sich die Schritte auf der Treppe, sind auf der Etage angekommen, Max’ bester Freund Paul kann es auch nicht sein, der liegt noch im Krankenhaus. Natalie linst durch den Türspion, wer ist denn das, sie kennt den Typen nicht, es ist keiner aus der Schule, sie tupft sich mit ihrem zerknüllten Papiertaschentuch über die Augen, seit Max’ Tod hat sie immer eines in der Hosentasche, ihre Lider fühlen sich entzündet an, sie kann es nicht ändern. Der Fremde zieht den Messingring hoch, der die Klingel an der Wohnungstür auslöst, Natalie öffnet, sieht ihn fragend an, spricht keinen Gruß aus. Erst mal soll er sich erklären.
»Hi«, beginnt er, Natalie sieht, dass ein entschlossener Ausdruck in seinem Gesicht einem erschrockenen, verlegenen weicht, unwillkürlich tritt er einen halben Schritt zurück. »Ich wollte eigentlich meine Sachen abholen, die ich ersteigert habe. Vielleicht passt es gerade nicht, aber so langsam will ich die jetzt mal haben. Bezahlt habe ich sie schließlich gleich. Vor über drei Wochen.«
»Was für Sachen?« Natalie verzieht das Gesicht. »Ich hab dich noch nie gesehen, und bei uns versteigert auch niemand was. Klingel mal bei den Nachbarn, vielleicht wissen die mehr.« Schon will sie die Tür schließen und ihn stehen lassen, doch der junge Mann reagiert schnell und setzt seinen Fuß auf die Schwelle.
»Ich bin hier richtig«, beteuert er und zieht ein zusammengefaltetes Blatt Papier aus seiner Jackentasche, faltet es auseinander und zeigt es ihr. »Das hier ist der Ausdruck von der Auktion. Mal- und Zeichenutensilien wegen Hobbyaufgabe zu versteigern, ich war Höchstbietender mit 37,36 Euro. Das Geld habe ich sofort online überwiesen; wenn du willst, zeige ich dir auch den Kontoauszug.«
Natalie reißt ihm den Ausdruck aus der Hand, starrt darauf. Starrt auf das Foto, sieht Maximilians Ölkreidestifte, seine Acryl- und Aquarellfarben, die Radiergummis und Bleistifte, seine Blöcke in verschiedenen Größen, zwei kleinere Leinwände auf Keilrahmen. Alle Sachen liegen unverkennbar auf seinem Schreibtisch, und ganz unten steht es auch: Verkäufer Maximilian Rothe, Bamberger Straße 10.
»Max hat seine Malsachen verkauft?«, fragt sie trotzdem, mehr sich selbst als ihn. »Sorry, das wusste ich nicht.« Sie schüttelt den Kopf, starrt noch einmal auf das Blatt, dann geht ein Ruck durch ihren Körper, sie blickt wieder auf und gibt es ihm zurück.
»Und es geht auch gar nicht«, sagt sie. »Tut mir echt leid, aber … du kannst die Sachen nicht haben.«
»Wieso nicht?« Der Käufer hat noch immer seinen Fuß in der Tür. »Sie gehören mir, und da dieser Maximilian weder das Paket losgeschickt noch auf E-Mails reagiert, geschweige denn mir das Geld zurücküberwiesen hat, wollte ich die Sachen jetzt abholen. Er kann froh sein, dass ich den Fall nicht im Portal gemeldet habe. Noch nicht.«
»Trotzdem rücke ich sie nicht einfach raus. Geh doch in einen Laden für Künstlerbedarf und hol dir was Neues, wenn du so dringend was brauchst. Max ist tot, er kann dir die Sachen nicht geben.«
»Tot?« Der junge Mann reißt die Augen auf. »Ach so, deshalb … das konnte ich nicht ahnen, das tut mir leid, also … dann ist es klar, dass er nicht antworten kann, wenn er … nein, das klingt zu makaber. Entschuldige, dagegen ist diese blöde Auktion natürlich völlig unwichtig, auch das mit dem Geld, also Schwamm drüber, so viel war es ja nicht, du hast jetzt ganz andere Sorgen, aber das wusste ich nicht, ehrlich, ich geh dann mal jetzt.«
Natalie nickt.
»Wer ist denn da an der Tür?«, ruft ihre Mutter aus Max’ Zimmer, und Natalie denkt, dass sie jetzt bloß nicht herkommen soll und noch weniger ihr Vater, keiner von beiden, sie würden den jungen Mann sofort wegschicken, der Vater mit harten, unfreundlichen Worten, die Mutter überfordert, und Natalie will auch nicht mehr zu ihnen in Max’ Zimmer, das eilt doch alles nicht, sie erträgt die Enge darin nicht und auch nicht, wie Stück für Stück von Max’ Sachen abgebaut werden, in Kartons verpackt, in Säcke für die Altkleidersammlung gelegt, oder willst du damit mal zum Flohmarkt gehen, Natalie, du kaufst doch selber manchmal da, auch wenn du das weiß Gott nicht nötig hättest. Nein, will sie nicht.
»Ist für mich«, ruft sie in die Wohnung und hofft, dass ihre Mutter es damit gut sein lässt , nicht weiter drängt und dass auch ihr Vater nicht auf irgendwelchen Prinzipien beharrt, von wegen es sei Trauer im Haus und jeglicher Besuch von Natalies jungen Leuten unangemessen.
Der junge Mann begreift, nimmt seinen Fuß von der Schwelle, bleibt aber stehen. Natalie betrachtet ihn, weiß plötzlich nicht mehr, was sie sagen soll, aber eigentlich wirkt er nicht unsympathisch, er muss nicht sofort gehen, so war das nicht gemeint. Sie stellt fest, dass er einen offenen, freundlichen Blick hat mit seinen hellen Augen, die blau sind oder grau, seine langen Haare hat er in der Mitte gescheitelt, nicht mit dem Kamm sondern nur irgendwie, auch nicht besonders gründlich gebürstet, hinten hat er sie zu einem Zopf gebunden. Seine Lederjacke, die irgendwann vielleicht mal cognacbraun gewesen ist, stammt sicher auch vom Flohmarkt, dazu trägt er eine rostrote Baumwollhose und beigefarbene Sneakers, ein verwaschenes Shirt. Kein übler Typ, wirklich nicht. Kein gelackter Affe wie Paul.
»Bist du Max’ Freundin?«, fragt er leise, und auf einmal begreift Natalie, dass er zu einer neuen Zeit in ihrem Leben gehört, der Zeit nach Max’ Tod, er kennt ihn nicht und wird ihn nie kennenlernen, er ist erst danach aufgetaucht, steht plötzlich hier vor der Tür und hat keine Ahnung, keine Ahnung von Max und was Natalie gerade durchmacht.
»Seine Schwester«, erläutert sie knapp und deutet auf die Halskrause, die sie seit dem Unfall tragen muss. »Ich hab überlebt, sogar nur leicht verletzt, aber er …« Sie spürt wieder die aufsteigenden Tränen, nicht jetzt, nicht jetzt. Sie atmet tief durch. Vielleicht ist es gut, mit ihm zu reden, rauszugehen und einfach diesem Fremden alles zu erzählen. Die kreisenden Fragen, den zähen Brei, der aber allein durch den Grund seines Kommens schon ein wenig flüssiger geworden ist. Dann war es doch Selbstmord. Wenn Max vorher seine Malsachen ins Netz gestellt hat, war es Selbstmord. Sonst hätte er das nie gemacht, nie.
»Wenn du jetzt lieber allein sein willst …«, sagt er und wendet sich schon zum Gehen, aber Natalie hält ihn am Jackenärmel fest.
»Nein«, flüstert sie, räuspert sich und strafft ihren Körper, versucht sich zu fangen. »Vielleicht gebe ich dir die Sachen doch mit. Aber erst will ich wissen, zum wem sie kommen. Ob Max das gewollt hätte, dass sie bei dir landen. Wenn ich kein gutes Gefühl habe, kannst du es vergessen, das sag ich dir gleich. Wir können ein bisschen rausgehen, wenn du noch Zeit hast.« Sie langt hinter sich an die Garderobe und tastet nach ihrer Jacke, aus Leder wie seine, nur schwarz statt hellbraun, schwarz wie alles, was sie trägt, immer schon, die Trauer um Max macht da keinen Unterschied. Dann will sie nach draußen treten und die Tür hinter sich zu ziehen, doch jetzt ist er es, der sie aufhält.
»Sag deinen Eltern Bescheid, dass du weggehst.«
Natalie blickt ihn verwundert an, tut aber, was er sagt. Ihre Eltern nicken nur, müde und willenlos, keiner von beiden hat inzwischen irgendetwas in die Kisten gepackt.
Rausgehen. Zum ersten Mal reden. Draußen sein mit jemandem, den es bisher noch nicht gab. Natalie riecht die warme Erde und spürt die Julisonne auf ihrer Stirn und ihren Wangen, als sie auf die Straße tritt. Man kann sich nicht ewig einigeln, sie ist sowieso nicht der Typ dafür. Es muss ja weitergehen, Max würde sich klammern an den Gedanken, dass wenigstens sie weitermacht. Sich jetzt nicht fallen lässt.
Wie von selbst und in stummer Übereinstimmung steuern sie den Weg zum Park an. Irgendwo dahinter beginnt der Friedhof.
»Ich bin übrigens Jonathan«, sagt er. »Erzähl einfach mal. Falls du die Malsachen doch noch rausrückst … dann weiß ich wenigstens, wer das war, dem sie gehört haben.«
2.
Max’ Beisetzung ist erst wenige Tage her, aber im Hochsommer verdirbt alles schnell. Die Kränze sind abgeräumt, die Gestecke verschwunden, leuchtende Mohnblumen und blauer Männertreu, geschickt arrangiert im Wechsel mit gelben Stiefmütterchen und rosa Rosen, verleihen seinem Grab eine sommerliche, fröhliche Ausstrahlung.
»Sieht toll aus«, bemerkt Jonathan. »Machst du das oder deine Eltern?«
»Meine Mutter kann noch nicht herkommen«, antwortet Natalie. »Das packt sie noch nicht, die Beerdigung war schon eine einzige Katastrophe. Und mein Ding ist dieser Blumenkram überhaupt nicht. Nein, das ist … das macht jemand anders. Von einer Gärtnerei hier in der Nähe.«
Jonathan nickt. »Es wirkt eher wie ein liebevoll gestaltetes Beet in einem Garten als wie eine letzte Ruhestätte.«
»Übertreib nicht.« Natalie wendet sich ab, will weitergehen. »Ich weiß, es sieht perfekt aus. Nach außen war alles perfekt in Max’ Leben. Trotzdem hat er es getan.«
»Getan? Was hat er getan?« Jonathans Stimme klingt sanft, geduldig, normalerweise regt Natalie so ein Gesäusel auf. Heute nicht. Er kennt sie nicht, weiß nichts. Dann kann er auch nichts beurteilen, nicht verurteilen. Sie kann einfach erzählen, egal wie lange es dauert, und wenn er ihr dämlich kommt, wird sie ihm sein Geld zurückgeben und ihn zum Mond schicken.
»Dein Kopf.« Er deutet auf ihre Narbe an der Schläfe, die noch immer gerötet und leicht geschwollen ist. »Was ist passiert?«
»Wenn ich das wüsste.« Natalies Blick ist düster, in die Ferne gerichtet. »Ich weiß nur noch, wie mies er drauf war am letzten Abend. Irgendwas war mit der Schule, das ging schon länger, mein Vater hat ihn immerzu drangsaliert, er sollte noch mehr und noch mehr lernen, dabei hatte er schon kaum noch Zeit für was anderes. Monatelang ging das so. Irgendwas war dann mit seinem Lehrer … und seiner Tussi … sorry, Jonathan, ich hab da echt ‘nen Filmriss. Muss durch den Aufprall kommen; ich hoffe, ich laufe jetzt nicht für den Rest meines Lebens mit Alzheimer rum. Ist sowieso ein Wunder, dass ich nicht mit draufgegangen bin. Ich habe nichts weiter als diese Narbe – und den Filmriss eben. Max hat das so gemacht …« Natalies Stimme bricht, sie schüttelt den Kopf, legt ihre Hand auf die Lippen, bleibt stehen. »Wir hätten alle draufgehen können, alle, die mit im Auto saßen. Wenn einer mit dem Auto gegen einen Baum rast, bleibt normalerweise nicht viel übrig, weder vom Wagen noch von den Insassen.«
»Kommt auf die Geschwindigkeit an und darauf, ob er frontal dagegen kracht oder noch versucht hat auszuweichen.«
»Draufgegangen ist jedenfalls nur Max. Wir anderen leben alle, auch wenn es seinen Kumpel Paul und seine Freundin Annika ganz schön erwischt hat. Paul liegt immer noch im Krankenhaus. Dabei saßen sie hinten und ich war die Beifahrerin.«
»Annika? Meinst du damit, sie war die Freundin von diesem Paul oder von deinem Bruder?«
»Sie war Max’ Freundin. Er war mit dieser Annika zusammen, obwohl sie nicht zu ihm gepasst hat. Ich hab das nie verstanden. Annika ist so eine Hübsche, Beliebte, die jeden Jungen haben kann, aber sie ist oberflächlich. Er war nicht glücklich mit ihr.«
Natalie reibt sich wieder die Stirn, der Kopf tut ihr weh, das passiert seit dem Crash oft, wenn sie grübelt.
»Du musst dich nicht bemühen«, versucht Jonathan sie zu beruhigen. »Wenn die Erinnerungen weg sind, kann das auch psychische Gründe haben, das ist ja der Hammer, was du gerade durchmachst. Wir können hier weggehen, wenn du willst. Möchtest du nach Hause?«
»Bloß nicht«, gibt Natalie zurück. »Nein, lass uns weitergehen, irgendwohin, aber nicht nach Hause. Da erschlägt mich alles, seit ich aus dem Krankenhaus entlassen bin.«
Sie schlendern auf die Straße zurück. Der Feierabendverkehr ist durch, nur noch vereinzelt passieren Autos in gemäßigtem Tempo die Nebenstraßen. Neben einem Springbrunnen halten sie an, blicken um sich und setzen sich schließlich auf eine Bank. Eine Weile lauschen sie stumm dem Plätschern der Wasserfontänen, Natalie vergewissert sich, dass es ihre Kopfschmerzen nicht verstärkt, stellt aber fest, dass es geht.
»Eine oberflächliche Schickse passt nicht zu deinem Bruder, wenn er Künstler ist«, äußert Jonathan schließlich. Es tut Natalie gut, wie er von Max in der Gegenwart spricht, anders als ihre Mutter, die das auch tut und dann nach jedem zweiten Satz in sich zusammensackt und weint, weil die Erkenntnis, dass er nicht mehr da ist, sie immer noch übermannt. Bei Jonathan zieht es sie nicht runter.
»Das habe ich ihm auch gesagt, und ich wollte ihm immer Mut machen, sich von ihr zu trennen. Ich hab gehofft, er schafft es von allein … Mir war so vieles nicht klar, ich hatte mit mir selber zu tun. Ich hätte mehr für ihn da sein sollen.«
»Bist du nicht die Jüngere von euch beiden?«
»Eben. Aber Max war ein ganz anderer Typ als ich. Ich lasse mir so leicht nichts sagen, nicht mal von meinem Vater, der immer meint, er muss uns herumkommandieren wie seine Angestellten. Deshalb musste ich oft für Max kämpfen.«
Jonathan grinst und lässt seinen Blick über Natalies Kleidung gleiten. »Dann eckst du bestimmt oft bei deinem Dad an.«
Natalie zuckt mit den Achseln. »Selbst wenn ich mir einen Hühnerknochen durch die Nase jagen wollte, wär das meine Sache, aber so weit gehe ich gar nicht. Ich trage halt meine schwarze Lederjacke und schnippel hier und da ein bisschen an meinen Shirts rum, hab eben meistens was Schwarzes an und bemale mein Gesicht entsprechend. Aber ich spiele Saxofon in einer Rockband, da läuft man nun mal nicht rum wie Kaiserin Sissi.«
»Saxofon in ’ner Rockband.« Jonathans Augen weiten sich. »Respekt, Respekt. Dann ist es ja klar, dass du dich nicht nur um deinen Bruder kümmern kannst.«
»Aber das ist genau das Problem. Max war so still, so unauffällig, der ist immer irgendwie dabei gewesen, ohne groß aufzufallen. Er rutschte überall so mit durch, kämpfte nicht, legte sich mit niemandem an.«
»Dann ging es ihm vielleicht schon länger beschissen, nicht nur an dem Abend, bevor er gegen den Baum gerast ist«, vermutet Jonathan.
»Aber ich habe es nicht bemerkt; jedenfalls nicht, wie krass es wirklich war. Er hat mich ja manchmal genervt, weil er immer so unentschlossen und zögerlich war.«
»Das ist verständlich. Immerhin ist er der Ältere, eigentlich hätte er für dich da sein müssen, als großer Bruder.«
»Zwischen uns lagen nur zwei Jahre und zwei Monate. Darum geht es auch nicht, ich bin kein Baby mehr, ich beiße mich schon selber durch. Aber beim letzten Mal hätte ich ihn nicht abwimmeln sollen.«
»Was war da los?«
Natalie schweigt. Max’ Gesicht taucht wie ein Blitzlicht vor ihr auf, seine Hand, die sich fest um den Türrahmen krallt, es war der Eingang zum Musiksaal, seine Augen angsterfüllt, er hatte eine Nachricht bekommen, musste dringend nach Hause, wollte sie bei einem Gespräch mit dem Vater dabeihaben. Natalie hatte abgelehnt, war mitten in einer Probe mit dem Schulorchester, es ging einfach nicht. Es hätte gehen müssen.
»Ich kann nicht darüber reden«, sagt sie schließlich. »Alles kommt wieder hoch. Wenn ich für Max da gewesen wäre, könnte er noch leben.«
»Es lag nicht nur an dir«, erwidert Jonathan. »Wenn sich einer was antut, gibt es nie nur einen einzigen Grund dafür. Du sagst, Max war still und unauffällig – da übersieht man leichter etwas als bei einem Menschen, der sein Herz auf der Zunge trägt. Mach dir keine Vorwürfe.«
»Trotzdem. Er ist tot, verstehst du? Niemand hat gewusst, wie es in ihm aussah, und das in der eigenen Familie, im Freundeskreis. Das ist doch arm.«
»Es kann nun mal nicht jeder Gedanken lesen. Wenn ihr so ein gutes Verhältnis hattet, hätte Max sich auch äußern können.«
»Hat er.« Natalie kämpft gegen einen Kloß im Hals an. »Hat er ja. Ich wusste genau, wie er gelitten hat, zumindest unter unserem Vater. Aber ich habe ihn abgewimmelt.«
Jonathan blickt sie von der Seite an. »Du konntest nicht wissen, dass es um Leben und Tod ging«, meint er. »Viele Jugendliche haben Stress mit den Eltern. Gib dir nicht die Schuld daran, dass er kein dickeres Fell hatte.«
»Aber ich habe es nicht mal richtig ernst genommen, wenn er mir davon erzählte. Ein paar übliche Floskeln, er soll sich nicht alles gefallen lassen, das war’s. Ich hab so oft gedacht: Mann, Max, wach mal auf, du bist volljährig, Daddy kann dir gar nichts. Oft hätte ich ihn schütteln können. Aber ich hab’s nicht getan. Vielleicht wäre sonst alles ganz anders gekommen.«
»Das glaube ich nicht«, zweifelt Jonathan. »Wenn sich jemand wirklich umbringen will, dann tut er es auch. Niemand hätte das verhindern können, weil niemand ganz genau wissen konnte, wie groß seine Not war. Gegen Selbstmord spricht bei deinem Bruder nur, dass er riskiert hat, andere mit in den Tod zu reißen. Menschen, denen er nahestand, das ist der Wahnsinn, dazu müsste schon viel passiert sein. Vielleicht ist es doch im Affekt geschehen.«
»Es ist viel passiert. Warte mal.« Natalie legt ihre Hand auf seinen Unterarm, ihre Augen weiten sich. »Da war was, eben hatte ich einen Erinnerungsfetzen … Max saß schon mit Annika und Paul im Auto, als ich eingestiegen bin. Irgendwas war da los, es muss Streit gegeben haben, bevor ich kam. Dann sind wir losgefahren … mehr weiß ich nicht, verdammt. Ab da ist wieder ein schwarzes Loch in meinem Hirn.«
»Vielleicht war Alkohol im Spiel«, vermutet Jonathan. »So was passiert immer wieder.«
»Nicht bei Max«, unterbricht ihn Natalie. »Wenn du so über ihn denkst, kannst du gleich den Abflug machen. Max hat fast nie getrunken, und wenn er fahren wollte sowieso nicht.«
»Schon gut«, beschwichtigt Jonathan schnell. »Es war nur ein Beispiel, gar nichts denke ich über Max. Ich will dir nur helfen, dass deine Erinnerung vielleicht zurückkehrt, und wenn es nur stückweise ist.«
»Ich hab Angst davor«, gesteht sie.
»Dann erzähl mir was anderes über ihn«, schlägt Jonathan vor. »Was Max so gemalt hat, zum Beispiel. Hat er auch Graffiti gesprüht?«
Natalie schüttelt den Kopf. »Wenn er malen wollte, hat er sich zurückgezogen. Du kannst nachher mit raufkommen, dann suche ich ein paar Bilder raus. Irgendwo in seinem Zimmer müssen ja welche sein. Aber noch nicht jetzt. Ich will noch nicht gehen.«
Wieso macht er das; denkt sie. Was bringt diesen Jungen dazu, seine Zeit mit mir zu verbringen und sich das alles anzuhören, wo es doch so traurig ist? Ein neuer Mensch in meinem Leben. Ich will gar nicht, dass er wieder verschwindet, wenn er erst die Malsachen von Max hat.
»Ich würde gern meine Füße in den Springbrunnen halten«, sagt sie. »Kommst du mit?«
3.
Seit Maximilians Tod und ihrer eigenen Entlassung aus dem Krankenhaus hat Natalie sich wieder in eine Art Schutzuniform gehüllt, die gleichen Sachen, die sie trug, bevor es passiert war, nur noch extremer; Destroyed Jeans, Shirts und Pullis im Heavy-Used-Look und ihre Nietenlederjacke, dunkles Augen-Make-up und schwarze Lippen, vor allem aber ihre derben schwarzen Lederboots. Es war eine Art Weigerung gewesen zu akzeptieren, dass das Leben weitergeht, ein Festhalten an dem letzten Frühjahr mit Max, und sie hat auch jetzt, an diesen glühenden ersten Julitagen, daran festgehalten. Sie setzt sich auf den Brunnenrand und löst ihre Schuhbänder, zerrt ungeduldig an den Stiefeln, erst jetzt spürt sie, wie ihre Füße brennen, auch die Socken reißt sie herunter und wirft sie achtlos zu Boden, ehe sie ihre Hosenbeine aufkrempelt und beide Füße gleichzeitig ins Wasser taucht. Ein Lächeln huscht über ihr Gesicht, kaltes Wasser, es ist so erfrischend, sie fühlt, wie es den Kreislauf ankurbelt und das Leben in ihr weckt. Ein leerer weißer Plastikbecher, eine durchtränkte Zigarettenkippe und ein hölzernes Eisstäbchen schwimmen an ihr vorüber, sie fischt alles heraus, ehe sie auch ihre Jacke abstreift, die Ärmel ihres Shirts aufkrempelt und mit den Armen bis zu den Ellbogen eintaucht, ihren Nacken mit Wasser benetzt, die Stirn anfeuchtet. Es ist fast wie beim Baden gehen früher, Baden gehen mit Max, vor vielen Jahren, als sie noch Kinder waren. Sommerferien an der Ostsee oder ein Nachmittag im Freibad, das Gefühl jetzt ist wieder das gleiche, die Erfrischung und die plötzlich aufkeimende Lust, unbeschwert herumzutoben, sich in die Unendlichkeit der Fluten fallen zu lassen.
Auch Jonathan lässt seine Füße ins Wasser hängen, lächelt sie an, er schaufelt etwas Wasser mit seiner Hand und spritzt Natalies Gesicht nass; große, breite Hände hat er. Natalie spritzt nicht zurück, so weit erholt ist sie noch nicht, und er spürt es, fühlt sich ein, bedrängt sie nicht, in Albereien zu verfallen, weiß ganz genau, wie unpassend es jetzt noch wäre. Aber auch er sieht, dass Natalie mit der Lederkleidung ein Stück ihrer Schale, ihres Panzers abgelegt hat. Eine Weile sitzen sie nur nebeneinander und sehen dem immer gleichen Kreislauf des Wassers in diesem Springbrunnen zu, für Natalie hat das gleichförmige Rauschen und Plätschern etwas Beruhigendes, Einlullendes.
»Dieses Unauffällige, Stille«, nimmt Jonathan irgendwann den Faden wieder auf. »Hatte dein Bruder das auch früher schon? Als ihr Kinder wart, meine ich?«
Natalie nickt. »Er war ein Einzelgänger«, erzählt sie. »Vor fremden Leuten hatte er Angst, sogar Kindern gegenüber war er sehr scheu. Bevor er eingeschult wurde, spielte er am liebsten mit mir – daran erinnere ich mich aber nicht mehr. Meine Mutter hat es mir erzählt. Manchmal wollten andere Jungs aus der Nachbarschaft ihn abholen, aber er ging nur, wenn ich auch mitkam. Sonst blieb er am liebsten im Zimmer und malte.«
»Musstest du dann auch neben ihm sitzen?«
»Quatsch.« Natalie zieht die Augenbrauen zusammen. »Wenn du mich jetzt veräppeln willst, dann verschwinde. An so einen Vollpfosten wie dich rücke ich Max’ Malsachen sowieso nicht raus. Deine paar Kröten kannst du zurückhaben, die wiegen den Wert sowieso nicht auf.«
»Entschuldige«, beeilt sich Jonathan zu sagen. »Es war ein blöder Spruch von mir, tut mir leid. Aber hast du dich nicht wahnsinnig eingeengt gefühlt, wenn er nichts ohne dich machen konnte?«
»Klar«, räumt Natalie ein. »Ich hatte ja Freundinnen und Freunde, schon im Kindergarten. Mit denen wollte ich auch spielen. Malen fand ich damals langweilig, höchstens mit Straßenkreide kritzelte ich draußen manchmal herum, mit den anderen eben. Max machte da selten mit, er war ein richtiger Stubenhocker.«
»Dabei hätte er auch draußen mit Kreide malen können. Hast du schon mal diese Straßenkünstler gesehen, die in der Innenstadt auf dem Pflaster malen? Da sind so tolle Bilder drunter. Neulich war auf dem Marktplatz einer, der malte einen Abgrund direkt an das Geländer zum U-Bahneingang, total irre. Der sah so dreidimensional aus, dass die Leute unwillkürlich einen großen Bogen um das Bild gemacht haben, obwohl sie wussten, dass es nur eine Zeichnung war.«
»Finde ich auch super«, stimmt Natalie zu. »Aber dazu war Max viel zu introvertiert. So ein Bild erregt Aufsehen. Ich wette, er hätte allein bei der Vorstellung schon nachts Albträume bekommen. Wie die Passanten stehen bleiben und ihm zusehen, wie er mitten auf dem Marktplatz hockt und malt.«
»Schade«, meint Jonathan. »Der Erfolg hätte ihm Auftrieb geben können.«
Natalie schweigt. Max hatte Erfolg, ganz zum Schluss. Der Wunsch, mehr aus seinem Talent zu machen, war unaufhaltsam in ihm gewachsen, er hatte ihn nur nicht entschlossen genug verteidigt. Er hätte Hilfe dabei gebraucht, Ermutigung, nicht nur von einem Menschen.
»Und du?«, forscht Jonathan weiter. »Wie warst du als Kind?«
»Ich weiß nicht.« Natalie zögert, blickt durch die Wasserfontänen hindurch in die Ferne. »Ganz normal eigentlich, fand ich jedenfalls. Aber wo Max zu brav war, bin ich zu unruhig gewesen. In der Schule zum Beispiel. Wenn mir was nicht gepasst hat, im Unterricht oder wenn die Lehrer jemanden ungerecht behandelt haben, dann habe ich das auch gesagt. Und zwar, wann es mir gepasst hat oder wenn ich fand, dass es genau in dem Moment sein musste. Da habe ich mich nicht erst ewig gemeldet und gewartet, bis die Lehrerin sich mal herablässt, mich dranzunehmen.«
»Kann ich mir vorstellen. Du bist ja jetzt noch eine kleine Rebellin.« Jonathan zwinkert ihr zu.
»Manchmal riefen die Lehrer nachmittags bei uns an, um sich zu beschweren. Vor allem meinem Vater war das furchtbar unangenehm, aber das hat er den Lehrern nicht gezeigt.«
»Sondern?«
»Er hat mich verteidigt. Das Gute war ja, ich habe nie schlechte Noten nach Hause gebracht, und dagegen konnten die Lehrer nichts sagen. Sonst hätte ich vielleicht richtig Stress haben können.«
»Du bist also immer genau das, was dein Bruder nicht ist«, schlussfolgert Jonathan.
»Meine Eltern fingen irgendwann an, mir Max als Vorbild hinzustellen. Warum bist du nicht wie er, Max hat noch bessere Noten und macht nie Ärger, sei nicht immer so renitent. Ich musste mich abgrenzen, sonst hätte ich das Gefühl gehabt, wir verschwinden beide.«
»Was meinst du damit?«
»Max hat immer versucht, unseren Eltern alles recht zu machen. Wenn sie sonntags mit uns einen Ausflug machen wollten, stieg er ins Auto und fuhr mit, obwohl ihm jedes Mal so schlecht wurde, dass er am Ziel noch auf dem Parkplatz kotzte. Mit mir hätten sie das nicht machen können. Ich habe so lange gemosert, bis ich zu Hause bleiben und mit meinen Freunden spielen durfte – oder einen von ihnen mitnehmen, um nicht vor Langeweile zu sterben. Genug Platz im Auto hatten wir ja.«
»Max hat sich übergeben, und trotzdem musste er immer wieder mit?«
»Meine Mutter fand irgendwann ein homöopathisches Mittelchen, damit wurde es etwas besser. Also fuhr er weiter mit.«
»Oft genug hätte er bestimmt lieber gemalt.«
»So ist es. Aber er wollte nicht, dass sie sauer auf ihn sind. Also dachten sie, es sei alles wieder in Ordnung. Und so war es immer. Max war der gute Junge, hatte überall Einsen, lernte Klavier, ging in den Ruderverein und zum Tennis, alles vorzeigbar. Er half hier und da mal im Haushalt mit oder wenn mein Vater das Auto von innen sauber machte … wer sollte da auf die Idee kommen, dass es ihm nicht gut ging? Beklagt hat er sich nie.«
Plötzlich sieht sie Jonathan an, muss sich räuspern.
»Was ist?«, fragt Jonathan.
»Hast du wirklich so viel Zeit, dir das alles anzuhören? Ich komme mir gerade so komisch vor … wir haben uns noch nie gesehen, und jetzt sitzen wir hier am Springbrunnen und ich labere dich mit meinem Zeug voll. Warum machst du das?«
»Wenn es dir unangenehm ist, musst du nicht weiterreden.«
»Ist es nicht.« Sie schüttelt heftig den Kopf. »Aber du machst das alles, nur damit ich die Sachen rausrücke, die sowieso dir gehören … ich geb sie dir schon. Nur im ersten Moment war ich geschockt, weil ich nicht wusste, dass Max sie versteigert hat.«
»Im Augenblick kann ich mir noch nicht vorstellen, sie zu benutzen. Es beginnt gerade, sich so anzufühlen, als hätte ich ihn gekannt. Außerdem mag ich es nicht, nur Small Talk zu reden. Und du bist mir sympathisch, Zeit hab ich auch … passt schon.«
»Mir kommt es auch so vor, als ob wir uns länger kennen als erst ein paar Stunden.«
»Aber sag Bescheid, wenn du nach Hause musst.«
»Du weißt nicht, wie ungern ich zurzeit dort bin. Was willst du hören?«
»Mehr über dich.«
»Ich bin nicht geheimnisvoll«, weicht sie aus. »Ich sage immer, was ich denke, Geheimnisse habe ich kaum. Typen wie Max sind interessanter. Aber die werden kaum beachtet.«
»Für mich bist du interessant.« Jonathan sieht sie an, sein Blick ist so intensiv, so voller Wärme, dass ihr einen Moment lang schwindlig wird. »Du hast eine Tiefe, die ich kaum von anderen Mädchen kenne, du ziehst dich außergewöhnlich an, und du spielst ein Instrument, das auch nicht alltäglich für Mädchen ist.«
»Das Saxofon?« Natalie lacht, hört selbst, dass es ein wenig bitterer klingt als beabsichtigt. »Eigentlich wollte ich Schlagzeug lernen. Aber da war mit meinem Vater nicht zu reden.«
»Als überarbeiteter Top-Manager will er vielleicht keine Schießbude im Haus, auf die du jeden Tag stundenlang eindrischst.«
»Das hätte ich ja noch verstanden, aber es war nicht der Grund. Schlagzeug ist kein Instrument für ein Mädchen, das ist seine Meinung, und ich hatte mich danach zu richten. Das Gleiche gilt für den E-Bass.«
»Es gibt viele Bands mit einer Drummerin oder Bassistin.«
»Ich weiß, aber über die rümpft er auch die Nase. Über das Saxofon, das meine dritte Wahl gewesen ist, eigentlich auch, aber da hat meine Mutter eingegriffen und ihm klargemacht, dass er seinen Kindern nicht im Weg stehen darf, indem er nur nach seinen Interessen geht. Da hat er nachgegeben. Ihr Hauptargument war dabei aber, dass Klavier und Sax gut miteinander harmonieren. Max spielte Klavier und mein Vater steht auf Ragtime und Jazz. Da konnte er nichts mehr einwenden.«
»Spielst du denn gerne?«
Natalie nickt. »Inzwischen könnte ich mir nichts Passenderes mehr vorstellen. Ich kann damit unheimlich gut ausdrücken, was ich gerade fühle. Nur aus dem Zusammenspiel mit Max wurde nicht viel. Nach der ersten Begeisterung als Kind spielte er nur noch unseren Eltern zuliebe, außer wenn er sich unbeobachtet fühlte und einfach so herumklimpern konnte.«
»Habt ihr an Wettbewerben teilgenommen?«
»Max nicht. Da hat er sich immerhin doch mal durchgesetzt. Er ging zum Unterricht bei irgendeiner alten Schreckschraube, aber zu Wettbewerben ließ er sich nie hinreißen. Er wäre auf der Bühne wahrscheinlich zusammengebrochen vor Aufregung.«
»Und du?«
Natalie öffnet die Lippen um zu antworten, doch im selben Moment nimmt sie aus dem Augenwinkel eine Bewegung wahr und schreckt auf. Eine Gruppe Fußballfans mit Schals und Trikots in den Farben ihres Lieblingsvereins wandert grölend auf den Platz zu und verteilt sich auf die freien Bänke um den Springbrunnen.
»Komm hier weg«, sagt Natalie, hebt ihre Füße aus dem Wasser und klaubt ihre Jacke, Schuhe und Strümpfe auf. »Das halte ich jetzt nicht aus. Gehen wir irgendwo was Trinken?«
4.
Noch ehe Jonathan antworten kann, klingelt Natalies Handy.
»Meine Mutter«, erklärt sie ihm nach einem Blick auf das Display. »Ich geh kurz ran.«
Sie entfernen sich vom Springbrunnen, erst nach der Straßenecke kann Natalie die Hand von ihrer Ohrmuschel nehmen, mit der sie versucht hat, die Stimmen der Fußballfans abzuschirmen.
»Wo bleibst du nur so lange?«, hört sie ihre Mutter mit gedämpfter Stimme fragen. »Hast du nicht gesagt, du würdest nur kurz mit dem jungen Mann rausgehen, der am Nachmittag an der Tür war? Jetzt ist schon Abendbrotzeit und du meldest dich nicht.«
»Entschuldige«, antwortet sie. »Wir haben uns ein bisschen verquatscht. Ich war so lange nicht mehr einfach so draußen.«
»Aber so viel ich mitbekommen habe, kennst du den jungen Mann doch kaum, Natalie. Nicht, dass dir auch noch was passiert.«
Im Hintergrund hört sie die Stimme ihres Vaters.
»Ihr müsst euch keine Sorgen machen. Jonathan ist total in Ordnung. Darf ich nicht noch ein bisschen bleiben?«
»Wo bist du denn überhaupt? Doch nicht etwa bei ihm zu Hause?«
Natalie verdreht die Augen. »Wir gehen einfach nur spazieren und reden«, berichtet sie. »Es ist tolles Wetter und er tut mir gut.« Mehr kann sie nicht sagen, in sich spürt sie den Impuls, aufzubrausen und sich zu wehren gegen die Sorge ihrer Mutter, die sie auch jetzt als übertrieben empfindet; am Tonfall des Vaters hört sie heraus, wie er verlangt, sie solle auf dem schnellsten Wege nach Hause kommen, es sei keinesfalls zu viel verlangt, wenn die Tochter sich gerade jetzt ein wenig an die Regeln des Familienlebens halte.
Familienleben. Eine Familie ohne Max ist eine andere Familie als die, die es vorher gegeben hatte.
»Ich komme nach Hause«, verspricht sie ihrer Mutter. »Nur eine Stunde noch, oder zwei. Es geht mir gut, wirklich. Ihr könnt auch schon schlafen gehen.«
Minutenlang starrt sie vor sich hin, nachdem sie aufgelegt hat. Schlafen gehen. Was für ein absurder Vorschlag, wo sie doch weiß, dass die Mutter seit dem Tod ihres Sohnes nur noch mit starken Beruhigungsmitteln überhaupt in ein paar kurze Stunden unruhigen Schlummers fällt. Den Vater hört sie nachts oft durch die Wohnung tigern, über das Parkett im Wohnzimmer, jeden Schritt hört sie, wenn sie selbst nicht einschlafen kann. Sie will noch nicht, nicht wieder diese Schritte hören, jetzt noch nicht. Noch nicht zurück. Noch nicht fort von Jonathan, nicht von dem Beginn einer vorsichtig aufschimmernden neuen Zeit.
Sie streifen weiter durch die Stadt, der Abend ist mild, Natalie lässt ihre Jacke offen. In der Fußgängerzone bleiben sie bei einem Straßenmusiker stehen, einer One-Man-Band, der mit Gitarre, Bluesharp und einer Trommel auf dem Rücken die Passanten unterhält; einige werfen Geldstücke in seinen Gitarrenkoffer. Natalie spürt, wie die Musik in ihr Inneres vordringt, gerade das Wimmern und Schluchzen der Mundharmonika ruft ein Ziehen in ihrer Brust hervor, das sie kaum aushält. Aber sie bleibt stehen, zerrt nicht Jonathan am Arm fort, sondern lässt es zu, dass ihr die Tränen kommen, weil die Trauer sie bei den melancholischen Klängen übermannt, sie lässt sie über ihre Wangen rinnen und wischt sie nicht fort; bricht nicht zusammen, aber lässt ihren Gefühlen freien Lauf, hier mit Jonathan an ihrer Seite muss sie keine Stärke beweisen wie zu Hause neben den Eltern, wo sie oft den Eindruck hat, neben der nach außen hin unerschütterlichen Haltung des Vaters die Einzige zu sein, die alles noch aufrecht hält. Erst als sie sich schnäuzen muss, bemerkt Jonathan, was mit ihr los ist, aber auch er versucht nicht, sie weiterzuziehen, sondern legt nur schweigend den Arm um ihre Schultern und Natalie lehnt sich an ihn, er nutzt es nicht aus, dass ihre trotzige, raue Schale, hinter der sie sich anfangs noch verborgen hat, Risse zeigt, versucht nicht, sie zu küssen oder seine Hand unter ihr Shirt zu schieben. Sie stehen noch lange und hören dem Musiker zu. Erst als er eine Pause ankündigt, wischt Natalie ihre Tränen fort und sie ziehen weiter. Immer wieder spürt Natalie Jonathans Blicke auf sich ruhen, er scheint abzuwarten, bis sie sich beruhigt hat, ehe er mit ihr irgendwo einkehren will. Natalie versucht es, zwingt sich zu einer gleichmäßigen Atmung, blickt sich um, bemüht, das Treiben dieses Sommerabends aufzunehmen und sich davon ablenken zu lassen, es gelingt ihr nur schwer. Menschen spazieren eng umschlungen und lachend an ihr vorbei, Stimmengewirr dringt aus Bars, Restaurants und Clubs, und immer wieder Musik, überall Musik. Das alles wird Max nie mehr sehen, denkt sie; verdammt, er wird es nie mehr sehen und hören! Kann das wahr sein, dass er für immer unter der Erde liegt, die Augen geschlossen und nichts mehr von diesem Sommer mitbekommt, nicht von dem im nächsten Jahr, nie mehr? Kann es wahr sein, dass ich ihm später zu Hause nicht von dem Abend mit Jonathan erzählen kann, heimlich, ohne dass unsere Eltern zuhören, heute nicht und an keinem anderen Tag, und auch sonst nie mehr mit ihm sprechen, solange ich lebe? Es kann nicht sein, denkt sie und stöhnt leise auf, fühlt Jonathans Arm fester um ihre Schulter. Wir hätten viel öfter miteinander reden sollen. Es gibt so vieles, was ich nicht von ihm weiß.
Vor der Kirche hat ein Porträtzeichner seine Bilder ausgebreitet, Bleistift- und Kohlezeichnungen von Schauspielern, Politikern und Stars der aktuellen Rock- und Popszene. Eine kleine Menschentraube hat sich um ihn gebildet, die den Künstler teilweise verdeckt. Natalie zieht Jonathan trotzdem schnell weiter.
»Tut mir leid«, sagt dieser schnell. »Ich wusste nicht, dass der hier malt, sonst wär ich mit dir woanders langgegangen.«
»Er malt beschissen«, zischt Natalie. »Pinselt bloß das ab, was er sieht; das Bild von Angela Merkel hat überhaupt keine Ähnlichkeit mit ihr.«
Ein paar Umstehende drehen sich um, irgendjemand wirft ihr einen zornigen Blick zu und legt den Finger auf die Lippen, eine ältere Dame schüttelt den Kopf.
»Nicht, dass er das noch hört«, warnt sie Natalie. »Die Zeichnung ist doch gut gelungen.«
»Habe ich mit Ihnen geredet?«, gibt Natalie zurück. »Der Typ denkt, bloß weil er ihr ein paar dicke Striche von der Nase bis zu den Mundwinkeln hinklatscht, hätte er sie getroffen.« Sie wendet sich wieder an Jonathan. »Max konnte so was viel besser.«
»Hat er Angie auch gezeichnet?« Jonathan unterdrückt ein leises Lachen.
»Nicht dass ich wüsste. Aber wenn er Porträts zeichnete, dann mit Gefühl. Er hat die Leute so gemalt, wie sie wirklich sind, oder zumindest wie er sie wahrgenommen hat. Seine Gesichter sind so treffend, fast wie bei einem Karikaturisten, aber ohne diese typischen Verzerrungen und Übertreibungen. Er hatte es einfach drauf.«
»Wenn er dich gezeichnet hat, würde ich das Bild gern mal sehen«, bemerkt Jonathan. »Natürlich nur, wenn es dir recht ist.«
»Ich weiß nicht, ob es ein Porträt von mir gibt«, erwidert Natalie. »Gezeigt hat er mir keines, jedenfalls nicht in letzter Zeit. Eines hat er mir mal geschenkt, als ich dreizehn war und er fünfzehn. Da hatte ich gerade ziemlich kurze, bunt gefärbte Haare, die fand er lustig. Klar kannst du das Bild irgendwann sehen.«
Sie biegen in eine Seitenstraße ein und entdecken ein kleines italienisches Restaurant, vor dem nur drei Tische stehen; einer wird gerade frei. Jonathan nimmt Natalies Hand und beeilt sich, den Tisch zu ergattern. Als der Kellner die Speisekarte bringt und Natalie einen Blick darauf wirft, zuckt sie zusammen; hier war Max mit Annika, schießt es ihr durch den Kopf, vor ein paar Wochen erst, hinterher wirkte er unruhig und durcheinander, als ob er etwas klären wollte, aber nicht zum Zuge kam. Sie hält sich den Kopf.
Jonathan bestellt eine Portion Bruschetta zum Teilen und zwei Cola. Nach einer richtigen Mahlzeit ist beiden nicht zumute.
»Wenn Max so gut zeichnen konnte«, beginnt Jonathan vorsichtig von Neuem, sobald die Gläser vor ihnen stehen und der Kellner sich wieder entfernt hat, »wollte er das nicht später auch beruflich machen? Es gibt ja viele Möglichkeiten in dem Bereich.«
Natalie spürt, wie erneut die Wut in ihr hochkocht, obwohl sie weiß, dass Jonathan nichts dafür kann. Obwohl er so behutsam, fast unnatürlich sensibel mit ihr umgeht, obwohl er weder sie noch Max jemals vorher gesehen hat. Er ist auch nicht anders als alle Leute, denkt sie; immer dieses Gerede über Max’ Begabung, oooh, so fantastische Bilder, aber als er jemanden gebraucht hat, der ihn wirklich ermutigt, mehr daraus zu machen, war niemand da und jetzt ist es zu spät. Sie stößt einen verächtlichen Laut aus.
»So wie du, oder wie?«
Jonathan blickt verdutzt. »Wie ich? Was meinst du damit? Ich studiere Kunst, ja klar. Ist doch normal, dass man sich das aussucht, was einem am meisten liegt, oder?«
»Normal.« Natalie beugt sich vor, starrt auf die Tischplatte und dreht ihr Glas hin und her. »Sicher ist das normal. Für jemanden wie dich vielleicht. Wie du da schon sitzt mit deinem langen Zopf und den alternativen Klamotten, gehören die überhaupt dir oder hast du sie ganz spontan von jemandem aus deiner WG geliehen, weil du so schön unangepasst und außergewöhnlich bist?«
»Was soll das denn jetzt?« In Jonathans Stimme schwingt Ärger mit, aber auch Verblüffung. Er blickt an sich herunter und schüttelt den Kopf. »Natürlich sind das meine, und was die WG betrifft: Ich wohne alleine, seit meine Freundin vor drei Wochen ausgezogen ist. Du bist nicht die Einzige, der es mies geht.«
Natalie atmet tief durch und winkt ab. »Schon gut«, lenkt sie ein. »Das wusste ich nicht. Es tut mir leid. Vielleicht sollte ich besser nach Hause gehen, bevor ich den Abend ganz verderbe.«
Aber im selben Moment kommt der Kellner und bringt den kleinen Imbiss. Sobald der Duft nach geröstetem Brot, Tomaten und Knoblauch zu ihr aufsteigt, spürt sie Appetit und nimmt sich eine der Scheiben.
»Wir müssen nicht weiter darüber reden«, sagt Jonathan, und sie hört, dass er noch verwirrt und verletzt ist. So soll dieser Abend nicht enden, denkt sie, aber sie spürt jetzt auch die Anstrengung des langen Spazierganges, es ist das erste Mal seit dem Unfall, dass sie so lange zu Fuß unterwegs war, zur Schule geht sie noch nicht wieder, da die Sommerferien vor Kurzem begonnen haben. Die Kopfschmerzen drohen unerträglich zu werden, sie sehnt sich jetzt doch danach, sich auf ihrem Bett auszustrecken und den Nacken nicht mehr aufrecht halten zu müssen, es war eindeutig zu viel heute, aber vielleicht kann sie besser schlafen, so müde, wie sie jetzt ist. Durchschlafen, erfrischt aufwachen. Dieses Gefühl kennt sie schon gar nicht mehr. Vielleicht würde es ihr etwas Zuversicht verleihen, wenigstens für ein paar Minuten.
Auch Jonathan nimmt sich eine Bruschetta und beißt hinein; er hat schöne Hände, denkt Natalie. Leicht gebräunt und mit hervorschimmernden Sehnen, die Nägel gepflegt, es würde ihr guttun, wenn er über den Tisch nach ihrer Hand greifen würde und sie halten, sachte über ihre Finger streichen. Aber er tut es nicht, berührt nur sein Stück Brot und danach wieder sein Colaglas, meidet es zuerst noch, sie anzusehen, streift schließlich doch ihr Gesicht mit einem flüchtigen Blick, ein Lächeln huscht über seine Lippen.
»Also«, versucht sie, den Faden wieder aufzunehmen. »Ich hab’s nicht so gemeint, sorry noch mal. Klar wollte Max am liebsten was mit Kunst machen, nach dem Abi. Irgendwas in dem Bereich studieren. Er hat sich sogar heimlich an einer Fachoberschule für Gestaltung beworben – ich weiß nicht, wie sie hieß. Aber es hat nicht geklappt.«
»Vielleicht hat ihm das den Boden unter den Füßen weggezogen. Wenn jemand sensibel ist und nicht angenommen wird …«
Natalie zuckt zusammen, sie fühlt das Blut aus ihrem Gesicht weichen. »Max wurde angenommen«, korrigiert sie. »Es kam eben was dazwischen, das soll vorkommen, oder?« Sie streckt ihre Hand aus, um nach einer zweiten Scheibe Bruschetta zu langen, zieht sie jedoch wieder zurück. »Ich kann nicht mehr«, stößt sie hervor und legt die Hand auf ihren Bauch, als hätte sie eine halbe Gans mit Klößen und Rotkohl verdrückt. »Können wir gehen?«
Jonathan nickt, winkt den Kellner heran und legt seine Geldbörse auf den Tisch.
»Ich bringe dich nach Hause«, verspricht er.
5.
Als Natalie die Wohnungstür aufsperrt, hört sie die Stimmen ihrer Eltern aus dem Wohnzimmer, dann die Schritte ihrer Mutter, die durch den Korridor auf sie zueilt.
»Gott sei Dank, da bist du«, seufzt sie und nimmt Natalie in den Arm. »Ich weiß, ich sollte nicht so überbesorgt sein, aber seit Max … es ist so still in der Wohnung, wenn du nicht da bist.«
»Ich bin da.« Natalie hängt ihre Lederjacke an den Haken und zieht ihre Schuhe aus; es kommt ihr vor, als wäre sie ewig weg gewesen. Still in der Wohnung, das ist es wirklich, denkt sie; dabei war es mit Max keineswegs lauter, es sei denn, er drehte seine Stereoanlage voll auf, aber das kam selten vor. Als sie ins Wohnzimmer tritt, fällt ihr Blick auf den Flügel. Die Tastatur ist abgedeckt, kein Notenheft steht auf der Halterung, Max müht sich hier nicht mehr ab, das Stück für die nächste Klavierstunde durchzuackern, immer nervös, weil er mitten im Geschehen sitzt und der Vater jeden Anschlag registriert, jeden falschen Ton, jedes verkehrt bediente Pedal. Sein Klavierspiel hat mehr zu den Abenden gehört als Natalies Üben mit dem Saxofon, das immer nur höchstens eine Stunde lang geduldet war; wenn sie versehentlich länger geübt hatte, schlug die Nachbarin unter ihnen mit einem metallenen Gegenstand gegen die Heizung. Jetzt ist alles still, die Mutter steht noch ein wenig unschlüssig im Flur, der Vater sitzt auf dem Sofa, müde und grau im Gesicht, Natalie hat ihn noch nicht oft mit Bartstoppeln gesehen, doch seit Max’ Tod lässt er sie mitunter sprießen, zumindest am Wochenende. Er nickt ihr zu, dann blättert er weiter in der Fernsehzeitschrift, überfliegt einen der belanglosen Artikel darin, nimmt einen Kugelschreiber vom Couchtisch und beginnt ein Kreuzworträtsel; beim ersten Begriff, den er nicht weiß, legt er beides wieder weg. Natalie strebt auf ihn zu und beugt sich herab, um ihm einen Kuss auf die Wange zu hauchen, dann murmelt sie etwas von Müdigkeit und Kopfschmerzen. Als sie erneut an ihrer Mutter vorbeigeht, sieht diese sie fragend an.
»Morgen holt er mich wieder ab«, berichtet Natalie. »Ich mag ihn. Versuch also nicht, es mir auszureden.«
Auf dem Weg in ihr Zimmer muss sie an dem von Max vorbei. Die Tür ist angelehnt, es brennt kein Licht, Natalie blickt schnell in die andere Richtung. Er müsste da sein, der Schein seiner Schreibtischlampe müsste in den dunklen Flur fallen, und sie würde ihren Kopf durch seine Tür stecken, um zu schauen, was er macht. Max würde auf seinem Bett sitzen, den Zeichenblock auf den Knien, oder am Schreibtisch gebannt auf irgendetwas am Bildschirm starren, vielleicht für die Schule lernen, nein, doch nicht, das hat er meist im Wohnzimmer getan, weiß der Kuckuck, warum. Sie selbst wäre nie auf die Idee gekommen.
Natalie geht ins Bad, wäscht ihr Gesicht, putzt sich die Zähne. Lächelt bei dem Gedanken an Jonathan und sie mit den Füßen im Springbrunnen, doch im nächsten Augenblick steigt wieder diese Angst in ihr auf, die Angst, die sie seit … seit jenem Abend jede Nacht zu Bett bringt, die Angst vor der langen, schweigenden Dunkelheit hinter ihrer angelehnten Tür, durch die sie manchmal das Rascheln der Bettdecken ihrer Eltern hört, weil auch sie nicht einschlafen können, nicht durchschlafen, es ist alles so falsch, so sollte es nicht sein, ihr Familienleben war nicht so geplant, dass Max verschwindet, allem ein Ende setzt. Der Familie, so wie sie war. Max hat sich in ihr nicht so wohlgefühlt, dass er sie erhalten wollte. Die Familie erhalten, das tun normalerweise Eltern.
In ihrem Zimmer schaltet Natalie das Deckenlicht ein, es ist ihr zu hell und sticht ihr in die Augen, verstärkt das grelle Hämmern in ihren Schläfen, aber sie will noch nicht ins Bett, will nicht, dass es dunkel ist, die Dunkelheit lässt sie immerzu daran denken, dass auch Max kein Licht mehr sieht, nicht hier auf der Erde, vielleicht irgendwo, wo immer er jetzt ist, aber nicht hier, nicht das künstliche Licht im Zimmer, nicht die Sonne oder den Mond. Nicht dasselbe Licht, das sie sehen kann.
Anders als früher legt sie ihre Sachen glatt auf den Stuhl neben ihrem Bett, schiebt Stifte und Papier auf ihrem Schreibtisch hin und her, lässt die Rollos herab, löscht schließlich doch das Licht, die Müdigkeit ist nicht mehr zu ertragen. Das Fenster bewegt sie in Kippstellung, um ein wenig Kontakt zur Außenwelt zu behalten, der leichte Hauch, der nun hereinweht erinnert Natalie daran, dass sie selbst eben noch draußen war und jederzeit wieder gehen kann. Ein bisschen vom Leben zurückerobern.
Doch als sie endlich liegt und nur noch die Nacht um sie herum ist, sind die Bilder wieder da. Natalie muss sich zwingen, nicht an die ausgeschaltete Deckenlampe zu starren, die aus weißen Milchglaskugeln besteht, jedes Mal im Dunkeln stellt sie sich Max’ Schädel bei diesem Anblick vor, also kneift sie die Augen zu wie ein Kind nach einem Albtraum, aber das ist es ja auch, ein Albtraum, aus dem sie nie wieder erwachen wird, genau wie Max, der ebenfalls nie mehr aufwacht, nie mehr »Guten Morgen« zu ihr sagen wird.
Ich hätte ihn damals nicht abwimmeln sollen, denkt sie wieder und wieder, wie in jeder Nacht, seit sie wieder so weit bei Bewusstsein ist, dass die Erinnerungen sie heimsuchen, die Wochen und Tage vor Max’ Selbstmord und das, was sie als ihre Schuld daran empfindet. Sie hat Jonathan nicht alles erzählt, noch nicht, konnte nicht. Es würde ihre Schuldgefühle nicht auslöschen, und die Tatsache, dass sie sie mit ihm teilen könnte, würde ihr keine Erleichterung verschaffen. Sie kann es nicht mehr rückgängig machen. Ich habe meinen Bruder weggeschickt und allein gelassen, als er mich am meisten brauchte, und jetzt kommt er nie mehr zurück, denkt sie.
Es stimmt nicht, dass sie einen Filmriss hat. Natalie weiß alles noch ganz genau, jede Einzelheit dieser wenigen Minuten, die zu seinem Tod geführt haben mussten. Sobald sie aus dem künstlichen Koma, in das man sie im Krankenhaus versetzt hatte, wieder erwacht und bei halbwegs klarem Verstand gewesen war, kam alles zurück und verfolgt sie seitdem in jeder Nacht und auch tagsüber, egal was sie tut, auch an diesem Nachmittag und Abend, während sie mit Jonathan unterwegs gewesen war. Max’ Augen, als er zum Musiksaal gekommen war, um sie zu bitten, mit ihm nach Hause zu kommen. Das eindringliche Flehen in seiner Stimme. Er hatte solche Angst vor dem Vater gehabt, weil er sich heimlich an jener Kunstschule angemeldet hatte, die sie Jonathan gegenüber heute Abend erwähnt hat, es war klar gewesen, dass der Vater durchdrehen würde, aber Max hatte es trotzdem getan, hatte es einfach gemacht, das allein war für ihn schon viel gewesen. Ich hätte mitgehen sollen, kreist es wieder in ihrem Kopf; wenn ich nur mitgegangen wäre. Meine Argumente zählen bei Papa auch nicht, aber Max hätte jemanden an seiner Seite gehabt, sich nicht so verlassen gefühlt. Sie war nicht gegangen, weil sie mit dem Schulorchester geprobt hatte, wie wichtig war ihr das erschienen, wichtig, wichtig. Es war nicht wichtiger als Max, sie hatte seine Not doch gesehen, sie hätte mitgehen sollen, was ist schon eine Orchesterprobe gegen das Leben ihres Bruders, gar nichts ist sie dagegen. Sie hätte mitgehen und dem Vater mit drei kraftvollen Sätzen klarmachen sollen, dass weder Maximilian noch sie die Marionetten ihrer Eltern seien, und dann hätte Max seinen Traum vielleicht weiterverfolgt, der Vater hätte nicht ewig in seinem selbstgerechten Zorn verharren können.
Ich habe seine Angst nicht ernst genug genommen, brütet sie weiter. Aber alle aus ihrem Orchester hatten mit den Augen gerollt und gestöhnt, auch der Lehrer hatte seinen Unmut bekundet, als sie ihr Instrument abgelegt hatte und zu Max gegangen war. Hatte genervt reagiert und gedacht, wieso kann er nicht einmal etwas alleine schaffen, ich bin nicht seine Nanny, Max muss endlich mal Biss zeigen. Hatte über die Blässe seines Gesichts hinweggesehen, die weißen Lippen ignoriert, ihn fortgeschickt. Aber den Rest der Probe hatte sie schlecht gespielt, war unkonzentriert gewesen, das Gefühl für die Musik war ihr abhanden gekommen. Die Probe schien kein Ende zu nehmen, gerade weil Natalie so oft von vorn beginnen musste; hinterher flog sie geradezu nach Hause, sie weiß noch genau, wie das Gewicht des Saxofons in der Tragetasche auf ihre Schultern drückte und ihr beim Rennen der Schweiß ausbrach. Doch als sie endlich ankam und die Wohnungstür aufstieß, hatte Max längst in seinem Zimmer gesessen, äußerlich ruhig, was auch sie beruhigt hatte, auf den Knien seinen Laptop. Natalie war erleichtert gewesen, auch darüber, dass Max in der folgenden Zeit ausgeglichener gewirkt hatte, nicht fröhlich, aber ruhiger, als hätte er sich abgefunden, Frieden geschlossen. Abgeschlossen mit allem. Sie hätte es wissen müssen, es ihm anmerken, die Zeichen waren doch da. Abgeschlossen mit dem Leben. Ein Leben ohne seine Kunst konnte es für Max nicht geben.
Natalie kriecht tiefer unter ihre Decke wie ein Kind, denk an was Schönes, hatte ihre Mutter früher immer gesagt, wenn sie schlecht geträumt oder vor etwas Angst hatte. Es gibt nichts Schönes mehr. Versuch, an Jonathan zu denken. Jonathan, beschwört sie sich im Stillen; Jonathan, Jonathan, sei wenigstens du ein winziges Licht in dieser endlosen schwarzen Traurigkeit, die sich anfühlt wie flüssiger Teer, noch nicht abgekühlt, noch nicht zur Straße geworden, auf der man längst wieder fährt oder geht, egal was vorher gewesen ist. Jonathan kommt morgen wieder. Diese Nacht muss Natalie überstehen, vielleicht schafft sie es. Einmal ohne Kopfschmerzen aufwachen; bisher hat sie es abgelehnt, die verschriebenen Schmerzmittel zu nehmen, aber jetzt tut sie es doch, die Begegnung mit Jonathan hat sie aufgewühlt, dieses leise Gefühl von Freude passt noch nicht, aber die Abwesenheit von Schmerz wäre schon etwas wert. Morgen werden sie hier bleiben, egal was die Eltern sagen. Jonathan hat angeboten beim Ausräumen zu helfen, ein Junge in Max’ Zimmer. Eigentlich ist es zu früh. Natalie schläft nicht ein.
6.
Es dämmert bereits gegen vier Uhr früh und Natalie hat noch immer nicht geschlafen. Das anbrechende Tageslicht verschafft ihr nur geringe Erleichterung, sie wartet darauf, endlich aufstehen zu können, tagsüber kann sie sich ablenken, auch wenn die Gedanken weiter kreisen, die Schuldgefühle sie in jeder Minute begleiten. Wenn sie sich mehr um Max gekümmert hätte, wäre sie sicher auch konsequenter gewesen, als sie Max an seinem letzten Abend so aufgebracht gesehen hatte. Sie hatte doch dieses ungute Gefühl gehabt, mehr als deutlich, als er sich hinters Steuer gesetzt hatte, und wahrscheinlich war es Paul und Annika nicht anders gegangen. Natalie hätte ihren Bruder bitten sollen, nicht zu fahren, eindringlich, hätte ihm den Schlüssel wegnehmen sollen und den Vater anrufen, ihn bitten, sie alle abzuholen. Max war der Einzige von ihnen gewesen, der keinen Alkohol getrunken hatte, und dennoch. Er hätte nicht fahren sollen, irgendwas war vorgefallen, sonst wäre Max nicht durchgedreht, Max war nicht der Typ, eigentlich blieb er immer ruhig, zumindest äußerlich. Vielleicht hatten sie sich gestritten und Paul hatte Annika nach dem Mund geredet, statt seinem Freund beizustehen. Paul, dieser Wichtigtuer, irgendwann in den nächsten Wochen muss er Geburtstag haben, achtzehn Jahre alt wird er, volljährig, sie ist gespannt, ob er zu diesem Anlass genauso den dicken Macker heraushängen lassen wird, wie er es vorhatte, selbst jetzt, wo Max ums Leben gekommen ist. Sie wird nicht hingehen.