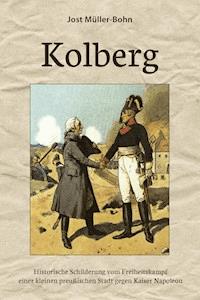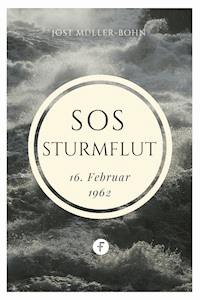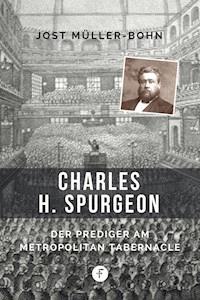Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Folgen Verlag
- Kategorie: Religion und Spiritualität
- Serie: 2. Weltkrieg
- Sprache: Deutsch
Im abschließenden Band der Trilogie erleben wir die dramatischen Schicksale jener, die den Krieg überlebt haben. Wir erfahren, wie sich versteckte Juden der tödlichen Treibjagd in Berlin entziehen konnten, welche Gefahren und Entbehrungen sie durchstehen mussten und wer am Ende Zuflucht fand. Gleichzeitig begleitet der Leser Eberhard Nowak, der nach einer Notlandung tief im russischen Urwald um seine Rückkehr kämpft. Sein Überleben gleicht einem Wunder, doch der Weg zurück in die Heimat ist voller Gefahren. Währenddessen versucht die Familie Nowak in Berlin, mit der allgegenwärtigen Angst umzugehen – in der ständigen Ungewissheit über das Schicksal ihrer Söhne und Freunde. In einer bewegenden Rückschau entfaltet sich die Geschichte der Überlebenden. Jahre nach Kriegsende, im wiedervereinigten Jerusalem, kommen sie zusammen, um ihre Vergangenheit zu reflektieren. Dort, in der heiligen Stadt, erkennen sie in geistlicher Deutung die zerstörerische Natur des antichristlichen Regimes des Dritten Reiches und finden Trost in ihrem Glauben. Die Trilogie Bleib du im ewgen Leben mein guter Kamerad zeigt mit eindringlicher Tiefe, wie gläubige Menschen inmitten eines brutalen Krieges um Menschlichkeit, Mut und Wahrhaftigkeit ringen mussten. Sie erzählt von Überleben und Verlust, von der Kraft des Glaubens und der Hoffnung, die selbst in dunkelster Zeit nicht erlischt.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 339
Veröffentlichungsjahr: 2017
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Bleib du im ewgen Leben mein guter Kamerad
Band III
Jost Müller-Bohn
Impressum
© 2017 Folgen Verlag, Langerwehe
Cover: Caspar Kaufmann
Autor: Jost Müller-Bohn
ISBN: 978-3-95893-049-0
Verlags-Seite: www.folgenverlag.de
Kontakt: info@folgenverlag.de
Dieses eBook darf ausschließlich auf einem Endgerät (Computer, eReader, etc.) des jeweiligen Kunden verwendet werden, der das eBook selbst, im von uns autorisierten eBook-Shop, gekauft hat. Jede Weitergabe an andere Personen entspricht nicht mehr der von uns erlaubten Nutzung, ist strafbar und schadet dem Autor und dem Verlagswesen.
Das eBook Bleib du im ewgen Leben mein guter Kamerad – Band 3 ist als Buch erstmals 1985 erschienen.
Autorenvorstellung
Jost Müller-Bohn, geboren 1932 in Berlin, ist der bekannte Evangelist und Schriftsteller von über 40 Büchern. Er studierte in Berlin Malerei und Musik. Über 40 Jahre hielt er missionarische Vorträge. Seine dynamische Art der Verkündigung wurde weit über die Grenzen Deutschlands hinaus bekannt.
Als Drehbuchautor und Kameramann ist er der Begründer der „Christlichen Filmmission“. Seine Stimme wurde unzähligen Zuhörer über Radio Luxemburg bekannt. Einige seiner Bücher wurden zu Bestsellern in der christlichen Literatur.
Inhalt
Titelblatt
Impressum
Autorenvorstellung
Dieses Jahr in Jerusalem
Aufklärer, wenn ich bitten darf
Jerusalem, die Burg des Friedens
Erster Feindflug – ein glatter Verlust
Der Ruf der Heimat
Der rote Bär und der braune Adler
Zwischen Berlin und Jerusalem
Gott hat Wege in der Wildnis
Retter über Stalingrad
Treibjagd durch Berlin
Als Feuer und Schwefel vom Himmel fielen
Die Schatten deiner Flügel
Unsere Empfehlungen
Dieses Jahr in Jerusalem
»Die Flügel sind stark, die mich tragen«, denkt Frau Nowak, während die Landeklappen des Jumbo-Jets ausgefahren werden. Die Boeing 747 befindet sich im Landeanflug auf den Flughafen von Tel Aviv.
Mit forschenden Blicken durchschreiten die Stewardessen die Gänge des gewaltigen Luftriesen, um zu überprüfen, ob alle Passagiere die Sicherheitsgurte vorschriftsmäßig angelegt haben.
»Sehen Sie dort, gnädige Frau, die funkelnden Lichter, das ist der Strand von Tel Aviv – oh, herrliches Israel, mein geliebtes, schönes Israel!«
Voller Begeisterung deutet ein leicht ergrauter Israeli auf die unzähligen Lichter in der großen Weltstadt des jungen Staates hin.
»Ein schönes Bild«, pflichtet ihm Frau Nowak bei. »Ja, einmalig schön.«
Die Beleuchtung im Passagierraum erlischt, um den Fluggästen den faszinierenden Anblick der Stadt noch eindrucksvoller werden zu lassen. Über den Schaumkronen des Mittelmeeres spiegeln sich die bunten Lichter der Geschäftsviertel. Durch die Bordfunkanlage erklingt die weltbekannte Melodie des Liedes: »Hevenu Shalom Alechem«. In die flotten Rhythmen stimmen die Israelis, aber auch einige andere Passagiere mit ein. Dazu klatschen sie schallend in die Hände. Freudenrufe sind zu vernehmen.
»Halleluja – Halleluja!« singen einige hocherfreut, während die Linienmaschine aus Frankfurt am Main auf die Stadt zuschwebt.
»Ist das nicht ein einmaliges Erlebnis?« fragt Michael Deutschkron seine Nachbarin. »Immer wieder ist mir so, als würde ich zum ersten Mal das ›Gelobte Land‹ erreichen, das Land Abrahams, Isaaks, Jakobs und aller Propheten.«
Frau Nowak nickt mit dem Kopf. Tränen steigen ihr in die Augen, Tränen der Freude, aber auch Tränen der Erinnerung an eine unglückselige Vergangenheit. Jetzt überquert die Düsenmaschine die belebte Innenstadt in nur geringer Höhe. Langsam schwebt der Riesenvogel der EL AL dem Ben-Gurion-Flughafen zu. Noch immer schaut Frau Nowak über die große Tragfläche der Boeing 747 bis hin zu den Positionslichtern. Wieder erklingt in ihr leise das Lied: »Die Flügel sind stark, die mich tragen, und unter den Flügeln ist Ruh.«
»Ich wünsche Ihnen einen glücklichen und gesegneten Aufenthalt in Israel, gnädige Frau. Wenn ich Ihnen bei den Zollformalitäten behilflich sein kann«, er macht eine einladende, elegante Geste, »aber Sie werden ja wohl gleich von Ihrer Bekannten in Empfang genommen. Also ›Shalom‹ und viel Freude im Land der Bibel!«
Als sie die Stufen der Gangway hinuntergehen, flutet ihnen tropische Wärme entgegen. Samtweich ist die Luft, die sich leider mit dem penetranten Geruch der Abgase von Kerosin und Öl vermischt.
Ruth Engelmann steht in der Empfangshalle des Flughafens inmitten einer erregten Menge von Wartenden. Von Zeit zu Zeit stellt sie sich auf die Zehenspitzen, um besser sehen zu können. Sie hält Ausschau nach ihrem heiß erwarteten Gast aus Deutschland. Ihr kommen die Nachkriegsjahre in der einstigen Heimat in den Sinn und das Durchgangslager Friedland, wo sie oft und lange, voller Erwartung und tiefer Sehnsucht auf die zurückkehrenden deutschen Soldaten geblickt, aber nur einen, ihren Hans Nowak, erwartet hat. Doch er kam nie. Wie lange hatte sie vergeblich dort gestanden mit einem großen Schild vor sich:
›Wer kennt den Kameraden Hans Nowak?
Letzter Standort: STALINGRAD‹
Damals lebte sie bei Frau Nowak, die von Mitteldeutschland in den Westen übergesiedelt war. Ihr Hans kam nicht zurück. Er hatte sich freiwillig für einen Kameraden zurückstellen lassen. An seiner Stelle war der Familienvater Siegfried Kittel aus dem Kessel von Stalingrad herausgeflogen worden.
Ruth war noch immer eine hübsche, gepflegte Frau in den besten Jahren. Sie wanderte 1965 nach Israel aus, denn alle ihre Verwandten und viele der einstigen Bekannten waren durch die grausame Treibjagd während des Hitlerregimes in irgendwelchen Konzentrationslagern ums Leben gekommen. Sie selber verdankte ihr Leben einigen Berliner Familien, die ihr Unterschlupf gewährt und so geholfen hatten, dass sie nicht entdeckt wurde.
Christen hatten den Mut besessen, und das unter Lebensgefahr, sie zu verstecken, bis die Stunde der Befreiung geschlagen.
»Mutter! – Mutter! – O, meine Mama!« rief Ruth aufgeregt und umarmte Frau Nowak stürmisch unter vielen Küssen.
Nachdem Frau Nowak ihr Gepäck in Empfang genommen hat, gehen die beiden zu einem Taxi. Die Nacht bricht schnell herein, die Sonne ist am Horizont versunken. Von einer Minute auf die andere hat die Dunkelheit das Sonnenlicht über Israel verdrängt. Sanfter, milder Wind streicht vom Meer her über die flache Küstenlandschaft. Nach der drückenden Hitze des Tages drängen sich die Bürger der Stadt auf den Straßen, um die angenehme Kühle des Abends zu genießen. Durch dunkle Wälder schnurrt der Dieselmotor des Taxis. Spiralenförmig windet sich die ausgebaute Straße hinauf nach Jerusalem. Mitten in der Stadt, und zwar in der Yaffa-Street, verlassen die beiden das Taxi. Ruth führt Frau Nowak die Treppe hinauf, ihre Wohnung liegt im zweiten Stock.
»Willkommen, Mama, herzlich willkommen bei deiner israelischen Tochter! – Fühl dich hier ganz daheim und wohl, so wie ich mich viele Jahre nach dem Krieg bei dir geborgen wissen durfte.«
Eine behagliche Dreieinhalb-Zimmer-Wohnung, geschmackvoll eingerichtet, ist Ruths Zuhause. Frau Nowak mustert alles mit erstaunten Blicken. Auf einem Sideboard steht, von Blumen geschmückt, das Bild ihres Sohnes Hans.
»Mach es dir bitte bequem, Mutter!« fordert Ruth ihren Gast auf.
»Hier findest du das Bad, wo du dich frischmachen kannst. Ich will uns inzwischen das Abendessen herrichten.«
Sie gibt ihr einen liebevollen Kuss auf die Stirn und eilt dann in die Küche. Frau Nowak tritt für einen Augenblick auf den kleinen Balkon, um den Anblick der Stadt Jerusalem mit nächtlicher Beleuchtung in sich aufzunehmen. Von hier aus kann sie einen kleinen Teil der angestrahlten Stadtmauer und den Davidsturm sehen. Der Wind rauscht in den Palmen, die vor dem Haus stehen. Rabbiner mit langen Bärten und schwarzen Hüten gehen, still betend, die Straße entlang. Zeitungsjungen rufen die letzten Nachrichten des Tages aus. Hin und wieder sieht man auch hübsche, junge Israelis Arm in Arm mit ihren Mädchen.
Wie schön doch diese Menschen sind, denkt Frau Nowak. Welch einen Ungeist der Dämonie hatte der Nationalsozialismus damals in die deutschen Landsleute gepflanzt: jüdische Untermenschen! – Abschaum der Menschheit! – Vom barbarischen Judenblut war die Rede gewesen. Es war nicht zu fassen, dass eine ganze Nation sich hatte hinreißen lassen, diese Menschen ausrotten zu wollen! Traurig geht Frau Nowak ins Zimmer zurück.
Ruth stellt die siebenarmige Menorah auf den Tisch und zündet die Kerzen an. Wie festlich alles aussieht.
Nach dem Essen sitzen die beiden Frauen beim flackernden Schein der Kerzen und lassen die Vergangenheit in Worten noch einmal auferstehen.
Frau Nowak hat mehrere Fotoalben mitgebracht. Was nicht in Bildern festgehalten ist, kramt sie aus der Erinnerung hervor, aus den Tagebüchern ihres Mannes und aus eigenen Aufzeichnungen. Auch Ruth weiß viel von ihrer dramatischen Flucht und Rettung zu erzählen. Nach einiger Zeit erkundigt sich Ruth: »Wie geht es eigentlich Eberhard?«
»Das kannst du ihn bald selber fragen«, entgegnet Frau Nowak, milde lächelnd.
»Wie soll ich das verstehen?« Neugierig blickt Ruth ihre deutsche Mama an.
»Ja, ja, mein Kind, Überraschungen bringen oft ungeahnte Glücksgefühle in unser Leben!«
»Ist er etwa auch hier?«
»Eberhard kam letzte Woche mit seiner Frau nach Israel, um das Land kennenzulernen und mit uns das Passahfest zu feiern.«
»Das ist ja wunderbar!« Ruth ist ganz außer sich vor Freude. Damit hatte sie überhaupt nicht gerechnet. »Ein österliches Familientreffen in Jerusalem!«
»Nur Hartmut fehlt, er konnte leider nicht mitkommen«, seufzt Frau Nowak. Ihr Gesicht bekommt dabei einen leicht melancholischen Ausdruck, Ruth beobachtet sie von der Seite und stellt fest, wie gütig und liebenswürdig sie doch aussieht. Der Glanz in ihren Augen lässt Nachsicht und Milde erwarten. Die Fältchen um die Augen und in den Wangen verheißen Frieden und Segen. Ganz leise sagt Frau Nowak: »Ach, wenn Vater und Hans doch noch bei uns wären und das Wunder der Sammlung eures Volkes, der Kinder Israels, hätten miterleben können, sicher würden auch sie vor Freude weinen.«
»Sie weilen bereits in einer besseren Welt, Mutter, und vielleicht blicken sie vom ›Himmlischen Jerusalem‹ auf uns herab«, antwortet Ruth tröstend.
Nach einem tiefen Seufzer sagt Frau Nowak: »Wie lange ist das alles schon her!« Über die flackernden Kerzen weht ein Hauch der Vergangenheit.
Aufklärer, wenn ich bitten darf
Bei der Musterung in Berlin-Lichterfelde wünschte Eberhard: »Aufklärer, wenn ich bitten darf, Herr Oberstabsarzt!«
Der Arzt machte sich seine Notizen, seine Augen schienen undurchdringlich.
»Großer Gott, hilf mir! Ich möchte nie in die Gefahr kommen, das Leben eines anderen Menschen auslöschen zu müssen. Hilf, Herr Jesus, denn dir ist alle Gewalt gegeben, im Himmel und auf Erden!« betete Eberhard im stillen. »Du kannst selbst die Gedanken eines Oberstabsarztes beeinflussen!«
Dem Wunsche wurde stattgegeben. Deshalb kam Eberhard zur Grundausbildung zur Luftwaffe und später zum Spezialunterricht für Fernaufklärer.
Eberhard Nowak hieß der »Neue«. Bald hatte es sich bei den Kameraden der Staffel herumgesprochen, er sei ein »Frommer«! Es gab geradezu einen kleinen Aufstand, als bekannt wurde, dass der Neue bei Tisch betete, und zwar am Morgen wie am Abend. Stets hatte er auch seine kleine Taschenbibel dabei! Wie konnte man einen solchen »Waschlappen« beim fliegenden Personal gebrauchen?, dachte wohl mancher.
Leutnant Hansen wollte sich mit diesem Sonderling unbedingt auf den Prüfstand der Bewährung begeben. Sein Plan stand fest, diesen, noch nicht ausgereiften jungen Mann, den härtesten Anforderungen bei einem Probeflug zu unterziehen. Durchdringend musterte er den Oberfähnrich, der zur kampferprobten Einheit als examinierter Kampfbeobachter frisch hinzugekommen war. Dieser Nowak entsprach keineswegs der schneidigen Erscheinung eines Soldaten der vielgerühmten deutschen Luftwaffe. Bei Höhenflügen bekam er regelmäßig Magenbeschwerden. Er betrachtete zudem alle körperlichen Anspannungen, die ihm das Fliegen verursachte, als von Gott auferlegte Prüfungen. Privat liebte er klassische Musik, war Nichtraucher und enthielt sich, soweit er nur konnte, allen Ausschweifungen und sinnlosen Saufgelagen.
Als er sich freiwillig zu den Fernaufklärern meldete, wurde seine Begabung als guter Fotograf wohlwollend anerkannt, aber seine Neigung zur Weitsichtigkeit nicht bemerkt. Während des Offizierslehrgangs verstand es der Oberfähnrich, diese kleine Augenschwäche zu verbergen. Im Grunde war es für den Bildbeobachter kein entscheidender Nachteil, denn bei der Auswertung der Frontaufnahmen konnte er sich getrost eine starke Lupe zu Hilfe nehmen.
›Ich will ihn auf Herz und Nieren prüfen‹, dachte der Flugzeugführer, ›ehe ich mit ihm bei den wilden Turbulenzen über Feindgebiet eine Pleite erlebe.‹
»Sagen Sie, Nowak, warum haben Sie sich eigentlich nicht zum Dienst beim Bodenpersonal gemeldet?«
»Ich wollte unter allen Umständen vermeiden, eine Waffe gebrauchen zu müssen, Herr Leutnant, weil ich als überzeugter Christ auf keinen Menschen schießen will.«
»Wie kamen Sie denn durch die Tauglichkeitsuntersuchung?« »Herr Leutnant, ich hatte einen unsichtbaren Helfer«, bekannte Eberhard.
Es schien, als habe er beim Leutnant einen schlechten Tag erwischt, denn dieser beobachtete seinen Neuling sehr misstrauisch. Mit leichter Ironie bemerkte er:
»Sie meinen wohl, sich im Ernstfall zwischen Himmel und Erde auch auf diesen sogenannten ›unsichtbaren Helfer‹ verlassen zu können?«
»Ich bin fest davon überzeugt, Herr Leutnant.«
Ein etwas zynisches Grinsen legte sich über das Gesicht des Offiziers, als er sagte:
»Aber kotzen Sie mir nicht jedes Mal die Maschine voll!« »Ich bitte Sie, Herr Leutnant, es mit mir zu wagen.«
Nowak glaubte, einen etwas versöhnlicheren Ton aus den Worten »… nicht jedes Mal …« heraushören zu können. Er nahm Haltung an und antwortete: »Augenblicklich fühle ich mich stabil und den Anforderungen gewachsen.«
»Wie Sie meinen. Sie können sich natürlich durchaus noch einmal vom Oberstabsarzt gründlich untersuchen lassen. Vielleicht erhalten Sie dann doch eine Untauglichkeitsbescheinigung.« Der Leutnant wirkte jetzt doch unerbittlich.
»Wenn ich erst in die Hände der Ärzte komme, so bedeutet das unweigerlich zeitraubende, langwierige Untersuchungen, und wer weiß, wohin man mich dann verfrachtet. Wie ich schon sagte, ich möchte auf keinen Fall zum Bodenpersonal, Herr Leutnant, ich bitte darum.«
»Komisch, komisch finde ich das. Die meisten sind darauf bedacht, irgendwo einen Drückebergerposten zu erhalten, und Sie wollen unter allen Umständen hoch in die Luft?« Der Leutnant fragte lächelnd:
»Sagen Sie mal, Nowak, so ganz privat, welche Berufsabsichten haben Sie eigentlich nach dem Krieg?«
»Wenn es im Willen Gottes ist, würde ich gern als Pastor das Evangelium verkündigen, Herr Leutnant.«
»So, so, wenn es der Wille Gottes ist …, und nun meinen Sie, in einem Kampfflugzeug dafür gute Erfahrungen sammeln zu können? Menschenskind, Nowak, in solch einer wackeligen Metallkiste können Sie sich doch nicht zum Theologen ausbilden!«
»Herr Leutnant, wenn die Gefahr am größten, ist Gott am nächsten, davon bin ich felsenfest überzeugt.«
»Ich möchte Ihren Glauben ja nicht antasten, Nowak, aber eines kann ich Ihnen versichern, ein Feindflug ist keine Spielerei! Dabei können Sie nicht singen: ›Nur wer dem Tod ins Angesicht schauen kann, der Soldat allein ist der freie Mann!‹ Dazu haben Sie dann keine Zeit mehr.« Herausfordernd sah er ihn an.
Eberhard aber blieb dem Leutnant keine Antwort schuldig: »Vielleicht gilt dann das Wort: ›Wenn alles bricht, Gott verlässt uns nicht, denn größer als der Helfer ist die Not ja nicht‹.«
Fromme Sprüche kennt er, dachte Hansen. Kurz entschlossen befahl er:
»Also gut, Herr Theologe, im Augenblick haben wir andere Sorgen, also gehen wir!«
Mit watschelnden Schritten wegen der klobigen Fliegerstiefel gingen die beiden zu den Liegeplätzen der Kampfflugzeuge. Das Bodenpersonal war gerade damit beschäftigt, die Maschinen startklar zu machen. Unter brüllendem Lärm wurden die starken Motoren abgebremst und magnetmäßig überprüft. An der »Diebischen Elster« warteten Feldwebel Schwarzkopf, der Funker und Bordmechaniker, und der Obergefreite Franz Springer, der Bordschütze. Auffallend kühl und reserviert begrüßten sie den »Neuen«. Die Männer hatten ihrer Maschine den Namen »Diebische Elster« gegeben, weil sie dem Feind möglichst alle Geheimnisse seiner rückwärtigen Bewegungen mit diebischer List entreißen wollten. Leutnant Hansen, der jetzt zu ihnen trat, lächelte aufgeräumt:
»Also, meine Herren, es kann losgehen!« Dabei zwinkerte er den kampferprobten »alten Hasen« verschmitzt zu.
An diesem Morgen sollte die gesamte Staffel für den Ernstfall getestet werden. Fünf Besatzungen mussten aus Gründen der Ergänzung für gefallene Kameraden in die Staffel neu eingeführt werden.
In aller Ruhe legten sich die Männer ihre Fallschirme an. Hansen kletterte auf den Pilotensitz und schnallte die Rückengurte fest. Eberhard nahm auf dem Hocker des Beobachters Platz. Schwarzkopf hantierte im rückwärtigen Teil der Kanzel an seinen Instrumenten herum, während sich Springer bequem in die Wanne legte. Hansen ließ die Maschine mit rasanter Geschwindigkeit zum Startpunkt rollen. Feldwebel Schwarzkopf ahnte bereits: das wird ein »Zirkusunternehmen« erster Klasse! Hansen will dem »Neuen« zeigen, was eine Harke ist.
Die »Elster« erzitterte unter dem Dröhnen der beiden 1500 PS starken Motoren. Der Startposten senkte die Flagge, Hansen gab Vollgas und beschleunigte dadurch die Propeller auf 1400 Umdrehungen pro Minute.
»Startklappen sind auf Startstellung ausgefahren!« meldete Eberhard befehlsgemäß. Hansen nickte und ließ den Vogel wie wild über die Startbahn rollen. Er drückte die Steuersäule an sich, bis das Leitwerk abhob und die Maschine mit der Gewalt von fast 3000 PS im Tiefflug davonbrauste. Nervös fingerte er mit seiner linken Hand an den Instrumenten herum. Ein leiser Ruck zeigte an, dass das Fahrwerk eingefahren war.
»Fahrwerk eingefahren«, meldete Nowak.
»Habe ich auch schon gemerkt! Vielen Dank!« höhnte der Pilot, obwohl die Meldung seines Beobachters einwandfrei war.
Die Maschine holte gierig Fahrt auf, sie wurde weich und schwebte schließlich gelöst zwischen Himmel und Erde. Eberhard atmete auf. Die leichte Bedrückung während des tollen Alarmstarts hatte sich verflüchtigt. Ein Gefühl irdischer Gelöstheit nahm von ihm Besitz. Er war bereit, den Beweis seiner Eignung für diesen Posten zu erbringen und alle Kraft zum Gelingen des Fluges unter schwersten Bedingungen einzusetzen. Bei dem lauten Geheul der beiden Triebwerke dachte er an die Worte:
»Aber die auf den Herrn harren, kriegen neue Kraft, dass sie auffahren mit Flügeln wie Adler, dass sie laufen und nicht matt werden, dass sie wandeln und nicht müde werden.«
Nein, er wollte nicht versagen, es sollte sich keine Schwäche breitmachen. Er war überzeugt, dass der Herr dem Schwachen Stärke geben würde und dachte an seinen Taufspruch: »Lass dir an meiner Gnade genügen; denn meine Kraft ist in den Schwachen mächtig.«
Nun hatte die »Elster« ihre normale Fluggeschwindigkeit von 450 km/h erreicht. Hansen forcierte das Tempo, scharf zog er das Höhenruder an sich, so dass sich der Vogel mächtig aufbäumte. Im äußersten Steigwinkel gewann die Maschine an Höhe. Eberhard schielte verstohlen auf das Variometer. Bald werden wir die Gipfelhöhe von 8000 Metern erreicht haben, dachte er. Mit seiner Sauerstoffmaske und der dunklen Sonnenbrille sah er wie ein vorsintflutliches Lebewesen aus. Tief unter ihnen lagen, märchen-haft verkleinert, die Straßen, Flüsse und Brücken; selbst beachtlich große Städte wurden zu tellergroßen Flecken. »Was ist der Mensch, dass du seiner gedenkst«, Eberhard dachte an dieses Bibelwort. Von einer solchen Höhe konnte man überhaupt kein menschliches Wesen wahrnehmen, keines dieser selbstherrlichen, überheblichen und aufgeblasenen Geschöpfe. Von der Krone der Schöpfung war aus dieser Entfernung nichts auszumachen.
Hansen beobachtete konzentriert das Armaturenbrett. Nur manchmal glitt sein Blick zur Seite. Er wollte Nowak nicht quälen, aber knallhart die Grenze von dessen Belastbarkeit erkunden.
»Schalte die Pumpen auf Steuerbordflächenbehälter um«, meldete Eberhard.
Seine Stimme klingt gefasst, dachte der Leutnant, bis jetzt noch. »Verstanden!« rief er.
»Die Pumpen arbeiten unregelmäßig; der linke Flächenbehälter wird zu schnell entleert«, fügte der Oberfähnrich noch hinzu. »Sie passen prächtig auf«, dankte der Leutnant und straffte sich: »Achtung! An alle!« schnarrte es aus der Ohrmuschel der FT-Haube:
»Ich fliege jetzt Gefahrenzustände! Erbitte mir höchste Konzentration auf allen Gefechtsposten aus!«
Hansen drückte die Steuersäule nach vorn, die Maschine neigte sich steil nach unten. Eberhards Hände verkrampften sich an den Metallholmen seines Hockers angesichts der ungeheuren Tiefe, die sich vor seinen Augen auftat. Er stemmte die Füße gegen die Abgrenzung der Instrumentenanlage. Sein sensibler Magen machte sich bemerkbar. Wie ein Wurfgeschoß rauschte die Elster mit rasender Geschwindigkeit der Erde entgegen.
»Herr, bewahre uns jetzt und lass das Flugzeug nicht am Boden zerschellen!« waren Eberhards Gedanken.
Wiesen, Wälder, Äcker, Flüsse, Straßen und Häuser kamen aus dem Schlund der Tiefe bedrohlich näher. Die Maschine besaß keine Sturzflugbremsen, deshalb erforderte es vom Piloten höchstes, fliegerisches Können, das Flugzeug rechtzeitig mit stärkstem Steuerdruck zu bändigen und es wieder in den horizontalen Flug überzuleiten. Die Bleche der Tragflächen flatterten erheblich und schienen durch die Überbelastung des Sturzfluges zerbersten zu wollen. Mit aller Kraft zog Hansen deshalb noch immer an der Steuersäule. Nur widerwillig, so schien es, leistete der blecherne Adler dem Piloten Gehorsam.
Eberhard hatte seine Bauchdecke angespannt und presste möglichst unauffällig seinen rechten Unterarm gegen die Magengegend, um den elenden Würgereiz zu bannen. Hansen lenkte die Elster in einer weit ausgeschwungenen Rechtskurve wieder allmählich in die Höhe. Der Oberfähnrich schwitzte aus allen Poren, er hörte sein Herz unter der FT-Haube hämmern.
»Mund offenhalten!« befahl Hansen, doch das hatten bereits alle Besatzungsmitglieder automatisch getan, um den lästigen Druck auf die Trommelfelle zu mildern. Krampfhaft biss Eberhard sich auf die Lippen. Doch plötzlich riss er blitzschnell die Sauerstoffmaske vom Gesicht und musste sich erbrechen. Hansen gab dem Oberfähnrich einen wohlwollenden Stoß in die Seite und meinte:
»Ist dem stärksten Riesen schon passiert!«
Schwarzkopf dachte sich sein Teil. Er grinste in sich hinein hinter seiner Maske. Schon wieder kletterte der Zeiger des Höhenmessers auf 6000 Meter.
»Also bitte, meine Herren, es geht noch einmal in die Achterbahn! « rief der Leutnant. Wollüstig drückte er die Steuersäule von sich. Die Maschine neigte sich. Insgesamt dreimal wiederholte er die Berg- und Talfahrt, wobei er stets mit einem halben Auge über seinen Beobachter wachte.
Schließlich erprobte er noch den Einmotorenflug. Er stellte den linken Motor ab und steuerte eine gefährlich aussehende Kurve über dem stehenden Motor. Dann ließ er das Triebwerk erneut anspringen. Der Anlasser jaulte, die Magneten zündeten, der ausgefallene Motor zog wieder kräftig mit. Das gleiche Spiel wiederholte er auch mit dem anderen Motor.
Alle atmeten erleichtert auf, als sie bemerkten, dass der Flugzeugführer den »Eignungstest unter erschwerten Bedingungen« abbrach. Ohne weiteren Kommentar flogen sie zum Feldflughafen zurück. Die Landung ging glatt vonstatten. Etwas benommen entstiegen die vier ihrer Maschine und wankten knieweich zu den Unterständen.
»Ich gehe noch zur Flugleitung, um mein Bordbuch abfertigen zu lassen«, rief Hansen ihnen zu.
Später begaben sich Schwarzkopf und Springer ins Kasino, um durch einen kräftigen Schluck ihren Kreislauf stabilisieren zu lassen. Eberhard lag währenddessen auf seinem harten Feldbett. Er hatte das Fenster geschlossen und das Verdunklungsrollo heruntergezogen. Auf dem groben, rechteckigen Tisch standen Rasierspiegel, Feldbecher, ein Kochgeschirr und andere Kleinigkeiten herum. Die vier doppelstöckigen Metallbetten waren an den Wänden aufgestellt. Der Raum wirkte in dem diffusen Licht einer schirmlosen Glühbirne gedrungen, kalt und hässlich. Auf den klobigen Stühlen hingen verschiedene Uniformstücke und Unterwäsche. Beim Ausbildungsgeschwader hätte eine solche Unordnung einen handfesten Krach mit anschließendem »praktischen Erdkundeunterricht« gegeben, wenn der Unteroffizier vom Dienst die Bude so vorgefunden. Aber hier draußen auf dem Feldflughafen ging alles legerer zu. In den mit dunkelgrüner Metallfarbe angestrichenen Kleiderschränken hingen so manche Bilder, unter den Betten standen Kartons und lagen Kleidersäcke, die zusätzlich auch noch als Ablage für privaten Krempel dienten.
Eberhard hatte seinen Kopf in beide Hände gestützt und blickte angewidert auf den ausgetretenen Fußboden. Bei mittlerer Erschütterung rieselte der Kalk von der Decke. Daheim, im väterlichen Einfamilienhaus in Berlin-Blankenburg, sah es auf dem Dachboden sogar noch wohnlicher aus als hier in dieser miesen Bude. Wie pflegte doch Unteroffizier Sander bei jeder Gelegenheit zu sagen? »Schmutz ist die beste Tarnfarbe! Es ist beileibe keine Schande, einmal in den Dreck zu fliegen; aber darin liegenzubleiben und nicht aufstehen zu wollen, hieße: sich im Schweinestall wohlzufühlen.« Wie recht hatte sein ehemaliger Ausbilder.
Während er so in das Durcheinander der Bude blickte, fragte er sich, ob sein Flugzeugführer nun zufrieden gewesen ist, auch trotz des kleinen unangenehmen Zwischenfalls, und ob er ihn einigermaßen überzeugen konnte. Würde er in naher Zukunft ein geeigneter Bildbeobachter werden? Er war sich seiner Sache nicht ganz sicher. So oft er auch seinen Körper auf dem plattgewalzten Strohsack drehte, er blieb im Zweifel und deshalb unzufrieden.
Seine Gedanken wanderten zu seinem Bruder Hans. Wie mochte es ihm ergehen? Ob er seine Grundausbildungen gut überstanden hatte? Wo mochte er jetzt stecken? Eberhard blieb unruhig und fühlte sich bedrückt. Warum nur musste dieser elende Krieg sein? Warum mussten junge Männer in der Blüte ihrer Jahre ihre Kräfte für diesen Wahnsinn einsetzen? Sein Innerstes schien ihm wie ausgedörrt, sein Dasein ohne Sinn und Kraft. Nur schlafen, dachte er, einfach schlafen, alle zwingenden Umstände vergessen und nicht denken zu müssen wie ein Tier, nicht mehr am Leben zu sein, wünschte er sich auf einmal. Er konnte aber nicht schlafen, denn die aufregenden Minuten des Übungsfluges hatten ihn zu sehr mitgenommen, er konnte die innere Ruhe nicht finden.
›Menschenskind, Nowak, in einer solchen wackeligen Metallkiste können Sie sich nicht zum Theologen ausbilden lassen‹, hatte ihm der Leutnant versichert.
Erneut übermannte ihn die Unruhe, wieder und wieder warf er sich auf seinem Lager von der rechten auf die linke Seite und von der linken auf die rechte. An Schlaf war nicht zu denken, seine aufgewühlten Sinne ließen ihn nicht zur Ruhe kommen. Er fand, es wäre angebrachter, aufzustehen und in der Bibel zu lesen. Aber schon gleich regten sich Zweifel, ob es Zweck hätte, in der Bibel zu lesen, ob er sich darüber beruhigen könne und ob er wirklich Trost für seinen Zustand finden würde.
Noch immer unschlüssig, erhob er sich endlich. Er kramte seine Brille hervor und putzte sie umständlich, indem er die Gläser wiederholt anhauchte und dann mit einem sauberen Taschentuch blankrieb. Er setzte sich an den Tisch, wo das blasse Licht flackerte und begann, in der Heiligen Schrift zu blättern. Nach einigem hin und her fand er einen Text, in den er sich vertiefte.
»Lobe den Herrn, meine Seele, und was in mir ist, seinen heiligen Namen!«
Diese Worte berührten seine Seele. Sie erreichten sein Innerstes und schienen aus einer anderen Welt zu kommen und in ihn einzudringen. Es war nicht die profane Sprache der Menschen, ihm erschienen die Worte wie ein überirdischer Lobgesang durch den ewigen Schöpfergeist.
»Lobe den Herrn, meine Seele, und vergiss nicht, was er dir Gutes getan.«
Ja, er war davon überzeugt, dass das Göttliche sich bei dem Aufrichtigen Bahn brechen würde, denn Gottes Güte währet ewiglich. Er dachte an seinen Bruder Hans, der sich bei der Infanterie in diesem Augenblick vielleicht im Dreck und Schlamm herumquälen musste, während er sich zu den pikfeinen, sogenannten »Schlipssoldaten« rechnen durfte. So wenigstens nannte man die Männer von der Luftwaffe im allgemeinen. Aufmerksam las er weiter:
»Der dir alle deine Sünden vergibt und heilet alle deine Gebrechen, der dein Leben vom Verderben erlöst, der dich krönt mit Gnade und Barmherzigkeit …«
Wie diese Worte in seiner Seele aufklangen, wie sie ihn ergriffen und seinem angeschlagenen Gemüt neuen Auftrieb gaben! Es war für ihn ein Hochtrieb, der ihn in unvergleichlicher Weise höher brachte, als etwa eine Gipfelhöhe von 8000 Metern, nämlich hinauf bis zur Unerreichbarkeit des ewigen Gottes. Und weiter zog es ihn mit Macht zu dem göttlichen Wort:
»Der deinen Mund fröhlich machet und du wieder jung wirst wie ein Adler …«
Ach ja, er war noch jung, sogar blutjung, wie man das zu nennen pflegte. Hier durfte er lesen, dass ihm neue Kraft gegeben werde, und schon bemerkte er, wie dieses von Gott gegebene Wort seinem Geist Flügel verschaffte, die sich ins Unermessliche ausweiten wollten.
»Barmherzig und gnädig ist der Herr, geduldig und von großer Gate.«
Ja, er verspürte etwas von der Gegenwart Gottes, himmlische Pforten schienen für ihn geöffnet zu sein: barmherzig und gnädig sollte und wollte Eberhard auch werden. Aber wie konnte er es unter den rohen Sitten des Krieges? Wie vermochte ein Jünger Jesu die Normen der Bergpredigt in Uniform zu erfüllen? »Selig sind die Sanftmütigen, denn sie werden das Erdreich besitzen.« Wie sollte das erfüllbar sein in dieser Zeit, wo Gewalt vor Recht ging? Er dachte an die kreischende Stimme des Diktators. Unterjochte dieser nicht fast alle Nationen Europas in seinem fanatischen Machtrausch?
»Selig sind die Barmherzigen, denn sie werden Barmherzigkeit erlangen.«
Solche Worte erfindet kein Menschengeist. Sie geleiteten ihn im Geist in das ewige Reich des Friedens, aber nicht in das tausendjährige Reich eines Wahnsinnigen, der die Welt mit seiner Politik beherrschen und damit knechten wollte.
Eberhard gab sich mit geschlossenen Augen seinen Gedanken hin.
Plötzlich vernahm er ein Geräusch, einen metallisch-hellen, fremdartigen, fast singenden Ton. Sein Unterbewusstsein witterte Gefahr. Ehe er dieses giftige Pfeifen recht identifizieren konnte, hämmerten schon Maschinengewehrsalven über den Flugplatz. Das Bellen der Abschüsse durch Bordkanonen mischte sich in die klatschenden Laute der Aufschläge.
Nein, das war kein himmlischer Gesang! Dieser höllische Krach versetzte ihn augenblicklich in die entsetzliche Gegenwart des Krieges. Blitzschnell ließ sich Eberhard auf den schmutzigen Boden fallen. Die Hände über dem Kopf verschränkt, rief er:
»Vater im Himmel, erbarme dich meiner, schütze mich! Hilf uns in dieser Not!« Jetzt hörte er das Motorengeräusch einer davonfliegenden Maschine. Vom Gang her lärmte es. Erregt stürmten seine Kameraden in den Raum und fanden ihn, den Bildbeobachter und Oberfähnrich, am Boden liegend. Obwohl auch ihnen noch der Schreck in den Gliedern saß, fingen sie an zu höhnen und zu spotten.
»Sieh mal einer an! Da liegt der heilige Oberfähnrich auf der Erde!«
Feldwebel Schwarzkopf stand breitbeinig im Türrahmen. Seine Hände hatte er ins Koppel gesteckt, so als wäre er der Reichsmarschall in Person. Über seine Schulter hinweg grinsten Franz Springer und andere Kameraden der Staffel.
Beschämt erhob sich Eberhard und blickte in das brutale Gesicht des Feldwebels.
»War das ein Tommy?« fragte er unsicher.
»Nee, nee, mein Lieber, es war ein Mosquito, ein ganz harmloser Aufklärer der Engländer. Ein paar hundert solcher Störflieger wären dem Führer sicher mehr wert als christliche Tiefflieger von deiner Sorte, die kaum vom Boden abheben können!«
Unbemerkt hatte sich Leutnant Hansen der Gruppe genähert. Er hatte einen wesentlichen Teil des Gesprächs mit angehört. Obwohl er die christliche Einstellung seines Beobachters keineswegs teilte, war ihm diese Art der Diffamierung doch sehr zuwider.
»Lassen Sie gefälligst solchen Unsinn! Sie sind doch auch wie eine aufgescheuchte Hammelherde aus der Kantine geflohen! Also Schluss mit dem Quatsch! Ihr Heldentum ist genauso groß oder auch klein, wie das des Oberfähnrichs. Schlimm genug, wenn ein einzelner Feindflieger über unseren Feldflughafen so ungestraft dahinbrausen kann und seine ›blauen Bohnen‹ wahllos über unseren Köpfen abfeuern darf!«
»Wo bleiben eigentlich die berühmten Eichenlaubträger der Jagdstaffel, die Herren Mölders oder Galland, wenn solche feindlichen Heinis einfach unsere Maschinen beschießen und dann quietschvergnügt das Weite suchen?« wollte der Feldwebel Schwarzkopf wissen.
»Das liegt gewiss nicht an unseren Ritterkreuzträgern, sondern einfach an der Qualität der Maschinen. Gegen die Jagdbomber der Feinde sind unsere hochmodernen JU 88 veraltete Schinken, meine Herren. Wenn wir unsere Mühlen mit Ach und Krach auf 500 km/h bringen, dann flitzen diese Mehrzweckflugzeuge mit fast 700 Sachen davon. Zum Glück sind nicht alle feindlichen Kampfflugzeuge so schnell. Wir haben also keinen Grund, darüber deprimiert zu sein.«
Hansen wechselte das Thema: »Heute Abend bekommen wir übrigens Besuch vom Generalstab der Heeresgruppe. Das gesamte fliegende Personal versammelt sich pünktlich um 19.45 Uhr im Kasino! Alles verstanden? Irgendwelche Unklarheiten? Also, dann bis später!«
Leutnant Hansen, ein Muster an Genügsamkeit, preußisch und spartanisch im Umgang mit den Männern seiner Staffel, verließ das Zimmer.
»Hört, hört, Leute, es gibt Besuch«, Schwarzkopf erhob seinen Finger, »und zwar hohen Besuch: ein Herr mit weißen Hosenstreifen beehrt uns.«
»Das hat was zu bedeuten, und ich wette«, unkte er weiter, »wieder solch ein Spürhund, der Jagd auf sogenannte Drückeberger macht.«
»Ob jetzt endlich die Invasion in England beginnt?« wollte der sonst so zurückhaltende Franz Springer wissen.
»Invasion in England? Dass ich nicht lache! Man merkt, dass Ihr schon lange nicht mehr gegen diese Inselfestung geflogen seid. Ihr wisst doch sicher genau, mit welcher Zähigkeit sich der britische Löwe verteidigt! – Nein, nein, die rosarot gefärbten Wehrmachtsberichte können uns doch nicht täuschen, es ist die Ruhe vor dem Sturm. Man gönnt den jungen Lämmern, die zur Auffrischung in unsere dezimierten Kampfverbände eingegliedert worden sind, noch eine kleine Galgenfrist. Ich habe da eine ganz andere Idee. Ich meine, auf dem Balkan tut sich etwas«, äußert sich ein Oberfeldwebel vom Kampfgeschwader, ehe er, geschmeidig wie eine Katze, aus dem Raum verschwindet.
Pünktlich hatten sich die Flugzeugführer, Bildbeobachter, Bordfunker und die Herren des Stabes im Kasino eingefunden. Der dienstälteste Offizier schrie: »Achtung!« und öffnete die Tür. Herein schritt der General der Luftwaffe, der beim Oberbefehlshaber des Heeres die Luftflotte vertrat, gefolgt von einem Ordonnanzoffizier, dem Gruppenkommandeur sowie dem Staffelkapitän mit dessen Adjudanten. Wie erstarrt standen die Männer des fliegenden Personals vor dem hochdekorierten Herrn in Gold und Weiß.
»Heil, Flieger!« rief der etwas korpulente Generalleutnant mit an den Mützenrand gelegter Hand.
»Heil, General!« schallte es ein wenig nacheinander, denn drei Worte im Chor fallen selten synchron aus. Der General trat sofort ans Rednerpult. Seine Mütze hatte er dem Ordonnanzoffizier übergeben. Der legte dem hohen Herrn ein Manuskript zurecht, während dieser damit beschäftigt war, eine lästige Falte seines Generalsrockes auf dem stramm gewölbten Bauch zu glätten.
»Kameraden, es ist mir eine Ehre, die sogenannten unscheinbaren Männer der mir persönlich unterstellten Aufklärungsstaffel begrüßen zu können. Sie alle haben bei Ihren Feindflügen besonderen Mut und fliegerisches Können bewiesen, weil Sie sich nicht nur unter ständiger Abwehr durch englische Jäger und gegen den feindlichen Flakbeschuss durchsetzen mussten, sondern weil Sie zudem auch allen Unbilden des Wetters ausgesetzt waren.«
Flüchtig überschaute der General die versammelte Mannschaft und putzte nun sein Einglas mit einem Taschentuch.
»Durch Ihren pausenlosen Einsatz haben Sie der Heeresführung sehr wichtige Erkundungsergebnisse gebracht. Aus den von Ihnen fotografierten Luftbildern entdeckten die Bildoffiziere manche Absichten und Bewegungen des Gegners, die dann den Stäben der kämpfenden Truppen übermittelt werden konnten. Auch der Generalstab des Heeres konnte viele Entscheidungen für die mobile Operationstätigkeit fällen, und somit wurden unzählige Menschenleben der deutschen Armee durch Ihren stillen Einsatz bewahrt. Ich möchte Ihnen im Namen des Oberbefehlshabers des Heeres herzlich dafür danken.«
Die Bewegungen des Generals bei seinen Ausführungen waren geschmeidig und passten zu der rosigen Glätte seines Gesichtes.
»Sie, meine Herren, können als Fernaufklärer nicht mit Zahlen aufwarten oder von sichtbaren Erfolgen sprechen. Ihre Maschinen tragen keine verderbenbringenden Angriffswaffen in sich, sie haben auch keine Bomben, die sie ins Hinterland des Feindes bringen.«
›Gott sei Dank!‹ dachte Eberhard, ›dass der Allmächtige mein innigstes Gebet erhört hat und ich keinen Bombenauslöseknopf über Marschkolonnen, Panzeransammlungen, Brücken, Eisenbahnstrecken oder über Sanitätswagen und Feldlazaretten betätigen muss.‹
Der General fuhr fort: »Ihre Waffen sind die hochwertigen optischen Geräte, die Reihenbildkameras mit ihrer unerhörten Schärfe, mit denen Sie, wenn möglich, unbemerkt die gegnerischen Absichten zu erkunden suchen. Den Kampf dürfen Sie nicht suchen, dem müssen Sie ausweichen, solange es nur geht. Ihre höchste Aufgabe besteht darin: Sicherstellung und Übermittlung wichtiger Erkundungsergebnisse um jeden Preis und schnellste Durchgabe aller erkannten Feindbewegungen. Sie fliegen auch nie im Schutze einer zusammengeballten Kraft, das heißt im Verband von Jagdflugzeugen und Zerstörern, sondern haben die Ihnen gestellten Aufgaben allein und völlig auf sich gestellt zu erfüllen …«
›Bla – bla – bla…‹ , dachte Schwarzkopf, ›warst du alter Herr denn schon einmal dem Flakfeuer über Feindgebiet ausgesetzt? Vielleicht im 1. Weltkrieg? Wenn nicht, dann hör endlich auf mit deinen Generalstabsweisheiten.‹
Monoton laberte die Stimme des Goldfasans weiter, aber Eberhard betete still vor sich hin: ›Mein Gott, ich hoffe auf dich! – Herr Jesus, ich vertraue dir von Tag zu Tag. – Zeig du mir den Weg, den ich gehen soll. – Lass mich nicht zuschanden werden bei diesem barbarischen Völkermorden. – Sei mir gnädig, dass ich nicht wie Kain meinen Bruder Abel oder einen anderen töten muss.‹
Obergefreiter Springer kaute an seinen Fingernägeln, was er immer tat, wenn ihm etwas auf die Nerven ging. Schließlich kam der hohe Gast zum Ende seiner Ausführungen: »Jeder übergebene Auftrag birgt eine große Verantwortung in sich. Von der gewissenhaftesten Durchführung der Ihnen erteilten Befehle hängt zum größten Teil der Erfolg unserer militärischen Operationen an der Front ab. Sie sind das Adlerauge der ganzen Armee. Die Erfolge der Infanterie, der Pioniere, Artilleristen, der Panzerschützen und Panzerjäger wird durch Ihren stillen Einsatz ermöglicht. Sie geben oft der Strategie eines Feldmarschalls den Ausschlag für seine Entscheidungen.«
Leutnant Hansen beobachtete seine Leute, Feldwebel Schwarzkopf blickte gleichmütig durch das Fenster zu dem verhangenen Himmel. Mit höchstem Pathos vollendete der General seine Ansprache: »Fliegen Sie, wie es der Befehl erfordert, getreu Ihrem Soldateneid für Führer und Volk, und wie alle anderen Kameraden der Luftwaffe bis zum endgültigen Sieg für die gerechte Sache. Dem geliebten Führer und Reichskanzler des deutschen Volkes geloben wir unabänderliche Treue und absoluten Gehorsam …«
In das vielstimmige »Hurra« der Anwesenden flüsterte Schwarzkopf sein diabolisches »Amen«! und blickte dabei Eberhard herausfordernd an.
Jerusalem, die Burg des Friedens
Ganz Israel ist in der Passah-Woche von Touristen geradezu überschwemmt. Viele Juden aus der ganzen Welt reisen für diese Tage in das Land ihrer Väter, um die höchsten Feiertage, zur Erinnerung an den Auszug der Kinder Israel aus dem Land der Pharaonen, miteinander zu verleben.
Schon vor Sonnenaufgang ließen sich Frau Nowak und Ruth mit einem Taxi auf den Ölberg fahren. Über die Höhen von Bethanien her krochen die ersten Sonnenstrahlen über die heilige Stadt.
Die Kuppel des Felsendomes, der sogenannten Omar-Moschee, erglänzte in strahlendem Gold. Das hellblaue Kuppeldach der EI-Aksa-Moschee dagegen wirkte recht bescheiden neben dem Prachtbau des Mittelalters. Das Kidrontal und der Garten Gethsemane lagen noch im Schatten.
»Jerusalem! Mein über alles geliebtes Jeruschalajim!«
Ruth breitete ihre Arme aus, als wollte sie die ganze Stadt umarmen. »Ist es nicht herrlich, diese einzig schöne Stadt zu überschauen?«
»Beim wundervollen Gott, es ist kein Traum! Ich stehe tatsächlich auf dem Ölberg, und vor mir liegt der Mittelpunkt der Welt – Jerusalem, Stadt, vom Golde erbaut. Geistliche Träume sind Bilder des Unvergänglichen, des Ewigen! – Heil denen, die dich lieben!«
»Frieden herrsche vor deinen Mauern, sichere Ruhe in deinen Palästen!« sagte Frau Nowak.
Beide Frauen haben sich umarmt, Kopf an Kopf gelehnt, blicken sie andächtig über die Dächer der heiligen Stadt mit ihren unzähligen Kirchtürmen, Minaretts, Kuppeln und prächtigen Bauten hinweg.
»Und doch ist diese Stadt nur ein Abglanz des Ewigen, des Kommenden, das Gott für uns bereithält.«
Bei diesen Worten blickt Frau Nowak empor zu den rötlich angehauchten Schäfchenwolken, die wie ein Netz unter dem westlichen Himmel ausgebreitet sind.
»Ich sah die heilige Stadt, ein neues Jerusalem, aus dem Himmel herabkommen von Gott her, ausgestattet wie eine für ihren Bräutigam geschmückte Braut …« wie ein feierliches Gedicht zitiert Ruth diese Worte der Offenbarung Christi – und schwärmt.
»Es wird herrlich, einfach unbeschreiblich herrlich sein, wenn das Alte vergangen ist und Gott, der Herr, ein neues Jerusalem geschaffen hat.« Wie ein Gebet klingen die Worte, die Ruth gesprochen hat.
Die beiden gehen hinab, am Garten Gethsemane vorbei und überqueren an der Kirche der Nationen die belebte Straße, die von Bethanien herkommt. Dann steigen sie hinauf zu den hohen Mauern der Stadt und blicken hinunter zum Teich Bethesda mit dem grünlich schimmernden Wasser, der umgeben ist von den zerborstenen Säulen aus alten Zeiten. Später schieben sie sich durch die Basargassen, lassen sich vom Strom der Käufer mitdrän-gen vorbei an Händlern und Verkäufern, an Touristen, Juden und Arabern, bis sie durch das Jaffator wieder in den jüdischen Teil der Stadt gelangen. Vor einem Eiscafé lassen sie sich an einem weißen, runden Tisch nieder. Umgeben von grünen Anlagen und unter Palmen ausruhend, blicken sie nun direkt auf die Stadtmauer und den Davidsturm. Sie bestellen Eis mit Sahne und türkischen Mokka. Man serviert ihnen beachtlich große Portionen Schokoladeneis, und das starke Getränk bringt ihren Kreislauf wieder in Schwung.
»Wenn ich diese aufgeblühte Stadt sehe, muss ich unwillkürlich an das Wort des Psalmisten denken: ›Das ist vom Herrn geschehen und ist ein Wunder vor unseren Augen!‹« sagt Frau Nowak. Und Ruth setzt lächelnd hinzu: »›Dies ist der Tag, den der Herr macht; lasset uns freu'n und fröhlich darin sein.‹ Ich meine, Heil für Israel bedeutet in gewisser Weise auch Heil für die Welt, denn, geht es dem Volk Israel gut, behält es sein Land und seine äußerliche Existenz, die ja der inneren Erneuerung vorausgehen soll, dann geht es auch allen anderen Völkern relativ gut, ehe das große Gericht hereinbricht!« Frau Nowak legt ihre Sonnenbrille auf den Tisch und tupft mit einem Erfrischungstuch über die Stirnpartie und den Nacken: »Deshalb gibt es für uns Christen eigentlich auch keine Neutralität in Bezug auf Israel, denn Neutralität wird nach der Aussage Jesu für uns zur Schuld: ›Wer nicht mit mir ist, der ist wider mich; und wer nicht mit mir sammelt, der zerstreut.‹«
»Meinst du, man kann diese Worte Jesu auch auf Israel beziehen?«
»Aber warum denn nicht? Wer gegen Israel ist, fällt unter Gottes Gericht. Wir haben es als Deutsche doch im eigenen Vaterland erlebt. Aus diesem Grunde müssen sich die Christen entschieden und klar von einer neutralen oder antisemitischen Haltung distanzieren, um nicht auch und erneut dem Gericht Gottes zu verfallen.«
»Aber so denken nicht alle Christen! Wie kommt es eigentlich, dass der Vatikan keine diplomatischen Beziehungen zu Israel aufnimmt, obwohl ein Papst bereits das Heilige Land besucht hat? Man hat sogar den Plan, die heilige Stadt zu internationalisieren.«
Ruth wischt sich mit der Serviette die Hände ab.
»Jerusalem kann nicht internationalisiert werden, denn es ist und bleibt des großen Königs Stadt. Gott hat diese Stadt als zukünftigen religiösen, politischen und auch wirtschaftlichen Mittelpunkt festgelegt. Jesus Christus ist der König des Friedens und wird auch einst von dieser Stadt aus die Welt regieren.«
Ruth bemerkt, dass andere Gäste, die an den Nebentischen sitzen, auf ihr Gespräch aufmerksam werden.
»Ich finde, Ben Gurion hat es so treffend gesagt: ›Seit zweitausend Jahren haben wir auf diesen Tag gewartet, und nun ist es geschehen. Wenn die Zeit erfüllet ist, kann dem Herrn nichts widerstehen!‹«
Frau Nowak bekräftigt diese Aussage mit dem Bibelwort: »Himmel und Erde werden vergehen; aber meine Worte vergehen nicht.«
Tausende von E-Books und Hörbücher
Ihre Zahl wächst ständig und Sie haben eine Fixpreisgarantie.
Sie haben über uns geschrieben: