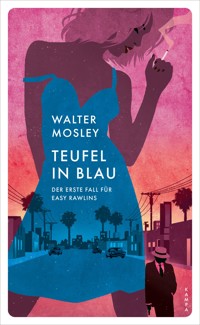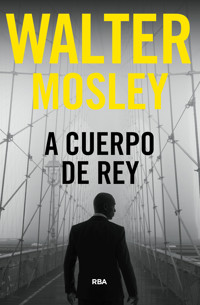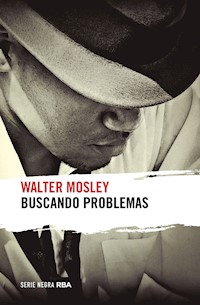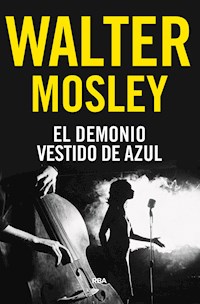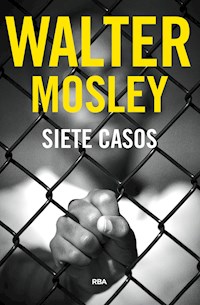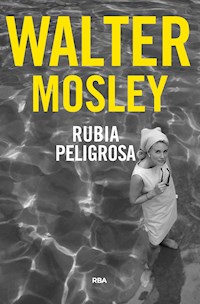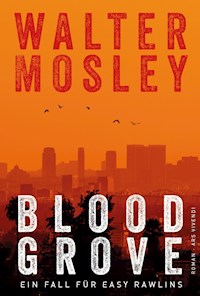
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: ars vivendi Verlag
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Endlich wieder auf Deutsch: Eine der prägendsten Reihen der Kriminalliteratur meldet sich mit einem brandneuen Fall zurück Los Angeles 1969. Ezekiel »Easy« Porterhouse Rawlins, schwarzer Privatdetektiv mit eigener Agentur, bekommt Besuch von einem weißen Vietnam-Veteranen. Der verstörte junge Mann erzählt Easy, er habe im Blood Grove vor den Toren der Stadt eine weiße Frau vor einem scharzen Mann beschützt und den Mann dabei möglicherweise getötet. Allerdings scheint niemand eine Leiche gemeldet zu haben. Easy erkennt, wie sehr der Krieg den Mann traumatisiert hat, und denkt an seine eigenen Erfahrungen im Zweiten Weltkrieg zurück. Trotz anfänglicher Bedenken übernimmt er den Fall, der ihn in die Wüste Kaliforniens, nach South Central, in Sexclubs, zu den Anwesen von Superreichen, zu Hippies, zur Mafia und, vielleicht am gefährlichsten, zu alten Freunden führt ...
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 411
Veröffentlichungsjahr: 2022
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
WALTER MOSLEY
BLOOD GROVE
EIN FALL FÜR EASY RAWLINS
ROMAN
AUS DEM AMERIKANISCHEN ENGLISCHVON JÜRGEN BÜRGER
Die Originalausgabe erschien 2021 unter dem TitelBlood Grove bei MULHOLLAND BOOKS.
Copyright © 2021 by The Thing Itself, Inc.
Vollständige eBook-Ausgabe der im ars vivendi verlag erschienenenDeutschen Originalausgabe (1. Auflage 2022)
© 2022 by ars vivendi verlag GmbH & Co. KG,Bauhof 1, 90556 CadolzburgAlle Rechte vorbehalten, insbesondere das des öffentlichen Vortrags sowie der Übertragung durch Rundfunk und Fernsehen, auch einzelner Teile.
Kein Teil des Werkes darf in irgendeiner Form (durch Fotografie, Mikrofilm oder andere Verfahren) ohne schriftliche Genehmigung des Verlages reproduziert oder unter Verwendung elektronischer Systeme verarbeitet, vervielfältigt oder verbreitet werden.
Für Inhalte von Webseiten Dritter, auf die in diesem Werk verwiesen wird, ist stets der jeweilige Anbieter oder Betreiber verantwortlich, wir übernehmen dafür keine Gewähr. Rechtswidrige Inhalte waren zum Zeitpunkt der Verlinkung nicht erkennbar.
www.arsvivendi.com
Umschlaggestaltung ars vivendi verlagunter Verwendung einer Fotografie von
© josh rose/unsplash
eISBN 978-3-7472-0425-2
Für Diane Houslin und ihre unermüdliche Suche nach der Wahrheit
INHALT
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
Der Autor
1
Montag, 7. Juli 1969
Ich sah aus dem Bürofenster im zweiten Stock auf das hastig errichtete Treibhaus im Garten des Nachbarn hinter dem Zaun am Ende unseres Grundstücks. Die Rahmenkonstruktion bestand aus Zehnmal-zehn-Kantholz, und das Gerüst war fest von halb blickdichten Plastikplanen umspannt, die in der Morgenbrise nur leicht flatterten. Das Treibhaus erinnerte mich an eine auf ein Drittel der normalen Größe zusammengeschrumpfte Armeebaracke. Das Ding war zwei Meter hoch und breit, bei einer Gesamtlänge von etwa acht Metern, und hatte ein teilweise abgeflachtes dreikantiges Dach. Die derzeitigen Nachbarn, sieben langhaarige Hippies, waren vor fünf Monaten eingezogen. Direkt am ersten Tag errichteten sie dieses Gartengebäude und verlegten Strom für ein ständig brennendes elektrisches Licht. Seitdem rannten sie nahezu jede Tageslichtstunde beladen mit Säcken voller Mutterboden, Gießkannen, Tontöpfen, Insektizidmixturen und diversen Gartengeräten hin und her.
Abends schmissen sie gelegentlich Partys. Diese Feierlichkeiten dehnten sich oft auf die Veranda vor dem Haus und den dortigen Rasen aus, nie jedoch auf den Garten hinter dem Haus. Das Treibhaus war für jeden außer den Sieben tabu.
Es war ein recht interessant aussehender Haufen. Drei junge Frauen und vier Männer, alle in den Zwanzigern. Alle weiß, bis auf einen jungen Schwarzen. In ihren bestickten Jeans und abgetragenen T-Shirts saßen sie fast jeden Nachmittag ungefähr eine Stunde um einen Redwood-Picknicktisch und aßen die Speisen, die von den Frauen zubereitet, serviert und geteilt wurden. Sie schenkten Gallo-Rotwein aus großen grünen Glasflaschen aus und ließen schier endlos selbst gedrehte Zigaretten vom einen zum anderen kreisen. Ich mochte die Stadtfarmer. Sie erinnerten mich an meine Kindheit in New Iberia, Louisiana.
LA war damals nur ein Durchgangsort. Fünf Monate war ein langer Aufenthalt für Mieter ohne Blutsbande oder Kinder.
Als die hintere Tür des Hippiehauses aufging, warf ich einen Blick auf das runde weiße Zifferblatt meines Chronometer mit Kalender der Firma Gruen. Es war 7:04 Uhr morgens, Montag, der 7. Juli 1969. Der Hippie, den ich Schnauz getauft hatte, kam nur in Jeans bekleidet aus dem terrassierten einstöckigen Haus. Den Spitznamen hatte ich ihm wegen seiner üppigen Lippenbehaarung gegeben. Ich stand an diesem Fenster, weil Schnauz jeden Tag frühmorgens mit einer langhalsigen Blechgießkanne herauskam und dabei weder Hemd noch Schuhe trug. Dieses Ritual hatte meinen detektivischen Instinkt geschärft.
Als Schnauz sich bückte, um den Gartenschlauch aufzuheben, wandte ich mich vom Fenster ab, blieb aber hinter dem übergroßen Schreibtisch stehen. Die letzte Woche war ich wegen eines Falls in Las Vegas gewesen. Ich war den ersten Tag wieder in der Detektei und war an diesem Morgen bislang als Einziger dort.
Ich dachte kurz daran, mich hinzusetzen und die Einzelheiten des Zuma-Falles aufzuschreiben, aber die Details, besonders das Problem mit der Bezahlung, schienen mir mehr zu sein, als ich an meinem ersten Arbeitstag verkraften konnte. Also beschloss ich, stattdessen erst mal eine Runde zu drehen und mich wieder mit den Büros vertraut zu machen, bevor meine Kollegen eintrafen.
Unsere Firma belegte das komplette Obergeschoss eines früheren großen Wohnhauses am Robertson Boulevard, nicht weit entfernt vom Pico. Mein Arbeitsraum war das einstige große Schlafzimmer ganz hinten. Wenn ich von dort aus den Flur hinaufging, kam ich zuerst an Tinsford Natlys Büro vorbei. Tinsford war allgemein bekannt als Whisper, und sein Raum brachte den zurückhaltenden Ton dieses Namens zum Ausdruck. Es war ein kleines, fensterloses Büro, möbliert mit einem ramponierten Eichenschreibtisch, kaum größer als ein Tisch, wie man ihn im Klassenzimmer einer Junior High erwarten würde. Es gab zwei Holzstühle mit gerader Rückenlehne, einen für Tinsford und einen für einen Besucher oder Klienten. Er sprach kaum je mit mehr als einer Person gleichzeitig, denn wie er sagte: »Zu viele Köpfe trüben das Wasser.«
Der Tisch war leer, was ungewöhnlich war. Soweit ich mich erinnern konnte, lag immer ein einzelnes Blatt Papier genau in der Mitte von Whispers Schreibtisch. Es war stets ein anderes Blatt, beschrieben mit scheinbar belanglosen Worten, die jedoch meist einen tieferen Sinn enthielten. An den Wänden hingen keine Bilder, es gab keinen Aktenschrank und auch keinen Teppich. Sein Büro war wie die Zelle eines Mönchs, in der ein altersloser Geistlicher über die Heilige Schrift nachdachte – immer nur ein Vers, manchmal nur ein Wort nach dem anderen.
Ein Stückchen weiter, auf der anderen Seite des Flurs, befand sich Saul Lynx’ Büro, dreimal so groß wie das von Whisper und ein Viertel so groß wie meines. Sein Mahagonischreibtisch war nierenförmig. Saul besaß ein blaues Zweiersofa und einen laubgrünen Polstersessel für Klienten. Ein burgunderroter Bürodrehstuhl stand hinter dem polierten Schreibtisch voller Krempel und Fotos seiner schwarzen Frau und ihren gemischtrassigen Kindern. Auf den Regalen neben dem Fenster standen mindestens zweihundert Bücher. Er besaß fünf Aktenschränke aus Ahorn, einen riesigen Standglobus und einen kleinen Arbeitstisch mit einer Lampe darüber, an dem er seine investigativen Feldzüge ausarbeitete.
In Sauls Büro herrschte Chaos mit Ordnung. Seine Tische waren meistens ziemlich unordentlich, weil Saul es normalerweise eilig hatte, raus auf die Straße zu kommen, wo Detektive wie wir mit den Jobs rangen, die wir annahmen. Aber an diesem Montagmorgen war alles an seinem Platz – fast so, als wäre er in Urlaub gefahren.
Ich ging von den rückwärtigen Büros zu dem umfunktionierten Foyer, wo Niska Redmans Schreibtisch stand. Niska war unsere Sekretärin, Empfangschefin und Büroleiterin. Vor ein paar Jahren hatte Tinsford ihrem Vater aus einer Klemme geholfen, und sie fing an, für ihn zu arbeiten. Als ich dann unvorhergesehen zu Geld kam und beschloss, die Detektei WRENS-L zu gründen, kam sie mit ihrem Chef dazu. Die karamellcremefarbene, gemischtrassige junge Frau war perfekt für unsere Bedürfnisse. Sie studierte abends an der Cal State, war freundlich und absolut zuverlässig. Sie kannte alle unsere Macken und Bedürfnisse, Temperamente und Gewohnheiten. Niska war eine dieser überaus seltenen Angestellten, denen man nicht groß sagen musste, was zu tun war, und die absolut in der Lage waren, selbstständig zu denken.
Ich setzte mich an ihren eleganten Kirschholzschreibtisch gegenüber der Eingangstür zu unseren Büros. Ich holte tief Luft und bemerkte, dass es ein gutes Gefühl war, allein zu sein und keine Eile zu haben. Alles war gut, daher bin ich nicht ganz sicher, warum sich mir die Dunkelheit in den Kopf drängte …
Vor vier Jahren war ich zum ersten Mal seit vielen Jahren wieder betrunken gewesen und fuhr nachts barfuß den Pacific Coast Highway hinunter, weit oberhalb des steinigen, dichten Gestrüpps unten an der Küste. Ich versuchte, einen Sattelschlepper zu überholen, wurde vom Gegenverkehr überrascht und musste vom Asphalt auf den Seitenstreifen ausweichen, der dann ins Nichts führte.
Ein paar Stunden später fand mich Mouse unter der Leitung der Hexe Mama Jo.
Ich lag mehrere Wochen im Koma, war mir aber unter diesem Sargtuch durchaus mancher Dinge bewusst und fühlte mich, als wäre ich weit über das Verfallsdatum hinausgegangen. Die Augenblicke eines vergeudeten Lebens müllten den Boden um mein Sterbebett herum zu.
Schutt genau der gleichen Sorte umgab mich in Niskas sonnenbeschienenem Büroraum. Das Atmen fiel mir schwer, und die Erinnerung an ein Leben voller Schmerz und Sterben schien aus einer unermesslichen Tiefe nach mir zu greifen. Es war, als wäre ich bei dem Unfall gestorben, und so musste ich jedes Mal, wenn das Gespenst von damals zurückkehrte, erneut gegen das Verlangen ankämpfen, einfach loszulassen. Ich hätte auf der Stelle mein Leben aushauchen können. Später würde ich von meinen Freunden gefunden werden, gestorben ohne eine erkennbare Ursache.
Obwohl mich Hoffnungslosigkeit überfiel, hatte ich keine Angst. Das Leiden meines Volkes und meines Lebens drückte wie winzige Glutstückchen auf die Erlösung, welche die Gefühllosigkeit des Todes versprach. Ich nahm einen Atemzug und dann noch einen. Langsam hoben und senkten sich mein Brustkorb und meine Schultern. In den Sonnenstrahlen, die durch die Fensterscheibe hereinfielen, sah ich vom Licht angestrahlte Staubpartikel. Diese Schwebestoffe wurden von unvorstellbar kleinen Insekten begleitet, die auf ihrer geflügelten Suche nach Nahrung, Beistand und Sex unterwegs waren. Als ich das stoßweise Knarren des Hauses in der Morgenbrise hörte, fand ich irgendwie in den Rhythmus des Lebens zurück.
Nach alldem war ich sowohl erschöpft als auch erleichtert. Es war eine Erinnerung daran, dass die erbittertsten Schlachten in unseren Herzen und Seelen geschlagen werden und dass der Tod nur ein letzter Trick des Verstandes ist.
»Hi, Mr. Rawlins.«
Ich sah zuerst kurz auf das weiße Zifferblatt meiner Armbanduhr, bevor ich zu Niska Redman aufschaute. Es war 8:17 Uhr. Fast eine Stunde war vergangen, seit ich ihren Bürosessel in Beschlag genommen hatte.
Niska trug ein einteiliges kleegrünes Kleid, das ihre hübschen Knie nicht ganz bedeckte. Ich mochte die Sommersprossen um ihre Nase und das Lächeln, das verriet, dass sie sich ehrlich freute, mich zu sehen. Über ihrer linken Schulter hing ein ziemlich großer chamoisfarbener Leinensack.
»Hey, N. Wie geht’s?«
»Bestens. Ich hab gestern Abend braunen Reispudding gemacht.«
Sie schwang die Umhängetasche auf den Schreibtisch und öffnete sie. Darin sah ich ihre gepunktete blau-weiße Handtasche, mehrere Bücher, eine Trainingsmatte, einen feinzahnigen Kamm und einen Afro-Kamm, zwei Bürsten, eine Kosmetiktasche und eine Einliter-Tupperdose. Letztere nahm sie heraus und stellte sie vor mich.
»Mögen Sie?«, fragte sie.
»Vielleicht später.« Ich erhob mich von ihrem Stuhl, und sie stellte sich daneben.
»Haben Sie irgendwas Bestimmtes in meinem Schreibtisch gesucht?«
»Nein. Ich brauchte nur mal eine andere Perspektive. Wo ist Tinsford? Ich kann mich nicht erinnern, schon mal vor ihm hier gewesen zu sein, es sei denn, er arbeitete an einem Fall.«
»Hm-hmm, entschuldigen Sie mich kurz, aber ich muss zur Toilette.«
Sie ging den Büroflur hinunter zu der Tür hinter der von Whisper. Ich zog einen Gästestuhl von der hinteren Wand heran und stellte ihn vor ihren Arbeitsplatz, immer noch unter dem Eindruck meines tödlichen Kampfes mit den Dämonen der Vergangenheit.
Das Telefon klingelte einmal, und ich nahm den Hörer ab.
»Detektivbüro WRENS-L.«
»Easy?«
»Hey, Saul. Von wo rufst du an?«
»Hat Niska dir nichts gesagt?«
»Sie ist gerade erst reingekommen.«
»Ich bin im Norden. Bei den Werften in Oakland.«
»In Oakland?«
»Die IC hat letzten Mittwoch angerufen«, sagte er. »Sie haben eine Police mit der Seahawk Shipping Line abgeschlossen. Im Verlauf der letzten achtzehn Monate ist zu viel Frachtgut abhandengekommen, und sie wollen, dass wir mal einen Blick darauf werfen.«
Die IC war kurz für die IIC, die International Insurance Corporation, ein Versicherungsunternehmen im Besitz von Jean-Paul Villar, Präsident und CEO von P9, einer der größten Versicherungsgruppen der Welt. JPs Nummer Zwei war Jackson Blue, ein guter Freund von mir. Wir arbeiteten auf Provisionsbasis für die IIC, weswegen sofort einer von uns reagierte, wenn sie anriefen.
»Hast du schon mal was von einer Gruppe namens Invisible Panthers gehört?«, fragte Saul.
»Nein.«
Im hinteren Teil der Büros wurde eine Toilette gespült.
»Wer sind die?«, fragte ich.
»Man sagt, es wäre eine linksorientierte politische Gruppe, die nicht bekannt werden will.«
Niska kam vom Flur herein und deutete mit einem fragenden Blick auf ihr Ohr.
»Es ist Saul«, sagte ich zu ihr, und dann fragte ich ihn: »Ist das eine richtige politische Organisation?«
»Ich weiß es wirklich nicht. Vielleicht paramilitärisch. Ist Niska bei dir?«
»Ja.«
»Grüß sie von mir.«
»Diese radikalen Gruppen da oben sind gefährlich. Vielleicht solltest du jemanden bei dir haben. Ich könnte Fearless bitten.«
»Nein. Zumindest jetzt noch nicht. Ich knüpfe nur ein paar Kontakte, um auf dem Schwarzmarkt japanische Elektronik zu kaufen. Bislang kein Grund zur Sorge.«
»Okay. Aber pass auf dich auf.«
»Keine Sorge. Sag Niska, ich mach die Reisekostenabrechnung, wenn ich zurück bin.«
»Okay. Wir reden später.«
»Tschüs, Mr. Lynx!«, rief Niska, bevor ich auflegte.
»Er sagt, er macht die Reisekostenabrechnung, wenn er wieder hier ist.«
»Das sagt er immer. Tinsford ist auch unterwegs.«
»Wohin?«
Niska begann, ihren Schreibtisch aufzuräumen, während sie meine Frage beantwortete.
»Diese ältere weiße Dame namens Tella Monique ist letzten Dienstag hier gewesen«, sagte sie. »Sie wollte, dass er ihren Sohn Mordello findet, weil ihr Mann nichts mehr mit ihm zu tun haben wollte und ihn rausgeworfen hat, als er vor neun Jahren eine Katholikin geheiratet hat.«
»Vor neun Jahren?«
»Hm-hmm. Nachdem ihr Mann jetzt aber gestorben ist, will sie ihren Sohn und seine Familie zurückhaben.«
»Und wo genau macht Whisper das alles?«, fragte ich.
»Er ist in Phoenix, weil der Sohn sich da draußen einer Rockerbande namens Snake-Eagles oder so ähnlich angeschlossen hat.«
»Eine schwarze Rockerbande?«
»Ich glaub nicht.«
»Scheiße. Ich hoffe, sein Testament ist auf dem aktuellen Stand.«
Niska grinste. »Kein Mensch bekommt Mr. Natly zu sehen. Die werden nicht mal wissen, dass er dort war.«
»Irgendwas Neues für mich?«
»Eigentlich nicht. Haben Sie den Scheck von Mr. Zuma?«
»Öh …«
Charles »Chuck« Zuma war ein Millionär, der eine Zwillingsschwester namens Charlotte hatte. Charlotte benötigte fast ihre gesamten Dreißigerjahre, um ihre Hälfte des beträchtlichen gemeinsamen Erbes aufzubrauchen. Anschließend nutzte sie ein Schlupfloch im Familientrust, um Chucks achtundzwanzig Millionen in Inhaberschuldverschreibungen umzuwandeln. Danach verschwand Charlotte Zuma.
Ihr Bruder bot mir zwei Zehntel Prozent des Geldes an, das ich zurückholen konnte. Ich nahm den Job an, weil er nicht mit einem Gewaltverbrechen zusammenhing. Ich versuchte, einfache Jobs anzunehmen, bei denen es, nur als Beispiel, nicht um Rockerbanden oder linke paramilitärische Gruppen ging.
»Haben Sie das Geld bekommen?«, fragte Niska wieder.
»Eigentlich.«
»Eigentlich wie viel?«
»Die Schwester hat aus ihren verschwenderischen Jahren gelernt«, sagte ich. »Ihre Anlageberater haben Chucks Geld auf fast vierzig Millionen vermehrt.«
»Das macht ein Honorar von achtzigtausend Dollar.« Das schaffte sie, ohne ihre Finger zu Hilfe nehmen zu müssen.
»Die vierzig Millionen stecken in Anlagen, die zu entwirren man ein ganzes Heer von Finanzsachverständigen benötigt.«
»Aber Sie brauchen nicht mehr als achtzigtausend.«
»Chuck ist pleite. Er wohnt bei einem reichen Cousin nördlich von Santa Barbara.«
»Also sehen wir kein Geld?«
»Es wird mindestens ein Jahr dauern, bevor er seines bekommt und wir damit unseres. Aber er hat mir ein Pfand gegeben.«
»Was für ein Pfand?«
»Einen hellgelben 1968er Rolls-Royce Phantom VI.« Schon möglich, dass ich ein wenig das Gesicht verzog, als ich den Namen aussprach.
»Ein Auto?«
»Von denen gibt’s nur ein paar Hundert«, sagte ich. »Und keinen einzigen in Amerika. Er ist mindestens das Doppelte von dem wert, was Zuma uns schuldet.«
»Aber man kann ein Auto nicht bei der Bank einzahlen.«
»Ich könnte es verkaufen.«
»Ein Auto.«
»Ja.«
»Haben Sie unten geparkt?«
»Es ist in der Werkstatt.«
»Ein Auto, das noch nicht mal fährt?«
»Ich bin in meinem Büro.«
2
Ich mochte Niska. Sie dachte über jedes Problem erst mal nach, bevor sie eine Antwort anbot, und machte von daher nahezu immer einen guten Job. Aber ich war nicht in der Stimmung für guten Service oder Kameradschaft. An diesem Morgen sehnte ich mich nach Abschottung. Schon allein das Geräusch ihrer Schritte auf dem Flur machte mich fertig. Als sie zum zweiten Mal zur Toilette ging, musste ich wegen des Pfeifens der Rohre und der sich mit einem Klick schließenden Tür das Buch aus der Hand legen, in dem ich gerade las. Selbst der schwache Hauch ihres auf ätherischem Öl basierenden Parfums schien mich zu bedrängen.
Gegen 10:17 Uhr traf ich eine Entscheidung. Ich brauchte ein paar weitere Minuten, um den unangemessenen Ärger zu unterdrücken, bevor ich zum Empfang hinausging.
Niska tippte mit großer Geschwindigkeit auf ihrer IBM Selectric. Sie tippte, organisierte und archivierte unsere Notizen, Korrespondenz und Falljournale. Bei fünfundsiebzig Wörtern pro Minute raubte mir das schnelle Klacken des Kugelkopfes auf Papier den letzten Nerv.
»Niska.«
»Ja, Mr. Rawlins?« Sie hörte mit dem Lärm auf und schaute unschuldig hoch.
Ich zwang mich zu einem Lächeln und fragte: »Sie stehen doch auf transzendentale Meditation, richtig?«
Überrascht zog sie ihren Kopf fünf, zehn Zentimeter zurück.
»Öhm«, machte sie. »Ja. Wieso?«
»Es gibt doch solche zweiwöchigen Angebote, wo alle Yoga machen, richtig?«
»Es werden auch Übungen gemacht, aber in erster Linie wird meditiert. Ich war schon auf zwei Wochenendseminaren, aber die Wochenangebote sind ziemlich teuer. Außerdem hab ich ja sowieso nur zwei Wochen Urlaub. Ich hatte schon überlegt, vielleicht um Weihnachten herum einen zu buchen.«
»Was heißt denn teuer?«, fragte ich.
»Hundertdreißig Dollar – pro Woche.«
»Wie wär’s, wenn ich Ihnen zwei Wochen frei und das Geld für das Seminar gebe – zusätzlich zu Ihrem normalen Gehalt? Sie könnten dort anrufen und gleich heute Morgen hinfahren.«
»Aber was ist mit den Akten und dem Telefon?«
»Akten können warten, und wie man ein Telefon bedient, hab ich schon gelernt, da waren Sie noch nicht auf der Welt.«
Das war etwas Neues für unsere Empfangschefin/Büroleiterin. Falten tauchten zwischen ihren Augenbrauen auf, und sie rümpfte die sommersprossige Nase.
»Ich komme da nicht ganz mit«, sagte sie.
»Ich möchte allein sein, Liebes. Das ist alles. Whisper und Saul sind bereits unterwegs, wahrscheinlich noch eine ganze Weile. Ich denke, es wäre für uns beide das Beste.«
»Dann soll ich also einfach meinen Kram nehmen und gehen?«
»Sobald ich das Geld, das Sie brauchen, aus dem Safe geholt habe, ja.«
Sie druckste herum und protestierte vor allem deshalb, weil es 1969 kaum einen Präzedenzfall dafür gab, dass ein Chef aus einer Laune heraus einfach so freigab. Und zweihundertsechzig Dollar plus das Gehalt für zwei Wochen, um etwas zu tun, das man gern machte, war fast undenkbar. Aber das Angebot war einfach zu gut, um es auszuschlagen, und so war sie dann mittags weg, und ich konnte in die Einsamkeit meines Büros zurückkehren.
Ich lehnte mich auf meinem geräumigen Eichenthron zurück und seufzte tief.
»Endlich allein«, sagte ich laut.
»Entweder für immer oder für nicht mehr lange«, intonierte eine körperlose Stimme. Im Leben hatte diese Stimme einem alten Mann gehört, den ich nur als Sorry kannte. Er war der weiseste Mann meiner Kindheit, dessen Ratschläge mich ungefähr alle paar Jahre daran erinnerten, dass ich nicht alles wusste und mich deshalb vor Bananenschalen und toten Winkeln, eifersüchtigen Ehemännern und attraktiven Ehefrauen in Acht nehmen sollte.
Mehr als nur einmal habe ich mir Sorgen gemacht, dass diese Stimme ein Zeichen für eine schwere Geisteskrankheit sein könnte. Aber dann rief ich mir wieder ins Gedächtnis, dass wir in einer Welt des Irrsinns lebten, in der jeder Tag durch Krieg, atomare Bedrohung und das Abschlachten von Kindern zu einer harten Belastungsprobe wurde.
In dem Amerika, das ich liebte und hasste, konnte man reich werden oder, was wahrscheinlicher war, im Handumdrehen pleitegehen. Deshalb hatte ich einen Haufen Bares an einem sicheren Ort versteckt, keine Miet- oder Hypothekenzahlungen und auch keine Grundsteuer zu entrichten. Und das war nur die materielle Seite des Lebens. Mein wahrer Reichtum war eine kleine Familie, ein paar gute Freunde und eine Telefonnummer, die nicht einmal der Polizei bekannt war.
Das waren ganz normale Vorsichtsmaßnahmen. Ich vergaß nie die simple Tatsache, dass ich ein schwarzer Mann in Amerika war, einem Land, das seine Größe auf den Bollwerken der Sklaverei und des Genozids errichtet hatte. Aber obwohl ich mir der Verbrechen und Verbrecher der Vereinigten Staaten absolut bewusst war, musste ich doch zugeben, dass unsere Nation jeder Frau und jedem Mann mit Verstand, Einsatzbereitschaft und mehr als nur ein bisschen Glück eine glänzende Zukunft bot …
Aus dem vorderen Teil der Büros, den Flur hinunter, kam ein Geräusch. Höchstwahrscheinlich ein Knacken des sich setzenden Fundaments. Aber vielleicht war es auch gar kein wirkliches Geräusch, sondern nur mein Bauchgefühl.
Ich schaute auf und sah den Schatten eines Mannes, der ein kurzes Stück vor der Tür stand, dem einzigen Ausgang meines Büros.
Geh nach links oder rechts, aber niemals geradeaus, es sei denn, es gibt keinen anderen Weg, lehrte Mr. Chen oft in seinem Selbstverteidigungskurs. Versuche, die Kontrolle über die Situation zu gewinnen, statt beweisen zu wollen, dass du der Stärkere bist. Der andere ist immer stärker, aber von rechts oder links wirst du ihn schlagen.
Das Problem war nur, dass ich auf einem Sessel an einem Schreibtisch saß und die nächste Waffe in der untersten Schublade lag. Wer immer hereingekommen war, war gut; er machte kaum ein Geräusch. Selbst wenn ich mich nach rechts fallen ließ und nach der Schublade griff, hätte er mich einfach durchs Holz erschießen können.
Er machte einen Schritt vorwärts. Ich sah, dass er groß und schlank war und sich wie ein Panther bewegte, aber sein Gesicht dennoch im Schatten verborgen blieb.
»Sind Sie Easy Rawlins?«, fragte er.
Mit diesen Worten trat der unangemeldete Besucher über die Schwelle. Er war irgendwas Anfang zwanzig, hatte sehr kurzes rötlich-blondes Haar und eine üble Prellung an der linken Schläfe. Er trug ein pfirsichfarben-weiß kariertes, kurzärmeliges Hemd über einem weißen Unterhemd. Seine Jeans wirkten steif und endeten oberhalb von lautlosen, weißen Turnschuhen. Ich hatte bereits am Klang seiner Worte erkannt, dass er ein weißer Junge war.
»Platzen Sie immer so bei Leuten rein?«, erwiderte ich.
»Die Tür war nicht abgeschlossen«, sagte er. »Und ich hab Hallo gesagt, als ich reingekommen bin.«
Er machte einen weiteren Schritt, und ich lehnte mich wieder zurück. Seine leeren Hände hielt er locker an den Seiten.
»Ich bin Rawlins. Wer sind Sie?«
Er machte einen weiteren Schritt und sagte: »Craig Kilian.«
Noch ein Schritt. Es fühlte sich an, als wollte er mir auf den Schreibtisch steigen.
»Warum nehmen Sie nicht einfach Platz, Mr. Kilian?«
Das Angebot schien den jungen Mann zu verwirren. Er schaute nach links und entdeckte den Stuhl aus Walnussholz mit gerader Rückenlehne. Kurz darauf machte er die erforderlichen Bewegungen, um sich zu setzen.
»Sind Sie frisch aus dem Militärdienst entlassen worden, Craig?«
»Hm-hmm. Sagen Sie das wegen meines Bürstenschnitts?«
»Ja. Klar.«
In Kilians Blick lag ein gequälter Ausdruck, der vermutlich auch noch da gewesen wäre, hätte er keinen übergezogen bekommen. Während des gesamten Zweiten Weltkriegs war ich Soldaten von beiden Seiten des Schlachtfelds begegnet, die diesen Blick hatten, die vom Lärm des Krieges gezeichnet waren.
Craig nahm ein Päckchen Zigaretten der Marke True aus der Brusttasche seines Hemdes, fischte mit den Lippen einen der Sargnägel heraus und zog ein Streichholzheftchen aus der Zellophanhülle des Packs. Er gab sich Feuer, nahm einen tiefen Zug und atmete aus.
Dann sah er mich fragend an. »Was dagegen, wenn ich rauche?«
Ich hatte was dagegen. Ich versuchte schon seit einigen Jahren aufzuhören. Aber etwas an Craigs finsterem Blick veranlasste mich, ihm gegenüber etwas großzügiger zu sein.
Wie ich ihn an dieser Zigarette nuckeln sah, wurde ich an einen frühen Morgen im Oktober 1945 erinnert. Es war außerhalb von Arnstadt in Deutschland, und ich hatte am Ende einer langen Nacht mit heftigem Regen Wachdienst. Der Krieg war gerade vorbei, und wir waren nicht mehr so wachsam wie im Kampf. Meine Marke war Lucky Strike. Während ich rauchte, fragte ich mich, wie es wohl wäre, nach Texas zurückzukommen, nachdem ich den weißen Mann ausgetrickst und besiegt und mich obendrein mit seinen Frauen angefreundet hatte.
Ich weiß nicht mehr, warum ich nach rechts gesehen habe – ein Geräusch, eine Eingebung –, jedenfalls sah ich einen deutschen Soldaten in einer schmutzigen, zerfledderten Uniform, der sich mit hoch erhobenem Bajonett auf mich stürzte. Ich drehte mich gerade noch rechtzeitig um und konnte das Handgelenk der messerschwingenden Hand packen. In diesem Augenblick hielten wir uns gegenseitig fest, waren fast bewegungslos, gefangen in einem Kampf auf Leben und Tod. Meine Zigarette fiel auf den Ärmel seines Mantels. Ich weiß nicht, wie ich auf ihn wirkte, sein ausgemergeltes Gesicht jedenfalls war verzweifelt und seltsamerweise fast flehend. Er verstärkte den Druck immer mehr, aber ich hielt in gleichem Maß dagegen. Wahrscheinlich war der entscheidende Faktor bei diesem Handgemenge die Tatsache, dass ich gut genährt war und er nicht. Durchaus möglich, dass er versuchte, mich umzubringen, um so vielleicht an ein paar Rationen zu kommen.
Der schwelende Ärmel begann zu brennen. Rauch zog mir ins linke Auge. Ich zuckte zusammen, und er drückte fester zu. Wir zitterten beide vor Anstrengung, standen buchstäblich in Flammen. Ich bemerkte eine Träne, die sich aus seinem Auge löste. Zuerst dachte ich, es sei eine Reaktion auf den Rauch, doch dann sah und spürte ich, dass er weinte. Er schüttelte sich heftiger, und es gelang mir, ihn in den regennassen Schlamm zu drücken. Auf dem Boden gewann ich die Oberhand und drückte die Klinge zu seiner Kehle hinunter. Er gab alles, um sich zu schützen, während er weiter flennte.
Ich hätte ihn töten können, wie schon Dutzende andere zuvor im Nahkampf. Den Tod zu bringen, war mir nach Jahren auf dem Schlachtfeld in Fleisch und Blut übergegangen. Doch stattdessen drückte ich seinen Bajonettarm zur Seite, schlug ihn auf die nasse Erde, löschte das Feuer. Er ließ den Dolch los, rollte sich zu einer Kugel zusammen und heulte, was das Zeug hielt. Ich saß lange Minuten neben ihm. Als er sich schließlich wieder aufrichtete, reichte ich ihm meine Feldverpflegung und gab ihm zu verstehen, dass er gehen könne. Ich hätte ihn als Kriegsgefangenen mitnehmen sollen, aber in letzter Zeit hatte unsere Truppe jeden hingerichtet, den sie für einen Nazi hielt.
Craig Kilian erinnerte mich an den Soldaten, den ich verschont hatte. Zutiefst traumatisiert durch den Krieg und überwältigt im Zivilleben, existierte er in seiner eigenen Welt und versuchte immer noch, einen Weg zurück nach Hause zu finden. Tausende junger Männer wie Craig kehrten aus Vietnam zurück. Unschuldige, Mörder und Kinder, alle gleichermaßen in den vom Krieg abgehärteten Körpern von Veteranen, die keine Ahnung hatten, was sie getan hatten oder warum.
Ich griff in die Schublade, in der sich meine Pistole befand, und holte einen Aschenbecher heraus, den ich dort für die Gelegenheiten aufbewahrte, wenn mein Freund Mouse zu Besuch kam. Ich stellte die Keramikschale vor Craig und sagte: »Tun Sie sich keinen Zwang an.«
Er nahm einen weiteren Zug von seiner Extraleicht-Zigarette und klopfte dann graue Asche auf das weiße Porzellan.
Da saßen wir also; er vornübergebeugt und rauchend, ich zurückgelehnt und mit der Frage beschäftigt, ob ich die Pistole aus der Schublade hätte nehmen sollen.
Es vergingen vielleicht zwei Minuten.
»Warum sind Sie hier, Mr. Kilian?«
»Ich … man hat mir gesagt, Sie wären ein guter Detektiv, und, äh, äh, ehrlich.«
»Wer hat Ihnen das gesagt?«, fragte ich.
»Ein Mann namens Larker. Kirkland Larker.«
»Ich kenne niemanden mit diesem Namen.«
Kilian starrte mich an, ein Reh, erstarrt im Scheinwerferlicht.
»Ist er ein Vet?«, fragte ich.
»Ja.«
»Welcher Krieg?«
»’Nam.«
»Ich war nie drüben. Ist er ein Schwarzer?«
»Können Sie mir helfen?«, fragte Craig, statt meine Frage zu beantworten.
»Ich nehme mal an, Sie brauchen einen ehrlichen Mann, weil es etwas Fragwürdiges gibt, das untersucht werden muss.«
»Wie kommen Sie darauf?«
»Die Prellung an Ihrem Kopf. Sie drucksen herum, statt mir einfach zu sagen, warum Sie hier sind. Und Sie sehen mir nicht in die Augen.«
»Ich brauche jemanden, dem ich vertrauen kann«, sagte er und sah mich direkt an.
»Um was zu tun?«
Die Frage hätte zwei stromführende Drähte sein können, die man an seine Kiefergelenke drückte. Sein Gesicht verzog sich wie das eines Cartoonbösewichts, dem es trotz seiner bestialischen Kraft nicht gelang, Popeye zu pulverisieren.
All dies war lediglich Vorspiel für das plötzliche donnernde Nachbeben der Explosion, die den Raum erschütterte.
3
Die Fensterscheiben hinter mir schepperten in ihren Rahmen. Ich spürte, wie die Luft auf mein Trommelfell drückte.
Es war nur ein weiterer Überschallknall, ein Düsenjäger, der die Schallmauer durchbrach. Ich hatte es schon so oft gehört, es bedeutete nichts mehr. Aber für den frischgebackenen Absolventen der Universität Vietnam ging es um Leben und Tod.
Sofort kam Craig über den breiten Schreibtisch auf mich zugeschossen. Ich bewegte mich nach rechts, war aber nicht schnell genug.
Craigs kräftiger linker Arm umschlang mich, und einen Moment lang glaubte ich schon, meine letzten Momente in den Händen eines kampferprobten Veteranen zu erleben, der im Dschungel von Vietnam den Verstand verloren hatte. Doch statt mich abzustechen, zu erwürgen oder auf mich einzudreschen, zog sich der junge Löwe in die nächste Ecke zurück und zog mich dabei wie eine Art Schutzschild mit sich. Er zitterte, und ein leises Stöhnen, fast schon ein Knurren, löste sich aus seiner Brust.
Ich stieß mich ab und drehte mich zu ihm, um ihm Schutz vor dem vermeintlichen Angriff zu bieten. Er hatte den Kopf in seinen Armen vergraben. Eine übernatürliche Stille umgab ihn.
»Alles okay, Soldat«, sprach ich ruhig in Richtung seines Kopfes. »Alles in Ordnung. Das war nur ein Überschallknall. Ein Überschallknall. Du bist in Sicherheit. Alles gut.«
»Wie viele, Sergeant?«, fragte er leise. »Wie viele sind es?«
»Die sind alle tot, Soldat. Sie sind schon lange tot. Du bist in Sicherheit, heil und unversehrt.«
Ich legte eine Hand auf seine rechte Schulter, was bewirkte, dass er zurückzuckte und nach Luft schnappte.
»Alles gut«, sagte ich. »Sie sind alle tot. Tot und beerdigt.«
Als ich ihn wieder mit einer Hand berührte, wehrte er sich nicht mehr.
»Ich kann sie hören«, sagte er. »Ich kann sie jede Nacht hören, wenn alle anderen schlafen. Ich höre sie.«
Ich erinnerte mich noch gut an meine Nachtängste, nachdem ich zum zweiten Mal an der Befreiung eines Konzentrationslagers teilgenommen hatte; die lebendigen Skelette von Männern und Frauen, die um die Leichen der Deutschen tanzten, die wir getötet hatten.
»Es war nur ein Überschallknall«, sagte ich wieder, und Craig hob den Kopf.
Er schaute sich verwirrt um. Es war, als wüsste er nicht, wie er dorthin gekommen war, auf dem Boden kauernd und mit einem schwarzen Mann, der vor ihm kniete.
»Was ist passiert?«, fragte er mich.
»Irgendein Schwachkopf hat die Schallmauer durchbrochen, und Sie hatten einen Flashback in den Krieg.«
Er nickte, und ich streckte eine Hand aus, mit der ich uns beide auf die Füße hochzog.
»Einer meiner Partner bewahrt eine schöne Flasche Bourbon in seiner Schreibtischschublade auf«, sagte ich. »Wieso genehmigen wir uns nicht ein Gläschen?«
Whisper hatte immer eine Flasche Cabin Still Sour Mash Bourbon in seiner unteren Schublade. Da waren auch Gläser. Ich leerte mein erstes Glas mit einem Zug. Craig genauso. Er musste ziemlich husten. Ich nippte nur an meinem zweiten Glas, aber er leerte auch das in einem Zug, wobei er diesmal nur ein bisschen würgte.
Er hielt mir das Glas für eine dritte Runde hin, aber ich schüttelte den Kopf und sagte: »Gehen wir erst mal wieder zurück in mein Büro und sprechen darüber, wozu Sie einen ehrlichen Detektiv brauchen.«
Wir saßen wieder, schwiegen wieder, während Craig überallhin schaute, nur mich sah er nicht an. Nachdem ich das eine Weile mitgemacht hatte, sagte ich schließlich: »Also, was wollen Sie, Craig?«
Er machte ein säuerliches Gesicht und wandte sich ab, wobei er dermaßen herumzappelte, dass es für einen Augenblick so aussah, als würde er von seinem Stuhl kriechen.
Dann erstarrte er.
»Haben Sie schon mal was von Blood Grove gehört?«, fragte er.
»Nee, ich glaub nicht. Eine Schlacht in Vietnam?«
»Nein. Es ist ein Orangenhain ganz am Ende des San Fernando Valley. Die haben sich auf Blutorangen spezialisiert.«
»Okay. Ist das Ihr Problem?« Ich war wirklich nicht ungeduldig, aber Craig musste ein bisschen gepusht werden, andernfalls kam er nicht in die Gänge.
»Ich, also, ich fahr da gern zum Kampieren raus, wenn die Albträume anfangen, obwohl ich noch wach bin, verstehen Sie?«
Ich nickte.
»Da draußen gibt’s eigentlich nur Farmen. Und wenn man zu dieser Stelle hinaufklettert, die Knowles Rock heißt, gibt’s da eine Hütte, die kein Mensch benutzt, und einen Campingplatz, wo man ein Feuer machen und so allein sein kann, als wäre man der einzige Mensch auf der Welt. Normalerweise gehe ich nur zu diesem Campingplatz, weil ich gern im Freien schlafe. Die Hütte liegt ungefähr eine Viertelmeile von dort entfernt.«
»Und Ihr Problem, was immer das ist, hat was mit da draußen zu tun?«
Craig blinzelte mich an.
»Ja«, sagte er. »Am frühen Abend war ich fest eingeschlafen. Es war ein heißer Tag gewesen, und von der Stelle, wo ich das Auto meiner Mutter zurücklasse, ist es ein Fußmarsch von sieben Meilen. Ich hab mich früh schlafen gelegt. Bei Mondaufgang bin ich dann urplötzlich aufgewacht. Der Vollmond hat mir direkt ins Gesicht geglotzt. Und als ich mich aufsetze, sehe ich ein Lagerfeuer oben an der Hütte.«
»Eine Viertelmeile entfernt«, sagte ich, nur um zu beweisen, dass ich zuhörte.
»Ja. Ich hab zum Mond hochgesehen und dann zum Leuchten des Lagerfeuers, und es war, als würde ich davon angezogen, wie eine Motte oder so was. Und dann hab ich eine Frau schreien hören. ›Alonzo! Alonzo!‹ Es war nur leise, wegen der Entfernung und den Bäumen und allem, aber ich hab’s gehört. Wahrscheinlich hatte sie das laut gebrüllt, und davon war ich wach geworden. Ehe ich mich versah, war ich auf den Beinen und bin nur in langer Unterhose und T-Shirt Richtung Hütte losgerannt. Je näher ich kam, desto lauter wurden ihre Schreie. Sie schien verrückt zu sein vor Angst.«
Craig unterbrach sich, hielt die rechte Hand über Mund und Nase. Ich dachte schon, ich müsste ihn wieder antreiben, aber dann fuhr er fort. »Sie waren vor der Hütte. Die Kleidung der Frau war total zerrissen. Ein großer Schwarzer mit langen glatten Haaren hatte sie an einen Baum gefesselt. Er hatte ein Messer in der Hand. Und ehe ich mich versah, bin ich dann auf ihn losgestürmt.«
Craig sprach nicht weiter, weil er sich an die Ereignisse in dem Orangenhain erinnerte. Er war wie hypnotisiert und keuchte schwer. »Was ist dann passiert?«, fragte ich.
»Ich hab ihn gepackt. Hab versucht, ihm das Messer abzunehmen. Wir sind zu Boden gestürzt, und die Frau, eigentlich noch ein Mädchen, brüllte: ›Nein, tu das nicht! Misch dich nicht ein!‹«
»Nicht einmischen in was?«
»Keine Ahnung«, sagte er beinahe flehend. »Ich weiß es nicht.«
Es folgte eine kurze Pause in der Geschichte. Ich war froh, Niska fortgeschickt zu haben.
Nach einer Weile sagte ich: »Warum erzählen Sie die Geschichte nicht einfach zu Ende, Craig? Erzählen Sie zu Ende, und dann trinken wir noch ein Glas.«
»Wir haben uns auf dem Boden gewälzt, um das Messer gekämpft, und das Mädchen hat dauernd geschrien … und dann hab ich ihn auf den Rücken geworfen.«
»Wie bei einem Judowurf?«
»Nee. Er hat versucht, auf mich drauf zu kommen, aber bevor er das geschafft hat, hab ich mich hochgewuchtet und bin auf ihn gestürzt. Das war der Punkt, an dem ich spürte, wie das Messer sich in seine Brust grub. Er bekam richtig große Augen, wie ein Mann, der begreift, dass er eine üble Verwundung abbekommen hat.«
Craig Kilian stand auf und wich zurück, stieß dabei den Stuhl um. Er kam bis zur Wand anderthalb Meter hinter ihm. Ich glaube, er wäre auch eine Meile gegangen, wenn nichts ihn aufgehalten hätte. »Ich stand über ihm, und er umklammerte das Heft von diesem Bajonett, ich meine, von diesem Messer. Das Mädchen schrie: ›Alonzo!‹«
»Alonzo?«, fragte ich.
»Ich wollte einen Sanitäter rufen, aber dann hat mich irgendwas erwischt.« Er hob seine Hand zu dem blauen Fleck an seiner Schläfe. Tränen rollten aus seinen Augen, aber er zeigte keines der anderen Anzeichen für Weinen – kein Schluchzen oder Jammern.
Ich konnte fast den sterbenden Mann sehen, der ausgestreckt vor Kilians Augen lag. Hinter ihm war der Vietnamkrieg mit all seinen Toten, den Flächenbombardierungen und schweren Stiefeln. In der Ferne, weit dahinter, stellte ich mir Korea und Auschwitz vor, Nagasaki und zehntausend Sklavenschiffe, die vom fernen Horizont über den Atlantik herüberkamen.
»Mr. Kilian.« Die letzten paar Minuten war kein Wort gesprochen worden. »Craig.«
Er hob den Blick vom Boden, wo der Mann namens Alonzo im Sterben lag. Er sah mich, aber ich war nicht sicher, ob er wusste, warum ich da war.
»Was?«
»Was ist passiert, nachdem Sie den Schlag bekommen haben?«
Seinem Gesichtsausdruck nach ergab die Frage für ihn keinen Sinn.
»Nachdem Sie Alonzo niedergestochen haben«, fügte ich hinzu.
»Ich war k. o.«, antwortete er. »Als ich wieder zu mir kam, war es Morgen. Ungefähr null-sechshundert Uhr. Die Sonne war schon aufgegangen.«
»Was war mit dem Mädchen und dem Mann, der niedergestochen wurde?«
»Keiner da«, sagte er und schüttelte den Kopf. »Keiner, außer dem Hund.«
»Welcher Hund?«
»Ein kleiner schwarzer Welpe hat mir das Gesicht abgeleckt. Aber nirgends ein weißes Mädchen oder ein schwarzer Mann. Ich hab nicht mal Blut auf dem Boden gesehen.«
»Alles weg?«
»Nur das Hündchen und ungefähr tausend Kohlweißlinge, die durchs Gras flatterten.«
»War die weiße Frau kräftig und stark?«, fragte ich.
»Nee. Sie war klein.«
»Und wie kräftig war Alonzo?«
»Bisschen größer als ich und stämmig. Sie wissen schon, neunzig Kilo oder mehr.«
»Kommen Sie«, sagte ich. »Trinken wir noch einen.«
4
Ich setzte mich hinter Whispers Schreibtisch und überließ Craig den Besucherstuhl. Ich sagte ihm, er solle dieses Glas in kleinen Schlucken trinken, denn mehr würde er nicht kriegen.
Ein Teil seiner Geschichte klang wahr, vielleicht sogar der größte Teil. Aber noch mehr als das glaubte ich an die inhärente Güte des traumatisierten Soldaten.
Güte ist in meinem Beruf ein komplexer Begriff. Gute Männer und Frauen können sich schrecklicher Verbrechen schuldig machen, genau wie es Menschen mit bösen Absichten gibt, die von einem Gericht niemals für schuldig befunden werden können. In einem Buch, das ich kürzlich gelesen hatte, war die Hauptfigur Billy Budd so gut wie ein Mensch nur sein kann, aber trotzdem bringt er einen bösen Mann namens Claggart um. Güte und Schuld gehen oft Hand in Hand.
»Also, was wollen Sie von mir?«, fragte ich.
Die erste Reaktion des Veteranen war, als hätte ich ihm eine Ohrfeige gegeben. Sein Kopf zuckte zurück, und in seinen Augen blitzte Zorn auf. Aber irgendwann hatte Craig Kilian offenbar gelernt, sein hitziges Temperament im Griff zu behalten. Er holte tief Luft und schüttelte sich.
»Sie sind Detektiv«, sagte er. »Ein guter, hab ich gehört.«
»Von einem Mann, von dem ich noch nie gehört habe.«
»Ich möchte, dass Sie rauskriegen, ob ich diesen Mann getötet habe und was aus der Frau geworden ist. Was haben sie dort gemacht?«
»Was jetzt genau? Was ist das Wichtigste? Ob der Mann gestorben ist oder ob das Mädchen noch lebt und es ihr gut geht. Oder warum sie dort waren.«
»Ob ich ihn umgebracht habe, das ist das Wichtigste«, sagte er. »Aber ich würde gern alles wissen. Ich finde, ich muss es wissen.«
»Hat Alonzo ihren Namen gesagt?«
»Nein.«
»Hat sie Sie geschlagen oder war sie noch gefesselt?«
Diese Frage erwischte Craig kalt. Er dachte einen Moment nach, dann noch einen Moment. Es schien, als sei die Antwort sehr wichtig.
»Sie war gefesselt, ja, mit ’nem Seil, aber das Seil war irgendwie locker, also könnte sie sich befreit haben.«
Ich lehnte mich zurück und dachte nach. Das hier war einer jener Fälle, die ich nicht mal in Erwägung ziehen sollte. Aber da war etwas …
»Warum brauchen Sie diese Antworten?«, fragte ich.
»Weil ich nicht schlafen kann. Seit diesem Morgen hab ich keine zehn Minuten mehr geschlafen.«
»Vor wie vielen Tagen ist das alles passiert?«
»Drei. Vor drei Tagen.«
»Hören Sie, Mann, Sie sind in eine Schlägerei geraten, haben vielleicht einen Kerl niedergestochen und sind dann bewusstlos geschlagen worden. Sie sind aufgewacht, und da war keine Leiche mehr und auch niemand, der einen so kräftigen Burschen von dort hätte wegtragen können. Höchstwahrscheinlich war es ihr Liebster, und sie hat ihm geholfen wegzukommen. So ist es normalerweise. Ein Mann und eine Frau geraten sich in die Haare. Er schlägt sie, und sie schreit Zeter und Mordio, aber sobald sich jemand einmischt, geht sie auf denjenigen los. Gibt ihm was mit einem Stein auf die Nuss.«
»Aber warum sollte sie so etwas tun?«
»Warum bringen junge Männer wie Sie in Vietnam Frauen und Kinder um?«, stellte ich die Gegenfrage.
Craig kniff die Augen zusammen. Er dachte über etwas nach. Diese Gedanken schafften es nicht, Worte zu werden. Dann nickte er. Ich meinte, ihn fast überzeugt zu haben und gerade noch mal davongekommen zu sein, mich seines Anliegens anzunehmen.
»Hm«, brummte er. »Ich versteh schon, was Sie sagen, aber könnten Sie mir einen Gefallen tun?«
»Was für eine Art von Gefallen?«
»Würden Sie mit meiner … meiner Mutter reden?«
»Ihrer Mutter?«
»Hm-hmm.«
»Warum?«
»Ich glaube, sie könnte es besser erklären als ich.«
»War Ihre Mutter dabei?«
»Nein. Aber sie kennt mich. Sie kann Ihnen erklären, worum ich bitte.«
»Was kann sie mir sagen, das Sie mir nicht sagen können?« Ich war wirklich perplex.
»Rufen Sie sie einfach an. Rufen Sie sie an, dann werden Sie schon sehen, was ich meine.«
Da war ich also, wie um 7:04 Uhr morgens, wenn ich darauf wartete, dass der Hippie mit seiner langhalsigen Gießkanne herauskam. Etwas an Craig Kilian machte mich neugierig.
»Und wie haben Sie mich noch mal gefunden?«, fragte ich.
»Ich hab es Ihnen doch schon gesagt. Kirkland Larker. Er sagte, dass Sie ein guter Detektiv sind, dass Sie kein Weißer sind und dass Sie möglicherweise etwas über diesen Alonzo herauskriegen können.«
»Aber ich kenne keinen Kirkland.«
»Aber er weiß von Ihnen.«
»Woher kennen Sie ihn?«, fragte ich, suchte nach einem Grund, nach irgendeinem Grund – so oder so.
»Es gibt da eine Bar an der Western, die heißt Little Anzio. Es ist nichts Offizielles oder so, aber zum größten Teil gehen da nur Veteranen hin.«
»War nie drin, aber ich kenne den Laden. Dieser Kirkland treibt sich dort rum?«
»Ja. Ja, da hab ich ihn kennengelernt.«
»Sie sehen nicht mal alt genug aus, um in eine Bar reingelassen zu werden.«
»Ich bin dreiundzwanzig.«
»Wie viele Einsätze hatten Sie?«
»Drei.«
»Was für welche?«
»Die beiden letzten waren Vernichtungsmissionen. Search and Destroy.« Je mehr er vom Krieg sprach, desto sicherer schien er zu werden.
»Und diesen Kirkland haben Sie im Little Anzio kennengelernt?«
»Er hat mir irgendwann mal ’nen Drink ausgegeben, und wir sind ins Gespräch gekommen.«
»Wann war das?«
»Vor ungefähr vier Monaten. So in der Richtung.«
»Und Sie haben ihm vor ein paar Tagen von Alonzo und dem weißen Mädchen erzählt?«
»Ja.«
»Und da hat er mich zum ersten Mal erwähnt?«
»Ja. Ich hab gesagt, dass ich wegen ’nem weißen Mädchen in ’ne Schlägerei mit ’nem … ’nem Schwarzen geraten bin. Ich hab gesagt, ich wäre k. o. geschlagen worden, und jetzt würd ich jemanden suchen, der herausfinden kann, ob mit ihr alles okay ist. Er hat kurz telefoniert und mir dann Ihren Namen gegeben.«
Er hatte eigentlich sagen wollen: Ich bin in eine Schlägerei mit einem Nigger geraten. Da war ich sicher.
Ich starrte ihn an, und er zappelte ein bisschen herum.
»Es kann nichts Gutes dabei herauskommen, wenn ich diesen Alonzo finde – tot oder lebendig«, sagte ich. »Wollen Sie im Gefängnis landen, nur weil Sie ein paar Nächte nicht schlafen konnten?«
Craig rührte sich auf seinem Stuhl. Man konnte das nur als wellenförmige Bewegung beschreiben; als ob ein Wesen, das in ihm geschlafen hatte, plötzlich erwacht wäre.
»Und? Werden Sie meine Mutter anrufen?«
»Nein.«
Der Schock, der sich auf seinem Gesicht abzeichnete, brachte mich fast zum Lachen. Er war wie ein Achtjähriger, nachdem er sein Herz ausgeschüttet hatte. Er konnte sich beim besten Willen nicht vorstellen, dass ich ihm seinen Wunsch nicht erfüllen könnte.
»Falls wir überhaupt miteinander reden, muss ich sie schon persönlich treffen«, sagte ich. »Man kann keiner Stimme am Telefon trauen, die von Mord redet.«
»Oh, okay«, sagte er. »Klar. Geht in Ordnung. Soll ich die Adresse aufschreiben? Ich ruf sie an und sag ihr, dass Sie kommen.«
Ich dachte, vielleicht sollte er ihr auch sagen, dass ich ein Narr bin. Vielleicht das auch.
Ich nahm ein Blatt Papier und einen gelben HB-Bleistift aus Tinsfords oberster Schublade. Während ich das tat, wurde mir klar, dass er merken würde, dass ich sein Büro benutzt und seinen Whiskey getrunken hatte. Ich hoffte, es würde ihm nichts ausmachen.
Ich gab Craig das Blatt und den Bleistift und sagte: »Schreiben Sie’s auf. Sagen Sie ihr, ich werde heute im späteren Tagesverlauf vorbeikommen. Geben Sie mir auch ihre Telefonnummer. Ich werd’ sie anrufen, aber nur, um zu sagen, wann ich komme. Und wo Sie schon mal dabei sind, können Sie mir auch gleich aufschreiben, wie man zu diesem Campingplatz kommt – nur für den Fall, dass ich mich dort mal umsehen möchte.«
»Wir könnten jetzt gleich hinfahren.«
»Ich habe noch andere Dinge zu erledigen.«
»Sie werden aber nicht zu den Cops gehen, oder?« Kilian spannte sich auf seinem Stuhl an, und ich bezweifelte, dass mein Selbstverteidigungstraining ausreichen würde, um mit ihm fertigzuwerden.
»Und was sollte ich denen sagen?«, fragte ich. »Dass so ein weißer Junge und Vietnamveteran sagt, er habe in einem anderen County jemanden mit Namen Alonzo niedergestochen, sei k. o. geschlagen worden und dann, als er wieder zu sich kam, war der Mann weg, den er niedergestochen hat?«
»Keine Ahnung. Vielleicht.«
»Schreiben Sie auf, wie ich fahren muss, dazu den Namen Ihrer Mutter, die Telefonnummer und die Adresse. Sagen Sie ihr, ich komme später vorbei.« Craigs Gesicht sagte mir, dass er Einwände erheben wollte. Wieder war er dieser achtjährige Junge, der unbedingt seinen Kopf durchsetzen wollte.
»So oder gar nicht«, sagte ich.
Nach ein, zwei Augenblicken fing er an zu schreiben.
Der Eingang zu unserem Büro führte zu einem eigenen Treppenhaus, durch das man von der Straße aus heraufkam. Ich begleitete Craig Kilian ans Kopfende der Treppe und sah zu, wie er hinunterging. Durch das kleine Fenster gegenüber der Eingangstür verfolgte ich weiter, wie er die Straße überquerte und in einen eierschalenfarbenen Studebaker stieg. Drei Minuten vergingen, bis der Motor ansprang und das Auto losfuhr.
Als er weg war, ging ich wieder hinein und vergewisserte mich, dass die Eingangstür abgeschlossen war. Dann spülte ich Tinsfords Gläser und stellte sie an ihren Platz in der Schublade zurück. Auf der kleinen Toilette erledigte ich mein Geschäft, machte dann sauber. Im Spiegel waren die Gesichter vieler Männer zu sehen: ein Schwarzer mittleren Alters, gut in Form, aber auch schon etwas abgenutzt; ein Veteran, der Craig Kilian nicht unähnlich war; ein eigener Herr, der Befehle nur aus Liebe, Pflichtgefühl oder, viel zu oft, aus Schuldgefühlen heraus befolgte.
Vielleicht zwölf Minuten nachdem mein potenzieller Auftraggeber verschwunden war, ging ich zuerst südlich zum Pico und dann nach Osten. Als ich die Kreuzung mit dem La Cienega Boulevard erreichte, hielt ich mich wieder in Richtung Süden.
Die ganze Zeit über fragte ich mich, warum ich die Bitte des Veteranen nicht einfach abgelehnt hatte. Es würde nichts als Ärger bedeuten, sich auf die Suche nach einem Mann zu machen, der mitten in einem Orangenhain niedergestochen worden war. Ein schwarzer Mann und eine weiße Frau, die vielleicht nur Wahnvorstellungen waren, was aber, bei meinem Glück in solchen Fällen, wahrscheinlich nicht zutraf.
Ich hätte ihn kurzerhand abgewiesen, wäre da nicht mein Verständnis des Amerikas gewesen, das ich zugleich liebte und verabscheute.
In Amerika geht es immer entweder um Rasse oder Geld oder eine Kombination von beidem. Wer du bist, was du hast, wie du aussiehst, woher deine Leute kommen und welcher Gott über ihre Brut wacht – das waren die wichtigsten Fragen. Dazu kommen dann noch die Rasse der Männer und die Rasse der Frauen. Die Reichen, Berühmten und Mächtigen glauben, sie hätten eine Rasse, und die Armen wissen ganz sicher, dass sie eine haben. Das Problem daran ist, dass die meisten Menschen mehr als eine Rasse haben. Weiße Leute haben Italiener, Deutsche, Iren, Polen, Engländer, Schotten, Portugiesen, Russen, Spanier aus der Alten Welt, Reiche aus der Neuen Welt und viele Kombinationen davon. Schwarze Leute haben ein Farbspektrum von hochgelb bis mondlose Nacht, von achtelschwarz bis tiefster Kongo. Und zu den Spaniern der Neuen Welt gehören alle Länder von Mexiko bis Puerto Rico, von Kolumbien bis Venezuela, von denen jedes eine eigene Rasse ist – ganz zu schweigen von den Imperien, angefangen bei den Azteken über die Maya bis zu den Olmeken.
Ich bin ein Schwarzer, der einer Mitternacht in Mississippi näher ist als dem dortigen gelben Mond. Außerdem bin ich ein Weststaatler, ein Kalifornier, der ursprünglich aus dem Süden stammt – Louisiana und Texas, um genau zu sein. Ich bin ein Vater, ein Leser, ein Privatdetektiv und ein Veteran.
Verdammt sicher bin ich ein Vet.
Von den mit Sand bedeckten Leichen des D-Day (an diesem Tag war meine Rasse für einen kurzen Augenblick durch und durch amerikanisch) über die Ardennenoffensive mit ihren hundertfünfzigtausend Toten bis hin zu den ausgemergelten Leichen, den lebenden und den toten, im Konzentrationslager Dachau. Die Explosionen in meinen Ohren, der Tod durch meine Hände und der Geruch von Schießpulver und Gemetzel machten mich zum Bruder eines jeden Mannes, einer jeden Frau oder eines jeden Kindes, die jemals Waffen erhoben haben oder gegen die Waffen erhoben wurden.
Wegen dieser blutigen Geschichte war Craig Kilian so sehr mein Blutsbruder wie jeder Schwarze in den Vereinigten Staaten. Ich musste ihm helfen, weil ich seinen Schmerz in meinem Spiegel sehen konnte.