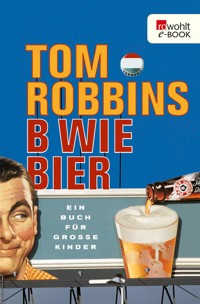9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: ROWOHLT E-Book
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Dieses Buch – der zweite Roman des amerikanischen Kultautors Tom Robbins – offenbart den Widerspruch zwischen sozialem Engagement und individueller Romantik, die Frage nach dem Zweck des Mondes, den Unterschied zwischen einem «Outlaw» und einem Allerweltsbanditen, kurz: das Problem der Liebe am Ende des 20. Jahrhunderts. Dass es bei all dem auch um das Problem der Rothaarigen geht, sollte hier nicht vorenthalten werden.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 372
Veröffentlichungsjahr: 2014
Ähnliche
Tom Robbins
Buntspecht
So was wie eine Liebesgeschichte
Über dieses Buch
Dieses Buch – der zweite Roman des amerikanischen Kultautors Tom Robbins – offenbart den Widerspruch zwischen sozialem Engagement und individueller Romantik, die Frage nach dem Zweck des Mondes, den Unterschied zwischen einem «Outlaw» und einem Allerweltsbanditen, kurz: das Problem der Liebe am Ende des 20. Jahrhunderts. Dass es bei all dem auch um das Problem der Rothaarigen geht, sollte hier nicht vorenthalten werden.
Vita
Tom Robbins, geboren 1932 in Blowing Rock, Virginia, wuchs im Süden der USA auf, lehrte während des Koreakrieges als Soldat der Air Force Meteorologie, studierte danach Kunst, Musik und Religion. Er arbeitete als Reporter bei verschiedenen Zeitungen und schrieb 1971 seinen ersten Roman «Ein Platz für Hot Dogs». Tom Robbins avancierte zum Kultautor. Es folgten weitere erfolgreiche Bücher wie «Buntspecht», «PanAroma» und «Sissy – Schicksalsjahre einer Tramperin». Die Fans lieben ihn für seinen klugen und warmherzigen Humor, seine verrückten Figuren und seine sprachlichen Purzelbäume. In «Tibetischer Pfirsichstrudel» erzählt er von seinem eigenen Leben – das genauso bunt, wild und voller skurriler Begegnungen ist wie seine Romane. Tom Robbins lebt als freier Schriftsteller in dem kleinen Fischerdorf La Conner bei Seattle.
Impressum
Die Originalausgabe erschien 1980 unter dem Titel «Still Life With Woodpecker» bei Bantam Books, Inc., New York.
Redaktion Eberhard Naumann
Veröffentlicht im Rowohlt Verlag, Reinbek bei Hamburg, August 2014
Copyright © 1983 by Rowohlt Taschenbuch Verlag GmbH, Reinbek bei Hamburg
«Still Life With Woodpecker» Copyright © 1980 by Tom Robbins
Published by arrangement with Bantam Books, an imprint of The Bantam Dell Publishing Group, a division of Random House, Inc.
Umschlagtypographie Dieter Wiesmüller
ISBN 978-3-644-52771-3
Schrift Droid Serif Copyright © 2007 by Google Corporation
Schrift Open Sans Copyright © by Steve Matteson, Ascender Corp
Dieses Werk ist urheberrechtlich geschützt, jede Verwertung bedarf der Genehmigung des Verlages.
Die Nutzung unserer Werke für Text- und Data-Mining im Sinne von § 44b UrhG behalten wir uns explizit vor.
Hinweise des Verlags
Abhängig vom eingesetzten Lesegerät kann es zu unterschiedlichen Darstellungen des vom Verlag freigegebenen Textes kommen.
Alle angegebenen Seitenzahlen beziehen sich auf die Printausgabe.
Im Text enthaltene externe Links begründen keine inhaltliche Verantwortung des Verlages, sondern sind allein von dem jeweiligen Dienstanbieter zu verantworten. Der Verlag hat die verlinkten externen Seiten zum Zeitpunkt der Buchveröffentlichung sorgfältig überprüft, mögliche Rechtsverstöße waren zum Zeitpunkt der Verlinkung nicht erkennbar. Auf spätere Veränderungen besteht keinerlei Einfluss. Eine Haftung des Verlags ist daher ausgeschlossen.
www.rowohlt.de
Inhaltsübersicht
Widmung
Mottos
Prolog
1. Phase
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Zwischenspiel
2. Phase
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
Zwischenspiel
3. Phase
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
Zwischenspiel
4. Phase
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
Epilog
Keith Wyman und Betty Bowen zum Gedenken: Wenn es einen Ort gibt, den die Menschen nach ihrem Tode bevölkern, so haben dessen Besitzer mit diesen beiden alle Hände voll zu tun.
All denen gewidmet, deren Briefe ich nie beantwortet habe.
Für G.R., Sonderzustellung.
Es ist nicht notwendig, dass du aus dem Hause gehst.
Bleib bei deinem Tisch und horche.
Horche nicht einmal, warte nur.
Warte nicht einmal, sei völlig still und allein.
Anbieten wird sich dir die Welt zur Entlarvung,
sie kann nicht anders,
verzückt wird sie sich vor dir winden.
Franz Kafka
Und hierhin müsste ein Bild meines Lieblingsapfels.
Akt & Flasche sind darin verborgen.
Eine ganze Landschaft ist darin verborgen.
Es geht nichts über Stillleben.
Erica Jong
Falls diese Schreibmaschine es nicht schafft, nun, zum Teufel, dann ist es nicht zu schaffen.
Dies ist eine brandneue Remington SL3, die Maschine, die die Frage beantwortet: «Was ist schwerer, die Brüder Karamasov lesen zu wollen, während man Stevie-Wonder-Platten anhört, oder auf den Tasten einer Schreibmaschine nach Ostereiern zu suchen?» Diese Maschine ist die Kirsche auf dem Cowgirl. Die Frikadelle, die dir von der Genie-Kellnerin serviert wird. Die Kaiserin-Karte.
Ich spüre, dass der Roman meiner Träume in dieser Remington SL3 steckt – auch wenn sie viel schneller schreibt, als ich buchstabieren kann. Und ungeachtet der Tatsache, dass mein Tippfinger vorige Woche von einer riesigen Landkrabbe gezwickt wurde. Die Kleine spricht beim leisesten Anstoß elektrischen Shakespeare und rattert eine Seite runter, wenn man sie nur mal scharf ansieht.
«Was erwarten Sie denn von einer Schreibmaschine?», fragte der Verkäufer.
«Etwas mehr als Wörter», antwortete ich. «Kristalle. Ich möchte meinen Lesern Armladungen von Kristallen schicken, manche davon in den Farben von Orchideen und Päonien, andere mit der Gabe, Funksignale aus einer verborgenen Stadt zu empfangen, die halb Paris, halb Coney Island ist.»
Er empfahl die Remington SL3.
Meine alte Schreibmaschine hieß Olivetti. Ich kenne einen außergewöhnlichen Jongleur namens Olivetti. Weder verwandt noch verschwägert. Und doch gibt es eine Ähnlichkeit zwischen dem Jonglieren und dem Dichten auf einer Schreibmaschine. Wenn man einen Schnitzer macht, tut man so, als gehöre er zum Kunststück, das ist der Trick.
In meinem Schrank, fest hinter Schloss und Riegel, habe ich die letzte Flasche Anaïs Nin (Green Label), die vor der Revolution aus Punta del Visionario herausgeschmuggelt wurde. Heut Abend werde ich ihr den Korken ziehen. Ich werde zehn Zenti davon in eine reife Limone spritzen, wie es die Eingebornen tun. Ich werde saugen. Und anfangen …
Wenn diese Schreibmaschine es nicht schafft, ich schwör’s, dann ist es nicht zu schaffen.
1. Phase
1
Im letzten Viertel des zwanzigsten Jahrhunderts, einer Zeit, in der die westliche Zivilisation zu rasch zur Neige ging, um es sich wohl sein zu lassen, und doch wieder zu langsam, um richtig aufregend zu sein, hockte fast alle Welt auf der Kante eines immer teurer werdenden Theatersessels und wartete – je nach persönlicher Neigung – in Furcht, Hoffnung oder Langeweile darauf, dass etwas Bedeutsames passierte.
Dass etwas Bedeutsames passieren musste, war klar. Schließlich konnte sich nicht das gesamte kollektive Unbewusste darin irren. Aber was würde es sein? Und: Würde es Apokalypse oder Erneuerung bedeuten? Die Kur gegen Krebs oder den nuklearen Knall? Eine Veränderung des Wetters oder eine Veränderung im Meer? Erdbeben in Kalifornien, Killerbienen in London, Araber an der Effektenbörse, Leben aus dem Reagenzglas oder ein UFO auf dem Rasen des Weißen Hauses? Würde der Mona Lisa ein Schnurrbart sprießen? Würde der Dollar Pleite machen?
Christliche Enthusiasten des Szenariums von der Wiederkehr des Herrn waren überzeugt, dass nach einem bangen Intervall von zweitausend Jahren bald auch der andere Schuh fallen würde.
Und fünf der bekanntesten Spiritisten jener Zeit, die sich im Chelsea Hotel versammelt hatten, sagten voraus, dass Atlantis bald wieder aus den Fluten auftauchen würde.
Hierzu meinte Prinzessin Leigh-Cheri: «Es gibt zwei verlorene Kontinente … einer von ihnen war Hawaii, genannt Mu, die Mutter; seine Gipfel ragen noch immer in unsere Sinne: Es ist das Land von Slap Dance, Fischermusik, Blumen und Glück. Es gibt drei verlorene Kontinente … Einer von ihnen sind wir: die Liebenden.»
Was immer man von Prinzessin Leigh-Cheris Gedanken über die Geographie halten mochte, man musste ihr zustimmen, dass das letzte Viertel des zwanzigsten Jahrhunderts eine raue Zeit für Liebende war. Es war eine Zeit, da Frauen sich offen gegen die Männer empörten, eine Zeit, da Männer sich von einer Frau verraten fühlten, eine Zeit, da es den romantischen Beziehungen so erging wie dem Eis im Frühling und viele Kindlein auf zerklüfteten und ungastlichen Schollen strandeten.
Niemand wusste mehr etwas mit dem Mond anzufangen.
2
Lassen Sie uns eine gewisse Nacht im August betrachten. Prinzessin Leigh-Cheri starrte aus ihrem Dachbodenfenster. Der Mond war voll. Der Mond war so aufgeschwemmt, dass er jeden Moment umzukippen drohte. Stellen Sie sich vor, Sie wachen auf und finden den Mond bäuchlings auf dem Boden Ihres Badezimmers liegen, wie Elvis Presley selig, vergiftet durch Banana Splits. Es war ein Mond, der eine Muh-Kuh zu wilder Leidenschaft aufwühlen konnte. Ein Mond, der den Teufel in einem Hoppelhäschen erwecken konnte. Ein Mond, der lug nuts in Mondsteine, Rotkäppchen in den großen bösen Wolf verwandeln konnte. Mehr als eine Stunde lang starrte Leigh-Cheri in das Himmelsmandala. «Hat der Mond einen Zweck?», erkundigte sie sich dann bei Prince Charming.
Prince Charming tat so, als habe sie eine törichte Frage gestellt. Vielleicht hatte sie das. Die gleiche Frage an die Adresse der Remington SL3 gerichtet, entlockte dieser die folgende Antwort: «Albert Camus hat geschrieben, die einzig ernste Frage sei, ob man sich umbringen soll oder nicht.»
Tom Robbins hat geschrieben, die einzig ernste Frage sei, ob die Zeit Anfang und Ende hat.
Camus ist eindeutig mit dem falschen Fuß aus dem Bett gestiegen, und Robbins muss vergessen haben, den Wecker zu stellen.
Es gibt nur eine ernste Frage. Und die lautet:
Wer kann die Liebe bleiben machen?
Beantworten Sie mir dies, und ich will Ihnen sagen, ob Sie sich umbringen sollen oder nicht.
Beantworten Sie mir dies, und ich will Sie über Anfang und Ende der Zeit beruhigen.
Beantworten Sie mir dies, und ich will Ihnen verraten, welchen Zweck der Mond hat.
3
Historisch gesehen, haben sich die Angehörigen von Leigh-Cheris Klasse nicht gerade oft verliebt. Sie verbanden sich für Macht und Reichtum, für Tradition und Erben und überließen die «wahre Liebe» den Massen. Die Massen hatten eh nichts zu verlieren. Jetzt aber schrieb man das letzte Viertel des zwanzigsten Jahrhunderts, und mit Ausnahme einiger wilder Hanswurste in Afrika hatte sich der Hochadel dieser Welt seit langem mit der Tatsache seiner sterblichen, wenn auch nicht gänzlich demokratischen Dimensionen abgefunden. Leigh-Cheris Familie war dafür ein treffendes Beispiel.
Der König hatte, seit er vor mehr als dreißig Jahren ins Exil ging, das Glücksspiel zu seinem Beruf gemacht. Poker war seitdem sein Tagewerk. Unlängst jedoch hatte er Bekanntschaft mit der Chirurgie am offenen Herzen gemacht. Eine der großen Herzklappen war entfernt und gegen ein Teflon-Ersatzteil ausgewechselt worden. Die künstliche Klappe funktionierte ganz ordentlich, machte aber beim Öffnen und Schließen ein metallisches Geklapper. Wenn der König in Erregung geriet, kriegte das jeder im Raum sofort mit. Bedingt durch das Geräusch seines Herzens, war es ihm nicht mehr möglich, das Pokern auszuüben, ein Spiel, bei dem es nicht ohne Bluff und Verstellung abgeht. «Jesus», sagte er. «Wenn ich ein gutes Blatt in die Hand bekomme, hört sich das an wie eine Tupperware-Party.» Er verbrachte seine Stunden damit, das Sportgeschehen im Fernsehen zu verfolgen, und klammerte sich an die guten alten Tage, als er einen Footballstar wie Howard Cosell an die Garotte hätte befehlen können.
Seine Frau, die Königin, einst Schönste von sieben Metropolen, litt an Reizmangel und Übergewicht. In Amerika hatte sie an so vielen zweitklassigen Tee-Partys, Wohltätigkeitsmodeschauen, an Dies-Galas und Das-Galas teilgenommen, dass sie angefangen hatte, eine Art Pâte de foie gras-Gas abzusondern, und der Rückstoß dieser Ausdünstung trieb sie von Party zu Ball weiter, als wäre sie eine von Wagner aufgeblasene Wurstpelle. Ohne eine Hofdame, ihr beizustehen, benötigte sie zwei Stunden, um sich anzukleiden, und da sie dreimal täglich die Garderobe wechselte, lief das Drapieren, Schmücken und Bemalen ihrer Körpermasse auf einen Fulltime-Job hinaus. Seit langem hatte die Königin ihren Mann an die Röhre und ihre Tochter an den Dachboden verloren. Ihre Söhne (sie wusste kaum noch, wie viele es eigentlich waren) lebten über ganz Europa verstreut und waren – in endlose finanzielle Abenteuer vorwiegend finsterer Natur verwickelt – für sie längst verloren. So blieb ihr nur ein Vertrauter: ein Chihuahua, den sie an ihren Busen drückte. Auf die Frage, was er vom letzten Viertel des zwanzigsten Jahrhunderts erwarte, hätte der König wahrscheinlich erwidert: «Heute, da es nicht mehr vernünftig ist, auf die Wiederherstellung der Monarchie zu hoffen, habe ich nur noch den sehnlichen Wunsch, dass die Seattle Mariners den Wimpel holen, die Seattle Sonics die Endrunde der NBA erreichen, die Seattle Seahawks zum Super Bowl einziehen und dass die Stadionreporter durch Sir Kenneth Clark ersetzt werden.»
Die gleiche Frage, an die Königin gerichtet, hätte folgende Reaktion hervorgerufen: «Oh-oh, Spaghetti-O.» (Das war ihr Lieblings-Amerikanismus.) «Wass kaan man errwarten von verrickte Leute? Ich bin nur glicklich, dass mein Vadder und Mamma in därr Himmel sind und nicht mießen leiden an keine stinken moderne Zeiten. Sacre bleu! Ich tu meiner Pflicht für derr Krone und dass ist dat.» Die Königin hatte ihr Englisch in sieben Metropolen gelernt.
Auf einem zerschlissenen, aber üppigen Kasanteppich neben einer baldachinbespannten Barke von einem Bett beugte die Königin allabendlich ihre Knie, die großen Kaugummiklumpen glichen, und betete für die Errettung der Krone, die Gesundheit ihres Chihuahua, das Wohl der Grand Opera und nicht viel mehr. König Max stahl sich allabendlich in die Küche und aß dort löffelweise Salz und Zucker, beides Dinge, die die Ärzte aus seiner Diät verbannt hatten.
«Was diese königliche Familie so verkorkst hat, ist mehr als fünf Jahrhunderte der Inzucht», dachte Prinzessin Leigh-Cheri, die von Klatschkolumnisten kürzlich als «abgedankte Cheerleaderin», als «mondsüchtige Sozialaktivistin» charakterisiert worden war, als «tragische Schönheit, die auf einem Dachboden die Einsamkeit sucht».
«Diese Familie hat den Letztes-Viertel-des-zwanzigsten-Jahrhunderts-Blues.»
4
Als Exilpalast diente den Furstenberg-Barcalonas, so hießen sie tatsächlich, ein geräumiges, dreigeschossiges gelbes Fachwerkhaus am Ufer des Puget Sound. Das Haus war 1911 für einen Holzbaron aus Seattle erbaut worden, der aus lauter Abscheu vor den Türmchen, Kuppeln und Mansardengiebeln, wie sie die Neue-Welt-Gotik der Ritterschlösser seiner Standesgenossen zierten, «ein amerikanisches Haus, ein Haus ohne Kinkerlitzchen» in Auftrag gegeben und genau das bekommen hatte: eine Scheune, ein Kasten mit einem spitzen Dach. Inmitten vier Hektar Brombeersträuchern stand es da wie eine verlassene Funkstation und morste sein Knarzen und Seufzen in den Regen. Dieses Haus also war Max und Tilli von der CIA geschenkt worden.
Die Heimat der Furstenberg-Barcalonas wurde mittlerweile von einer rechtslastigen Junta beherrscht, mit Unterstützung der Regierung der Vereinigten Staaten und natürlich der römisch-katholischen Kirche. Die US-Öffentlichkeit bedauerte zwar, dass die Junta so wenig bürgerliche Freiheiten zuließ, war jedoch abgeneigt, sich in die inneren Angelegenheiten eines souveränen Landes einzumischen, eines Landes vor allem, auf das man als Bündnispartner gegen jene linkslastigen Länder rechnen konnte, in deren innere Angelegenheiten die USA sich regelmäßig einmischten. Die USA zeigten sich beunruhigt, dass Max und Tilli, nach wie vor treu ergebene Royalisten, die politische Stabilität in diesem Teil der Welt ins Wanken bringen könnten. Um die Form zu wahren und keine Flammen zu schüren, zahlten die USA König Max eine bescheidene Pension. Zu Weihnachten sandte der Papst Königin Tilli Jahr für Jahr ein Kruzifix, eine Kerze oder sonst welchen, von ihm persönlich geweihten Schnickschnack.
Einmal benutzte Prinzessin Leigh-Cheri eine päpstliche Kerze zum Zwecke der Selbstbefriedigung. Sie hatte gehofft, im entscheidenden Augenblick vom Lamm oder dem Tier heimgesucht zu werden, aber wie üblich erschien ihr nur Ralph Nader.
5
Falls die CIA sich eingebildet haben sollte, Max und Tilli Furstenberg-Barcalona würden vor lauter Begeisterung über so viel Gastfreundschaft aus ihren monogrammbestickten Socken kippen, so war das eine Fehlanzeige mehr. Zwar hatte sich das Königspaar in den ersten zehn Jahren seines Aufenthaltes nie über das schäbige alte Herrenhaus beklagt, aus Furcht, die Bude sei verwanzt; in späteren Jahren jedoch – mit fortschreitendem Alter schamlos geworden (wie der Lachs scheint auch die Keckheit der Kindheit zu ihrem Ursprung zurückzukehren) – meckerten sie nach Herzenslust.
Der König stand gemeinhin (während der Halbzeit oder der seventh-inning stretch) am Fenster und starrte besorgt auf die kriechende Brombeerflut. «Ich bin vielleicht der erste Monarch in der Geschichte, der von Brombeeren ermordet wird», murrte er dann. Seine Teflonklappe fiel in sein Murren ein.
Die Königin liebkoste ihren Chihuahua. «Weißt du, wer hier lebte vor untz? Smokey derr Bär.»
Jeder Versuch Leigh-Cheris, ihre Eltern zum Umziehen zu ermutigen, blieb vergeblich.
Max, ein großer, pferdegesichtiger Mann mit einem Hitlerbärtchen, schüttelte seinen Kopf so heftig und so lange, dass, hätte er seine Krone getragen, diese heruntergepurzelt und in die Beerenranken gekollert wäre. «Am Tisch die Plätze zu vertauschen, betrügt die Karten nicht», sagte er.
«Umziehän? Ich hab drei Tees diese Wochä», sagte Königin Tilli. «Nein! Ich vergessen. Ich hab vier Tees. Oh-oh, Spaghetti-O.»
Wie ein in einem spanischen Songbuch gefangenes Pärchen von ‹r›s lungerten Tilli und Max in ihrem Schuhschachtelschloss und warteten darauf, gerollt zu werden.
6
Die Prinzessin wohnte auf dem Dachboden.
Schon als Kind war das ihr Lieblingsspielplatz gewesen. Es war heimelig und gemütlich dort oben. Besonders die niedrige schräge Decke hatte es ihr angetan und das völlige Fehlen von wappenverzierten Tapeten. Sie liebte den Blick aus den beiden Dachbodenfenstern: Nach Westen hin sah man den Puget Sound, im Osten lagen die Cascade Mountains. Ein Berg hatte es ihr ganz besonders angetan, ein weißer Sporn, breit und wolkenrammend, der beinah das ganze Ostfenster ausfüllte, es sei denn, der Ausblick wurde von Nebel oder Regen verdüstert. Der Berg hatte einen Namen, aber Leigh-Cheri konnte sich nie daran erinnern. «Es ist ein indianischer Name, glaube ich.»
«Tonto?», fragte die Königin.
Mittlerweile waren die Fenster schwarz bemalt – bis auf eine einzige kleine Scheibe, durch die die Prinzessin gelegentlich ein Eckchen vom Mond empfangen konnte.
Die Prinzessin wohnte auf dem Dachboden, ohne ihn jemals zu verlassen. Sie hätte ihn verlassen können, aber sie zog vor, es nicht zu tun. Sie hätte die Fenster hochschieben oder die Farbe abkratzen können, aber sie zog vor, auch das nicht zu tun. Die Fenster vernageln und schwarz anmalen zu lassen, war ihre Idee gewesen. Der Dachboden wurde von einer Vierzig-Watt-Birne beleuchtet. Auch das war ihre Idee gewesen. Darüber hinaus hatte die Prinzessin den Dachboden selbst möbliert.
Die Dachbodenmöblierung bestand aus einem Feldbett, einem Nachttopf und einer Packung Camel-Zigaretten.
7
Einst hatte Leigh-Cheri, wie so manch andere junge Frau auch, im Haushalt ihrer Eltern gelebt. Sie hatte ein Zimmer an der Nordseite der zweiten Etage, ein Zimmer mit einem breiten Bett und einem bequemen Sessel, einem Schreibtisch, an dem sie ihre Schularbeiten machen konnte, und einer Kommode voller Kosmetika und Unterwäsche. Es gab einen Plattenspieler, der getreulichen Wiedergabe von Rock ’n’ Roll gewidmet, und einen Spiegel, der schmeichelhaften Wiedergabe ihres eigenen Bildes gewidmet. Es gab Gardinen an den Fenstern und alt-ererbte Teppiche auf dem Boden, und an den Wänden rieben Poster von den hawaiischen Inseln ihre Kanten an Fotografien von Ralph Nader.
Verglichen mit jener «großen weiten Welt da draußen», nach der sie sich sehnte, erschien ihr das Zimmer manchmal beklemmend und stickig, aber sie mochte ihr Zuhause ganz gern und hatte ganz und gar nichts dagegen, jeden Abend, wenn die Kurse vorbei waren oder wenn dies oder jenes Komitee für diese oder jene gute ökologische Sache wieder mal vertagt worden war, dorthin zurückzukehren.
Selbst nachdem sie aus der Cheerleadertruppe der University of Washington vertrieben worden war – eine demütigende Erfahrung, die sie dazu bewegte, sich vom College zurückzuziehen –, bewohnte sie ihr Zimmer so selbstverständlich wie ein Zephalopode seine Muschel. Das war zu jener Zeit, als sie das Zimmer mit Prince Charming teilte.
Prince Charming war eine Kröte. Er wohnte in einem Terrarium am Fußende von Leigh-Cheris Bett. Und, ja – ihr Neugierigen –, sie hatte die Kröte geküsst. Einmal. Leicht. Und, ja, sie war sich beschissen albern dabei vorgekommen. Allerdings wird man als Prinzessin von Dingen versucht, die wir gewöhnlichen Menschen kaum begreifen, und außerdem waren die Umstände, unter denen sie in den Besitz der Kröte gelangt war, dem Aberglauben förderlich; und mal ehrlich: War denn ein kleines rasches Teenieküsschen auf einen Froschkopf so viel alberner, als das Bild eines Ersehnten zu küssen – und wer von uns hat nicht schon mal eine Fotografie geküsst? Leigh-Cheri küsste ziemlich häufig ein Foto von Ralph Nader. An dieser Stelle könnte angemerkt werden, dass freudianische Märchenanalytiker vermuten, das Küssen von Kröten und Fröschen symbolisiere Fellatio. In dieser Hinsicht war Prinzessin Leigh-Cheri auf bewusster Ebene unschuldig, wenngleich nicht so naiv wie Königin Tilli, die dachte, Fellatio sei eine verschollene italienische Oper, und sich darüber ärgerte, dass sie die Partitur nicht finden konnte.
8
Prince Charming war Leigh-Cheri von der alten Gulietta geschenkt worden, der einzigen Überlebenden aus der kleinen Dienerschar, die Max und Tilli ins Exil begleitet hatte. Bei Leigh-Cheris Geburt, in Paris, standen noch vier dieser Königstreuen in Diensten, aber alle bis auf Gulietta starben, bald nachdem die Familie im Puget-Sound-Palast die Zelte aufgeschlagen hatte. Vielleicht lag es an der Feuchtigkeit.
Die US-Regierung hatte ebenfalls einen Diener beigesteuert, einen Mann namens Chuck, der als Gärtner, Chauffeur und allgemeines Faktotum fungieren sollte. Er war natürlich CIA-Spitzel. Als das Alter ihm zu seiner angeborenen Trägheit noch Gebrechlichkeit bescherte, war Chuck den Brombeeren des Great Northwest nicht mehr gewachsen, und sie drängten immer näher an die Mauern des Hauses heran. Am Steuer war er fürchterlich. König Max und die Prinzessin hatten es bereits vor einigen Jahren abgelehnt, sich von ihm fahren zu lassen. Die Königin fuhr er jedoch nach wie vor zu ihren Galas und Tees, anscheinend taub für die Gegrüßet-seist-du-Marias und Oh-oh, Spaghetti-Os, die in schierem Entsetzen aus dem Fond blubberten.
Regelmäßig, alle vierzehn Tage, setzte Chuck sich hin, um mit dem König zu pokern. Selbst mit seinem verräterischen Geticker zog der König Chuck alle vierzehn Tage bis auf die Unterhosen aus. Auf diese Weise fügte Max Chucks Gehalt seinem eigenen hinzu. «Das ist alles, wozu er taugt», sagte Max, und sein großes Maultiergesicht lächelte matt über den, wie ihm scheinen mochte, kleinen Streich gegen die CIA.
Gulietta hingegen war über achtzig, tüchtig und energisch. Wie durch ein Wunder hatte sie das riesige Haus von Spinnweben und Schimmelpilz freigehalten, während sie gleichzeitig die königliche Wäsche besorgte und sechs Mahlzeiten pro Tag zubereitete: Da Max und Tilli Fleischfresser waren und Leigh-Cheri Vegetarierin, bestand jede Mahlzeit eigentlich aus zweien.
Die alte Gulietta sprach kein Englisch, und Leigh-Cheri, die nach Amerika gebracht worden war, als sie noch nicht viel größer als ein Weinkrug war, sprach nichts anderes. Und doch war es Gulietta, die Leigh-Cheri jeden Abend, bis sie fünfzehn war, ihre Gutenachtgeschichte erzählte, immer die gleiche Geschichte, in solch hartnäckiger Wiederholung, dass das Mädchen schließlich nicht nur ihre allgemeine Bedeutung, sondern wirklich jedes einzelne Wort verstand, trotz der ihr unbekannten Sprache. Und es war Gulietta, die das wahre Ausmaß von Leigh-Cheris Depression empfand, als diese während eines Heimspiels der University of Washington eine Fehlgeburt erlitt. (Sie war – ganz Sprung – mitten in der Luft, als das Blut hervorbrach und Bächlein wie zum hämophilen touchdown unter ihrem winzigen Cheerleader-Röckchen hervorstürzten.) Gulietta war es, die spürte, dass ihre junge Herrin an diesem Herbstnachmittag mehr als ein Baby verloren hatte, dass sie in Wirklichkeit sogar mehr verloren hatte als den Vater des Babys (den second string quarterback, einen Jurastudenten, der die Campusgruppe des Sierra Club leitete und beabsichtigte, eines Tages für Ralph Nader zu arbeiten), obwohl die Erinnerung an ihn, wie er auf der Bank hockte und so tat, als bemerke er nicht, dass sie in Verlegenheit und Furcht auf schnellstem Weg aus dem Husky-Stadion geschleppt wurde, ihren Sinn und ihr Herz verfolgte wie ein Gespenst in schmutzigen Schuhen.
Gulietta war es, die nach jenem unglücklichen Nachspiel zu ihr gekommen war, die Hexenhände um eine Kröte gewölbt. Die Prinzessin war nicht sofort außer sich vor Freude. Aber sie hatte in Sagen von Totemtieren der Alten Welt gehört, und falls Krötenzauber helfen konnte, wollte sie’s damit versuchen – mochten die Warzen fallen, wie sie wollten.
Aber ach, Gulietta, dies war ein amerikanischer Frosch aus dem letzten Viertel des zwanzigsten Jahrhunderts, einer Zeit, als das Wünschen offensichtlich zu nichts mehr führte, und so taufte Leigh-Cheri ihn schließlich Prince Charming, nach «diesem Hurensohn, der doch niemals durchkommt».
9
Sandwiches sind vom Earl of Sandwich erfunden worden, Popcorn vom Earl of Popcorn und die Salattunke vom Oil of Vinegar. Der Mond hat den natürlichen Rhythmus erfunden. Die Zivilisation hat ihn wegerfunden. Prinzessin Leigh-Cheri hätte ihn gerne wiedererfunden, aber zu diesem Zeitpunkt hatte sie noch keinen Schimmer.
Sie hatte jenes Gummiplätzchen, genannt Diaphragma, in die Röhre geschoben und war schwanger geworden. Wie so viele Frauen. Sie hatte auch jenen schnörkeligen metallischen Hausfreund beherbergt, der sich Spirale nennt, und an Krämpfen und Infektionen gelitten. Wie so viele Frauen. Sie hatte, aus Verzweiflung und gegen ihre elementaren Instinkte, die Pille eingeworfen. Sie wurde krank, physisch emotional. Wie so viele Frauen. Sie hatte mit all den Mixturen und Marmeladen, Salben und Säuren, Sprays und Suppositorien, Schäumen und Schmieralien, Duschen und Desinfektionen herumexperimentiert und kam dabei nur ihrer romantischen Natur auf die Schliche – sie war mit europäischen Volksmärchen (mit einem Märchen zumindest) aufgewachsen und verabscheute technologische Texturen, industrielle Odeurs und den Duft von Napalm. Wie so viele romantische Naturen.
Dieses dauernde Gefecht mit ihrem Reproduktionsprozess, ein Krieg, bei dem ihr einzig und allein pharmazeutische Roboter zur Seite standen, fremde Agenten, deren künstliche Unterstützung ihr eher verräterisch als vertrauenswürdig erschien, nagte mit Plastikzähnen an ihren innigsten Vorstellungen von Liebe. War es gänzlich paranoid, zu argwöhnen, dass all diese zur Empfängnisverhütung ersonnenen Stopper, Dingsdas und Substanzen nicht so sehr beabsichtigten, die Frauen von den – ihren natürlichen Leidenschaften auferlegten – biologischen und sozialen Strafen zu befreien, als vielmehr, nach den heimtückischen Plänen kapitalistischer Puritaner, den Sex technisieren, seine dunklen Säfte verwässern, seine wilden Feuer eindämmen, seine süße Schmutzigkeit zensieren, ihn sauber schrubben sollten (sauber wie einen Laborsterilisator, sauber wie ein Krankenhausbett), um ihn einheitlich ordnen, ihn sicher machen zu können; um das Risiko unkontrollierter Gefühle, unlogischer Bindungen und tiefer Verstrickungen zu eliminieren (und durch um so viel weniger geheimnisvolle Risiken, zahmere Risiken wie Infektion, Blutungen, Krebs und hormonelle Entgleisung zu ersetzen); ja, die sexuelle Liebe so sicher und sachlich und sanitär zu machen, so glatt und vergnüglich, so zwanglos, dass sie kein Manifest der Liebe mehr wäre, sondern ein fast anonymes, fast autonom hedonistisches Kratzen an einer Stelle, wo’s juckt, so bar jeden Zusammenhangs mit den fiebernden Rätseln von Leben und Tod, ein so gut programmiertes Kratzen, dass es unmöglich mehr den eigentlichen Zweck der Menschen in einer kapitalistischen, puritanischen Gesellschaft stören kann, nämlich Waren zu produzieren und zu konsumieren?
Da sie diese Frage unmöglich beantworten konnte – sie konnte sie nicht einmal stellen, ohne außer Atem zu kommen – und da die Mittagspausen-Parkplatz-Rendezvous im Kombicamper ihres Boyfriends ehrlich gesagt gewisser romantischer Details ermangelten, die sie immer mit Sex assoziiert hatte, beschloss die Prinzessin, in ein zweites Exil zu gehen: ins Zölibat. Bevor sie sich aber mit der nötigen Vorsicht über die Grenze schleichen konnte, holte die biologische Zollfahndung sie ein und forderte unerbittlich ihren Tribut.
10
Als ihr Geliebter, der Quarterback, sie anflehte, wegen ihrer Schwangerschaft «etwas tun» zu lassen, stützte Prinzessin Leigh-Cheri ihre Stirn gegen die Fensterscheibe des vegetarischen Restaurants, in dem sie aßen, und weinte. «Nein», sagte sie. «Nein, nein-nein.»
Sie hatte bereits mit neunzehn eine Abtreibung durchgemacht. Eine zweite würde sie nicht ertragen. «Nein», sagte sie. Aus jedem ihrer blauen Augen hing eine Träne, wie zwei aus Mietskasernenfenstern gebeugte dicke Frauen. Sie ruckten, balancierten, ruckten wieder, als fürchteten sie die ungewisse Reise die Wangen hinunter. Derart unschlüssig, spiegelten ihre Tränen für einen Moment den Schimmer des Sojabohnenquarks auf ihrem Teller wider. «Keine Staubsauger mehr und keinen Stahl. Sie können mein Herz auskratzen, sie können mein Hirn auskratzen, bevor sie noch einmal meinen Uterus auskratzen werden. Seit meiner letzten Abtreibung ist schon mehr als ein Jahr vergangen, und ich fühle mich immer noch wund da drinnen. Es fühlt sich bitter an, wo es sich süß anfühlen sollte, es fühlt sich schartig an, wo es sich glatt anfühlen sollte. Der Tod hat eine Herrenpartie im heiligsten Zimmer meines Körpers gefeiert. Von jetzt an gehört dieser Raum dem Leben.»
Jedes Mal, wenn die Technologie einen gutartigen Naturvorgang umstürzt, riechen die Sensiblen Schwefel. Für Prinzessin Leigh-Cheri hatten Abtreibungen nicht nur den Ruch von Totalitarismus an sich, sondern auch den Aufschrei missbrauchten Fleisches. Wenn aber eine weitere Abtreibung ein unerträglicher Gedanke war, so war die Aussicht auf ungelegene Mutterschaft ebenso peinlich – und das nicht nur aus den üblichen Gründen. Die Furstenberg-Barcalonas waren ein altes Geschlecht, bei dem sich ein strenger Kodex entwickelt hatte. Wenn ein weibliches Mitglied der Familie ihr volles Privileg zu wahren wünschte, wenn sie eines Tages Königin sein wollte, durfte sie vor dem einundzwanzigsten Lebensjahr weder heiraten noch Mutter werden; auch konnte sie nicht vor diesem Alter ihr Elternhaus verlassen. Und obwohl sie sich für einen Menschen wie du und ich hielt, begehrte Leigh-Cheri das volle königliche Privileg ganz außerordentlich. Leigh-Cheri glaubte nämlich, sie könne dieses Privileg benutzen, um der Welt zu helfen.
«Märchen und Mythen sind voll von Berichten über errettete Prinzessinnen», räsonierte sie. «Ist es nicht an der Zeit, dass eine Prinzessin den Gefallen mal erwidert?» Leigh-Cheri hatte eine Vision von der Prinzessin als Held.
Oder, wie Königin Tilli sich ausdrückte, als Max sie fragte, was ihre einzige Tochter ihrer Meinung nach vom Leben begehre: «Sie will derr Wält eine Coke spendieren.»
«Was?»
«Sie will derr Wält eine Coke spendieren.»
«Na», sagte Max, «das kann sie sich nicht leisten. Außerdem würde die Welt sowieso eine Diät-Pepsi haben wollen. Warum spendiert sie mir nicht stattdessen einen Martini?»
11
Es war Herbst, Frühling des Todes. Regen prasselte auf faulendes Laub, und ein wilder Wind heulte. Der Tod sang unter der Dusche. Der Tod freute sich seines Lebens. Der Fötus sprang ins Leere – ohne Fallschirm. Er landete im Abseits des Astroturfs und brachte die Cheerleaderinnen so aus der Fassung, dass ihre «Hurras» für den Rest des Nachmittags kaum mehr als Piepser waren. Die Huskies gewannen auch so und servierten die favorisierte UCLA mit 28:21 ab. Im nahen Universitätskrankenhaus, wo Leigh-Cheri sich einen halben Liter gemeinen Blutes in ihren königlichen Kreislauf pumpen lassen musste, befanden sich die jungen Ärzte in Hochstimmung.
Für den Augenblick war Leigh-Cheris Problem gelöst, aber sie fühlte sich wie eine schwarze Kerze bei der Totenwacht für eine Schlange. Als ein Arzt «Proud Mary» pfiff, verspürte sie keinerlei Neigung mitzusingen.
Gegen acht Uhr desselben Abends rief ihr Boyfriend an. Er war in seinem Verbindungshaus. Sie feierten die Siegesparty. Er sagte, er würde am nächsten Tag im Hospital vorbeischauen, aber er muss wohl die Adresse verloren haben.
Als man spitzkriegte, wer sie war, wurde die Prinzessin in ein Privatzimmer verlegt. Sie bekam das beste Sedativ im Hause. Château du Phenobarbital 1979. Endlich eingeschlafen, träumte sie von dem Fetus. In ihrem Traum watschelte er eine holprige Sandstraße hinunter, wie Charlie Chaplin am Schluss eines Stummfilms.
Am Dienstag war sie physisch so weit genesen, dass sie auf den Campus zurückkehren konnte, wo sie erfahren sollte, dass ihr Status als einzige echte Prinzessin von New York nicht genügte, um die moralische Empörung des Cheerleaderkomitees zu entschärfen. Aufgefordert, aus der Kreischtruppe auszutreten, blieb sie auch den Kursen fern. Sie zog sich auch von den Männern zurück – reichlich spät, um König und Königin noch zu beschwichtigen.
Max’ Herz ratterte wie ein Tablett voller Teller, als er Leigh-Cheri sagte, sie müsse sich zusammenreißen oder ausziehen. «Wir waren immer tolerant mit dir», sagte Max, «weil, nun ja, immerhin, dies ist Amerika …» Max versäumte darauf hinzuweisen, dass man sich außerdem im letzten Viertel des zwanzigsten Jahrhunderts befand, aber das verstand sich zweifellos von selbst.
«Adolphe Itlär war Wegetarier», ermahnte Königin Tilli Leigh-Cheri zum dreihundertsten Mal. Tilli versuchte ihre Tochter davon abzuhalten, sich einer Naturkostkommune in Hawaii anzuschließen, eine Möglichkeit, die ihr offenzustehen schien, falls sie es vorzog, auf königliche Privilegien zu verzichten. Leigh-Cheri wiederum hätte die Königin daran erinnern können, dass Hitler zwei Pfund Schokolade pro Tag gegessen hatte, aber sie war dieser Diätdebatte überdrüssig geworden. Außerdem hatte sie beschlossen, ihren Anspruch auf königliche Privilegien zu wahren, auch wenn das bedeutete, sich engeren sozialen Beschränkungen zu unterwerfen.
«Du wirst also ein gutt Girl sein?»
«Ja, Mutter.»
«Wenn wir dir neue Karten austeilen, wirst du nach den Regeln spielen?»
«Ja, Vater.»
Die beiden sahen ihr hinterher, als sie sich umdrehte und die Treppe hinaufging. Sie sahen ihr hinterher, als wär’s das erste Mal seit Jahren, dass sie sie wirklich anschauten. Trotz ihrer bleichen Farbe und dem Unglück, das an ihr hing, wie ein böser Traum an einem zerknautschten Kopfkissen hängt, war sie reizvoll. Ihr Haar, glatt und rot wie geplätteter Ketchup, fuhr mit dem One-Way-Ticket der Schwerkraft bis zu ihrer Taille hinab; ihre blauen Augen waren sanft und feucht wie huevos rancheros, und die langen Ringel ihrer Wimpern ließen filigranhafte Schatten auf die Rundung ihrer Wangen fallen. Sie war nicht groß, aber die Beine, die unter ihrem Rock baumelten, schienen die Beine einer hochgewachsenen Frau zu sein, und unter ihrem Atomkraft-Nein-Danke-T-Shirt zitterten ganz leise ihre erstaunlich runden Brüste, wie auf den Nasen valiumfressender Seehunde balancierte Bälle.
Tilli streichelte ihren Chihuahua. Max’ Herz machte ein Geräusch wie die Schlittenglocken an Frau Weihnachtsmanns Dildo.
12
Neotenie. Neotenie. Neot – Oh, wie die Remington SL3 dieses Wort genießt! Ungehindert, würde sie die Seite mit Neotenieneotenieneotenieneotenie füllen. Natürlich schert sich die Remington SL3 kein Komma darum, dass nur wenige Leser wissen, was das Wort bedeutet. Hätte sie dadurch aber die Gelegenheit, es noch einmal zu schreiben, würde sich die Maschine auch zu einer Definition breitschlagen lassen.
«Neotenie» heißt «jung bleiben», und es grenzt an Ironie, dass kaum einer das weiß, ist doch die menschliche Evolution davon beherrscht. Die Menschen haben sich zu ihrem relativ hohen Stand entwickelt, indem sie die unreifen Merkmale ihrer Vorfahren beibehielten. Die Menschen sind die fortgeschrittensten Säugetiere – obgleich man sich auch für die Delphine verwenden könnte –, weil sie selten erwachsen werden. Verhaltenszüge wie Neugier auf die Welt, Flexibilität der Reaktionen und das Spielerische sind praktisch allen jungen Säugetieren gemeinsam, verlieren sich aber meist rasch mit einsetzender Reife bei allen, außer den Menschen. Die Menschheit macht Fortschritte, falls sie Fortschritte macht, nicht weil sie nüchtern, verantwortlich und vorsichtig wäre, sondern weil sie spielerisch, rebellisch und unreif ist.
Man braucht sich nicht für übermäßig ungebildet zu halten, falls man den Begriff Neotenie nicht kennt. Es hat Königinnen und Könige und Prinzessinnen gegeben, die ebenfalls blind gegen diesen Begriff waren, in Worten wie in Taten.
Während der Zeit, die auf Leigh-Cheris Fehlgeburt folgte, entwickelte sich im Puget-Sound-Palast die sogenannte Tugend der Reife zur Kardinalfrage. Obgleich verständlicherweise im Unklaren darüber, was Reife wirklich sein könnte, strebte Leigh-Cheri mit Unterstützung ihrer Eltern danach, mehr davon zu erwerben. Allabendlich, bis sie fünfzehn war und noch ein paar Abende danach, war ihr eine Gutenachtgeschichte erzählt worden; bis vor wenigen Wochen hatte sie inmitten von Troddeln und Quasten anfallartig um sich gedroschen, hatte unverständliche Beschwörungen gekreischt, die das Glück einer Bande unschuldiger, dem Kult einer heiligen Frucht ergebener Kobolde fördern sollten (von dem Glück ebendieser Footballmannschaft hing für gewöhnlich das Bankkonto des reifen Königs Max ab, aber das ist eine andere Geschichte). Es war Zeit, dass sie erwachsen wurde. Prinzessinnen bekam man nicht gerade sechs für einen Heller. Und diese Prinzessin, so dämmerte es Tilli und Max plötzlich, war eine Sexpartie.
Von ihr konnte man erwarten, sich, wenn sie das Alter von einundzwanzig erreichte, gut, ja sehr gut zu verheiraten. In der Tat gab es wahrscheinlich keinen Mann von Prinz Charles bis zum Sohn des Präsidenten der USA, dem sie nicht ebenbürtig gewesen wäre. Solche Aussichten gefielen König und Königin. Bislang, da sie unter dem wachsamen Auge der CIA lebten und einwilligen mussten, sich von den Kreisen des Hochadels «zurückzuziehen», hatten die Furstenberg-Barcalonas keine besonderen Ambitionen für ihre Tochter gehegt und waren zufrieden, sie eine normale amerikanische Mädchenzeit genießen zu lassen (wiewohl sie kaum überzeugt waren, dass Erscheinungen wie Vegetarismus und Ökologie normal sein könnten). Jetzt kam ihnen die Idee, dass, falls diese junge Frau die Aufmerksamkeit des richtigen Mannes auf sich ziehen sollte, eines der aufsteigenden arabischen Herrscher zum Beispiel, selbst die CIA keine Macht hätte, solch höchst vorteilhafte Verbindung zu verhindern.
Es war der falsche Zeitpunkt, Leigh-Cheri mit Hochzeit zu kommen. Sie hatte einen hölzernen Pflock durchs Valentinssträußchen getrieben. Doch unter der Voraussetzung, dass es der Vorbereitung auf ihre Lebensaufgabe nützlich sein könnte, unter der Voraussetzung, dass sie sich, sollte sie jemals wieder ihr Studium der Umweltwissenschaften aufnehmen, nicht mehr so leicht von den Vibrationen des Halb-Muscheltiers/Halb-Pfirsichs, der das warme Becken ihrer unteren Regionen bewohnte, ablenken lassen würde, gab sie sich der Reife hin, falls die Reife sie denn haben wollte.
Weg mit dem Teddybär. Weg mit den Beach-Boys-Platten. Weg mit der Phantasie von hawaiianischen Flitterwochen mit Ralph Nader, dem Tagtraum von Ralph und ihr, wie sie mit angeschnallten Sicherheitsgurten in den Sonnenuntergang am Haleakala hineinfuhren. Nicht dass sie ihre Meinung geändert hätte, wie perfekt sie zu ihm passen würde – er arbeitete zu hart, lächelte zu wenig und speiste wie einer, dem Geschmack und Geschick gleichgültig sind; er war eindeutig ein Held, der der Rettung durch eine Prinzessin bedurfte – nur dass genau solche romantischen Phantasien … unreif waren.
Leigh-Cheri las Bücher über Sonnenheizung. Sie blätterte in Broschüren über die Überbevölkerung. Um mit den laufenden Ereignissen Schritt zu halten, sah sie jede Nachrichtensendung, die sie sehen konnte, und floh sofort aus dem Fernsehzimmer, wann immer eine Lovestory angekündigt wurde. Sie schenkte ihr Ohr Mozart und Vivaldi (Tschaikowsky tat weh). Sie verfütterte Fliegen an Prince Charming. Und sie mühte sich ab, ihre Person und ihr Zimmer äußerst sauber zu halten.
Sauberkeit kommt gleich nach Göttlichkeit, war eine der Reife-Parolen, die Leigh-Cheri gläubig unterschreiben konnte – ohne sich mit der Überlegung aufzuhalten, dass, wenn im letzten Viertel des zwanzigsten Jahrhunderts Göttlichkeit vor nichts Interessanterem als Sauberkeit rangierte, es vielleicht an der Zeit war, unsere Vorstellungen von Göttlichkeit neu zu überdenken.
13
Am Sonntag nahm Gulietta ihren freien Tag. Das war nur fair. Sogar Freitag machte am Donnerstag blau, dank Robinson Crusoe. An Sonntagen pflegte Königin Tilli, ihren Chihuahua liebevoll an sich gedrückt, in die Küche zu wanken und für den Brunch zu sorgen.
Der Duft von brutzelndem Speck, Wurstkringeln und Schinken trippelte auf Schweinefüßchen bis hinauf in den zweiten Stock. Unvermeidlich weckte er dort Leigh-Cheri. Unvermeidlich machte der Duft sie heißhungrig und widerte sie zugleich an. Sie hasste dieses Gefühl. Es erinnerte sie an die Schwangerschaft. Jeden Sonntagmorgen, ungeachtet ihres Zölibats, erwachte Leigh-Cheri mit einer Pfanne voll frittierter Furcht.
Selbst wenn die Panik nachgelassen hatte, fand sie an einem Sonntag wenig Bewunderswertes. Für sie war der Sonntag ein Tag, an dem Gott seine wollenen Schlüpfer anbehielt. Es war ein Tag mit stumpfer Schneide, die noch so viel Freizeit nicht schärfen konnte. Manche finden ihn entspannend, aber die Prinzessin schätzte, dass viele, viele ihr Gefühl teilten, der Sonntag erzeuge eine übernatürliche Depression.
Sonntag, ein bleicher starrer Schatten des robusten Sonnabends. Sonntag, der Tag, da geschiedene Väter mit «Besuchserlaubnis» ihre Kinder in den Zoo führen. Sonntag, erzwungene Muße für Leute, die keine Begabung zur Muße haben. Sonntag, da der Katzenjammer keine Grenzen kennt. Sonntag, der Tag, als der Boyfriend nicht ins Hospital kam. Sonntag, eine überfütterte weiße Katze, die Hymnen miaut und Footbälle furzt.
Den Tag des vollen Mondes, wenn der Mond weder zunimmt noch abnimmt, nannten die Babylonier Sa-bat, und das heißt «Herzens-Ruhe». Man glaubte, dass an diesem Tag die Frau im Mond, Ischtar, so hieß die Mondgöttin in Babylon, menstruiere; denn in Babylon, wie praktisch in jeder alten und primitiven Gesellschaft, hatte es seit frühesten Zeiten ein Tabu gegeben, das einer Frau verbot, zu arbeiten, Nahrung zuzubereiten oder zu reisen, wenn sie ihr Monatsblut vergoss. Am Sa-bat, aus dem unser Sabbat entstanden ist, war Männern wie Frauen befohlen zu ruhen, denn wenn der Mond menstruierte, lag das Tabu auf jedermann. Ursprünglich (natürlich) einmal im Monat eingehalten, sollte der Sabbat später von den Christen in ihren Schöpfungsmythos eingebaut und allwöchentlich begangen werden. Und deshalb sind heute harte Männer mit harten Muskeln und harten Hüten am Sonntag von ihren Jobs befreit – aufgrund einer archetypischen psychologischen Reaktion auf die Menstruation.
Wie hätte Leigh-Cheri wohl gekichert, hätte sie das gewusst. An einem bestimmten Sonntag Anfang Januar, wobei der Januar für das Jahr etwa das darstellt, was der Sonntag für die Woche ist, wusste sie es aber noch nicht und erwachte schlechtgelaunt. Sie zog sich einen Morgenrock über ihren Flanellpyjama (sie hatte entdeckt, dass Seide die Tendenz hatte, den Pfirsichfisch zu erregen), bürstete sich die Knoten aus dem Haar, rieb sich mit den Fingerknöcheln die knusprigen Körnchen aus den Augenwinkeln und stieg gähnend und sich reckend in die heiße Schweinehölle des Brunch hinab. (Sie wusste, ohne zu kosten, dass selbst ihr Sojabohnenquark etwas vom Schinkenfluidum aufgenommen haben würde.)
Wie so vielen anderen seit urlanger Zeit, halfen auch ihr die Sonntagsblätter über den Tag. Ganz gleich, was die Presse sonst noch zu unserer Kultur beigetragen haben sollte, ob sie nun unsere stärkste Waffe gegen den Totalitarismus oder aber eine launische Macht ist, die authentische Erfahrungen untergräbt, indem sie diese gemäß einem modischen öffentlichen Interesse in Rubriken einteilt, hat die Presse uns die dicken Sonntagsblätter geschenkt, um unsere allwöchentliche geistige Menstruationsblähung zu lindern. Prinzessin Leigh-Cheri, winde dich noch ein letztes Mal in deine Cheerleaderuniform und zeige uns, wie man Hurra schreit: Eins, zwei, drei vier, wen lieben wir? Die Sonntagsblätter, die Sonntagsblätter, yeah!
Es war die Seattle-Zeitung, an diesem gewissen Sonntag, Anfang Januar, in der Leigh-Cheri erstmals über das Geo-Therapy-Care-Fest las, über die Was-tun-wir-für-den-Planeten-bevor-das-einundzwanzigste-Jahrhundert-kommt-Konferenz. Es war ein Ereignis, das ihren Puls selbst dann beschleunigt hätte, wenn als Austragungsort nicht Hawaii festgesetzt worden wäre. Da es aber so war, hüpfte sie zum ersten Mal seit Jahren ihrer Mutter auf den Schoß – nicht gerade ein Akt äußerster Reife – und läutete damit ihre Petition ein, an der Konferenz teilnehmen zu dürfen; denn nach dem Code der Furstenberg-Barcalonas, den sie jetzt strikt befolgte, würde die Königin sie begleiten müssen. Tilli auf Maui? Oh-oh, Spaghetti-O.
14
Für das letzte Viertel des zwanzigsten Jahrhunderts kann gesagt werden: Die Binsenwahrheit, dass wir, wenn wir eine bessere Welt wollen, bessere Menschen werden müssen, wurde von einer signifikant großen Minderheit endlich anerkannt, wenn auch nicht ganz verstanden. Trotz der Langeweile und Angst der Epoche, oder vielleicht gerade deswegen, trotz der unsicheren Meere, die die Geschlechter trennten, oder vielleicht gerade deswegen, schienen Tausende, Zehntausende bereit, ihre Körper, ihr Geld und ihre Fähigkeiten verschiedenen planetarischen Rettungsmissionen anzuvertrauen.
Die Koordination solch weitgespannter Projekte war ein Hauptziel des Geo-Therapy-Care-Festes, das während der letzten Februarwoche in Lahaina, Maui, Hawaii, stattfinden sollte. Führende Experten auf dem Feld der alternativen Energiequellen, der organischen Landwirtschaft, der Wildniserhaltung, der alternativen Erziehung, der ganzheitlichen Medizin und Ernährung, des Verbraucherschutzes, des Recyclings und der Weltraumkolonisation sollten Vorträge halten sowie Podiumsdiskussionen und Workshops leiten. Befürworter vieler verschiedener hausgemachter Systeme und Bewusstseins-Heilslehren, von alt-orientalischen bis zu modern-kalifornischen, sollten ebenfalls zugegen sein. Außerdem waren gewisse Futuristen, Artisten, visionäre Denker, Schamanen und poetische Seher eingeladen worden, wenngleich einige Dichter und ein Schriftsteller von den Organisatoren verdächtigt wurden, in den Reihen der Wahnsinnigen zu marschieren.
Die Nachricht von dieser Konferenz hätte auf dreißig Schritt den Zuckerguss vom Hundekuchen geschmolzen, das könnt ihr mir glauben. Hätte Leigh-Cheri ihr Leben als Salat gefristet, sie wäre kopfüber in die Tunke gesprungen, um dieser Konferenz ein Crouton zu kredenzen. Nicht wenig trug zu ihrer Erregung die Mitteilung bei, Ralph Nader würde dort eine Schlüsselrede halten, und ein ganzer Abend wäre dem Thema alternativer Geburtenkontrollmethoden gewidmet. Selbst in der eisigen Verbannung ihres Zölibats war Leigh-Cheri an Verhütung interessiert. Die damit verbundenen Probleme waren für sie frustrierender gewesen als das aggressive, rivalisierende, selbstbewusste, egozentrische und grobe Verhalten der Männer, mit denen diese Probleme hätten geteilt werden sollen, und obwohl sie gegenwärtig frei von dem Problem war, war sie zu intelligent, um Flucht mit Sieg zu verwechseln.
König und Königin hatten ihre Tochter seit Monaten nicht so lebhaft gesehen. Gewiss, diese Lebhaftigkeit war relativ: Leigh-Cheri bewegte sich umher wie ein Zombie, doch vor einigen Tagen hatte sie noch einer Leiche geglichen. Das war schon ein Fortschritt. Es gab jetzt Augenblicke, da sie, über das Care-Fest spekulierend, am Rande eines Lächelns zu sein schien. Und was würden in einer solchen Situation alle mitleidsvollen Eltern tun? Nachgeben, natürlich. Ihr ihre Konferenz erlauben.
Als der Termin näherkam, befand Königin Tilli, Maui sei einfach zu barbarisch. Es war schlimm genug, am Stadtrand von Seattle festzustecken, wo es Tag und Nacht Forellenzähne regnete und die Brombeerranken sich einen Weg in die Privatsphäre ihres eignen Gemachs zu erzwingen suchten; sie wollte ihre strammen Pfunde nicht auch noch auf irgendeine Urwaldinsel transportieren, voll von Surferboys und urlaubenden Nutten, deren Kreis an diesem einen Wochenende noch um ein paar tausend Knallköpfe erweitert sein würde, die darauf aus waren, eine Welt zu retten, in die sie ohnehin nicht hineinpassten. Die Seattle Opera Company brachte in der gleichen Woche Norma