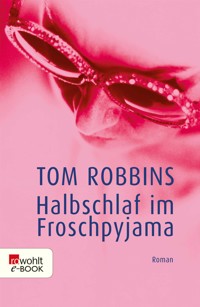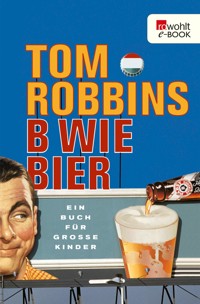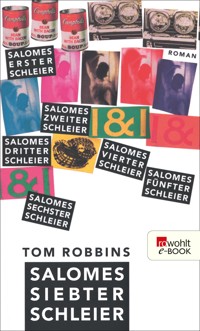
9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: ROWOHLT E-Book
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Ein Jude und ein Araber eröffnen gemeinsam ein Restaurant gegenüber dem New Yorker UNO-Gebäude. Da solch ein Ort der Völkerverständigung militanten Fundamentalisten aller Seiten ein Dorn im Auge sein muss, gehen bald die Bombendrohungen ein. Eine phantastische Geschichte. Auf den Seiten tanzen – wild und erotisch wie Salome – die verrücktesten Gestalten, die schärfsten Sprüche und die provokantesten Gedanken. «‹Salomes siebter Schleier› ist Tom Robbins' Meisterwerk … eine wahre, wohlige Lust zu lesen.» (Berliner Morgenpost)
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 771
Veröffentlichungsjahr: 2014
Ähnliche
Tom Robbins
Salomes siebter Schleier
Roman
Aus dem Englischen von Pociao
Rowohlt E-Book
Inhaltsübersicht
Für Alexa d’Avalon und Ginny Ruffner und ihre rosaroten Schuhe
Der Messias wird erst kommen, wenn er nicht mehr nötig sein wird.
Franz Kafka
It’s the end of the world as we know it
(And I feel fine.)
R.E.M.
Vorspiel
Das ist der Raum mit der Wolfsmuttertapete. Das Giftpilzmotel, das du stets für ein Volksmärchen hieltest, für eine sentimentale, altmodische Erfindung vom Lande.
Das ist der Raum, in dem dein weisester Vorfahr zur Welt kam, ganz gleich ob du Christ, Araber oder Jude bist. Das Linoleum unter deinen Füßen ist geweihtes Linoleum. Bitte zieh die Schuhe aus. Erst vor kurzem wurde dieses Linoleum mit einem Wachs aus Hornissenfett wieder auf seinen ursprünglichen Hochglanz gebracht. Es nutzt sich schnell ab. Also mach dir nichts draus, wenn du Löcher in den Socken hast.
Das ist der Raum, wo deine Musik erfunden wurde. Beachte das geplatzte Trommelfell an der Wand, das auf die Wolfsmuttertapete genagelt ist über dem Waschbecken in der Ecke, wo die störrische Ehefrau ihre seidenen Unterhöschen wusch und sie im bläulichen Schein des Neonlichts («Belegt!») begutachtete, das draußen im fahlen Eidechsenmorgengrau verdächtig flackerte.
Welcher Raum das ist? Es ist der Raum, wo das Geweih den Kürbis ausstach. Es ist der Raum, wo sich die Abflussrohre am Mondschein berauschten. Es ist der Raum, wo das Moos allmählich den Schatz erstickte, die Rubine zuletzt. Signale aus Insektenantennen wurden in diesem Raum abgehört. Erstaunlich, wie oft sie in ihren Sendungen auf die Sterne anspielten.
Ein Hinweis: Das ist der Raum, wo der bemalte Stock begraben, wo die Schneckenmuschel in schmeichlerischen Papyrus gehüllt lag. Liebhaber häuteten sich schlangengleich in diesem Raum aus Lehm. Erinnerst du dich jetzt an die Tapete? An die Sprache der Tapete? An die Rosen aus dem Blut der Wolfsmutter, die hier vibrierten?
Doch genug von diesem wilden Fuchsgebell. Du bist in einem uralten Cadillac gekommen, einer Kiste, von der du sagst, du hättest vergessen, wie man sie fährt. Du hast zwischen dem Swimmingpool und der Reihe von geschwärzten Schädeln geparkt. Klar weißt du, welcher Raum das ist.
Es ist der Raum, wo Jezabel sich die Lider mit dem tragischen Flimmer der Geschichte bestäubte, wo Delila ihre Konzession als Kosmetikerin erwarb, der Raum, in dem Salome den siebten Schleier fallen ließ, als sie den Tanz der höchsten Erkenntnis tanzte, mit Storchenbeinen und allem.
Der erste Schleier
Es war ein strahlender Tag zu Beginn des Frühlings, sanft wie ein Weidenkätzchen, alles taute und schmolz, und die Jungvermählten fuhren in einem großen Truthahn quer durchs Land.
Der Truthahn lag auf dem Rücken, wie es sich für gebratene Truthähne gehört, die Brust willig dem Tranchiermesser dargeboten, die fetten Schlegel steif, aber unbekümmert emporgereckt, als wollte er im nächsten Augenblick wieder auf die Füße springen, aber natürlich hatte er keine Füße, was diese Möglichkeit vage und lächerlich erscheinen ließ und noch zu der Aura vertrottelter Verletzlichkeit beitrug, die den Truthahn umgab.
Trotz fehlender Füße, einer mitleiderregenden Verkrüppelung, schoss dieser gebratene Truthahn – beziehungsweise sein überdimensionales Ebenbild – mit fünfundsechzig Meilen pro Stunde über den Highway und kam so mit gespreizten Beinen schneller und weiter voran als so manches aufstrebende Filmsternchen.
Der Truthahn, der jetzt im schwachen Licht der Märzsonne glänzte, war das Hochzeitsgeschenk des Bräutigams an die Braut gewesen, obgleich das Eigentumsrecht beim Bräutigam verblieb und er tatsächlich nie auf seinen Besitzanspruch verzichten sollte. Eigentlich machte die Präparierung des Truthahns, ja das bloße Phänomen seiner Existenz, das eigentliche Geschenk an die Braut aus. Wichtiger noch, die Materialisation des Truthahns, die überschwängliche, schwindelerregende Überraschung seiner Kreation, hatte letztendlich erst zur Eheschließung geführt: Der Bräutigam Boomer Petway hatte den Truthahn benutzt, um Ellen Cherry Charles auszutricksen. Jedenfalls dachte Ellen Cherry das in diesem Augenblick, kaum eine Woche nach der Hochzeit, während sie zusah, wie der Truthahn die schmelzende Landschaft in seine Windschutzscheibe sog und durch den Rückspiegel wieder ausspie: dass Boomer sie reingelegt hatte. Kaum eine Woche nach der Hochzeit war das wohl nicht gerade ein günstiges Vorzeichen für bevorstehende Jahrzehnte ehelichen Glücks.
Manche Ehen werden im Himmel geschlossen, dachte Ellen Cherry. Meine ist made in Hongkong. Wie die kleinen Schweinekoteletts aus Gummi, die sie im K-Mart in der Tierabteilung verkaufen.
Spottdrosseln sind wahre Künstler im Königreich der Vögel. Will heißen, sie kommen zwar mit einem charakteristischen Gesang zur Welt, einer angeborenen Melodie, die zufällig eine der vielseitigsten Ausdrucksweisen der Vogelwelt ist, doch geben Spottdrosseln sich keineswegs damit zufrieden, die Karte zu spielen, die sie zufällig gezogen haben. Wie alle Künstler sind sie darauf aus, die Realität zu verändern. Innovativ, eigensinnig, wagemutig, keineswegs an Regeln gebunden, die andere blind befolgen würden, schnappt die Spottdrossel alle möglichen Fetzen von Vogelgesang auf, in diesem Baum einen und von jenem Feld einen anderen, macht sie sich zu eigen, stellt sie in einen neuen und unerwarteten Kontext, erschafft eine neue Welt aus der alten. In South Carolina soll es eine Spottdrossel gegeben haben, die den Gesang von zweiunddreißig verschiedenen Vogelarten zu einem zehnminütigen Konzert verschmelzen konnte, eine virtuose Darbietung, die keinem praktischen Zweck diente und daher in die Sparte reine Kunst fiel.
Und so kam es, dass Spottdrosseln in den Hornsträuchern und Fliederbüschen auf dem Gelände der Third Baptist Church von Colonial Pines Kunst schufen und «dem Herrn ein fröhlich Lied sangen», während sich im Inneren des Gebäudes, eines typisch georgianischen Rechtecks aus staubfarbenen Ziegeln mit pedantischen weißen Verzierungen, mehrere hundert frisch geschrubbte, wohlgenährte menschliche Wesen keineswegs um die Schöpfung kümmerten, sondern um die Vernichtung. Die endgültige Vernichtung.
Im Zentrum Virginias, wo Colonial Pines gelegen ist, war der Frühling schneller auf den Beinen als drüben im äußersten Westen, durch den Boomers und Ellen Cherrys Truthahn stetig ostwärts fuhr. Die Weidenkätzchen waren in Virginia bereits gekommen und wieder gegangen, und Hornstrauchblüten mit kränklichen Gesichtern, die an Elfen mit Verstopfung erinnerten, strengten sich an, ihren Platz einzunehmen. Aus unterirdischen Silos feuerten Jonquillenzwiebeln eine Salve von butterspitzenbewehrten Stängeln nach der anderen ab; alle Arten von Knospen schwollen und platzten auf, Vögel (nicht nur Spottdrosseln) spannten Vogelsangleinen von Baumwipfel zu Zaunpfahl, Bienen und andere Insekten erwachten vom ungewohnten Alarm ihres eigenen leisen Summens; überall befand sich die warme Welt der Natur in einem Prozess von Wiedergeburt und Erneuerung, fast als wolle sie bewusst Zweifel an der Richtigkeit der Predigt säen, die im Inneren der Kirche gerade zu Ende ging.
«Gott hat uns ein Zeichen gegeben», donnerte der Prediger von seiner eichenfurnierten Kanzel herab. «Ein Zeichen! ’ne Warnung, wenn ihr so wollt. ’nen weisen Ratschlag. Er hat seinen Kindern ein deutliches, leicht verständliches Zeichen gegeben, Worte in hohen schwarzen Lettern, vielleicht in goldnen Lettern – vielleicht sogar in Neonschrift. Jedenfalls so, dass keinerlei Zweifel an seiner Botschaft bestehn. Dieses Zeichen hat der Herr seinem geliebten Jünger Johannes unter die Nase gehalten, und da Johannes ein rechtschaffener Kerl war, ein weiser Bursche, hat er nich mit der Wimper gezuckt, sich am Kopf gekratzt oder nach Einzelheiten gefragt, nein: Der heilige Johannes hat nich erst beim Anwalt angerufen und sich juristischen Beistand geholt, nein, Johannes las das Zeichen, schrieb es nieder und gab es an die Menschheit weiter. An euch und an mich.»
Die Stimme des Predigers erinnerte an ein Saxophon. Nicht an das coole, lakonische Horn eines Lester Young, sondern an das volle, satte, lebendige Saxophon eines, na, sagen wir Charlie Barnet. Es lag eine wunderbare, dunkle Poesie in seiner Stimme, eine Art Trotz, der aus tiefer Einsamkeit erwächst. Sein pockennarbiges Gesicht war hager und wirkte hungrig, es war ein gezeichnetes Gesicht, verunstaltet von Pusteln und den Absonderungen fauliger Zähne. Doch der Klang der Stimme, der aus diesem Gesicht unter dem jungenhaft feuchten schwarzen Haarschopf drang, dieser Klang war schöpferisch und rund und düster romantisch. Besonders die Frauen in der Gemeinde waren hingerissen von dieser Stimme, kamen allerdings nie auf die Idee, dass vielleicht nur frischer Eiter ihren erregenden Klang bewirkte.
«Was Gott der allmächtige Vater Johannes gesagt hat, war Folgendes: Wenn die Juden in ihre Heimat zurückkehren – jawohl! wenn die Juden erst wieder im Lande Is-ra-el zu Hause sind –, dann is das Ende der Welt nich mehr weit!»
Der Prediger machte eine Pause. Seine hungrigen Augen fixierten die Gemeinde. Verlin Charles würde später sagen: «Manchmal, wenn er uns so anstarrt, hab ich das Gefühl, er will mir die Blüte aus’m Knopfloch fressen.» Worauf seine Frau Patsy erwiderte: «Ich weiß nich, ich finde, er sieht eher aus, als würd er im Geist an mei’m Höschen sabbern.» Verlin Charles hielt überhaupt nichts von Patsy Charles’ Interpretation der hungrigen Blicke des Predigers und machte auch keinen Hehl daraus.
Links vom Altar hob ein Radiotechniker drei Finger. Reverend Buddy Winkler nahm die Geste aus den Augenwinkeln wahr, ließ von der starren Betrachtung seiner Herde ab und wandte sich wieder dem Mikrophon zu.
«Nach der Rückkehr der Juden in ihre Heimat is das Ende der Welt nich mehr weit. Das is das Zeichen, das Gott uns hinterlassen hat. Warum hat er das getan? Ich möcht euch mal was fragen. Glaubt ihr, Gott hat uns diese kleine Neuigkeit einfach so nebenbei mitgeteilt, als wär’s ein Stück Tratsch, ein interessanter Absatz aus dem Reader’s Digest? Oder hat Gott vielleicht was damit bezweckt, als er Johannes das Zeichen offenbarte? Hat er ein Motiv gehabt, als er Johannes befahl, die Prophezeiung im Buch der Offenbarungen niederzuschreiben? Solln wir vielleicht auf diese Botschaft irgendwie reagieren?»
Der Techniker hob zwei Finger. Buddy Winkler nickte und beschleunigte sein Tempo. Jetzt ging er in die Vollen wie Charlie Parker, ließ eine geballte Ladung harmonischer Rhetorik auf seine Zuhörer niederprasseln und brachte seine Saxstimme auf ungefähr achtundfünfzig Takte in der Minute. Den üblichen Tenor hatte er am Eingang der Synkopen abgegeben, er setzte jetzt mit dem Altsaxophon zu einer scharfen Schmährede gegen Semiten und Antisemiten gleichermaßen an: Unter einem Schwall ornamentaler Riffs forderte er seine Brüder auf, ihr Augenmerk auf Jerusalem zu richten, auf die Stadt, in der sich ihr Schicksal erfüllen würde, er ermahnte sie, sich auf ihren physischen Einzug nach Jerusalem vorzubereiten, wo die Rechtschaffenen unter ihnen den verheißenen Lohn in Empfang nehmen würden, kündigte für den folgenden Sonntag eine Beschreibung der Zustände im neuen Jerusalem an und erinnerte sie schließlich, dass auch diese Predigt wie alle in der Serie, die sich mit dem unmittelbar bevorstehenden Ende beschäftigten, über die Southern Baptist Voice of the Sparrow Network übertragen würde, dem die regionale Sendeanstalt WCPV angeschlossen war. Er hängte eine letzte schrille Gebetscoda an und schloss genau in dem Moment, als sich der Zeigefinger des Radiotechnikers senkte, mit «Amen».
Speichelrosetten schmückten sein Lächeln, als er vor der Kirchentür die Glückwünsche seiner Schäfchen entgegennahm.
«Starke Predigt, Reverend Winkler.»
«Gott schütze Sie, Roy.»
«Reverend Winkler, niemand predigt so wie Sie! Es berührt mich tief im Herzen, Sie sprechen etwas in mir an, Sie –»
«Es is der Herr, der durch mich spricht, Miss Packett.» Er quetschte ihr die Hand. «Es is das Werk des Herrn.»
«Wirklich prima, Bud. Übrigens, die Kröten sind unterwegs.»
«Weiß nich, ob ich dies Frühjahr Zeit zum Stechen hab, Verlin.»
«Bist wohl hinter andern Kröten her, wie, Bud?»
Die Pusteln in seinem Gesicht verfärbten sich tiefrot. «Also wirklich, Patsy!»
«Hast noch mehr Fische an der Angel, was?»
«Patsy!» Er sprach ihren Namen mit Mühe aus, als koste es ihn eine Riesenanstrengung, diese einsame, tiefe Note aus seinem Saxophontrichter zu locken. Es war Tadel und flehentliche Bitte zugleich. Patsy grinste und überließ ihn seiner Herde.
Verlin und Patsy Charles machten sich auf den Weg zu ihrem Buick Regal, der auf dem Parkplatz stand.
«Du könntest ihn wenigstens hier in Ruhe lassen, Patsy. In Gottes Haus …»
«Er stand doch draußen auf der Treppe.»
«… am Sabbat.»
«Bud bleibt Bud, egal, ob sonntags oder am vierten Juli.»
«Und am Jüngsten Tag?»
«Das werden wir noch schnell genug erleben, schätz ich mal», sagte Patsy, und Verlin lächelte im Schutz der Fliederhecke.
«Weißt du», sagte er, während er stehen blieb und einen neuen Ford-Lieferwagen bewunderte, der einem Bekannten von ihnen gehörte, «das Ende der Welt kann gar nich so unmittelbar vor der Tür stehn, wie er immer tut. Weißt du auch, warum? Weil’s ’ne Tatsache ist, dass mehr Juden in New York leben als in ganz Is-ra-el.» Er versuchte, es so auszusprechen wie sein Vetter Buddy, aber Verlins Stimme hatte mehr von einem Fiedelbogen als von einem Saxophon.
«Willst du sie etwa deportieren?»
«Mich juckt’s nich, wenn New York jüdischer is als Jerusalem. Hab eh keine Lust aufs Armageddon. Ich muss meine Rechnungen bezahlen.»
«Du musst eine Tochter durchfüttern, die dabei is, nach New York zu ziehen.»
Verlin runzelte nicht nur die Stirn, sondern gleich das ganze Gesicht. Es war ein rosiges Gesicht, weder auf der Westbank noch in den östlichen Gefilden von einem einzigen Barthaar besetzt. Verlin gehörte zu den Männern, die sich von innen zu rasieren scheinen. Er war schlaksig wie sein Vetter, der Prediger, doch sein Gesicht war rund, glatt, satt (was nicht dasselbe ist wie «zufrieden»), und es roch unweigerlich nach muffigem Waschlappen, egal, wie viel Old Spice Aftershave er draufschüttete. «Nett, dass du mich dran erinnerst», sagte er.
«Millionen von Menschen leben in New York. So schlimm kann es nicht sein.»
«Perverse. Puerto Ricaner. Straßenräuber. Terroristen. Und wie nennen sie das noch gleich: Stadtstreicher.»
«Terroristen in New York? Liebling, New York liegt in den USA, nur damit du’s weißt.»
«Sie werden kommen, wenn sie nich schon längst da sind. Juden ziehn den Terrorismus an wie Scheiße die Fliegen. Is schon immer so gewesen.»
«Ich schwör dir, du hörst dich schon an wie Bud. Schließlich sind die Juden nich erst seit letzten Dienstag in New York. Die Stadt ist voll von ihnen, seit was weiß ich wie lang. Und 1940 oder so haben sie angefangen, sie nach Israel zurückzuschicken. Ich weiß wirklich nich, warum ihr beide euch plötzlich dermaßen über die Juden aufregt.»
«Ach, vielleicht weil es in den Nachrichten plötzlich dauernd um den Nahen Osten geht.» Er seufzte. «Scheint, als gäb’s kaum noch was andres auf der Welt.»
«Außerdem wird Boomer auf Ellen Cherry aufpassen. Das hast du selbst gesagt.»
«Is lang her, dass ich so was gesagt hab. Heute würd ich’s nich mehr tun. Diese verdammte Kiste, die er gebastelt hat, um sie da abzuholen! Ich glaub, sie hat ihm mittlerweile so den Kopf verdreht, dass er jetzt schon genauso spinnt wie sie.» Verlin spuckte aus. «Künstler!»
Während das Paar auf den Buick zusteuerte, flogen zwei Spottdrosseln von dessen Kühlergrill auf. Die eine zwitscherte in einem wenig bekannten Dialekt der Distelfinken, die andere vermischte ihren Spottdrosselschrei mit einem heiseren Krächzen, das sie einem Buntspecht abgelauscht hatte. Jahrhundertelang hatten Spottdrosseln lebende Insekten gejagt und sich von Saatkörnern ernährt, doch als auf den Straßen des Südens Autos in großer Zahl aufzutauchen begannen, lernten sie, dass sie es viel einfacher haben konnten, wenn sie die toten Insekten vom Kühlergrill geparkter Wagen pickten. Diese Spottdrosseln. Machten sich auf ihre typische Art modernste Technik zunutze. Erfanden neue Tricks, um ihre Ausdrucksfähigkeit zu erhöhen. Künstler eben!
Kurz bevor das statische Rauschen sie schließlich ganz verschluckte, knisterte noch ein Teil der Sonntagspredigt von Reverend Buddy Winkler aus dem Truthahnradio. «Onkel Buddy», sagte Ellen Cherry und verzog das Gesicht. Obgleich er im Grunde nur das war, was die Leute im Süden als «Hemdschoßverwandten» bezeichneten, hatte sie ihn «Onkel» genannt, seit sie krabbeln konnte. «Der gute alte Onkel Buddy kommt ja echt groß raus.»
Für Boomer war das nichts Neues. In den vergangenen Jahren hatte er der Familie ihres Vaters nähergestanden als sie selbst. Boomer schien nicht zu merken, dass sie das Autoradio auf eine Nachrichtensendung einstellte. («Im arabischen Viertel von Jerusalem eröffneten auch heute wieder israelische Soldaten das Feuer auf …») Boomer schien Kühe zu zählen. Kühe, die am Horizont klebten wie Mücken an einem Fliegenfänger. Immer wenn er eine bestimmte Zahl erreicht hatte, lächelte er. Und Ellen Cherry dachte: Ich werde wohl nie dahinterkommen, wie viele kleine ferne Kühe nötig sind, um meinen Mann zum Lächeln zu bringen.
Merkwürdig, aber in einem Land wie diesem – trocken, unfruchtbar und weit, einem Land voller Viehweiden, flacher Felsen und Klapperschlangen – hatte Buddy Winklers apokalyptischer Eifer eine gewisse Glaubwürdigkeit. Westlich der Cascade Range, um Seattle herum, wo sie ihre Reise begonnen hatten, waren die Bäume so dick, kräftig und hoch, dass sie grünes Gras ausschwitzten, moosige Schnurrbärte trugen und die Waldarbeiter mit Sprüchen wie «Fällt euch doch selbst, ihr Holzköpfe!» begrüßten. Diese kühlen Wälder, gelassen in der Gewissheit um ihre uralte Lebenskraft, schienen den fundiertesten eschatologischen Überzeugungen zu trotzen. Hier dagegen wuchsen die Bäume verkrüppelt, trist und spärlich. Die Straße, ein klares und schnurgerades Band, entrollte sich vor dem Truthahn, wand sich hinter ihm wieder auf und nahm seine Passagiere mit einem einschläfernden, leblosen Rhythmus in Beschlag, von dem die körnige gelbbraune Schichttorte zu beiden Seiten kaum Erleichterung versprach. Die Kuhflecken in der Ferne, Rosinen im schmelzenden Zuckerguss, übertrafen die Weidenkätzchen an Zahl, und tatsächlich schien alles wie von einem gigantischen Hufabdruck geprägt.
In einem Land wie diesem erwartete Ellen Cherry immer, im nächsten Moment die goldene Uhr losschrillen zu hören. Die Uhr mit dem Wecker, der nach Feuersbrunst und Flügelhörnern klang. Gefolgt von Orson Welles, der aus dem Totenbuch rezitierte. «Wär ja wieder typisch», sagte sie, «wenn das Jüngste Gericht käme, und wir hocken hier draußen am Arsch der Welt, meilenweit vom nächsten Telefon.»
Boomer gab keine Antwort. Er konzentrierte sich auf einen entgegenkommenden Viehtransporter. Als er näher kam, bremste der Laster plötzlich ab und fing an zu schlingern. Um ein Haar hätte er sie gerammt, als sie an ihm vorbeifuhren. Der Fahrer hängte den Kopf aus dem Fenster und glotzte. Boomer scherte aus und drückte auf die Hupe.
«Blöder Cowboy», schimpfte er. «Hätte uns fast ein Bein ausgerissen.»
Colonial Pines war ein Vorort ohne Ort. Mit zweiundzwanzig Meilen lag es zu weit von Richmond entfernt, um wirklich dessen Anhängsel zu sein, doch fehlte ihm die Autonomie einer selbständigen Stadt. Es konnte sich keiner nennenswerten Industrie rühmen; andererseits wurden in der unmittelbaren Umgebung jede Menge ausgezeichnete Tomaten angebaut, ohne dass man Colonial Pines deshalb als landwirtschaftliches Zentrum hätte bezeichnen können. Merkwürdigerweise hatte es nicht einmal ein Zentrum. Was man in Colonial Pines als Einkaufsviertel bezeichnete, war ein vierspuriger Highway, der trotz der Schnellstraße, die den Verkehr heutzutage weiträumig an der Stadt vorbeileitete, noch immer Tausende von Yankee-Touristen nach Florida und zurück führte. In Colonial Pines reihten sich auf diesem Highway über eine Strecke von drei Meilen unzählige Motels, Tankstellen und Restaurants Nase an Nase – dabei war Restaurants vielleicht eine etwas hochgegriffene Bezeichnung für die Imbissstuben, Eisdielen, Fernfahrerkneipen und sogenannten «familienfreundlichen» Gaststätten (deren fade, beinahe totalitäre Küche unterdrückte Geschmacksknospen garantiert nicht mit neuartigen oder gewagten Kreationen kitzeln würde). Angeblich verdienten die Bewohner dieser Quasi-Stadt ihren Lebensunterhalt auf dem «Strip», wie man diesen Abschnitt nannte (ihn mit dem Strip von Las Vegas zu vergleichen wäre dasselbe wie Marie Osmond auf eine Stufe mit Mae West zu stellen), doch zugleich lag die Vermutung nahe, dass sie auch von den Erlösen aus Verfahren gegen Temposünder profitierten: Der Ruf der Radarfalle in Colonial Pines reichte von Boston bis Miami.
Wie sich eine Gemeinde von neunzehntausend ausschließlich weißen Angehörigen der unteren Mittelschicht hier halten konnte, wie sie ihre grünen Fensterläden, elektrischen Rasenmäher und allgegenwärtigen amerikanischen Flaggen bezahlte, ist eine Frage, die einem Demographen einen unnötigen Monat Arbeit beschert hätte, uns aber Gott sei Dank nicht beschäftigt. Uns genügt es zu wissen, dass Ellen Cherry Charles in Colonial Pines, Virginia, geboren wurde und hier aufwuchs, dass sie es vom ersten Tag an hasste und schon als kleines Mädchen Pläne schmiedete, dem Dunstkreis der ewigen Langeweile zu entfliehen, der sie zu ersticken drohte. Schließlich machte sie sich tatsächlich aus dem Staub, und es kostete sie einige Mühe. Doch die Tentakel der Heimat sind ebenso zäh wie unsichtbar, und dass Ellen Cherry noch beweisen musste, dass sie sich endgültig aus ihren Umschlingungen befreit hatte, zeigte sich in den allwöchentlichen Telefonaten mit dem Elternhaus. Eins davon fand an diesem Märztag statt.
«Hi.»
«Liebling!», rief Patsy. «Schön, deine Stimme zu hören. Bleib ’nen Augenblick dran, ich muss mir schnell was überziehen, bevor wir reden. Du hast mich im falschen Augenblick erwischt – ich bin grade so nackig, wie Gott mich erschaffen hat.»
«Nackig oder nackt, Mami?»
«Wo zum Teufel is der Unterschied? Hast du etwa Yankee-Manieren angenommen und machst dich über meine Art zu reden lustig? Was im Übrigen auch mal deine Art zu reden war.»
«Nein, nein, Mami, keine Sorge. ‹Nackt› heißt, du hast nichts an. ‹Nackig› heißt, du hast nichts an und gewisse Absichten.»
Patsy kicherte. «Ach so, Kleines, aber das hab ich schon hinter mir.» Sie senkte ihre Stimme, bis sie kaum mehr als ein Flüstern war. «Tatsache is, dass dein Daddy sich grad mit mir verlustiert hat, wie jeden Sonntagnachmittag. Ich hab gehört, die meisten dieser Einmal-die-Woche-Leute ziehn den Samstagabend vor, aber irgendwie muss dein Daddy sich ja von den anderen unterscheiden, nehm ich an. Ich schwör dir, ich glaub fast, dass irgendwas in Buddys Predigten ihn scharfmacht, genauso scharf wie die halbe fromme baptistische Weiblichkeit. Vielleicht is es auch der Football, ich hab keine Ahnung. Jedenfalls guckt er immer zuerst Football.» Patsy hielt inne und räusperte sich, um den kichernden Unterton aus ihrer Stimme zu vertreiben. «Na ja, vielleicht sollte ich ausgerechnet dich mit so intimen Einzelheiten verschonen. Obwohl du natürlich inzwischen selbst ein alter Ehehase bist.»
«Boomer is okay, Mami.»
«Gut. Von wo rufst du an?»
«Aus irgendeinem Rodeokaff. Kurz vor Idaho, glaube ich. Man sollte meinen, dass es in einem solchen Ort, wo die Kühe praktisch auf der Hauptstraße weiden, gute Hamburger geben müsste, aber ich sage dir, in dem Rinderhack hier steckt mehr Sägemehl als in dem in Colonial Pines. Trotzdem hat Boomer schon zwei verdrückt. Er ist gerade beim dritten.»
«Pass bloß auf den Jungen auf! Nich dass sich diese tollen Muskeln in Fettpolster verwandeln!»
Bei diesen Worten warf Ellen Cherry einen Blick über die Schulter auf die Snackbar an der Straße, wo sie ihren muskulösen Bräutigam zuletzt gesehen hatte. Ungefähr ein halbes Dutzend Männer hatte sich staunend um den großen Truthahn versammelt, und Boomer stand mitten unter ihnen.
«Nennt man euch Herrschaften eigentlich immer noch Cowboys?», fragte Boomer. Er nagte an der trockenen Brötchenrinde, die von seinem Hamburger übrig war, so wie heulende Wölfe manchmal an der Mondsichel zu nagen scheinen.
Offensichtlich war der Teenager, an den er seine Frage gerichtet hatte, zu schüchtern, um zu antworten. Der junge Mann nahm die Gelegenheit wahr, seine Stiefel zu begutachten. Sah so aus, als könnten sie vor dem Sommer neue Sohlen gebrauchen.
Einer der älteren Männer reckte den Hals aus dem blauen Overallkragen wie ein Ganter und besaß zumindest den Anstand, Boomer zu antworten. «Wie sollte man uns denn Ihrer Meinung nach sonst nennen?» Seine Stimme war träge und bedächtig, eine vollgefressene Viper, die langsam über einen Steinhaufen kriecht.
«Ach, ich dachte halt, heutzutage würde man womöglich ‹Aufsichtspersonal für Rindvieh› sagen.» Boomer gluckste. Dann stopfte er sich das letzte Stück senfverschmierte Brötchenrinde in den Mund. «Irgendwo hab ich gelesen», sagte er und kaute genüsslich, «die präziseste Arbeitsbeschreibung für den guten alten Cowboy im Wilden Westen wäre ‹grobianisch-reaktionärer Landarbeiter›. Ich glaub kaum, dass das erstrebenswerter ist.»
Allgemeines Stiefelscharren.
«Oje», sagte Ellen Cherry.
«Liebling, lass mich schnell was überziehen», drängte Patsy.
«Mami, ich glaube, wir müssen los. Und zwar schleunigst. Ich hab dich lieb. Wiedersehen.»
Vielleicht ist die Bewunderung für den Cowboy als Verkörperung des prototypischen amerikanischen Helden tatsächlich nicht mehr so verbreitet wie einst. Während seiner Reise durch das Reich des «Aufsichtspersonals für Rindvieh» von Wyoming sollte Can o’ Beans später einmal äußern, dass im Vergleich zwischen dem amerikanischen Cowboy und, sagen wir, dem japanischen Samurai Ersterer ziemlich alt aussah. «Bevor ein Samurai in die Schlacht zog», erzählte Can o’ Beans, «verbrannte er Räucherwerk in seinem Helm, damit dem Feind, der ihm vielleicht den Kopf abschlug, wenigstens ein angenehmes Aroma in die Nase stieg. Cowboys dagegen badeten oder wechselten ihre vor Dreck starrenden Klamotten so gut wie nie. Wenn der Feind eines Samurai sein Schwert verlor, überreichte ihm der Samurai sein Ersatzschwert, damit der Kampf auf ehrenwerte und faire Art weitergehen konnte. Cowboys spezialisierten sich darauf, ihren Gegnern hinter Büschen aufzulauern und sie von hinten zu erledigen. Seht ihr den Unterschied?» Spoon und Dirty Sock wunderten sich, dass Can o’ Beans so gut über Samurai Bescheid wusste. «Oh, ich stand mal über einen Monat lang neben einer Schachtel japanischer Reiscracker im Regal», erklärte Can o’ Beans. «Man kann eine Menge lernen, wenn man sich mit Ausländern unterhält.»
Ah, doch wir eilen unserer Geschichte voraus. Im Moment bleibt bloß festzuhalten, dass Boomer und Ellen Cherry genötigt waren, das Rodeokaff reichlich überstürzt zu verlassen. Eine wilde Meute jagte den Truthahn und verfolgte ihn, von einer Flotte japanischer Kleintransporter getragen, zwanzig Meilen über die Staatsgrenze nach Idaho hinein.
Als die Verbindung jäh unterbrochen wurde, zwängte sich Ellen Cherrys Mutter leicht verwirrt und frisch begattet in ihren Morgenrock, goss sich eine Tasse Kaffee ein und setzte sich auf die Glasveranda, um nachzudenken. Wieder einmal war sie bestrebt, herauszukriegen, ob ihre Tochter sich nicht geirrt haben könnte, als sie Boomer Petway heiratete, und ob Verlin und sein Vetter sich nicht auf hinterhältigste Weise in Ellen Cherrys Leben eingemischt hatten, nicht nur in Bezug auf Boomer, sondern ganz allgemein. Patsy hatte nämlich insgeheim ihre eigenen Pläne für Ellen Cherry, und es fuchste sie, dass es Verlin vielleicht doch noch gelingen könnte, sie zu durchkreuzen.
Wenn sie in New York den Durchbruch als Künstlerin schafft, hat sie das mir zu verdanken, dachte Patsy. Sie öffnete den Morgenmantel ein wenig, sodass die späte Nachmittagssonne sie zwischen den Beinen wärmen konnte, wo sich jetzt eine Lache jener männlichen Flüssigkeit bildete, in der, wie sie gelegentlich argwöhnte, ihre eigene Kunst untergegangen war.
Als Teenager war Patsy Cheerleader gewesen und hatte vom Tanzen geträumt. Und siehe da, mit fünfzehn wurde sie Grapefruit-Prinzessin von Okaloosa County! Mit siebzehn lernte sie Verlin Charles kennen, einen Luftwaffenpiloten vom Stützpunkt Pensacola, und heiratete ihn. Nach seiner Entlassung nahm Verlin sie mit nach Virginia, wo er seine zivile Karriere als Ingenieur wiederaufnahm. Von nun an tanzte Patsy, wenn Verlin bei der Arbeit war: allein, zu Hause, in niedlichen weißen Go-go-Stiefelchen.
Ellen Cherry schaute ihr gern dabei zu, doch es war, ehrlich gesagt, nicht Patsys Gehopse, das Ellen Cherry zur Kunst gebracht hatte. Es war die Übelkeit. Und Colonial Pines.
Zweimal im Jahr fuhr die ganze Familie runter nach Florida, um Patsys Verwandte zu besuchen. Unweigerlich wurde es Ellen Cherry im Wagen schlecht. Um den Brechreiz zu unterdrücken, musste sie im hinteren Teil des Kombis auf dem Rücken liegen und nach oben schauen. Infolgedessen fing sie an, die Welt aus einem anderen Blickwinkel zu betrachten.
Telefonmasten flogen in einer Wellenlinie vorbei. Sie registrierte zuerst die Beleuchtung der Reklametafeln, dann die Oberkante und schließlich ihre verwischte Botschaft: den sich auflösenden Marlboro-Mann, das in die Länge gezogene Stück Fleischpastete. Mit der Zeit begann sie zu experimentieren. Erfand das sogenannte «Augenspiel». Wenn sie die Augen zusammenkniff und das Blinzeln kontrollierte, brachte sie es fertig, dass Objekt und Hintergrund die Plätze tauschten. Objekt-Hintergrund, Hintergrund-Objekt, es ging hin und her. Sie brachte es sogar so weit, nach Belieben farbenblind zu werden. Meilenweit war die Landschaft ausschließlich rot, wenn sie es wollte.
«Na, wie geht’s meiner Kleinen?», fragte Verlin vom Fahrersitz. «Musst du mal Pipi?» Häufig gab seine Kleine keine Antwort. Die Kleine war damit beschäftigt, ihren Fokus zu verschieben, um die gewohnten Assoziationseffekte von Objekt und Raum zu dämpfen oder zu verzerren, sie ihrer gewöhnlichen Bedeutung oder symbolischen Funktion zu berauben, damit sie sich in jenen höchst geheimnisvollen Bereich zwischen Hornhaut und Gehirn begaben – nur um dort weiter Faxen mit ihnen machen zu können. Die parallelen Linien der Telegraphenleitungen zeigten unter ihrem dynamischen Blick eine Neigung zum Überlappen, bis sie ihre Verbindung abbrachen und den freien Raum zwischen sich vergrößerten. Das war besonders interessant, wenn man einen Amselschwarm in das optische Experiment integrieren konnte. Zuweilen ruhte ihr Blick auf dem Horizont, doch ohne eine einzelne, besonders hervorstechende Form, einen Wasserturm etwa, zu bevorzugen; stattdessen konzentrierte sie sich auf den Raum um den Turm herum und entdeckte Struktur und Substanz in Bereichen, die auf unsere Augen normalerweise sekundär, leer, schemenhaft wirken. Und das alles sah sie auf dem Kopf oder auf der Seite stehend, und immer war ihr dabei übel. Was Wunder also, dass sie Boomer Petways Gewohnheit, Kühe zu zählen, ein bisschen albern fand?
Schon im Kindergarten konnte Ellen Cherry besser zeichnen als jedes andere Kind in ihrer Gruppe, und daran änderte sich bis zum Abschlussexamen in der Highschool nichts. Bei allem Respekt vor Patsys Einbildung: Das war ein Talent, das sie von ihrem Vater geerbt hatte. Als Ingenieur konnte er meisterhafte Grundrisse und technische Zeichnungen hinzaubern. (Von ihrer Mutter hatte sie, abgesehen von einer lebhaften Phantasie, den quecksilbrigen Körper geerbt, perfekt geformte Brüste, die – Grapefruit-Prinzessin hin, Grapefruit-Prinzessin her – in der Skala der Zitrusfrüchte eher zur Mandarinenseite neigten, die freche Stupsnase, den Schmollmund, große blaue Augen und eine wirre Masse karamellfarbener Locken, die, ganz gleich, wie sie gebändigt wurden, immer aussahen, als hätten sie im ersten Teil von The Wizard of Oz die Hauptrolle gespielt. Ellen Cherrys Haar allerdings drehte seine eigenen Dinger.) Jede Schule hat ihren inoffiziellen Künstler, nicht wahr, und natürlich war es auf der Highschool Ellen Cherry. Im Lauf der Jahre, als sie lernte, das optische Erz zu veredeln, das sie auf ihren Ausflügen nach Florida förderte, wurden ihre künstlerischen Projekte immer abenteuerlicher und komplexer. Sie verlor ihre lokale Anhängerschaft. Klassenkameraden machten grausame Bemerkungen. Sie hörte nicht darauf. Sie hatte beschlossen, Malerin zu werden.
In Colonial Pines gab es weniger Kunst als Pornographie im Wohnzimmer eines Quäkers. Wie es gelegentlich vorkommt, verwandelte sich der schiere Mangel an kultureller Inspiration in eine kulturelle Inspiration. Ellen Cherry sah in der Kunst einen Wegweiser, der eindeutig von Colonial Pines wegführte. Die Kunst würde Ellen Cherry auf einem fliegenden Teppich aus dieser Gemeinde herausholen, deren einziges Kino ein schäbiges Drive-in war, das nur deshalb noch existierte, weil es Liebespaaren als Ersatz für verschwiegene Gässchen diente.
Im letzten Highschool-Jahr, als Ellen Cherry unter einer chronischen Krankheit litt, die Patsy aus langer Erfahrung am eigenen Leib als «Hummeln im Hintern» bezeichnete, besuchte sie in Begleitung von Boomer Petway regelmäßig jeden Freitagabend die Filmvorführungen dieses Drive-ins. Im folgenden Herbst, wenn sie auf die Kunsthochschule wechselte, würde sie den guten Boomer nie wiedersehen, dachte sie, und das war ihr eigentlich ganz recht. Doch schon in der ersten Nacht, die sie im Erstsemester-Mädchenflügel verbrachte, hörte sie gegen zwei Uhr Geräusche an ihrem Fenster – und dann kam Boomer hereingeklettert, eine Dose Pabst in der Faust und eine Rose zwischen den Zähnen. Er war auf der Harley seines Bruders nach Richmond gebraust und hatte dann drei Stockwerke hoch eine tückische, efeubewachsene Mauer erklommen. Boomer war nämlich bis über beide Ohren, mordsmäßig und – das muss zu seiner Ehre gesagt werden – aufrichtig verknallt.
«Das kannst du mir nicht antun», flehte Boomer, als Ellen Cherry versuchte, ihn wieder durch die Fensteröffnung zu bugsieren. «Du musst wieder nach Hause kommen. Bei mir bleiben. Nach allem, was wir zusammen erlebt haben! Wir – wir haben uns in dem Motel damals als Mann und Frau eingetragen! Du hast – du hast es mir mit dem Mund gemacht!»
«Du hättest eben das Kleingedruckte lesen sollen, Schatz», flüsterte Ellen Cherry und versuchte, ihm so leise wie möglich die Efeuranken hinabzuhelfen. «Dass ich dir mal einen geblasen habe, heißt noch lange nicht, dass du lebenslänglich Garantie darauf hast.»
Letztendlich muss man den Truthahn als Monument für Boomers Liebe sehen.
Schau ihn dir an, wie er schwer und glänzend über Idaho hinwegschwebt, als wäre er eine überdimensionale, mutierte Samenkapsel. Hör zu, wie der Auspuff knallt, wenn er an den Silberminen vorbeikommt: Vielleicht ist das sein Tribut an die Herkunft von Messern und Gabeln aus prachtvollem Sterlingsilber, die der Truthahn, und allein der Truthahn mit seinem Charisma, aus dunklen Schubladen auf festlich gedeckte Tafeln zu locken vermag.
Sieh nur, wie gemütlich er durch die Kartoffelfelder schaukelt, denn mit Kartoffeln steht er auf gutem Fuß, aber zugleich ist da ein Ausdruck freudiger Erwartung auf seinem Gesicht, als könnte jeden Augenblick ein satter Schwall Sauce auf ihn niedergehen.
Der Truthahn birgt in seinem rundlichen Inneren eine beachtliche Menge unseres primitiven heidnischen Gepäcks.
Primitiv? Heidnisch? Wir? Wir mit unseren Lasern, unseren Mikrochips, wir mit unseren christlich-theologischen Seminaren und Time-Magazinen? Na sicher. Nehmen nicht zweimal im Jahr Millionen und Abermillionen von uns kybernetisch geschulten Christen und faxgewohnten Juden an einer rituellen, hochgradig stilisierten Zeremonie teil, in deren Mittelpunkt ein großer toter Vogel steht?
Und wird dieses Tier nicht geopfert wie in uralten Zeiten, um die Aufmerksamkeit eines göttlichen Geistes zu erwecken, Dankbarkeit für erwiesene Gnade zu bezeugen und zukünftigen Segen zu erflehen?
Der Truthahn wird geschlachtet und langsam über gas- oder stromgespeisten Feuern geröstet. Er ist der Mittelpunkt unseres heiligen Festes. Er ist das Totemtier, das unseren Stamm zusammenbringt.
Und weil es ein merkwürdiges und eigensinniges Geschöpf ist, begründet und fördert das Tranchieren eines Truthahns die Stammeshierarchie. Es gibt nur zwei Schlegel, zwei Flügel, eine bestimmte Menge weißes und ein begrenztes Quantum dunkles Fleisch. Wer welches Stück bekommt, ja sogar wer den Vogel zerteilt und seine Glieder und Organe den anderen vorlegt, unterstreicht auf anschauliche Weise, welchen Rang jedes Mitglied der Versammlung innehat.
Denken wir daran, dass die Schlegel dieses Vogels in Amerika «drumsticks» heißen, nach den rituellen Objekten, die verwendet wurden, um dem ursprünglichsten und heiligsten aller Instrumente Musik zu entlocken. Unsere Vorfahren betrachteten ihre Trommeln als Allgemeinbesitz, die Stöcke aber, von denen eine aktive Magie ausging, wurden gewöhnlich an Orten gehütet, die nur dem Schamanen, dem Medizinmann, dem Hohepriester oder der weisen alten Frau bekannt waren. Der Flügel des Vogels ist ein Symbol für den Auftrieb der Seele, mit dem Schlegel aber beschwört man den Rhythmus, den Puls, den Herzschlag des Universums.
Wenige von uns beteiligen sich heute noch an der eigentlichen Jagd und Erlegung des Truthahns, doch wir alle beobachten, zuweilen tief bewegt, die alltägliche Neuinszenierung dieses alten Brauchs. Wir verfolgen sie im Fernsehen, unmittelbar vor dem gemeinsamen Mahl. Denn was sind Footbälle anderes als metaphorische Truthähne, die über eine Wiese flattern? Und was ist ein Touchdown, wenn nicht ein Abschuss, erzielt von einem der beiden feindlichen Stämme? Unter unserem Applaus erlegen großartige junge Jäger aus Alabama oder Notre Dame den Vogel. Dann ruft uns die weise alte Frau in Gestalt der Großmutter an den Tisch, wo wir in der Überzeugung, unsere primitiven Verhaltensweisen längst abgelegt zu haben, den Vogel gierig in Stücke reißen.
War Boomer Petway sich über diese totemistischen Implikationen im Klaren, als er, um seine Geliebte zu beeindrucken, das überdimensionale Kernstück des Erntedankfests anfertigte? Nein, bewusst sicher nicht. Wenn der letzte Schleier fiele, würde er vielleicht verstehen, was er sich da zusammengebastelt hatte. Im Augenblick aber war er ebenso ahnungslos wie Can o’ Beans, Spoon und Dirty Sock, bevor Conch Shell und Painted Stick ihr Bewusstsein für derartige Phänomene schärften.
Und doch war es Boomer, der den garen Braten quer durch Idaho lenkte, über die natürliche Messerschneide der Sawtooth Mountains bugsierte und ein- oder zweimal an Rastplätzen in der Wildnis parkte, wobei die Flora in der Umgebung die Funktion der Petersilie übernahm.
Randolph «Boomer» Petway war Schweißer von Beruf. Er war sieben Jahre älter als Ellen Cherry Charles, kräftig, dunkel und auf seine breitgesichtige, dümmlich grinsende, brutale Art sogar gut aussehend. Er trank viel, lachte viel und humpelte ein bisschen, seit ihm bei einem Unfall in der Schweißbrennerei ein Stück Eisen den Knöchel zerschmettert hatte. Trotz dieser Behinderung tanzte er exzentrischer zum Country Rock als jeder andere Mann im Zentrum Virginias. Ein diesbezüglicher Fachmann, der hinter der Theke seiner Stammkneipe arbeitete, meinte, wenn Boomer tanzte, sähe er aus wie ein Affe auf Rollschuhen, der mitten im Hurrikan mit Rasierklingen jongliert.
«Er hat wirklich nicht alle Tassen im Schrank», berichtete Ellen Cherry ihrer Mutter. «Aber ich muss zugeben, es macht tierisch Spaß mit ihm.»
Was Ellen Cherry, abgesehen von seiner «affenartigen Körperbehaarung», noch an Boomer störte, war, dass er keinen Schimmer von Kunst hatte, sich keinen Deut aus Kunst machte und obendrein auch noch versuchte, sie von ihrem Interesse daran abzubringen. (Obwohl Boomer jedes Mal, wenn die jungen Banausen von Colonial Pines sarkastische Bemerkungen über Ellen Cherrys «bekloppte» Gemälde abließen, drohte, ihnen mit seinen stahlverstärkten Arbeitsschuhen die Fresse zu polieren – ein Versprechen, von dem sie wussten, dass er es garantiert gehalten hätte.) Von der Highschool war er abgegangen.
Als man ihn eine Woche vom Unterricht ausschloss, weil er im Biologieraum Bier getrunken und bei verschiedenen Gelegenheiten Randale gemacht hatte, ging er eines Tages nach Hause und setzte nie wieder einen Fuß in die Schule. Der Trainer hätte fast geheult und flehte ihn auf Knien an, sich die Sache noch einmal zu überlegen. Denn Boomer hatte zu diesem Zeitpunkt bereits den Landesrekord im Kugelstoßen und Diskuswerfen gebrochen. Die Hälfte aller Universitäten an der Atlantikküste hatte ihm Stipendien angeboten. Man witterte olympisches Material.
«Stell dir vor, ich würd die besten Jahre meines Lebens auf irgendwelchen Leichtathletikveranstaltungen verbringen», sagte er zu Ellen Cherry. «Nach all dem Training, dem Schweiß und der Anstrengung, wo du nie von was andrem träumst als Kugelstoßen, und so muss es sein, wenn du zur Weltklasse gehören willst – wozu wär ich dann am Ende fähig, außer Werbung für Cornflakes zu machen?»
«Und wozu bist du jetzt fähig, Liebling? Werbung für Pabst Blue Ribbon zu machen?»
Im Dosenbiertrinken gehörte Boomer tatsächlich zur Weltspitze. Er soff wie ein Stier, nicht nur Bier, sondern mindestens genauso viel RC-Cola. Schaufelte Unmengen von Pizza, Wassermelonen und Schoko-Doughnuts in sich rein. Lenkte seinen Schweißbrenner mit rauem Zartgefühl und steckte seinen gesamten Verdienst in einen aufgemotzten Camaro, der nie richtig zu laufen schien. Tanzte und zettelte Schlägereien an und las Spionageromane. Einmal prahlte er damit, jeden Thriller der Welt gelesen zu haben, manche sogar zweimal. Er rauchte billige Zigarren. Machte sich Sorgen um sein schwindendes Haar. Nahm heimlich Tango-Unterricht. Und war verknallt in Ellen Cherry Charles.
Dass diese Liebe von Verlin und Buddy gebilligt und sogar begünstigt wurde, schien auf den ersten Blick unlogisch, einmal wegen Boomers Ruf als Raufbold, zum anderen in Anbetracht der Tatsache, dass Verlin umso strenger mit seiner Tochter umging, je älter sie wurde. Auf Buddys Rat hin hatte Verlin eine konservative Kleiderordnung für Ellen Cherry durchgesetzt. Er zensierte ihre Lektüre, überwachte ihren Fernsehkonsum, setzte Sperrstunden fest und verbot ihr, den leisesten Hauch von Make-up oder Parfüm zu benutzen. Bestimmt hätten Buddy und Verlin sich nicht träumen lassen, dass ihre Ellen Cherry jeden Freitagabend im Robert E. Lee Drive-in saß, das Höschen bis zu den Schienbeinen runtergeschoben, und sich zuckend auf einem von Boomers dicken Kugelstoßfingern wand. Oder?
Die Petways waren eine feine, alteingesessene Familie in Virginia. Es gab Richter und Gesetzgeber in ihrem Clan. Verlin und Buddy hatten mit Boomers Daddy so manche Kröte gestochen. Einen Jungen wie Boomer konnten sie verstehen. Picasso nicht.
«Auf der Kunsthochschule verschwendest du bloß deine Zeit und mein Geld», protestierte Verlin. «Das Ganze is völliger Schwachsinn. Bud sagt, Kunst is die Art des Teufels, Gottes Schöpfung zu bekritteln, und damit könnte er gar nich so falsch liegen. Warum gehst du nich auf ein anständiges College für christliche Frauen und wirst Lehrerin? Oder lernst Sekretärin? Irgendwas, auf das du zurückgreifen kannst. Das dir Sicherheit gibt. Heiratest jemand, der für dich sorgen kann –»
«Wie den guten Boomer zum Beispiel?»
«Eine Frau braucht nun mal ’nen starken, tüchtigen Mann. Willst du etwa mit einem von diesen Waschlappen enden, die in rattenverseuchten Dachstübchen hocken und rumspintisieren?»
Ellen Cherry lächelte. Sie dachte an die Nagetiere, die sich zwischen den Wagen mit beschlagenen Fensterscheiben im Robert E. Lee um Popcornreste balgten.
Es war nur Patsys militanter Unterstützung zu verdanken, dass Ellen Cherry die Erlaubnis bekam, sich an der Virginia Commonwealth University von Richmond einzuschreiben, die über einen der besten Fachbereiche für Kunst im ganzen Land verfügte. Sie war glücklich und erfolgreich auf der VCU. Sie war aufgeregt. Sie lernte, eine Leinwand richtig zu spannen und zu präparieren und einen Lithographiestein einzufärben. Sie entdeckte den postmalerischen Expressionismus und Georgia O’Keeffe. O’Keeffe wurde auf der Stelle zu ihrem Ideal, zu ihrer Heldin und zum Thema eines Aufsatzes, für den Ellen Cherry ihre erste Auszeichnung auf dem College bekam. Mit frischem Eifer besann sie sich auf das Augenspiel aus ihrer Kindheit und entdeckte darin eine Art Mistgabel, mit der sich alles, was Melville einmal als die «Pappmachémaske» der sichtbaren Realität bezeichnet hatte, aufspießen ließ. Sie fing an zu verstehen, was de Kooning gemeint hatte, als er sagte: «Alles, was ich sehe, wird zu meiner Form und meiner Bedingung.»
An den Wochenenden fuhr sie per Greyhound nach Colonial Pines – Daddys Befehl –, wo sie sich weiterhin mit Boomer Petway traf. Bier zu trinken und mit Boomer durch die Motelbetten zu hüpfen erwies sich als entspannender Ausgleich für die Anstrengungen im Klassenzimmer und im Atelier. So lebte sie nun wie die Katze im Brei. Bis etwas passierte, das alle Träume platzen ließ und ihr eine emotionale Verkrüppelung beibrachte, die weitaus schlimmer war als Boomers schwankender Gang.
In der Gemeinde der Third Baptist Church von Colonial Pines hatte sich das Gerücht verbreitet, dass die Kunststudenten an der VCU gezwungen würden, nackte Körper zu zeichnen. Es wurde gemunkelt, dass sowohl Frauen als auch Männer splitternackt vor gemischtgeschlechtlichen Klassen auf und ab spazierten. Im Großen und Ganzen entsprach das der Wahrheit, nur wurde niemand «gezwungen», am Aktzeichnen teilzunehmen, und die männlichen Modelle posierten ausnahmslos mit Sackhaltern. Jedenfalls beschlossen Reverend Buddy Winkler und Verlin Charles, als die Antwort der Schule auf ihre schriftliche Anfrage sie nicht befriedigte (und Ellen Cherry aus Gründen der Selbstverteidigung die Existenz solcher Klassen rundheraus abgestritten hatte), sich mit eigenen Augen zu überzeugen.
Buds und Verlins Erstürmung des Klassenzimmers verlief so melodramatisch, dass viele der anwesenden Studenten in brüllendes Gelächter ausbrachen und «Rambo! Rambo!» johlten. Doch Ellen Cherry war das Lachen vergangen. Ihre Proteste nahmen einen hysterischen Tonfall an, als Verlin sie aus dem Raum zerrte. (Buddy Winkler blieb zurück, um den Professor zurechtzustauchen und dem ziemlich verlegenen Modell Gottes Wort zu verkünden.) Schreie, so durchdringend wie Fleischerhaken und so düster wie Sumpfwasser, entrangen sich ihrer Brust, als Verlin anfing, ihre Sachen zu packen.
Kurz darauf kam Buddy ins Zimmer. Wie von Sinnen griffen die beiden Männer nach trockenen Waschlappen und rieben ihr Lippenstift, Rouge und Lidschatten aus dem Gesicht. Die Prozedur war dermaßen grob, dass sie ihr die Wangen aufschürften. Ihre Lippen sprangen auf wie die Haut einer gebrühten Tomate. Ihre Lider schwollen an, bis sie das Gefühl hatte, ihr Zimmer nur noch durch einen Ascheschleier zu sehen. Es war, als sei sie in einen Feuersturm geraten, der ihren reinsten und sanftesten Teil zerstörte.
Und währenddessen stießen die Männer immer wieder ein einziges Wort aus.
«Jezabel», sangen sie.
«Jezabel!»
Jezabel saß mit Ellen Cherry und Boomer in dem großen Truthahn. Wo immer Ellen Cherry hinging, Jezabel kam mit. Wenn Georgia O’Keeffe ihr vorübergehendes Vorbild gewesen war, so entwickelte Jezabel sich zu ihrer ständigen Begleiterin, ihrer Vertrauten, zu einer klaffenden Wunde, zu einem Keramikskelett, das in ihrem Fleisch klapperte. Vom Tag ihrer Erniedrigung an der VCU bis zum gegenwärtigen Augenblick schlug ein Tamburin in ihrem Blut. Es hätte Salomes Tamburin sein können, doch für Ellen Cherry gehörte es zu Jezabel. Gewöhnlich war sein Klang leise, sein Rhythmus weit entfernt: Monate vergingen, in denen sie und ihr unsichtbarer Zwilling sich höchstens einmal im Flur begegneten. Doch kaum begann der Truthahn einen farbenprächtigen Canyon im südöstlichen Idaho zu durchqueren, eine Landschaft, in der der Sandstein lavendelfarbenen Lidschatten und granatapfelroten Lippenbalsam aufgelegt zu haben schien, da verbreitete sich Jezabels verborgener Weihrauch im Inneren des Truthahns wie der Duft einer Füllung, und …
Aber halt. Jezabel hat so lange gewartet, sie kann auch noch ein bisschen länger ausharren. Zuerst sollten wir uns dem Truthahn selbst zuwenden; seinem Ursprung, seinem Ziel, seiner Raison d’être.
Nach dem erzwungenen Rückzug aus dem College verbrachte Ellen Cherry ganze Tage in ihrem Zimmer und weinte. Währenddessen fochten Patsy und Verlin unten im Wohnzimmer erbitterte Kämpfe aus. Verlin nannte Patsy eine Dirne, eine Mutter, die ihrer Tochter nichts als Lüsternheit beibrachte. Patsy nannte Verlin einen Heuchler, der Lüsternheit genoss, aber nicht Manns genug war, es zuzugeben.
«Gott hat meinen Körper geschaffen», sagte Patsy. «Ich schäm mich nich, wenn ich nackig bin.»
«Na prima», sagte Verlin. «Warum ziehst du dich dann nich aus, und ich lad meine Freunde ein, rüberzukommen und Bilder von dir zu malen.»
«Deine Freunde könnten nich mal ’ne Scheißhauswand anstreichen!»
Patsy führte an, dass sie hätte Tänzerin werden können, wenn er nicht gewesen wäre. Verlin erwiderte, sie könne auf die Knie fallen und ihm danken, dass er sie vor dieser Schande bewahrt habe.
Irgendwann hörte Ellen Cherry Verlin sagen: «Sie hat sich jetzt verdammt noch mal ’ne ganze Woche lang da oben eingeschlossen. Wann kommt sie eigentlich wieder runter?»
«Oh, wahrscheinlich, wenn ihr Gesicht verheilt ist», gab Patsy zurück.
«So schlimm is es ja nun auch wieder nich mit ihrem Gesicht. Wir haben sie gereinigt, zum Teufel, nicht gehäutet!»
«Auf alle Fälle kann sie runterkommen, wann immer ihr danach is. Sie is frei, weiß und achtzehn.»
Stimmt, dachte Ellen Cherry und saß plötzlich kerzengerade in ihrer tränenverschmierten Bettwäsche, aufgeschreckt von der Erkenntnis dessen, was doch auf der Hand lag. «Sie hat recht!»
Als sie sicher war, dass Johnny Carson die Show für diesen Abend beendet hatte, schlich sie hinunter – Verlin lag im Schlafzimmer und schnarchte wie ein Alligator, Patsy wälzte sich auf dem Sofa hin und her – und machte sich ein Omelett aus vier Eiern, das sie mit dem einzigen Alkohol im Haus, dem für Patsys englischen Kuchen bestimmten Brandy, hinunterspülte.
Am Morgen tauchte sie in der Schweißbrennerei auf, wo sie Boomer irgendwie überredete, ihr fünfhundert Dollar zu leihen. Vielleicht drohte sie ihm, seinen Saufkumpanen zu erzählen, dass er heimlich Tango-Unterricht nahm. Vielleicht bohrte sie ihm auch die Zunge ins Ohr.
Um Mitternacht schlich sie wieder hinunter. Patsy war ins Schlafzimmer umgezogen, Verlin schnarchte auf dem Sofa. Eine Weile stand sie vor ihrem Vater. Sein rosiges Gesicht, das auf einem Teich süßen Vergessens trieb, erinnerte sie an eine Wasserlilie von Monet. Sie kam zu der Erkenntnis, dass er ein zwar ehrenhafter, aber von Dogmen verknöcherter Mann war. Patsy und Onkel Buddy stritten sich um seine unschlüssige Seele. Buddy lag in Führung. Trotzdem hätte Ellen Cherry Boomers fünfhundert auf Patsy gesetzt. Als sie sich herabbeugte, um ihn auf die Wange zu küssen, stieg ihr ein muffiger Geruch in die Nase, und sie überlegte es sich anders.
Ellen Cherry stieg in den nächsten Greyhound, der in Colonial Pines hielt. Das war um vier Uhr morgens. Er brachte sie nach Cincinnati. Von dort trampte sie weiter, Richtung New Mexico, um irgendetwas Albernes und Romantisches zu tun, ihre Staffelei neben Georgia O’Keeffes Grab aufzustellen oder so was. Sie hatte jedoch nicht mit den Irrwegen des Lebens auf der Straße gerechnet und landete schließlich in Seattle, wo sie sich genötigt sah, ihr Augenspiel so zu modifizieren, dass es den sprühenden Regenschleiern gerecht wurde.
Obwohl sie nachts als Kellnerin arbeitete, schaffte sie binnen drei Jahren ihren Abschluss auf dem Cornish College of the Arts. Nur in einer Hinsicht beeinflusste das Examen ihr Schicksal: Jetzt konnte sie ihre Mitgliedschaft bei den «Daughters of the Daily Special» beantragen, einer örtlichen Vereinigung von Kellnerinnen mit Hochschulabschluss. Mit relativ hohen wöchentlichen Abgaben und zusätzlichen Geldern, die sie sich verdienten, indem sie Autowäschen im Bikini anboten oder Kuchen verkauften, den sie größtenteils in den Restaurants geklaut hatten, wo sie arbeiteten, brachten die Daughters einen Fonds zustande, der verdienten Mitgliedern Stipendien bewilligte, sodass diese die Möglichkeit erhielten, das Tablett an den Nagel zu hängen und sich eine Weile ihrer eigentlichen Berufung zu widmen. Als Ellen Cherry ihr Stipendium bekam, malte sie sechs Monate hintereinander. Die fertigen Arbeiten wurden in einem Restaurant ausgestellt. «Ich bin entkommen, meine Bilder nicht», sagte sie zu den anderen Mädchen. Vielleicht war es die glücklichste Zeit ihres Lebens.
Mehrere Jahre lang wurde Seattles Kunstszene, genau wie die in New York, von der Schule der «großen hässlichen Köpfe» beherrscht. Händler und Sammler, die zu unsicher waren, um sich gegen die Mode aufzulehnen, sahen sich gezwungen, ihre Wände mit kantschädeligen Porträts von aggressiven Opfern der Großstadtangst zu schmücken: jenen zornigen und gequälten Sauertöpfen, für die das nächste Plutoniumklistier offenbar schon bereitlag. Im Hintergrund sah man unweigerlich brennende Gebäude, Totenköpfe und gekreuzte Knochen oder tollwütige Hunde mit erigierten Schwänzen. Zum Glück dreht sich die Welt der Kunst meistens recht schnell um ihre geldgeschmierte Achse, und – BUMS! – waren von einem Tag auf den anderen Kunstkenner wieder an Integrität, Vision und Technik interessiert. Vielleicht aus einer gewissen Nostalgie heraus, aufgrund der unbewussten Sehnsucht nach einer Natur, die nicht durch Umweltverschmutzung und Nutzbarmachung zum Untergang verdammt war, nahm man zum ersten Mal seit der großen Depression die Landschaftsmalerei wieder ernst. Und begann Ellen Cherry die Tür einzurennen.
Sicher, sie malte Schachtelhalme, die aus dem Bug eines Fährschiffes sprossen, sicher, ihre Bäume waren Kringel im Raum, ihre Berge himmelblau und ihre Himmel so braun wie Gestein: Dennoch handelte es sich unverkennbar um Landschaften, und sie fanden ein Publikum. Ellen Cherry hatte keine Schickeria-Galerie und nicht die elegantesten Mäzene, aber sie wurde lanciert, wie es so schön heißt, und reduzierte ihre Arbeit im War on Tuna Café auf zwei Schichten pro Woche.
So stellte sich ihre Situation mehr oder weniger dar, als Boomers Truthahn in Seattle auftauchte.
Als Boomers Vater auf den Ruhestand zuging, hatte er sich ein Airstream-Wohnmobil gekauft, in der Hoffnung, er und seine Frau könnten ihre goldenen Jahre kreuz und quer durch die Vereinigten Staaten tourend verbringen. «Mit diesem Prachtstück zockeln wir vom Atlantik bis zum Pazifik», verkündete er. «Ohne eine einzige von unseren Lieblingssendungen im Fernsehen zu verpassen», setzte Mrs. Petway hinzu.
Dann aber, mitten in seiner Pensionierungsfeier, auf dem Höhepunkt der Stimmung, war Mr. Petway plötzlich tot zusammengebrochen. Seine Witwe verkaufte das Haus und zog zu ihrer Schwester, nicht ohne zuvor Boomer das Wohnmobil zu überschreiben.
«Was zum Teufel soll ich mit einem acht Tonnen schweren silbernen Ei anfangen?», fragte sich Boomer.
Die Metapher traf ins Schwarze. Abgesehen davon, dass es ein Cockpit mit Lenkrad hatte, sah das Airstream-Wohnmobil genauso aus wie der ovoide Ableger eines metallenen Lindwurms, wie das hartgekochte Eichen, das sich die Freiheitsstatue zum Frühstück pellen würde. Silbern glänzend wie Sterngefunkel, knollig wie eine Tümmlernase, glich der Airstream einer in die Länge gezogenen Erbse, einer Bohne, einer quecksilbergefüllten Wurstpelle, einem Zeppelin, einer Zitrone, dem Football der Titanen.
Jeden Morgen, bevor er zur Arbeit ging, stand Boomer mit den Händen in den Taschen in seiner Einfahrt, musterte den Airstream und schüttelte den Kopf. An manchen Tagen, wenn er nicht verkatert war oder spät dran oder gar beides, umkreiste er ihn und zeichnete mit dem lahmen Fuß seine Umrisse im Staub nach. Eines Morgens kam ihm eine wahnwitzige Idee. Von da an musste er jedes Mal, wenn sein Blick auf das Wohnmobil fiel, an diese Vorstellung denken.
So ging es ungefähr ein Jahr, bis er eines Freitagmorgens in einer Stimmung aufwachte, die man am treffendsten als opernhaft bezeichnen könnte. Überdreht, melodramatisch, vor Energie sprühend, in einer theatralischen, fatalistischen Ouvertürenwolke schwebend, vertrieb er die Sopranstimme, mit der er die Nacht verbracht hatte, griff sich ein Sechserpack und lenkte das Wohnmobil zur Schweißbrennerei, wo er, ohne sich um irgendwelche Arbeitsaufträge oder den Spott seiner Kumpel zu kümmern, einen Monat damit verbrachte, ein Paar überdimensionale Truthahnschlegel und zwei plumpe Flügel aus Metall anzufertigen, die er dann an den entsprechenden Stellen ans Wohnmobil schweißte.
«Da», sagte Boomer, «sieht er nicht haargenau aus wie ’n echter Truthahn?»
«Er ist süß», sagten die Mädchen. «Wie ist dir das bloß eingefallen?» Und kicherten nervös.
«Da hast du ein verflucht teures Ding für nichts und wieder nichts demoliert», beschuldigten ihn seine Kumpel. Und schämten sich für ihn.
Seelenruhig packte er seine gesamte Garderobe (sechs Jeans, fünf Hawaiihemden), seine Schweißbrennerausrüstung und seine Sammlung von Spionageromanen in das vordere Ablageschränkchen. Dann nahm er einen ordentlichen Vorrat Pabst an Bord. Und schließlich richtete er die schimmernde Brust des Bratens nach Nordwesten.
«Wenn Ellen Cherry da nicht mitmacht, fahr ich einfach runter nach Mexiko und mach mich mit Tequila zu, bis ich ein lebendiges Fossil bin», sagte er.
Frauen hatten mehr für Sex übrig als Männer, davon war Ellen Cherry überzeugt. Zugegeben, Männer redeten mehr über Sex. Männer machten immer ein großes Getue darum mit ihren Witzen, ihren Hustler-Magazinen, ihrer aggressiven Anmache und allzu durchsichtigen Aufschneiderei – doch Ellen Cherry zufolge war das meiste davon für die Ohren anderer Männer bestimmt. Sie hielten es für männlich, so zu tun, als seien sie wahre Dynamos im Bett. So diente es größtenteils der Stabilisierung ihrer ungefestigten Männlichkeit, wenn sie sich in eine primitive Zurschaustellung ihrer Sexualität flüchteten, obwohl gerade ihr relativ geringes Interesse an echtem Körperkontakt häufig den Ursprung ihrer Unsicherheit bildete. Warum bin ich nicht geiler? Warum ist mein Schwanz nicht größer? Warum bin ich nach einem Orgasmus erledigt, während sie ein Dutzend hat und immer noch (mit einem neuen Mann) weitermachen könnte? Woher weiß ich, dass das wirklich mein Kind ist? Es hat rotes Haar! Ellen Cherry musste lachen.
Typisch, dass ihr eigener Appetit auf Sex unstillbar und unergründlich war. Und sich obendrein bedeckt hielt. In einer patriarchalischen Gesellschaft musste die unerschöpfliche Lust einer gesunden Frau auf Sex gut getarnt werden. Ohne sich der Ironie ihres Tuns bewusst zu werden, machten die Männer ein Mordsgetue um ihre schlaffe Begierde, während die intensivere Leidenschaft der Frau gewöhnlich versteckt wurde. Diese Überzeugung ließ sich Ellen Cherry von keinem ausreden.
Das Einzige, was sie mehr interessierte als Sex – in den fünf Jahren in Seattle hatte sie mindestens acht Knäblein den nächtlichen Tau ausgesaugt, aber keiner war, wie sie zu ihrer Enttäuschung feststellen musste, auch nur halb so gut wie Boomer –, war die Liebe. Und die Kunst. So kam es, dass sich Sex, Liebe und Kunst vermischten, als Boomer den umgemodelten Airstream auf dem Parkplatz vor ihrem Mietshaus abstellte.
Er hupte so laut, dass sie aus dem Fenster der kleinen Küche spähte. Die berüchtigten Regentropfen von Seattle schlugen Blasen auf der Feuerleiter, und der Himmel sah aus wie verschimmelter Bananenbrei. Aber da war er! Glänzend im Einheitsgrau. Zehn Meter lang, achteinhalb Tonnen schwer. Mit blinkenden Warnleuchten und einander jagenden Scheibenwischern. Und daneben Boomer Petway, der einen wilden, komischen Tanz aufführte und das Pfützenwasser fast bis zu den Extremitäten des Truthahns aufstieben ließ.
«Ich hab ihn für dich gemacht!», schrie Boomer. «Nur für dich, mein süßes Honigpfläumchen!»
«Juhuu!»
Nachdem sie sich mit dem erstbesten Utensil – zufällig ein tofuverkrustetes chinesisches Essstäbchen – durch die Locken gefahren war, rannte sie die Treppe hinunter. Ungeachtet der niederprasselnden Regendusche, strahlend vor Überraschung und Freude, spazierte sie Hand in Hand mit seinem Schöpfer um das exotische Truthahnmobil herum. Immer wieder machten sie die Runde, in halb amüsierter, halb ehrfurchtsvoller Trance, bis sie praktisch einen Pfad in den feuchten Asphalt getrampelt hatten. Schließlich nahm er sie in die Arme und trug sie ins Innere des Vogels. Ihr Höschen flog in die Ecke, noch bevor sie auf dem Bett landete.
Er hat mich ausgetrickst, dachte Ellen Cherry jetzt. Mir Kunst und Sex als Liebe verkauft.
Dummerweise traute sie ihren eigenen Gefühlen für Boomer auch nicht so recht. Nach kaum einwöchiger Ehe hing die Liebe schon durch wie ein ausgeleierter Keilriemen. Und auch die Lust, fürchtete sie, könnte mit der Zeit abhandenkommen. Könnte eines Morgens auf ihren salzigen roten Schwingen durchs Oberlicht davonschwirren. Doch was immer passierte, die Kunst würde ihr darüber hinweghelfen. Ihr traute sie genug, um sie mit nach New York zu nehmen. Sie würde ihr großen Spaß bringen. Ihr zum großen Durchbruch verhelfen. Ihr Manhattan schenken. Die Bronx und Staten Island gleich mit. Ihr ihr täglich Brot geben. Und Boomer mit seiner Schweißerei würde vorläufig für den Schinken darauf sorgen, und für Terpentin.
Boomer hatte sie mal bei einem Anruf aus Virginia gefragt: «Warum bedeutet dir dieses verrückte Zeug, dieser handgemalte Wahnsinn, eigentlich so dermaßen viel? Er taugt doch nur dazu, völlig normale Wände zu verschandeln.»
Es war eine schlechte Verbindung, aber er hätte schwören können, dass er sie antworten hörte: «Im Spukschloss des Lebens ist die Kunst die einzige Treppe, die nicht knarrt.»
Mr. und Mrs. Petway, Trickser und Ausgetrickste, zockelten in ihrem Truthahn durch eine Schlaufe des Bibelgürtels, jener gottesfürchtigen Region im Süden der Vereinigten Staaten. Überall sprangen ihnen die Slogans des Todeskults in die Augen. «Jesus kommt», verkündeten die Reklametafeln. «Bereite dich auf die Begegnung mit deinem Schöpfer vor.» – «Bereut, denn das Ende ist nah.» Can o’ Beans hatte das Gefühl, wenn der Weltuntergang nicht bald von selber käme, würden diese Leute eine Kollekte veranstalten und ihn in Auftrag geben.
«Die Zeit verrinnt.» – «Hast du dir deinen Platz im Neuen Jerusalem gesichert?» Echos der Sprüche von Onkel Buddy und seiner Sippschaft. Sie jagten Ellen Cherry heiße Schauer über den Rücken. Zumal es den bunt gefärbten Klippen und Kratern um die Reklametafeln gelungen war, ihre Doppelgängerin Jezabel aus dem Rougetiegel zu befreien.
«Bringt ihm das blutige Haupt der Hure», hieß es auf einem Schild, und das machte sie dann wirklich fickrig, denn sie war fest davon überzeugt, dass mit «Hure» niemand anderes gemeint sein konnte als Jezabel.
Mit zunehmendem Alter hatten sich ihre Übelkeitsanfälle beim Autofahren gelegt; trotzdem kniff sie jetzt die Augen zusammen, um sich mit dem guten alten Augenspiel abzulenken. Sofort wurden die groben, kantigen Konturen der Sandstein-Landschaft, die ineinander verschachtelten Konfigurationen von Plateaus, tief eingeschnittenen Wasserrinnen und natürlichen Kaminen weicher, unschärfer; der Hintergrund verschwamm, und die Landschaft trat hervor, bis sie nur noch Millimeter von Ellen Cherrys Nase entfernt war und wie ein vielfältig verwobenes Muster aus sich überlagernden Farbschichten wirkte. Doch da die körnige Oberfläche auch sehr dekorativ war – sie bestand hauptsächlich aus Lachs-, Trauben- und Elfenbeintönen –, wurde ihre Ähnlichkeit mit Schminke nur noch deutlicher betont als aus der Hard-Edge-Perspektive und Jezabels Gegenwart eher hervorgehoben als verdrängt. Daraufhin brach die Künstlerin das Spiel ab.
Kurz nach der Ankunft in Seattle, als der Vorfall an der VCU in ihrem Kopf noch schmerzlich lebendig gewesen war, hatte sie sich eine Bibel besorgt und nach den schmutzigen Details von Jezabels Ausschweifungen gesucht. Aus der Sonntagsschule hatte sie das vage Bild einer zutiefst unmoralischen, wie ein Rock-’n’-Roll-Vamp aufgedonnerten Schlampe behalten, konnte sich aber an kein einziges biographisches Faktum erinnern. Man stelle sich ihre Überraschung vor, als das alttestamentarische Buch der Könige sie darüber belehrte, dass Jezabel eine königliche – und treue – Ehefrau war.
Eigentlich ist die biblische Geschichte von Jezabel nur ein paar Sätze lang. Offenbar wurden sie und ihr Mann, König Ahab, von einem jungen Rechtsradikalen namens Jehu, der selbst scharf auf den Thron war, der Götzenverehrung beschuldigt. Zuvor hatte Ahab mit zweifelhaften Methoden einem Nachbarn ein Stück Land abgeluchst, und von Jezabel hieß es, sie habe ein Gerücht in die Welt gesetzt, das den Tod dieses Nachbarn zur Folge gehabt hatte. Der Hebräer Ahab war König von Nordisrael, Jezabel die Tochter eines phönizischen Königspaares. Als Ausländerin betete sie den Gott der Juden nicht gerade aus tiefstem Herzen an. Vielleicht gab das Anlass für den Vorwurf der Götzenverehrung, doch abgesehen davon, dass sie ihrem Mann bei seinem dubiosen Grundstücksdeal loyal zur Seite stand, legte sie offenbar ein ebenso korrektes Benehmen an den Tag wie, sagen wir, Königin Elisabeth.
Dann folgte eine seltsame, fatale Episode. Der ehrgeizige Jehu, der heimlich Jezabels Sohn ermordet hatte (Ahab war mittlerweile auf dem Schlachtfeld gefallen), erschien vor dem Tor von Jezabels Palast. Als Jezabel von seinem unerwarteten Besuch erfuhr, so die Bibel, «schminkte sie ihr Angesicht und schmückte ihr Haupt und sah zum Fenster hinaus». Einer anderen Überlieferung zufolge schminkte sie ihre «Augen» und «richtete ihr Haar». Jedenfalls stand sie königlich geschmückt am Fenster und sah auf den hebräischen Rebellen hinab, als dieser «zwei oder drei Kämmerer» aufforderte, «sie herabzustürzen». «Die Wand und die Rosse wurden mit ihrem Blut besprengt», so das grausame Alte Testament weiter. Jehu ließ sie im Hof liegen, wo die Hunde sie fraßen, während er hineinging und sich über den Wein hermachte. Nach ein paar Krügen aber müssen ihm doch Gewissensbisse gekommen sein, denn er gab seinen Vasallen den Befehl, ihre Leiche zu bestatten. Aber da hatten die Köter schon nichts mehr von ihr übrig gelassen «denn den Schädel und die Füße und die flachen Hände».
Tausende von E-Books und Hörbücher
Ihre Zahl wächst ständig und Sie haben eine Fixpreisgarantie.
Sie haben über uns geschrieben: