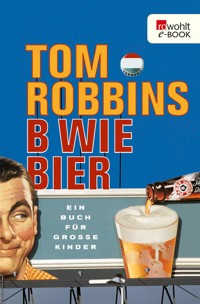9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: ROWOHLT E-Book
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
«Ein altes ukrainisches Sprichwort warnt: Eine Geschichte, die mit einer Roten Bete anfängt, endet mit dem Teufel.» In «Pan Aroma» lauern noch ganz andere Gefahren auf den Leser: Wohlgerüche schlagen um in infernalischen Gestank, Dematerialisation birgt das Risiko einer Reise ohne Wiederkehr, und die Flüchtigkeit des Parfüms als Quelle ewigen Lebens wird zum Ausgangspunkt einer abenteuerlichen Jagd nach einem göttlichen Parfümfläschchen.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 707
Veröffentlichungsjahr: 2013
Ähnliche
Tom Robbins
Pan Aroma
Jitterbug Perfume
Über dieses Buch
«Ein altes ukrainisches Sprichwort warnt: Eine Geschichte, die mit einer Roten Bete anfängt, endet mit dem Teufel.»
In «Pan Aroma» lauern noch ganz andere Gefahren auf den Leser: Wohlgerüche schlagen um in infernalischen Gestank, Dematerialisation birgt das Risiko einer Reise ohne Wiederkehr, und die Flüchtigkeit des Parfüms als Quelle ewigen Lebens wird zum Ausgangspunkt einer abenteuerlichen Jagd nach einem göttlichen Parfümfläschchen.
Vita
Tom Robbins, geboren 1932 in Blowing Rock, Virginia, wuchs im Süden der USA auf, lehrte während des Koreakrieges als Soldat der Air Force Meteorologie, studierte danach Kunst, Musik und Religion. Er arbeitete als Reporter bei verschiedenen Zeitungen und schrieb 1971 seinen ersten Roman «Ein Platz für Hot Dogs». Tom Robbins avancierte zum Kultautor. Es folgten weitere erfolgreiche Bücher wie «Buntspecht», «PanAroma» und «Sissy – Schicksalsjahre einer Tramperin». Die Fans lieben ihn für seinen klugen und warmherzigen Humor, seine verrückten Figuren und seine sprachlichen Purzelbäume. In «Tibetischer Pfirsichstrudel» erzählt er von seinem eigenen Leben – das genauso bunt, wild und voller skurriler Begegnungen ist wie seine Romane. Tom Robbins lebt als freier Schriftsteller in dem kleinen Fischerdorf La Conner bei Seattle.
Impressum
Veröffentlicht im Rowohlt Verlag, Reinbek bei Hamburg, März 2013
Copyright © 1985 by Rowohlt Taschenbuch Verlag GmbH, Reinbek bei Hamburg
«Jitterbug Perfume» Copyright © 1984 by Tibetan Peach Pie Incorporated
Published by arrangement with Bantam Books, Inc., New York
Umschlaggestaltung any.way, Barbara Hanke/Cordula Schmidt
ISBN 978-3-644-49941-6
Schrift Droid Serif Copyright © 2007 by Google Corporation
Schrift Open Sans Copyright © by Steve Matteson, Ascender Corp
Dieses Werk ist urheberrechtlich geschützt, jede Verwertung bedarf der Genehmigung des Verlages.
Die Nutzung unserer Werke für Text- und Data-Mining im Sinne von § 44b UrhG behalten wir uns explizit vor.
Hinweise des Verlags
Abhängig vom eingesetzten Lesegerät kann es zu unterschiedlichen Darstellungen des vom Verlag freigegebenen Textes kommen.
Alle angegebenen Seitenzahlen beziehen sich auf die Printausgabe.
Im Text enthaltene externe Links begründen keine inhaltliche Verantwortung des Verlages, sondern sind allein von dem jeweiligen Dienstanbieter zu verantworten. Der Verlag hat die verlinkten externen Seiten zum Zeitpunkt der Buchveröffentlichung sorgfältig überprüft, mögliche Rechtsverstöße waren zum Zeitpunkt der Verlinkung nicht erkennbar. Auf spätere Veränderungen besteht keinerlei Einfluss. Eine Haftung des Verlags ist daher ausgeschlossen.
www.rowohlt.de
Inhaltsübersicht
Widmung
Der Autor dankt ...
Von Urzeiten an ...
Heute im Angebot
Seattle
New Orleans
Paris
I. Teil Das Haar und die Bohne
In der Zitadelle ...
Seattle
New Orleans
Paris
II. Teil Ein Blick unter Chomolungmas Kleid
Im Laufe des ...
Seattle
New Orleans
Paris
III. Teil Versprich ihr das Blaue vom Himmel, aber gib ihr K 23
Die höchste Funktion ...
Seattle
New Orleans
Paris
IV. Teil Rückenwind vom perfekten Taco
In der Zitadelle ...
Mehr noch, Alobar ...
Aus einem Zufall ...
Es heißt, der ...
Die Rechnung
FÜR DONNA UND DIE OHANA
Und für all jene, deren Briefe ich noch immer nicht beantwortet habe.
Der Autor dankt seiner Agentin und Freundin Phoebe Larmore; seinem beherzten Lektor Alan Rinzler; Laren Elizabeth Stover, die ihm in mit Lippenstift adressierten Briefumschlägen die Geheimnisse der Duftindustrie zukommen lief; und Jessica Maxwell, deren Vorfahr einst Besitzer einer Parfümerie in New Orleans war, die sie von ihm für eine wellige Muschelschale eintauschte.
Von Urzeiten an hat das charakteristische Problem des Menschen in dem zwingenden Bedürfnis bestanden, das menschliche Leben zu spiritualisieren, es auf eine besondere Ebene von Unsterblichkeit zu heben, jenseits der Zyklen von Leben und Tod, die allen anderen Organismen eigen sind.
Ernest Becker
Die Geschichte der Zivilisation ist die Geschichte der Emanzipation des Menschen von einer Gemeinschaft, deren Mitglieder grob, brutal und von kleinem Wuchs waren. Jeder Schritt auf dem beschwerlichen Weg hinauf zu einer differenzierten Lebensweise wurde begleitet von einer entsprechenden Vervollkommnung in der Kunst der Parfümerie.
Eric Maple
Wüten, wüten gegen das Sterben des Lichts.
Dylan Thomas
(Und) immer so gut riechen wie möglich.
Lynda Barry
Heute im Angebot
Die Rote Bete ist das intensivste aller Gemüse. Zugegeben, der Rettich ist aufregender, aber das Feuer des Rettichs ist ein kaltes Feuer, ist das Feuer der Unzufriedenheit, nicht das der Leidenschaft. Tomaten sind immerhin lebhaft frisch, aber Tomaten werden durchzogen von einem Hauch Frivolität. Rote Beten sind todernst.
Slawische Völker verdanken ihre physischen Charakteristika den Kartoffeln, ihre schwelende Unruhe den Rettichen, ihre Ernsthaftigkeit den Roten Beten.
Die Rote Bete ist das melancholische Gemüse, jenes, das am bereitwilligsten leidet. Soll mal jemand versuchen, aus einer Steckrübe Blut zu quetschen …
Die Rote Bete ist der Mörder, der an den Tatort zurückkehrt. Die Rote Bete ist das, was da anfängt, wo die Kirsche mit der Karotte aufhört. Die Rote Bete ist der Urahn des Herbstmondes, bärtig, begraben, alles, nur nicht leblos; sie ist das dunkelgrüne Segel des gestrandeten Mondbootes, genäht mit Venen aus Ur-Plasma; sie ist die Drachenschnur, die einst den Mond mit der Erde verband und die jetzt nichts weiter ist als ein schlammverschmierter Schnurrbart, der verzweifelt nach Rubinen bohrt.
Die Rote Bete war Rasputins Lieblingsgemüse. Man konnte es seinen Augen ansehen.
In Europa ist der Anbau einer großen Bete verbreitet, die Mangold genannt wird. Vielleicht ist es der Mangold, den wir in Rasputin erkennen. Auf jeden Fall finden wir Mangold in der Musik Wagners, wenngleich es ein anderer Komponist ist, dessen Name so anfängt: B-e----.
Freilich gibt es auch weiße Beten und Beten, die statt Blut Zuckerwasser absondern, aber es ist die Rote Bete, die uns hier beschäftigen wird; jene Art, die errötet und anschwillt wie eine Hämorrhoide, gegen die es keinerlei Mittel gibt. (Das heißt, es gibt doch eines: Beauftragen Sie einen Töpfer, Ihnen ein Keramik-Arschloch zu bauen – und wenn Sie gerade nicht drauf sitzen, können Sie es als Schüssel für Borschtsch benutzen.)
Ein altes ukrainisches Sprichwort warnt: «Eine Geschichte, die mit einer Roten Bete anfängt, endet mit dem Teufel.»
Dieses Risiko müssen wir eingehen.
Seattle
Priscilla wohnte in einem Studio-Apartment. «Studio» deshalb, weil Kunst angeblich etwas Reizvolles an sich hat und weil Hausbesitzer ein berechtigtes Interesse hegen, uns glauben zu machen, dass Künstler es vorziehen, in ihrem Arbeitsraum zu schlafen. Echte Künstler wohnen so gut wie nie in Studio-Apartments. Es gibt nicht genug Platz, und das Licht ist vollkommen daneben. Angestellte wohnen in Studio-Apartments. Büroangestellte, Verkäuferinnen, Anwaltsgehilfen, Volkshochschul-Studenten, ältere Witwen und ledige Kellnerinnen wie Priscilla.
Das Gebäude, in dem dieses spezifische Studio-Apartment sein trügerisches Dasein fristete, war während der großen Wirtschaftskrise gebaut worden. In Seattle gibt es viele solche Gebäude, die auf den dicht besiedelten Hängen zwischen Lake Washington und Elliott Bay ihre Ziegel vom Regen salben lassen. Architektonisch erinnerten die schlichte Fassade und die klaren Linien an das Kleid, das Eleanor Roosevelt auf dem Ball zur Amtseinführung ihres Mannes trug, aber die Innenwände kündeten nach wie vor originalgetreu vom Zetergeschrei des verdünnten Erbsenbreis, der in Hunderten von Suppenküchen aufgetischt wurde. Im Laufe der Zeit war das Gebäude so ausgiebig bewohnt worden, dass es eine Art Eigenleben für sich geltend machen konnte. Jede Toilettenschüssel gurgelte wie ein italienischer Tenor, der den Mund voller WC-Reiniger hat, und die Eisschränke gaben in der Nacht Geräusche von sich, die lebhaft an weidende Büffel erinnerten.
Die meisten dieser älteren Studio-Apartments beheimateten Gerüche, die ebenso eindeutig waren wie ihre Farben und ihre Geräusche – Gerüche, die ihren Ursprung fanden in dem von Generation zu Generation vererbten Braten von Lachs-Frikadellen und Kochen von Broccoli. Doch in diesem Punkt unterschied sich Priscillas Apartment von den anderen. Es roch nach Chemikalien – weniger giftig als vielmehr süß –, und es war dieser Geruch, der sie wie ein eingepferchter Köter zur Begrüßung ansprang, wenn sie müde zu mitternächtlicher Stunde ihre Wohnungstür aufsperrte.
Nachdem sie das Deckenlicht angemacht hatte, schlenzte sie als Erstes ihre flachen Kellnerinnenschuhe durch den Raum. Als Zweites stieß sie mit einem Zeh gegen ein Tischbein. Der Tisch, an den sich schon zahllose Witwen zum Canasta niedergesetzt hatten, erschauderte krampfartig, sodass Bechergläser mit Chemikalien zum Klirren und ins Schwanken kamen. Glücklicherweise wurden nur wenige Tropfen ihres Inhalts verschüttet.
Priscilla ließ sich auf die Couch fallen, die gleichzeitig auch ihr Bett war, und massierte sich die Füße, wobei sie dem angeschlagenen Zeh besondere Aufmerksamkeit widmete. «Verdammte Scheiße», sagte sie, «was bin ich bloß für ein Hornochse. Ich verdiene es nicht, in dieser Welt zu leben. Man sollte mich auf einen dieser Planeten schicken, auf denen es keine Schwerkraft gibt.» Früher am Abend, im Restaurant, hatte sie ein ganzes Tablett mit Cocktails fallen lassen.
Die Nylonstrümpfe verliehen ihren Füßen das Rosa von frisch geborenen Mäusen. Vor den Ballen schienen kleine Dampfwolken aufzusteigen. Mäusefürze. Priscilla rieb sich die Füße, bis sie sich einigermaßen angenehm anfühlten. Dann rieb sie sich die Augen. Mit einem schläfrigen Seufzer ließ sie sich, den Kopf voran, über die Couch rollen, wurde jedoch sofort wieder aufgeschreckt. Ein Schwall von Münzen, das gesamte Trinkgeld des Abends, hatte sich aus ihren Taschen über ihren Kopf und ihren Körper, über die Couch und den Fußboden ergossen. Sie schaute einem Zehner hinterher, der über den abgetretenen Teppich rollte, als wollte er zum Ausgang. «Das versteht man also unter galoppierender Inflation», dachte sie. «Komm sofort zurück, du Feigling!»
Sie seufzte ein zweites Mal, stand auf und sammelte das Geld zusammen. Die wenigen geknäulten Geldscheine stopfte sie in ihr Portemonnaie, die Münzen ließ sie in ein verstaubtes Goldfischglas klimpern, das auf der Frisierkommode stand. Das Glas war zum Überlaufen voll. «Morgen eröffne ich ein Bankkonto», schwor sie sich. Diesen Schwur leistete sie nicht zum ersten Mal.
Sie zog ihre Uniform aus – ein blaues Matrosenkleid mit weißen und roten Biesen – und warf sie in die Ecke. In Strumpfhose und BH stand sie im Badezimmer vor dem Waschbecken und wusch sich die Haare. Eigentlich war sie viel zu erschöpft, um sich die Haare zu waschen, aber sie stanken derart nach Bratfett und Zigarettenrauch, dass sie in Konkurrenz zu dem Eigengeruch der Wohnung traten, und das kam nicht in Frage. Der Verschluss für die Shampooflasche war weg. Sie konnte sich nicht einmal mehr erinnern, wann das Shampoo – oder die Zahnpasta – zuletzt einen Verschluss gesehen hatte. «Ich könnte schwören, dass ein Verschluss drauf war, als ich es gekauft hab», sagte sie.
An dem Stück Seife klebten ein paar kurze, gekräuselte Haare. Bei ihrem Anblick zuckte sie zusammen. Die Haare erinnerten sie an einen Zwischenfall bei der Arbeit. Sie und Ricki verbrachten ihre Pausen gewöhnlich zusammen. Sie schlossen sich gemeinsam in der Mitarbeiter-Toilette ein und rauchten einen Joint oder schnupften eine Linie Koks. Egal was, Hauptsache, das Gewicht der Tabletts wurde erträglicher. Ohne anstößige Bemerkungen von Ricki ging das nie über die Bühne. Manchmal legte sie dabei wie zufällig ihre Hand auf Priscillas Körper. Priscilla war nicht wirklich empört. Ricki war eine der wenigen Kolleginnen im Restaurant, die auch intellektuell Anspruchsvolleres als eine Speisekarte lesen konnten. Darüber hinaus war sie auf eine dumpfige, leicht schnurrbärtige Weise hübsch. Vielleicht fühlte sich Priscilla durch Rickis Annäherungen aber auch auf eine schräge Art angemacht. Sie wehrte sie gewöhnlich auf eine Weise ab, über die sie beide lachen konnten. An diesem Abend jedoch, als Ricki unter dem Vorwand, einen Maulwurfshügel glätten zu wollen, den sie angeblich in Priscillas Strumpfhose gesichtet hatte, ihre weitschweifigen und immer größere Gebiete umfassenden Liebkosungen auf die Rückseite ihrer Oberschenkel auszudehnen begann, hatte Priscilla sie angefaucht und sie hart auf den Arm geschlagen. Schon bei Beendigung ihrer Schicht tat ihr das leid. «Ich bin einfach müde», sagte sie zu Ricki. «Wirklich total beschissen ausgelaugt.» Ricki meinte, es sei schon gut, sagte das aber in einem Tonfall, der auf einen ernsten Treffer am Gebäude ihrer Freundschaft schließen ließ. Und genau darum kreisten Priscillas Gedanken, während sie die paar Schamhaare von der Seife zupfte.
Die indirekte Funktion eines Badezimmerspiegels besteht darin, murrende Geräusche im geistigen Sumpf zu messen. Priscilla betrachtete ihren «Seismographen», und was sie dort sah, gefiel ihr gar nicht. Sie war bleich wie ein Q-Tip und ebenso bereit, sich aufzulösen. Sie ließ die Seife ins Waschbecken fallen und zwang ihrem Spiegelbild ein Lächeln auf. Mit einem schaumigen Finger drückte sie auf die dreieckige Spitze des knusprigen kleinen Mais-Chips, der ihre Nase war. Eins nach dem anderen blinzelte sie mit den Augen. Ihre Augen waren gleichermaßen riesig, gleichermaßen violett, aber das linke Auge blinzelte leichtgängig, während es beim rechten einiger Anstrengung und des Zusammenpressens von Fleisch bedurfte. Sie zog an ihrem nassen, herbstfarbenen Haar, als wollte sie in der Straßenbahn das Signal zum Anhalten geben. «Du bist immer noch hübsch wie ein Baby», sagte sie zu sich selbst. «Ich habe zwar noch nie ein hübsches Baby gesehen, aber wie könnte ich für mich in Anspruch nehmen, der Weisheit von Generationen zu widersprechen?» Sie spitzte ihren Kaugummi-Mund, bis er durch seine übertriebene Sinnlichkeit ihre Aufmerksamkeit ganz auf sich lenkte, weg von den blaublütigen Halbmonden unterhalb ihrer Augen. «Meine Koffer sind vielleicht schon gepackt, aber ich habe die Stadt noch nicht verlassen. Kein Wunder, dass Ricki mich unwiderstehlich findet. Sie ist auch nur ein Mensch.»
Priscilla lehnte ihre Stirn gegen den schaumigen Rand des Waschbeckens und fing ganz plötzlich an zu weinen. Sie weinte so lange, bis nur noch die Wärme ihrer Tränenflüssigkeit, die bloße Geschwindigkeit des Tränenflusses da waren und es Priscilla endgültig unmöglich wurde, den ohnehin schwer verständlichen Anlass ihrer Traurigkeit nachzuvollziehen. Und als eine Erinnerung nach der anderen ihre scharfen Umrisse verlor und sich sogar Müdigkeit und Einsamkeit als wasserlöslich erwiesen, schloss sie die Schleusen ihrer Tränenkanäle mit fast hörbarer Entschiedenheit. Sie schnupfte sich in einen Waschlappen aus (ihre Schminktücher waren seit einer Woche alle), schüttelte ihr klammes Haar, zog einen Laborkittel über ihre Unterwäsche und ging ins Wohnzimmer plus Schlafzimmer plus Labor, wo sie bis zur Morgendämmerung mit einer umfangreichen Sammlung von Brennern, Bechergläsern und brodelnden Glasröhrchen herumwerkelte, auf Sorgfalt bedacht wie sonst nur selten.
Im Leben von Priscilla, der vom Genie geküssten Kellnerin, stellte diese Nacht im Großen und Ganzen reine Routine dar. Nur in einem einzigen Punkt unterschied sie sich wesentlich von all den anderen Nächten des Jahres: Schätzungsweise gegen fünf Uhr früh – ihre Uhr war stehen geblieben und sie war noch nicht dazu gekommen, sie wieder aufzuziehen –, pochte es sanft an ihrer Tür. Da sie auf dem Capitol Hill wohnte, einer Gegend mit hoher Kriminalität, und davon einmal abgesehen auch nicht das Bedürfnis hatte, von Ricki oder irgendeinem Mann gestört zu werden, mit dem sie irgendwann einmal aus einem Bedürfnis heraus geschlafen und ihn dann vergessen hatte, beschloss sie, nicht weiter darauf zu reagieren. Bei Sonnenaufgang jedoch, kurz bevor sie sich ihre täglichen, viel zu kurzen sechs Stunden Schlaf gönnen wollte, öffnete sie die Tür, um nachzusehen, ob ihr Besucher eine Nachricht hinterlassen hatte. Zu ihrer großen Überraschung fand sie auf der Türschwelle einen einsamen Klumpen Zeugs, den sie erst nach sorgfältiger Untersuchung als Rote Bete identifizierte.
New Orleans
Was ist die Uhr, V’lu?»
«Die wass?»
«Die Uhr. Was ist die Uhr?»
«Wiesso, Madam, die Uh’ isst dass ’unde Ding mit den sswei Sseige’n in de’ Mitte.»
«V’lu!», sagte Madame Devalier. Wenn Madame Devalier ihre Stimme erhob, war das ungefähr so, wie wenn sich die Gallier gegen die Römer erhoben. Sogar die Termiten im Fundament gingen in Habt-Acht-Stellung. «Wie spät ist es?»
«Ess isst d’ei Uh’, Madam.»
Ungläubig fasste sich Madame Devalier an den Überhang ihres Busens. «Drei Uhr morgens!»
«D’ei Uh’ in de’ Nacht, Madam. Ssie wissen, dass in New O’leanss nicht Mo’gen isst, biss die Ssonne aufgeht.» V’lu lachte. Ihr Lachen erinnerte an das Klingeln eines Spielzeug-Xylophons. «Manchmal, wenn die Hu’icane-T’opfen die ’unde machen, wi’d ess den ganssen Tag nicht Mo’gen.»
«Du hast recht wie immer, Chérie. Aber lass uns nicht von den Hurricane-Tropfen reden. In diesem Laden wird ausschließlich Parfüm verkauft. Und was für Parfüm! Drei Uhr mor… nachts! Dieser Sud hat mir so die Sinne verwirrt, dass ich jegliches Zeitgefühl verloren habe.» Sie blinzelte in einen Kessel mit durchgeseihten Blütenblättern. Das Bild in dem Kessel erinnerte an ein Wasserballett mit Esther Williams, gefilmt in den Lagunen der Hölle.
«Dies ist der stärkste Jasmin, den ich je gerochen habe. Er macht mich ganz wirr im Kopf, V’lu. Bei diesem Jamaikaner haben wir nicht das letzte Mal gekauft.»
Das dunkelhäutige Mädchen nickte. «Alle im Vie’tel ’eden von dem Insselnigge’, Madam. E’ ve’kauft Blumen, e’ ssingt Liede’, und die gansse Sseit ssummen diesse Honigbienen um sseinen Kopf …»
«Das ist in der Tat höchst ungewöhnlich», bestätigte Madame Devalier. «Manchmal umkreisen sie ihn wie ein Heiligenschein und dann wieder so, als wären sie Hörner. Er trägt diese Bienen wie eine Krone, eine lebendige Krone.»
«Meinen Ssie, dass e’ die Bienen auch aufhat, wenn e’ abendss inss Bett geht?»
Madame Devalier drohte der jungen Frau mit dem Zeigefinger. Der Finger war dick, runzelig und beringt, gekrönt von einem knallroten Nagel. «Wenn du weißt, was gut für dich ist, wirst du dir deinen hübschen Kopf nicht darüber zerbrechen, was er im Bett macht. Und jetzt bring mir noch ein bisschen Alkohol, Cher. Wir müssen diesen Sud verdünnen, ehe er eine Kettenreaktion auslöst und New Orleans hinaus in den Golf von Mexiko gepustet wird. Wir kochen hier nichts anderes als Nagasaki à la Jasmin!»
Tatsächlich wurde ein einsamer Trinker, der die Royal Street entlangtorkelte, von der olfaktorischen Kraft des Duftes, der in jener Nacht durch die geschlossenen Fensterläden des kleinen Ladens drang, augenblicklich in den Zustand der Nüchternheit versetzt. Der Mann, der schon seit langer Zeit in der Gegend wohnte, starrte auf das verblichene Schild – Parfümerie Devalier – und bekreuzigte sich, ehe er seinen Weg fortsetzte.
Madame Lily Devalier betrieb den Laden seit vierzig Jahren. Vor ihr hatte ihn fünfzig Jahre lang ihr Vater betrieben. Im Laufe der Zeit waren, so heißt es, eine Reihe sonderbarer Dinge über die Schwelle des Ladens getragen worden. Mond-Medizin und Aufpulver-Pulver. Glücks-Wurz und Komm-zusammen-Potensorium. Maskottchen-Salbe und Loa-Lotion. Hurricane-Tropfen, Lass-mich-am-Leben-Saft, Waschbärenarsch-Schmeichlerpomade und ein spezielles «Mitternachts-Öl», das mit Überstunden im Büro nicht das Geringste zu tun hatte. Unter den feinen Leuten des Französischen Viertels war Madame D. bekannt als die Königin der Guten Gerüche. Es gab Zeiten, da klang das bei gewissen Leuten im Viertel eher wie «Gerüchte». Nun jedoch, da der größte Teil des Viertels – darunter auch der Laden – seine besten Tage hinter sich hatte, versuchte Madame, einen Teil jener Kundschaft zurückzugewinnen, die sie an die großen internationalen Parfümerien verloren hatte; darum handelte sie mit Parfüm, und zwar ausschließlich mit Parfüm. Das behauptete sie zumindest.
Unter dem prüfenden Blick ihrer Gebieterin goss V’lu etwas von dem aus Melasse destillierten Alkohol in einen Tonkrug. In dem Tonkrug sammelte sich die Öl-Essenz, die aus einem Filter-Röhrchen tröpfelte, das an den Kessel mit dem brodelnden Sud angeschlossen war. Der jamaikanische Jasmin verbreitete jedoch einen dermaßen beißenden Geruch, dass er die Verdünnerin bis an den Rand der Ohnmacht brachte.
«Ooh, là, là!», rief Madame Devalier. Sie ließ ihr Kürbis-Teil, ihren spanischen Ballsaal, ihr heidnisches Götzenbild von einem Körper auf ein limonengrünes samtenes Sofa plumpsen. «Dieser Sud raubt mir noch die Sinne.»
«Ich k’iege fu’chtba’e Kopfschme’ssen», jammerte V’lu.
Draußen auf der Royal Street wandelte derweil ein großer, hagerer Schwarzer mit einer grünlich gelben Kappe in den Fußstapfen des inzwischen verschwundenen Säufers. Auch er hielt erst einmal vor den geschlossenen Fensterläden der Parfümerie Devalier inne. Er schnüffelte in der Luft herum wie ein Hirsch, der eine Witterung hat. Erfreut klatschte er in die Hände und verfiel in ein lautes Kichern. Und das Käppchen verrutschte ein wenig auf seinem Kopf, ließ ein schläfriges Flüstern vernehmen und flatterte mit seinen vielen Flügeln.
Da Augenzeugen nicht zur Stelle waren, wird es sich niemals aufklären lassen, ob dieser Mann es war, der jene Rote Bete – es handelte sich um eine Garten-Züchtung – durch das offene Fenster im zweiten Stock geworfen hatte, die V’lu wenig später auf ihrem Feldbett entdeckte, als sie sich gerade schlafen legen wollte in jener Nacht (und dank irgendeiner Medizin, die sehr an Hurricane-Tropfen erinnerte und die ihre Arbeitgeberin ihr gegen die Kopfschmerzen verabreicht hatte, war es doch noch Nacht, V’lu, stimmt’s?).
Paris
Mitten auf der Marmorplatte eines Schreibtisches, direkt unter einem kristallenen Kerzenleuchter, ganz allein auf einem silbernen Tablett, lag eine große rohe Rote Bete. Die Rote Bete musste bereits seit einer Woche oder noch länger dem Boden entnommen gewesen sein, denn sie hatte das aschfarbene Äußere eines Krebsopfers. Wenn das Flackern des Kerzenlichts jedoch aus einem bestimmten Winkel von dem Leuchter auf die Bete fiel, schien ihr Herz nach außen durch, wie weingetränkter Samt.
Der Tisch befand sich in einem Büro, das Büro in einem Wolkenkratzer. Der Wolkenkratzer war – wie alle Wolkenkratzer – ein schmaler, hoher Turm aus Stahl und Glas, bar aller Verzierungen und allen sonstigen Schmuckes. Selbst seine Höhe – schlichte dreiundzwanzig Stockwerke – verdiente keine besondere Beachtung. Das einzig Erwähnenswerte war die Umgebung, aus der er sich erhob. Gegenüber vom Haupteingang auf der anderen Straßenseite standen ein Mönchskloster und eine Kirche, deren Sandsteinstufen vom jahrhundertelangen frommen Kommen und Gehen ebenso muldenartig ausgelatscht waren wie blaue Serge-Hosen an den Knien, nur in die entgegengesetzte Richtung. Rechts von dem Gebäude stand ein Block mit Fahrradgeschäften und Cafés; links ein Hotel mit Schieferdach, in dem vor einigen Jahrzehnten tatsächlich Künstler in denselben vier Wänden geschlafen und gearbeitet hatten, ohne sich träumen zu lassen, dass ihre elendigen Lebensumstände dereinst in «Studio-Apartment»-Anzeigen romantisiert werden würden. Der Himmel über dem Gebäude war trostlos und grau und erinnerte an Passagen aus «Die Elenden». Unter ihm (alles steht auf irgendetwas anderem) befanden sich die Ruinen einer Brauerei, die einst die Mönche von der gegenüberliegenden Straßenseite betrieben hatten. Um 1200 hatten Kreuzritter bei ihrer Rückkehr aus Palästina Parfüm nach Frankreich gebracht, und nachdem es dort recht beliebt geworden war, hatten die Mönche neben Bier auch Parfüm produziert. Überreste der alten Parfümerie waren im Keller des Wolkenkratzers zu sehen. In der Tat hatte die Familie LeFever, die den Wolkenkratzer gebaut hatte, im siebzehnten Jahrhundert die Parfüm-Produktion von dem Kloster erworben und war nach wie vor im Geschäft.
An diesem Tage, der bereits meteorologisch beschrieben wurde in einer Weise, die schrecklichste Erinnerungen an Victor Hugo wachruft, war Claude LeFever unangemeldet in das Büro von Marcel LeFever geplatzt. Warum auch nicht? Sie waren Blutsverwandte und beide Vizepräsidenten des Unternehmens. Formalitäten waren also zweifellos überflüssig. Dennoch schien Marcel verärgert zu sein. Vielleicht deswegen, weil er gerade seine Walfischmaske trug.
Claude stemmte die Hände in die Hüften und starrte seinen Cousin an.
«Da bläst sie also wieder ihre Fontänen!», rief er.
«Leck mich am Arsch», sagte Marcel aus dem Inneren seiner Maske.
«Verzeih mir, aber mir ist nicht ganz klar, wo ich bei einem Fisch nach dem Arschloch suchen müsste.»
«Wale sind keine Fische, du Blödmann.»
«Oh, natürlich.»
(Die Unterhaltung zwischen Claude und Marcel LeFever verlief auf Französisch. Diese Simultanübersetzung ins Deutsche erreicht den Leser über literarischen Satelliten.)
Claude, der akademische Grade sowohl in Ökonomie als auch in Jura besaß, traf die Finanz-Entscheidungen für die Familie LeFever. Marcel, der in den Parfüm-Laboratorien groß geworden war und dort gelernt hatte, mit seiner Nase zu denken, war für «Kreativität» zuständig, ein Begriff, den Claude nicht gänzlich verstand, dessen grundlegende Bedeutung er jedoch irgendwie ahnte, was ihm zur Ehre gereichte. Wenn die Kreativität dadurch zu steigern war, dass man mit einer Pappmachémaske durch die Räume der Geschäftsführung lief, so hatte Claude nichts dagegen, ganz gleich, wie sehr es auch die Sekretärinnen erschrecken mochte. Was den sparsamen Claude beunruhigte, war vielmehr Marcels Angewohnheit, große Geldspenden an ökologische Kommandos zu geben, deren Ziel es war, die Walindustrie zu sabotieren. Claude wusste sehr wohl Bescheid über die Bedeutung, die Ambra – eine Substanz, die von vorübergehend geschwächten Walen ausgeschieden wird – ursprünglich für die Parfüm-Industrie hatte, doch er war überzeugt davon, dass petrochemische und Steinkohlenteer-Fixative vollkommen gleichwertige Substitute seien. «Fischkotze ist Schnee von gestern», pflegte er zu Marcel zu sagen.
«Wale sind Säugetiere, du Idiot.»
«Oh, natürlich.»
In Marcels Büro gab es, genau wie in dem von Claude, ein Fenster, das vom Boden bis zur Decke reichte und durch das man hinabschauen konnte auf die Kirchturmspitze. «Wir sind dem Himmel näher als die Mönche», sagte Claude gern und nicht ohne Stolz. An diesem Tag jedoch schien der Himmel, der von einer Schicht dünner Altostratoswolken und von Smog überzogen war, in erster Linie die menschlichen Leiden widerzuspiegeln, sodass in Claude keinerlei paradiesische Visionen wachgerufen wurden. Vielmehr erinnerte ihn dieser Himmel in seiner düsteren Auszehrung an die Tatsache, dass er sein Frühstück hatte ausfallen lassen, um pünktlich bei einer Sitzung der Geschäftsführung zu sein, zu der Marcel, und das war vielleicht nicht das Verkehrteste, nicht erschienen war. «Warum nimmst du nicht dieses blöde Ding ab, und dann gehen wir was essen», schlug Claude vor.
Marcel fuhr fort, durch die Augenlöcher der Maske aus dem Fenster zu starren. «Heute Morgen mit der Post ist etwas sehr Interessantes gekommen», sagte er.
«Was war das?»
«Was sollte es schon anderes gewesen sein als eine Rote Bete?» Marcel wandte den Blick vom Fenster zur Mitte seines Schreibtisches.
«Ach ja. Eigentlich wollte ich die Rote Bete gar nicht erwähnen. In all den Jahren als dein Cousin und dein Geschäftspartner habe ich gelernt, dass es meist am besten ist, schlafende Hunde nicht zu wecken. Jetzt, wo du das Thema zur Sprache gebracht hast, muss ich zugeben, dass auf deinem Schreibtisch, und zwar sehr auffällig platziert, eine Rote Bete liegt. Die ist also mit der Post gekommen, sagst du?»
Ohne jeden Anflug von Befangenheit nahm Marcel die Maske ab und legte sie neben seinen Stuhl auf den Fußboden, wobei eine imposante gallische Nase, ein grau melierter Bart von der Form einer Schippe, feuchte braune Augen und schwarzes Haar zum Vorschein kamen, das mit Pomade nach hinten gekämmt war und an Lackleder erinnerte. Abgesehen von der Tatsache, dass Claudes Augen weniger schwermütig waren und sein Haar weniger heftig eingefettet war, glichen sich die beiden Vettern wie ein Ei dem anderen – einschließlich des Schnitts ihrer Nadelstreifenanzüge. Konkurrenten sprachen von ihnen häufig als den LeFever-Zwillingen.
«Sie ist nicht wirklich per Post gekommen, falls du das meinst. Sie war auch nicht eingepackt. Sie kam in ihrem Adamskostüm, mit anderen Worten, es kam einfach dieser Körper aus Rote-Bete-Fleisch. Das ganze lag im Postkorb ganz obenauf, als ich heute Morgen hereinkam.»
«Ein Andenken von einem Bewunderer. Irgendeine Frau – oder ein Mann – hier aus dem Haus. Eine Rote Bete ist nicht vollkommen frei von phallischen Anspielungen.»
«Claude, dies ist das dritte Mal, seit ich aus Amerika zurück bin, dass eine Rote Bete in der Frühpost liegt.»
«Na also. Irgendjemandem geht es verdammt dreckig, du wunderhübscher Teufel, du. Oder das Ganze ist ein Scherz.»
«Der Pförtner sagt, dass im Foyer jedes Mal ein strenger, unangenehmer Geruch herrschte, kurz bevor die Rote Bete auftauchte …»
«Ein Scherz, wie ich gesagt habe. Ein unangenehmer Geruch im LeFever-Haus? Ein sehr amüsanter Streich.»
«Ja. Und ein Rest des Geruchs haftet noch an der Roten Bete. Etwas, das ich schon mal gerochen habe. Moschus, nur intensiver. Claude, ich bin einem solchen Geruch in den Vereinigten Staaten begegnet, aber ich kann mich einfach nicht erinnern, wo, und das macht mich total irre. Du weißt ja, wie das ist mit meiner Nase.»
«In der Tat», sagte Claude. «Ich hätte niemals zugelassen, dass LeFever deine Nase bei Lloyd’s in London für eine Million Franc versichert, wäre ich nicht von ihrer Unfehlbarkeit überzeugt. Umso weniger Grund zur Beunruhigung. Dein Riecher wird das Rätsel lösen, selbst wenn dein Verstand versagt. Und inzwischen hat dieses blöde Gerede über Rote Bete meinen Appetit erheblich angeregt. Lass uns vor dem großen Mittagsandrang in ein Restaurant gehen.» Er knöpfte sein Jackett zu. Nach kurzem Zögern erhob sich Marcel und tat es ihm gleich. Der trübe Wolkenhimmel, an dem das LeFever-Gebäude kratzte, ließ es ratsam erscheinen, sich den Elementen nicht völlig schutzlos preiszugeben. «Übrigens», fügte Claude hinzu, «da wir gerade von den Vereinigten Staaten reden – hast du was von V’lu gehört?»
Als der Name V’lu fiel, knöpfte Marcel sein Jackett wieder auf. Er setzte sich wieder hin. Er zog sich die Maske über den Kopf und stöhnte so, wie möglicherweise ein Wal stöhnt, wenn er im Begriff ist, etwas Ambra zu erbrechen.
I. Teil Das Haar und die Bohne
In der Zitadelle war es dunkel, und die Helden schliefen. Wenn sie atmeten, klang es so, als würden sie prüfen, ob Drachengeruch in der Luft lag.
Auf ihrer Bettstatt aus Gewürzen und Federn schliefen auch die Konkubinen einen unruhigen Schlaf. In jenen Tagen war die Erde noch eine Scheibe, und den Menschen träumte häufig, über irgendwelche Ränder hinabzufallen.
Hufschmiede hämmerten auf den Ambossen ihrer geschlossenen Augenlider, um die Randschlange zu schmieden. Stellmacher rollten sie, den Schwanz im Maul, die Fahrwege ihres Schlafes hinab. Köche brieten sie in Traummulden, Näherinnen nähten sie an den Dachshäuten fest, unter denen sie lagen, der Geisterbeschwörer bei Hofe entdeckte ihre Konturen in dem Stroh, in dem er sich wälzte. Nur die Säuglinge im Kinderraum lagen friedlich da und ließen sich nicht einmal von den Flöhen stören, die sich an ihrer Zartheit labten.
König Alobar schlief überhaupt nicht. Er war ebenso wach wie die Wachen am Tor. Sogar noch wacher, denn die Wachen waren in Gedanken versunken und träumten, während ihre Augen über den bewaldeten Horizont wanderten, von Met, von gekochten Roten Beten und von gefesselten Frauen; der König hingegen war bei so wachem Bewusstsein wie ein aus der Scheide gezogenes Messer – bei kühlem wachem Bewusstsein und wärmstens beunruhigt.
Neben ihm unter der Hermelindecke dösten sein großer Hund Mik und seine Frau Alma, ohne etwas von den Nöten ihres Herrn zu ahnen. Nun gut, sollten sie vor sich hin schnarchen, denn weder die Zunge des Hundes noch die der Frau konnte die Falten von seiner Stirne lecken, wenngleich es in erster Linie ihre Zunge war, die ihn an diesem Abend bewogen hatte, Alma zu sich kommen zu lassen. Almas Mund, die Lippen rot vom Saft der Roten Bete, vermochte ihn in eine fleischliche Umarmung zu verwickeln, die, solange sie andauerte, jeden Gedanken an die Windungen des Schicksals jenseits des Randes verbot. Jedoch auch der schönste Augenblick ist einmal vorüber, und spätestens wenn Almas Schluckauf den Pilzgeruch seines Endspurts zutage förderte, bereute er seine Wahl. Er hätte Wren kommen lassen sollen, seine Lieblingsfrau, denn ihr mangelte es zwar an den speziellen sexuellen Fertigkeiten Almas, aber dafür kannte sie sein Herz. Wren konnte er sich anvertrauen, ohne befürchten zu müssen, dass seine Geständnisse eingesponnen würden in den alltäglichen Klatsch auf den Webstühlen der Konkubinen.
Alobars Schloss, in Wirklichkeit nichts weiter als eine einfache Festung aus Stein und Holz, umgeben von einem Zaun aus Baumstämmen, beherbergte Schätze, unter denen sich auch eine Scheibe polierten Glases befand, die ihren Weg aus dem fernen Ägypten an diesen Ort gefunden hatte, um dem König sein Gesicht zu zeigen. Die Konkubinen vergötterten dieses Wunderglas, und Alobar, dessen Gesicht so sehr von Bart überwuchert war, dass ihn sein Spiegelbild nur mit einem Minimum an Beschaulichkeit entlohnte, hatte nichts dagegen, es in ihren Gemächern zu wissen, wo sie täglich viele Stunden damit zubrachten, die Wunder zu bestaunen, die es hervorbrachte. Einmal hatte eine sehr junge Konkubine namens Frol den Spiegel fallen gelassen, und dabei war eine Ecke abgebrochen. Der Hohe Rat hatte sie in den Wald verbannen wollen, wo Wölfe oder die Krieger eines benachbarten Reiches ihr die Knochen ausgesaugt hätten, doch Alobar war eingeschritten und hatte ihre Bestrafung auf dreißig Peitschenhiebe begrenzt. Später, als ihre Wunden verheilt waren, gebar sie ihm wundervolle Zwillingssöhne. Allerdings kam seitdem der König jedes Mal bei Neumond in den Harem, um sich zu vergewissern, dass das Spiegelglas seine Fähigkeiten noch nicht verloren hatte.
An jenem Tag nun, dem Neumond jenes Teils des Kalenders, den wir als September kennen, hatte Alobar bei der Durchführung seiner Routineinspektion länger und genauer in den Spiegel geschaut als gewöhnlich. Irgendetwas von den Geheimnissen und Schatten auf der nur unzulänglich polierten Oberfläche hatte seine Aufmerksamkeit erregt. Er starrte, und während er starrte, begann sein Puls, sich auf und davon zu machen. Er trug das Glas an ein geöffnetes Fenster, wo brechende Funken von Sonnenlicht zwar seine Tiefen belebten, jedoch nicht dazu beitrugen, die einmal gemachte Aussage zu ändern. «So bald schon?», flüsterte er, während er den Spiegel neigte. Ein anderer Winkel, dasselbe Ergebnis. Vielleicht spielt das Glas mir einen Streich, dachte er. Magische Dinge neigen zur Täuschung.
Obwohl der Tag recht mild war, zog er sich die Kapuze seines groben Leinengewands über und errötete wie der reiche Oheim des Blutes höchstpersönlich, als er den Spiegel der Konkubine in die Hand drückte, die am dichtesten bei ihm stand – und das war zufällig Frol. Die anderen Frauen rangen nach Luft. Einige von ihnen eilten herbei, um ihr den wertvollen Gegenstand abzunehmen. Alobar verließ den Raum.
Nicht ohne Schwierigkeiten – denn immer wieder versuchten andere darauf zu bestehen, ihn zu begleiten – gelang es dem König, sich bei Hofe zu entschuldigen, um draußen vor den Toren der Zitadelle mit seinem riesigen Hund Mik herumzutollen. Auf langen Umwegen gelangte er in den Wald und zu einer Quelle, die er kannte. Dort fiel er auf die Knie und beugte sich ganz dicht über das Wasser, so als wolle er trinken. Begraben unter einem Wirbel wolkiger Strudel, war sein Spiegelbild nur in kurzen Momenten scharf zu sehen. Dennoch erkannte er es zwischen all den Bläschen, Ästchen und tanzenden Licht- und Farbpartikeln wieder: ein Haar, so weiß wie der Schnee, über den ein Schwan hinweggeflogen ist. Es kräuselte sich an seiner rechten Schläfe.
Weder gelenkt noch behindert von Gedanken, schoss die Hand des Königs Alobar empor, als wolle sie den Schlag eines Feindes abwehren. Mit einem Ruck riss er das Haar aus seiner Verankerung und betrachtete es, wie man gemeinhin eine getötete Schlange betrachtet, um es dann, nachdem er sich mit einem Blick über die Schulter vergewissert hatte, dass außer Mik keine Augenzeugen anwesend waren, in das Quellwasser zu schnipsen, wo es lange wirbelte und quirlte, ehe es versank und nicht mehr zu sehen war.
Alma knirschte im Schlaf mit ihren in Samen gebadeten Zähnen. Jeder noch so entfernte Schrei einer Eule ließ Mik zusammenzucken. Zwischen beiden lag Alobar, die Augen weit geöffnet. Mit seinen vom Kampfe gezeichneten Händen streichelte er die Felldecken, um sich zu trösten. In tiefer Scham und mit großer Furcht lege ich mich heute Nacht zur Ruhe, dachte der König. Bei der Bestürzung, die auf mir liegt, brauche ich keine Bettdecke.
In Alobars Königreich, einem winzigen Stadtstaat, einem Stamm, wenn man so will, war es Brauch, den König zu töten, sobald bei ihm das erste Anzeichen des Alterns zu erkennen war. Könige durften nur so lange herrschen, wie sie sich ihre Stärke und ihre Lebenskraft erhielten. Der Stamm, der seine Herrscher als Halbgötter betrachtete – Gottmenschen, die den Gang der Natur bestimmten –, befürchtete Katastrophen gewaltigen Ausmaßes, wenn der Herrscher allmählich schwächer würde und am Ende im Tod alle seine Kräfte verlöre. Die einzige Möglichkeit, solches Unheil abzuwenden, bestand darin, den König zu töten, sobald er Anzeichen des Verfalls zeigte, sodass seine Seele auf einen kraftvollen jungen Nachfolger übergehen konnte, ehe sie Schaden nahm. Eines der verhängnisvollen Anzeichen schwindender Kraft war die Unfähigkeit des Königs, die sexuellen Leidenschaften seiner Frauen zu befriedigen. Ein anderes waren die ersten Falten oder grauen Haare, die auf so indiskrete Weise den Verfall anzeigten.
Bislang hatte Alobar diese Tradition nicht als ungerecht betrachtet. Würde nicht, wenn es dem König gestattet wäre, gebrechlich und krank zu werden, seine Schwäche auf sein Reich übergreifen, sich auf die Vermehrung des Viehs auswirken, für das Verrotten der Rote-Beten-Ernte auf den Feldern verantwortlich sein, die Männer im Kampfe behindern und ganz allgemein die Krankheit, den Wahnsinn und die Unfruchtbarkeit unter denen, die er beherrschte, auf ewig festschreiben? Und sahen nicht alle intelligenten Völker (abgesehen von den Römern) dies als die Wahrheit an? Warum genügte in manchen benachbarten Königreichen bereits ein leichter Makel am königlichen Leib, wie zum Beispiel der Verlust eines Zahnes, um den Todesspruch zu rechtfertigen? In Alobars Stadt war die Hinrichtung eine Zeremonie von großer Würde und großem ästhetischen Gewicht, wobei der Lieblingsfrau des Königs die verantwortungsvolle Aufgabe zufiel, das vergiftete Ei an die Lippen ihres Mannes zu führen. Bei weniger zivilisierten Völkern der Gegend wurde der König mit der rohen, wenngleich vollkommen hinreichenden Methode eines Schlages auf den Kopf ins Jenseits befördert.
Bislang war Alobar das Ritual der Tötung des Königs ganz natürlich, unvermeidlich und gerecht vorgekommen. Aber in dieser Nacht … in dieser Nacht verfluchte er jene grausam verräterische Faser, jenen ergrauten Wimpel der Sterblichkeit, der so gedankenlos an seiner ansonsten dunklen Schläfe flatterte; jene spärliche silbrige Schriftrolle, auf der in deutlichen Lettern, die jedes Geschöpf zu lesen vermochte, eine Einladung zum Grabhügel geschrieben stand. Oh, äußerst ungelegenes Haar!
Von den zitronengelben Inseln im Süden bis zu den bergigen Schlupfwinkeln der Kobolde gab es keinen ehrbaren Menschen, der König Alobar einen Feigling hätte nennen können. Häufig hatte er in der Schlacht sein Leben aufs Spiel gesetzt, aufmunternd seine Befehle rufend. Und warum auch nicht, was gab es am Tode zu fürchten? Der Tod war der Tribut an diese Welt und das Erbe der anderen Welt. Ihm auszuweichen bedeutete, beide Seiten zu betrügen. Indem er sich das graue Haar ausriss, das ahnte er, hatte er sein Volk verraten, seine Götter – und sich selbst. Sich selbst? Selbst? Was bedeutete denn das? Alobar hämmerte mit seinem Kopf auf das Kissen, sodass Mik anfing, leise zu knurren, und Alma mit beiden Armen ruderte, ohne jedoch aus dem Meer ohne Fische aufzutauchen.
Bei der ersten Morgendämmerung, noch ehe einer der Hähne mit seinem stolzen Kikeriki-Part die knallharten Tatsachen der vergangenen Nacht besingen konnte, rüttelte Alobar Alma wach, befahl ihr, zurück in den Harem zu gehen, und bat sie, an ihrer statt Wren zu ihm zu schicken.
«Warum grinst du so?»
«Mein Herr, ich bin ganz einfach froh darüber, dass Ihr Euren Appetit zurückgewonnen habt.»
«Worauf spielst du an, Frau?»
«Auf nichts, mein Herr.»
«Worauf?» Er griff sie bei ihren blonden Zöpfen.
«Zürnt nicht, Herr. Es ist nur so, dass einige Eurer Frauen murren, Ihr hättet sie in letzter Zeit vernachlässigt.»
Der König ließ sie los. Automatisch hob er seine Faust empor zu jener Schläfe, an der das weiße Haar gesprossen war. Sollte sich ein weiteres sehen lassen, würde er es samt Follikel zermalmen.
«Haben sie … haben sie auch vor dem Hohen Rat davon gesprochen?»
«O nein, mein Herr! So weit ist es nicht gekommen. Um ehrlich zu sein, ich glaube, sie sind ganz einfach sauer, weil Ihr Euren besten Samen in diese tollpatschige kleine Votze Frol verströmt.»
In den Tiefen seines wirren Bartes gelang Alobar eine Art Lächeln. Die junge Frol war wieder schwanger, und wenn man von der Größe ihres Bauches ausging, wuchs darin ein zweites Paar Zwillinge heran.
Da das Küssen seinerzeit in Europa noch nicht entdeckt war, rieb Alobar seine Nase an der Almas. «Meine Eier sind so schwer, dass ich nicht aus dem Bett komme. Los jetzt. Hol mir Wren!»
Sobald sie gegangen war, erhob er sich und stieß das schwere Eichenfenster auf. Während Mik ihm die Füße leckte, richtete er eine Reihe von Gebeten an das rasch verblassende Funkeln des Morgensterns.
Jene, die Alobar beherrschte, gehörten einer blonden Rasse an, die erst vor so kurzer Zeit aus dem hohen Norden gekommen war, dass in den Geschichten, die die Alten am Feuer zum Besten gaben, nach wie vor Schneekobolde und rote Giftpilze ihr Unwesen trieben, wenngleich der König selbst, einmal abgesehen von dem morbiden Fädchen, das er in der Quelle versenkt hatte, eher ein dunkler Typ war. Wren, die Tochter eines südländischen Häuptlings, den Alobars Vorgänger im Kampf niedergemetzelt hatte, war noch dunkler. «Das einzige dunkle Fleisch in der Speisekammer des Königs», witzelten manchmal die Krieger. Ihre Färbung war einer der Gründe dafür, dass er sie den anderen vorzog. Wichtiger war jedoch, dass er ihre Vernunft liebte, wenngleich zu jener Zeit an jenem Ort die «Vernunft» bei einer Frau ebenso wenig als Tugend galt wie die «Liebe» bei einem König.
Almas Vorankündigung schien ihre Wirkung nicht verfehlt zu haben, denn Wren erschien bereits nackt und frisch gebadet, zu allen Schandtaten bereit. Entsprechend überrascht war sie, als sie ihren Gatten vollständig bekleidet auf dem riesigen Bärenfell am Fußende seines Bettes sitzen sah, den Hund neben sich.
«Ver-ver-verzeihung, mein Herr», stotterte sie. Der Kelterer in ihren Adern griff zu einer roteren Traube. «Mir wurde gesagt, Ihr hättet mich herbestellt.»
«So ist es, meine liebe Wren. Bitte, komm und setz dich an meine Seite.»
«Nun, ja, gerne. Doch erlaubt mir, zunächst mein Kleid zu holen. Ich habe es im Vestibül gelassen.»
Alobar lächelte über ihren Aufzug und versuchte, sie zurückzuhalten. Trotz seiner inneren Unruhe nahm er sich die Zeit, diese wandelnde Blume von vernunftbegabtem Rosa, dieses betriebsame Gewerbe von Honig und Salzlauge zu bewundern. Aber der Anblick von Haar warf seine Schatten, und er gestattete ihr, sich anzuziehen. Er tätschelte den Hund.
«Ihr habt es Euch also ausgerissen», sagte sie, nachdem er sie in die Ereignisse des vorangegangenen Tages eingeweiht hatte.
«Ja, das habe ich getan.»
«Ausgerissen?»
«Ja.»
«Aber warum?»
«Ich hatte gehofft, du könntest mir helfen, das zu beantworten.»
Wren schüttelte ihren Kopf mit den rabenschwarzen Locken. Sie schien verwirrt. «Nein, mein Herr. Ich glaube nicht. Ich habe nie jemanden kennengelernt oder von jemandem gehört, der sich auf diese Weise dem Schicksal widersetzt.»
«Ich bin gewiss nicht der Erste», sagte Alobar. «Wenn doch, dann muss ich ebenso verrückt wie feige sein.»
«Oh, keines von beidem, mein Alobar.»
«Dann was?» Er beobachtete gelassen, wie Mik sich erhob, gähnte, sich streckte und sich in eine entlegene Ecke des Raumes schleppte, um dort sein Geschäft zu machen. «Sag mir, Wren, was, glaubst du, erwartet dich, wenn du gestorben bist?»
«Was mich erwartet? Mich, Wren? Ich habe nie darüber nachgedacht, was der Tod für diesen einen Menschen bereithält, für die geborene Wrenna von Pindus, heute Wren, Frau des Alobar. Der Tod ist keine persönliche Angelegenheit, oder? Er ist Sache des Stammes. Unser Stamm ist dafür verantwortlich, das Überleben unserer Rasse gegen all die schrecklichen Launen des Himmels und der Erde zu sichern, und da der Verlust eines seiner Angehörigen den Stamm schwächt, kann jeder Tod eine Feuerprobe für das Ganze bedeuten.»
Der König nickte. Kein graues Haar nickte mit, wenngleich er sich dessen nicht vollkommen sicher sein konnte, weil er an diesem Morgen noch nicht nachgesehen hatte. «Das ist auch die Erklärung dafür, warum unser Volk solche bis in alle Einzelheiten durchdachten und eindringlichen Begräbnisse feiert. Wir kümmern uns um die Unsterblichen, um sie möglicherweise davon zu überzeugen, uns beizustehen, damit wir die Kraft und die Einheit wiedergewinnen, die uns durch den Tod geraubt wird. Doch – und dieser Gedanke ist mir in der vergangenen Nacht gekommen, als ich traumlos im Bette lag – meist gelingt es dem Stamm, die Lücke zu schließen, die der Tod in seine Verteidigungsanlagen reißt, aber was ist mit dem, der stirbt? In manchen Gegenden glaubt man, er würde im Frühjahr wieder sprießen wie ein Krokus, doch bin ich niemals Zeuge eines solchen Blühens geworden. Früher habe ich geglaubt: Ich muss mich denen anvertrauen, die in der nächstfolgenden Welt die Mächtigsten sind, seien es nun Götter oder Dämonen. Doch nun, da mein eigenes rasches Hinscheiden zunehmend wahrscheinlich wird, übernehme ich nur ungerne die Rolle des ersten Preises im Tauziehen einer anderen Welt.»
«Ist das Gotteslästerung, mein Herr?»
«Ich glaube nicht. Jene, die mich geschaffen haben, ob Götter oder Dämonen sei einmal dahingestellt, schufen auch dieses Gehirn, das meinen Widerstand gegen ihre Ordnung hervorbringt. Bestimmt waren sie so weise, bei dem Spinnrad, auf dem ich gesponnen wurde, auch den zukünftigen Widerstand in dem Herzen zu berücksichtigen, das sie da in die Welt setzten.» Alobar sah sie erwartungsvoll an. «Kannst du mir nicht zustimmen?»
Wren legte ihre sanfte Hand auf Miks Fell. Es schien bei der Berührung fast so, als würde der riesige Hund schnurren. «Ich kann weder zustimmen noch widersprechen. Ich bin in der Morgendämmerung, noch halb schlafend, hierhergekommen in der Erwartung, meine Ackerfurche würde gepflügt, und nun muss ich erleben, wie Ihr solch sonderbare Vorstellungen in mein Gehirn pflanzt.» Sie hielt Mik ihre Finger hin, sodass er sie liebevoll besabbern konnte.
«Vielleicht», sagte Alobar, «sollte ich den Geisterbeschwörer um Rat fragen.»
«Nein, nein, Alobar. Tut das nicht. Bitte tut das nicht.»
«Sag mir, warum?»
«Es fällt mir schwer, mein Herr, das zu erklären, aber ich werde es versuchen. Die Könige unter Euren Vorfahren sind bei so manchem Freudenfeuer gefeiert worden. Gefeiert jedoch für ihre Schlauheit und für ihre Muskeln. Weisheit, wahres Wissen, ist allein die Domäne des Geisterbeschwörers gewesen. Durch Euch hat sich all das verändert, und das gefällt Noog nicht. Ihr müsst mir vergeben für das, was ich Euch zu sagen habe, aber es entspricht ganz der Wahrheit. Es gibt Männer in den Mauern dieser Stadt, die kräftiger gebaut sind als Ihr, Alobar, die geschickter mit dem Speer umzugehen wissen. Männer, die schneller laufen können, die einen Stein weiter zu schleudern vermögen, die wie Ihr dem furchteinflößenden Feind ohne ein Zittern der Angst entgegentreten, die wie Ihr einen Harem mit einer standhaften Lanze zu befrieden verstehen. Aber Ihr, nun, ohne dass ich mir erklären kann, wie Ihr dazu gekommen seid, Ihr besitzt ein Gehirn. Wieder und wieder habt Ihr Eure ungewöhnliche Fähigkeit unter Beweis gestellt, in den Menschen hineinzusehen und die schweigenden Klagerufe zu verstehen, die sie an die Sterne richten. In der Vergangenheit sind die Könige Herrscher dieses Volkes gewesen. Ihr aber seid ein Gouverneur.»
«Gouverneur?»
«Das ist ein hellenisches Wort –»
«Hellenisch.» Alobar schloss die Augen und dachte darüber nach, was er über die hellenischen Stadtstaaten weit im Südosten, ganz nah am Rande der Welt, gehört hatte. Wie ruhmreich sollten sie gewesen sein, wie reich und gebildet und stolz auf ihre Künste. Vor langer Zeit waren Stämme aus dem Norden gekommen, ähnlich seinen Vorfahren, und hatten sie ausgeplündert. Was nützte eine gerechte Herrschaft, wenn irgendwelche unzivilisierten Leute kommen konnten, wann immer sie wollten, um einen abzuschlachten?
«– ein hellenisches Wort, das bedeutet, einen direkten Einfluss auszuüben. Und das habt Ihr getan. Die Heldentaten der Herrscher aus vergangenen Tagen haben Euer Königreich lediglich in einem Zustand der Aufregung gehalten. Ihr habt es beruhigt. Und das nimmt Noog Euch übel, denn eine Folge Eurer vernünftigen Führung ist es, dass der Geisterbeschwörer weniger gebraucht und weniger bewundert wird.»
«Das überrascht mich nicht. Es gibt Grenzen für die Bewunderung, die wir einem Mann entgegenbringen sollten, der seine Zeit damit verbringt, mit einem Stock in den Innereien von Hühnern herumzustochern.»
«Die Wahrsagerei hat ihren Wert.»
«Ja, und das Gleiche gilt möglicherweise auch für die Beseitigung von Königen, an denen der Zahn der Zeit nagt. Dennoch rumort beim heutigen Tagesanbruch die Rebellion in meinem Inneren. Ich weiß deine Warnungen, was Noog angeht, zu schätzen. Wenn ich ihm sagen könnte, was ich im Begriff bin, dir zu sagen, würde ich das bittere Ei verspeisen, noch ehe der Mond in voller Reife am Himmel steht. Ich habe miterlebt, wie Könige in jenes Ei beißen, wie sie grün werden wie Efeublätter und über den Hof flattern wie Federvieh, dem gerade der Kopf abgeschnitten wurde. Und die ganze Zeit schaut das Volk zu, als würde es einem Kampf zwischen Bär und Hund beiwohnen. Aus Sicht der Sterne mögen die Menschen nicht höher stehen als die wilden Tiere, und der königliche Mensch mag nicht mehr wert sein als der elende. Vergib mir, vielleicht hat mich der Saft jenes silbrigen Haares im Inneren meines Schädels betrunken gemacht, aber ich bin erfüllt von der Sehnsucht, mehr zu sein. Etwas zu sein, dessen Widerhall das Rasseln des Todes verschlingt.»
Während Wren angesichts seines sonderbaren Verhaltens mit ihren asphaltfarbenen Lidern klimperte, erhob sich Alobar, warf seine Kleider ab und drehte sich langsam vor ihr im Kreis wie beste Ware auf dem Sklavenmarkt. Abgesehen von einzelnen glänzenden Stellen, an denen der gelegentliche Stich einer Klinge ihn gezeichnet hatte, war sein Körper glatt und ebenmäßig braun, muskelbepackt, geschmeidig, schnell; weder so massig noch so behaart wie der vieler Krieger, die in seinem Gefolge marschiert waren. Seine kastanienrote Mähne war zwei Zentimeter unterhalb der Ohren glatt abgeschnitten, sein Bart war zottig und dicht. Seine Nase, die sich weniger weit hervorwagte als ihr eigenes, südländisches Modell (vielleicht gibt es in tropischem Klima einfach mehr zu schnuppern), wurde auf dem Nasenbein von einem Stück Wundverband geziert. Seine Augen, die leuchteten wie Fackeln in einer Gletscherhöhle, waren so unendlich blau, dass sie an bestimmten Tagen mit der Farbe des Himmels zu verlaufen schienen. Alobars Mund, von dem man durch den dichten Bart nur wenig zu sehen bekam, war schmaler als die fleischigen Münder seiner Stammesgenossen und gleichzeitig weniger grob; er erinnerte Wren an den Mund ihres toten Vaters und faszinierte sie deswegen von allen körperlichen Charakteristika des Alobar am stärksten. Manches Mal, wenn sie mit ihm zusammen war, hätte sie um Lippenbreite das Küssen entdeckt.
Nachdem er sich lange genug zur Schau gestellt hatte, legte er seine Hände auf seine beiden Wangen und sagte mit zugleich trotziger und zitternder Stimme: «Der Mann, der hier vor dir steht, ist Teil der Gemeinschaft, der Rasse und der Art, aber dennoch gehört er irgendwie nicht wirklich dazu. Diese Vorstellung erschrickt dich, das sehe ich dir an. Aber Wren, ich kann nicht tatenlos die Vernichtung all dessen hinnehmen, was ich mir selbst bedeute. Meine Taten sind nicht so gering, dass man ihrer am Feuer nicht gedenken wird, doch das reicht nicht, um meine Sehnsüchte zu erfüllen. Mein Leben ist nicht allein ein öffentliches Phänomen, es ist darüber hinaus ein einzigartiges Erlebnis.» Er schlug sich auf die Schenkel. «Nur schwer vermag ich mir vorzustellen, wie dieser mir vertraute Körper erkaltet. Diese Glieder, dieser Leib, dies schlagende Herz – sie alle drängen mich, entgegen meiner ganzen Erziehung, der Unterwerfung unter das kollektive Schicksal Widerstand zu leisten.»
Wrens Mund öffnete sich mit der Zaghaftigkeit einer Muschel. «Eitelkeit?», fragte sie. Obwohl ihr der Schreck noch in den Gliedern saß, sorgte sie – ganz Weib – dafür, dass es weniger wie eine Anschuldigung, sondern vielmehr wie eine Frage klang. «Eitelkeit?»
«Eitelkeit? Ich bin nicht sicher. Vom Gefühl her ist es anders als Eitelkeit. Wenn ich nichts anderes bin als eitel, werden die Dämonen meinen Geist von Hölle zu Hölle scheuchen. Zu meiner Verteidigung kann ich nur dies sagen: Ich habe für meine Stammesbrüder gekämpft, und ich würde wieder für sie kämpfen; sie brauchen nur den Feind zu nennen. Aber ich bin nicht bereit, hinzunehmen, dass sie den Kopf eines anderen mit der Krone zieren, auch wenn seiner blond ist wie Schwefel und meiner weißer, als jemals ein Schneegestöber im Winter es war.»
Lange saß Wren schweigend da in einer Haltung, die an einen Blutstropfen auf der Spitze eines Dolches erinnerte. Dann sagte sie: «Euch scheint an meiner Meinung gelegen, mein Herr. Also sage ich Euch: Es wäre schmerzvoll für mich, Euch das Gift reichen zu müssen. Es täte mir weh, Euren Körper reglos und kalt zu sehen, auch wenn das Fortleben unseres Stammes dadurch einfacher wäre. Eure Worte verwirren mich unendlich. Aber ich vertraue Euch mehr, als ich je einem Menschen vertraut habe, ausgenommen meinem Vater. Wenn es Euer Wille ist, mit dem Mittel der Täuschung weiterzuleben, so will ich alles tun, um Beihilfe zu dem Betrug zu leisten. Ganz sicher werde ich mich jeglicher Erwähnung des Vorganges enthalten.»
«Es handelt sich nicht um einen wirklichen Betrug. Sofern meine Eltern keine Lügner waren, habe ich bislang nicht öfter als siebenunddreißigmal das Fest der Feste begangen. Ich bin nach wie vor jung und leistungsfähig, ganz gleich, was das verräterische Haar herausposaunt.» Wieder schlug er sich auf die Schenkel. Dann sprudelte es mit einem Mal aus ihm hervor: «Ach, Wren, vielleicht bleibt dir gar nicht viel Zeit, unser Geheimnis zu hüten. Ich habe die Eigenarten von Haaren genau beobachtet, und es wird nicht viele Tage die Sonne aufgehen, ehe das nächste hervorsprießt, ebenso farblos wie das letzte. Und das nächste, und das nächste, wie Tauben auf der Stange. Tag für Tag werde ich meinen Kopf im Spiegel betrachten müssen, und dabei kann ich den Spiegel nicht den Konkubinen wegnehmen, ohne dass sie Verdacht schöpfen. Du bist über alle Maßen treu ergeben, aber es ist kaum von Nutzen …» Er ließ sich neben sie auf das Fell fallen.
«Ich werde Euer Spiegel sein», sagte Wren.
Er verstand und umarmte sie voller Dankbarkeit, bis er schließlich spürte, wie seine Lebensgeister zurückkehrten. Ein behutsames Lächeln verdrängte sein schattiges Laubwerk. «Mir steht der Sinn danach, dich niederzustrecken und zu spalten wie eine Hammelrippe. Was würdest du dazu sagen?»
«Ihr wisst sehr wohl, was ich dazu sagen würde. Ich würde jene kaum verständlichen halbverrückten Laute von mir geben, die die Pantherin vernehmen lässt, wenn sie im Fieberwahn ihrer stets wiederkehrenden heißen Zeit von ihrem Männchen bestiegen wird.»
Alobar stand auf und wollte das Fenster schließen, um das einsetzende Summen und Treiben des städtischen Alltags aus dem Raum zu verbannen. Dann überlegte er es sich anders und ließ das Fenster weit offen. Es würde zu seinem Vorteil sein, so machte er sich klar, wenn das Volk die wilden Schreie der Pantherin aus seinem Zimmer vernähme.
Die Tage wurden kürzer. Die Zitadelle hüllte sich in Frühnebel. Rote Beten, die aussahen wie die Herzen von Gnomen, türmten sich in den Vorratskellern. Enten standen Schlange, um ihre Fahrkarten in südliche Sümpfe zu kaufen. Met wurde in Krüge gefüllt. Klingen und Leder wurden gefettet. Vor den Mäulern der Wölfe bildeten sich Wolken, wenn sie des Nachts heulten. Vielleicht waren sie der Ursprung des Nebels. Überall gab es Geräusche vom Schroten von Maiskörnern, von tanzenden Jungfern, von Bienen auf einem letzten Einkaufsbummel, vom Prasseln eines Feuers mit einer letzten Opfergabe auf einem Altar.
Auch an König Alobar ging der Wechsel der Jahreszeiten nicht spurlos vorüber. Wren hielt Wort und diente ihm als Spiegel, und ungefähr einmal pro Woche entdeckte sie einen weißen Siedler, der die schattigen und zottigen Ufer zu kolonisieren trachtete. Prompt vertrieb sie ihn aus der Gegend.
Alobar war nachdenklicher denn je und teilte seine Gedanken mit ihr. «Ich glaube, dass ich etwas suche», gestand er ihr einmal, als sie allein im westlichen Wachturm standen, um aus unblutiger Entfernung die Schlachtung magerer Rinder zu beobachten. «Was ich suche, hat nichts zu tun mit Beute oder neuen Gebieten, mit mehr Frauen oder mehr Ruhm und auch nichts, um keine Zweifel aufkommen zu lassen, mit einer lediglich verlängerten Lebenszeit. Was ich suche, hat es noch nie gegeben, weder zu Lande noch zu Wasser.»
Was er suchte, sollte etwas Einzigartiges werden, hervorgegangen aus seiner einzigartigen Erfahrung – und Wren mochte sich noch so sehr bemühen, sie konnte es nicht verstehen. Wenn ihr schon die Wahrnehmung eines Individuums, das sich um seiner selbst willen dem Tode widersetzt, nicht vertraut war (und niemandem in jenem Umfeld wäre es anders ergangen als ihr), so musste ihr die Vorstellung von der Einmaligkeit eines einzigen Menschenlebens fremd bis zur völligen Unbegreiflichkeit sein. Da sie dem gotteslästerlichen Unsinn ihres Gatten das Durcheinander auf den Viehkoppeln entschieden vorzog, hörte sie einfach nicht mehr hin und rief stattdessen den Schlächtern ihre Aufmunterungen zu.
Und dennoch diente Wren ihrem Alobar weit über das Maß aller Pflicht hinaus. In einem verzweifelten Versuch, seine Lebenskraft unter Beweis zu stellen, machte sich der König über seinen Harem her wie eine verhungerte Ratte über ein Fass mit Pfirsichen. Nacht für Nacht versenkte, verrenkte und versprengte er. Genussvoll stieg er über Frols dicken Bauch. Wenn er Juun oder Helga verließ, klagten sie über Schmerzen in ihren niederen Gefilden. Die Leiber von Ruba und Mag umgab er mit einer funkelnden Morgenröte. Alma verschaffte er eine Vorstellung vom Geschmack ihrer eigenen Medizin. Jede Nacht, wenn er sich mit der einen oder anderen von ihnen vergnügt hatte, rubbelte er ihre Nasen, zog sie an ihren Zöpfen und schickte sie zurück in ihre Gemächer, um Wren zu holen. Während Alobar erschöpft an ihrer Seite lag, sie streichelte und unvorsichtige Bemerkungen machte wie: «Frauen sind wunderbar, aber warum musste ich so viele haben?», täuschte Wren die Schreie einer Löwin vor. Des Morgens, während er noch von der relativen Ruhe des Krieges träumte, tat sie es noch einmal. Es dauerte nicht lange, da schämten sie sich beide so sehr für ihr falsches Spiel, dass sie es kaum noch ertragen konnten, sich anzusehen. Es war in der Tat eine Erleichterung, als die Angelegenheit zum Ende kam.
Noog, der Geisterbeschwörer, schenkte den Aktivitäten des Königs große Aufmerksamkeit. Das hatte er schon seit Jahren getan. Er hatte Alobars allmählich schwindenden sexuellen Enthusiasmus genauestens registriert, sodass ihm auch die Verzweiflung nicht entging, die der plötzlichen Gegenentwicklung innewohnte. Als er aus den Eingeweiden mehrerer Hennen die Bestätigung für seine Vermutungen herausgelesen hatte, beschloss er, sich persönlich Klarheit zu verschaffen.
Es kam so, dass eines Morgens, als Noog sich an das königliche Fenster heranschlich, nachdem er einen Wächter mit einer Glasperle bestochen hatte, Alobar und Wren tatsächlich gerade miteinander schliefen. An jenem Tage hatten ihn ihre albernen Schauspielereien erregt. Schließlich war sie ihm wichtiger als alle anderen. So hatte er mit ungewöhnlicher Zärtlichkeit ihren Bauch berührt, und schon bald entsprach ihr Stöhnen den Tatsachen. Noog war eben im Begriff, sich enttäuscht abzuwenden, als sich die Elster, die auf seiner Schulter saß, plötzlich in die Lüfte erhob und in das Gemach des Königs flatterte. In Alobars Bart war im Laufe der Nacht, so hell wie ein Eiszapfen, ein langes lockiges Haar gesprossen, das bislang von dem sich liebenden Paar noch unentdeckt geblieben war. Die Elster flog direkt darauf zu, zog es mit ihrem Schnabel heraus und legte es in die von Innereien besudelten Hände des Magiers.
Nach einem ganzen Tag voller Jubel, Gesang und wildem Tanz von angemalten Wesen in Tierkostümen fand in der Abenddämmerung die Hinrichtung statt.
Alobar saß in Erwartung des Ausklangs seines irdischen Daseins auf einem bronzenen Thron und trug zum letzten Mal eine schwere, aus Gold geschmiedete Krone. Auf seinem Schoß lag die heilige Muschel. Die Muschel und die Krone stritten sich mit dem ägyptischen Spiegel um den ersten Rang in der Hierarchie der Schatzfunde der Stadt. Genau in dem Moment, da das Auge der Sonne blinzelnd hinter den Bergen im Westen verschwand, trat Wren aus einer winzigen Hütte aus Tannenzweigen, die speziell zu diesem Anlass errichtet worden war; auf einem Hermelinkissen trug sie das dampfende Ei. Als hätte sie seit Tagen geübt, tänzelte sie ohne einen einzigen Schrittfehler dreimal im Kreis um das Freudenfeuer und dann hinauf zum Thron. Eigentlich sollte es sich um das Ei einer Natter handeln, doch Alobar hatte den Verdacht, es sei das Produkt von Noogs Elster.
Wie auch immer, Wren hob es graziös an Alobars Lippen, und während die Sänger schwiegen und die Tänzer in ihren Bewegungen innehielten, schluckte er es hinunter. Sofort begann er, sich zu winden. Sein Gesicht nahm die Farbe der Tannenzweige an. Er stürzte vom Thron und landete mit weit heraushängender grüner Zunge kopfüber im Matsch. Noog kam herbei, reinigte die Krone, die ein paar Spritzer abbekommen hatte, und setzte sie auf das Haupt des jungen Helden, der bereits Alobars Platz auf dem Thron eingenommen hatte. Alobar trat mit beiden Stiefeln aus, dann lag er regungslos da.
Der neue König wischte mit einer kurzen Handbewegung einen Klecks grünen Schaums vom Thron. Er hob seinen Speer und lächelte. In der Stadt brach Jubel aus, der jedoch nur von kurzer Dauer war, da Mik auf den bronzenen Thron losstürzte und dem neuen Inhaber des Platzes das Bein abgebissen hätte, wäre er nicht daran gehindert worden. Kaum war der Hund gebändigt, als von neuem ein Fauchen zu hören war. Diesmal stammte es von Frol, der vierzehnjährigen Konkubine, die zum Entsetzen der Menge den Zauberspiegel aus ihrem Umstandskleid hervorzog und ihn auf den Scheiten des Freudenfeuers zerschmetterte.
Der Grabhügel lag außerhalb der Stadtmauern auf einem freien Feld, das übersät war mit Kuhfladen und großen Steinen. Die Steine waren in geometrischen Mustern angeordnet, denen die Götter, so hoffte man, eine Bedeutung zumaßen. Die Kuhfladen waren vermutlich rein zufällig an ihren jeweiligen Platz gefallen, wenngleich es damals wie heute außerordentlich schwierig erscheint, die Trennlinie zu ziehen zwischen dem, was zufälliger Natur, und dem, was Absicht ist.