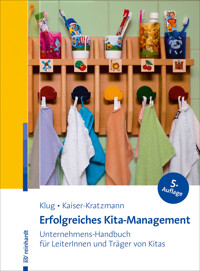28,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Ernst Reinhardt Verlag
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Deutsch
Mit der Methode des Case Management können Probleme der Kooperation und Koordination von Dienst- und Gesundheitsleistungen minimiert werden, die Versorgungsleistung wird so optimiert. Die Beiträge des Buches vermitteln einen Einblick in Case Management, mit Schwerpunkten im Bereich der Sozialen Arbeit. In den Beiträgen werden theoretische und praktische Fragen zum Case Management beantwortet: generelle und spezifische Anwendung von Case Management, Qualifizierungsfragen im Case Management, Fall- und Systemsteuerung. Das Buch ist für Praktiker geeignet, für die Case Management zum Handwerkszeug gehört, sowie für Studium und Lehre.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2018
Ähnliche
Prof. Dr. Peter Löcherbach, Dipl. Päd., Dipl. Soz.-Päd. (FH), Professor für Sozialarbeitswissenschaft an der Kath. Hochschule Mainz und Vorsitzender der DGCC
Prof. Dr. Wolfgang Klug, Dipl. Soz.-Päd. (FH), Professur für Methoden der Sozialen Arbeit an der Katholischen Universität Eichstätt-Ingolstadt
Prof.in Ruth Remmel-Faßbender, Dipl. Päd., Dipl. Soz. Arb. (FH), Dipl. Rel. Päd. (FH), Professorin für Interventionslehre an der Kath. Hochschule Mainz
Prof. Dr. phil. Wolf Rainer Wendt, Dipl.-Psych.; Duale Hochschule BW Stuttgart
Alle vier HerausgeberInnen sind Case Management Ausbilder (DGCC).
Bibliografische Information der Deutschen Nationalbibliothek
Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen Nationalbibliografie; detaillierte bibliografische Daten sind im Internet über <http://dnb.d-nb.de> abrufbar.
ISBN 978-3-497-02824-5 (Print)
ISBN 978-3-497-61008-2 (PDF-E-Book)
ISBN 978-3-497-61009-9 (EPUB)
5. Auflage
© 2018 by Ernst Reinhardt, GmbH & Co KG, Verlag, München
Dieses Werk, einschließlich aller seiner Teile, ist urheberrechtlich geschützt. Jede Verwertung außerhalb der engen Grenzen des Urheberrechtsgesetzes ist ohne schriftliche Zustimmung der Ernst Reinhardt GmbH & Co KG, München, unzulässig und strafbar. Das gilt insbesondere für Vervielfältigungen, Übersetzungen in andere Sprachen, Mikroverfilmungen und für die Einspeicherung und Verarbeitung in elektronischen Systemen.
Printed in EU
Cover: © iStock.com / Photo_Concepts
Satz: JÖRG KALIES – Satz, Layout, Grafik & Druck, Unterumbach
Ernst Reinhardt Verlag, Kemnatenstr. 46, D-80639 München
Net: www.reinhardt-verlag.de · E-Mail: [email protected]
Inhalt
Vorwort
Grundlagen
Case Management
Stand und Positionen in der Entwicklung von Programm und Verfahren
Von Wolf Rainer Wendt
Case Management im US-amerikanischen Kontext
Anmerkungen zur Bilanz und Folgerungen für die Weiterentwicklung von Case Management in Deutschland
Von Wolfgang Klug
Case Management als Handlungskonzept der Sozialen Arbeit
Erfahrungen und Perspektiven
Von Ruth Remmel-Faßbender
Ergebnisse und Anwendungen
Case Management in der Sozialpädiatrie
Das Modell Bunter Kreis
Von Waltraud Baur, Andreas Podeswik, Horst Erhardt, Friedrich Porz
Beschäftigungsorientiertes Fallmanagement im SGB II
Von Rainer Göckler
Case Management in der Suchtkranken- und Drogenhilfe
Ergebnisse aus zwei Modellprojekten
Von Martina Schu
Dienstleistungsketten und Produktionsnetzwerke – die „Systemebene“ des Case Managements
Von Claus Reis
Case Management mit alten pflegebedürftigen Menschen
Lehren aus einem Modellversuch
Von Michael Wissert
Case Management in Strafvollzug und Straffälligenhilfe:
Allgemeine Grundlagen und spezifische Erfordernisse
Von Wolfgang Wirth, Birgit Grosch
Perspektiven
Qualifizierung im Case Management
Bedarf und Angebote
Von Peter Löcherbach
Anhang
Literatur
Die Autorinnen und Autoren
Sachregister
Vorwort
Case Management ist zu einem verbreiteten Handlungsansatz im Sozial- und Gesundheitswesen geworden. Interessiert an ihm sind SozialarbeiterInnen, Pflegefachkräfte und andere Berufsgruppen in Humandiensten. Case Management verspricht ein effektives und effizientes Arbeiten und eine bessere Gestaltung des Vorgehens, insbesondere bei komplexen Problemen. Aus ökonomischen Gründen sind daran auch die Leistungsträger und sozialpolitischen Akteure interessiert und entwickeln für verschiedene Anwendungsbereiche Modelle, die sie mit dem Begriff „Case Management“ belegen. Der vielfältige und durchaus uneinheitliche Einsatz des Verfahrens bedarf nun allerdings in Theorie und Praxis einer kritischen Begleitung, die sich am Konzept des Case Managements orientiert und es für den Alltag im Berufsfeld wie für die Ausbildung erläutert. Das ist der Zweck des vorliegenden Buches.
In seiner Anwendung werden die Möglichkeiten, die das Verfahren bietet, oft nicht hinreichend genutzt. Das Konzept ist offen und variabel genug, um es auch in einzelnen Ausschnitten zu dem Zweck einzusetzen, die bisherige Praxis zu verbessern. Das bringt die Gefahr mit sich, dass Flickschusterei betrieben wird und das Ergebnis für die Beteiligten enttäuschend ausfällt. Das Potenzial von Case Management wird nicht ausgeschöpft, wenn es nur auf der Ebene eines einzelnen Dienstes oder gar nur von der einzelnen Fachkraft als Methode eingesetzt wird und nicht mit einer Organisationsentwicklung verbunden ist, in der das Konzept des Case Managements als Prinzip der Systemsteuerung genutzt wird.
In diesem Band werden aus verschiedenen Perspektiven der Verwendungszusammenhang des Case Managements, damit verbundene Probleme und Ausbildungsanforderungen dargestellt. Der erste Teil bezieht sich auf übergreifende theoretische, methodische und forschungsrelevante Fragen zur aktuellen Positionierung von Case Management im deutschsprachigen Raum. Hier werden wesentliche Entwicklungslinien der letzten Jahre aufgezeigt, um Case Management in der Vielfalt der humandienstlichen Versorgungsgebiete und Versorgungswege systematisch zu verorten.
Im ersten Beitrag reflektiert Wolf Rainer Wendt zunächst die Bedeutung des Fallbezugs und des Systembezugs im Verfahren des Case Managements. Er zeigt auf, dass das methodische Vorgehen im Einzelfall letztlich nicht optimal realisiert werden kann, wenn nicht gleichzeitig auch Veränderungen auf der systemsteuernden Ebene erfolgen, also sich eine Organisationsentwicklung vollzieht. Unterschiede in den Begrifflichkeiten und Konzepten von Care und Case Management sowie Managed Care werden, auch in ihrer Beziehung zueinander, verdeutlicht. Es wird ein praxisbezogener Überblick über den zunehmenden Einsatz von Case Management in der stationären und ambulanten Versorgung von Kranken und Pflegebedürftigen, in der Altenhilfe, der Suchtkranken- und Wohnungslosenhilfe, der Sozialhilfe, der Jugendhilfe, der Rehabilitation, der Straffälligenhilfe und der Psychiatrie gegeben. Die Vielfalt der Anwendungen ist Ausdruck einer Entwicklung (die auch verstärkt gesetzlich verankert wird) hin zu effektiveren und effizienteren integrierten Versorgungssystemen. Dabei werden gelingende, vorbildliche Entwicklungen ebenso aufgezeigt wie Probleme, die durch eine fragmentierte Anwendung, mangelnde Rollenklärung und strukturbedingte Reibungsflächen bei der Implementierung entstehen.
Der Beitrag von Wolfgang Klug behandelt die Einführung von Case Management im „Ursprungsland“ USA und den Stand der Forschung zum Verfahren. Die Entwicklung von Standards für die Ausgestaltung der verschiedenen Phasen des Case Managements sowie die Entwicklung von Kriterien zur Evaluation sind dabei zentrale Fragestellungen. Nach einem Rückblick auf den Entstehungszusammenhang in den USA ab den 1970er Jahren und die Ausdifferenzierung nach zielgruppenspezifischen Konzepten in den 1990er Jahren verweist Klug auf die Bedeutung, die „Obamacare“ dem Einsatz von Case Management verliehen hat. Sodann setzt sich Klug kritisch mit der oft vorzufindenden einseitigen ökonomischen Orientierung im Case Management-Verfahren auseinander. Er zeigt die programmatischen Leitlinien auf – im Streben nach Effizienz und Effektivität, Qualitätsstandards, Kundenorientierung und in der Empowerment-Haltung –, die der Implementierung und Verbreitung des Konzepts zugrunde liegen. Ebenso setzt er sich (auch unter berufsethischen Fragestellungen) mit der Bedeutung und Zielsetzung unterschiedlicher Auftraggeber auseinander und benennt Konsequenzen, auch auf der Systemebene, für eine Nutzung von Case Management in Deutschland.
Ruth Remmel-Faßbender setzt sich mit Fragen des Case Managements als einem spezifischen Methodenkonzept Sozialer Arbeit auseinander. Sie zeigt den zögerlichen Weg mit vielen Vorbehalten von Sozialprofessionellen seit den Anfängen mit dem Verfahren in Deutschland bis zu seiner Etablierung in vielen Arbeitsfeldern mit komplexen Problemlagen auf. Dabei wird einerseits der Einfluss gesellschaftlicher Veränderungen, deren Bedeutung für veränderte Problemsituationen, der stärker werdende Ökonomisierungsdruck und die damit verbundene Qualitätsentwicklung als Wegbereiter für Case Management analysiert, andererseits werden fachliche Anforderungen benannt, die zum konkreten Einsatz von Case Management in vielen Handlungsfeldern geführt haben. Sie reflektiert kritisch Einwände und Missverständnisse eines technokratischen, routinemäßig anmutenden Verfahrens im Rahmen einer personenbezogenen Dienstleistung, verdeutlicht aber am Beispiel konkreter Arbeitsfelder und gesetzlicher Grundlagen die Chancen des Verfahrens für die Ausgestaltung einer individuellen bedarfsgerechten Hilfe, auch wenn in der Praxis noch Klärungs- und Handlungsbedarf hinsichtlich organisationsbezogener Rahmenbedingungen und Rolle von Case ManagerInnen in der Steuerung von Hilfe- und Versorgungsprozessen bestehen.
Die Beiträge im zweiten Teil des Buches beschäftigen sich mit praktischen Anwendungen in verschiedenen Handlungsfeldern der Sozialen Arbeit und des Gesundheitswesens. Sie analysieren Entwicklungen von Case Management in unterschiedlicher Weise, richten ihr Augenmerk auf einzelfallbezogene wie auf systembezogene Aspekte. Sie setzen sich dabei auch mit Grenzen, Widerstandserfahrungen und der notwendigen Veränderung von Strukturbedingungen auseinander.
Waltraud Baur, Friedrich Porz, Horst Erhardt und Andreas Podeswik schildern das an der Augsburger Kinderklinik entwickelte interdisziplinäre Nachsorgemodell für Früh- und Risikogeborene sowie chronisch- und schwerstkranke Kinder und deren Familien. 90 Nachsorgezentren in Deutschland praktizieren das Modell inzwischen. Case ManagerInnen (das können je nach medizinisch-therapeutischen oder psychosozialen Erfordernissen KrankenpflegerInnen oder SozialpädagogInnen sein) werden einer Familie möglichst frühzeitig, also bereits während der stationären Versorgung ihres Kindes, an die Seite gestellt. Sie haben die Aufgabe, durch Schaffung und Koordination eines Betreuungsnetzes und dessen Steuerung einen optimalen Übergang von der Klinik zur häuslichen Betreuung sicherzustellen. Dies geschieht durch sektorübergreifende, multiprofessionelle Koordination, unabhängig von der fachlichen, hierarchischen oder institutionellen Zuordnung, und in enger Zusammenarbeit mit den Eltern. Oberstes Ziel ist dabei, die Eigenkompetenz der Familien zu unterstützen und eine erfolgreiche Integration der kranken Kinder zu ermöglichen. Insbesondere wird in dieser Praxis der Blick vom erkrankten Kind auf eine Stabilisierung des gesamten familiären Systems erweitert. Fragen der Schulung von Case ManagerInnen, der erreichten, aber noch ungenügenden Finanzierung, der Qualitätssicherung, Evaluation und Begleitforschung werden erörtert.
Integration in Arbeit ist zu einem besonders gewichtigen Einsatzgebiet des Case Managements geworden. Rainer Göckler stellt auf der gesetzlichen Grundlage des SGB II (besser bekannt unter dem Kürzel „Hartz IV“) die Entwicklung und Grundkonzeption des beschäftigungsorientierten Fallmanagements dar. Der Begriff des „Fallmanagements“ wird im Sinne eines individuellen Case Managements definiert, die einzelnen Prozessschritte werden differenziert erläutert. Neben den fallbezogenen Aktivitäten geht Göckler auf die organisatorischen Erfordernisse für eine sinnvolle Umsetzung im Jobcenter bzw. einer Agentur für Arbeit ein. Das reicht von Fragen der fallübergreifenden Differenzierung der KundInnen, über die Steuerung von Unterstützungsprozessen bis hin zu Aspekten der Feldverantwortung im regionalen Kontext. Das Fachkonzept hat für die Entwicklung von Standards in der Beschäftigungsförderung und der Begleitung von Arbeitsuchenden eine Pilotfunktion erfüllt. Die Bundesagentur für Arbeit ist zum größten Ausbilder von Case ManagerInnen geworden. Die Diskussion ihres Einsatzes, ihrer Zuständigkeiten und der strukturellen Gegebenheiten im Umgang mit den komplexen Problemen bei Arbeitslosigkeit und ihrer Überwindung dauert indes an.
Im nächsten Beitrag beschreibt Martina Schu die Entwicklung von Case Management in der Suchtkranken- und Drogenhilfe anhand der Ergebnisse zweier Modellprojekte. Sie zeigt differenzierte Erfolge auch hinsichtlich der Unterschiede bei der Abhängigkeit von verschiedenen Suchtmitteln auf. Die Bedeutung aufsuchender und aktiv nachgehender Hilfen bei mehrfachbeeinträchtigten Abhängigen wird besonders betont. In Kombination mit Motivational Interviewing konnten mit dem Ansatz viele Suchtkranke erreicht werden, die noch nie vorher die Hilfe von Fachkräften angenommen hatten. Schu betont besonders die Qualität der professionellen Beziehungsarbeit als einen zentralen Faktor für die Motivation zur Inanspruchnahme des Case Managements. Die Ziele der individuellen Betreuung gingen über die Suchtprobleme allerdings weit hinaus. Kritisch merkt sie auch die teilweise mangelnde Qualifikation der Case ManagerInnen an. Sie benennt Widerstände in den Einrichtungen, die die Arbeit der Case ManagerInnen eher behinderten bzw. diesen nicht den bestmöglichen Zugang zu bestimmten Ressourcen ermöglichten.
Die Systemsteuerung im Ablauf vernetzten Handelns im Case Management ist Gegenstand der Ausführungen von Claus Reis. Exemplarisch zeigt sich in der Migrationsarbeit, dass es für die vielen Geflüchteten auf verlässliche Unterstützungsstrukturen ankommt, in denen die vielfältigen Hilfen zur Integration koordiniert und kontinuierlich vollzogen werden können. Reis diskutiert die Bildung von Dienstleitungsketten bei bestimmten Fallkonstellationen. In einem „Produktionsnetzwerk“ von Akteuren lässt sich unter Nutzung der in ihm vorhandenen Ressourcen das individuelle Case Management vollziehen. Das Netzwerk ist auf die Verteilung von Macht, Kompetenz und Interessen in ihm zu besehen. Deren Balancierung, die Auswahl von Partnern, die Regulierung der Zusammenarbeit und eine stete Engagementförderung sind Aufgabe eines Netzwerkmanagements, das der Produktivität und auch der individuellen Fallführung die Bahnen bereitet. Der Einzelfall wird, so Reis, nach organisatorisch und professionell geprägten Handlungsmustern bearbeitet, mit deren Konstruktion sich die Theorie und die Forschung im Case Management befassen sollten.
Michael Wissert stellt anhand eines Modellversuchs in Berlin, der das Ziel hatte, bei alten Menschen zwischen 70 und 85 Jahren eine nicht erwünschte Heimunterbringung abzuwenden oder zeitlich hinaus zu zögern, Anforderungen an das Case Management in der Altenhilfe dar. Besondere Bedeutung kommt dabei der Selbstbeurteilung der alten Menschen und ihrer Zustimmung zu den vorgeschlagenen Hilfen zu. Diese können je nach ermitteltem Bedarf von rehabilitativ-therapeutischen Hilfen über Unterstützung im Haushalt bis zu baulichen Wohnungsanpassungen reichen. Über die Hälfte der im Modellvorhaben aufgenommenen Personen, die von Heimunterbringung bedroht waren, konnte mit Hilfe des Case Managements nach Hause zurückkehren, wobei auch die subjektive Befindlichkeit sich besserte. Institutionelle und personenbezogene Erschwernisse, angefangen von Kommunikationsproblemen bis hin zu interdisziplinären Vorbehalten, erschwerten u.a. eine effektivere Arbeit des externen Beratungsteams.
In den letzten Jahren hat das Case Management Einzug gehalten in den Bereich des Strafvollzugs und der Straffälligenhilfe. Wolfgang Wirth und Birgit Grosch zeigen auf, dass nur durch ein professionelles und institutionalisiertes Übergangsmanagement bedarfsgerecht auf die multiplen Problemlagen der (ehemaligen) Gefangenen fachlich umfassend reagiert werden kann. Nordrhein-Westfalen ist in Deutschland das erste Bundesland, das landesweit die (Re-)Integration nach den Standards des Case Managements umsetzt. Aufgrund ihrer langjährigen Erfahrung im Feld betonen Wirth und Grosch, wie wichtig nicht nur die Fall- und Netzwerksteuerung ist, sondern dass eine Implementationssteuerung die systematische Koordinierungsleistung zur Institutionalisierung des Handlungskonzeptes in der Justiz adressiert. Sie kommen zu dem Schluss, dass Case Management zwar ein voraussetzungsvolles, gleichzeitig aber auch das am besten geeignete Handlungskonzept zur effektiven Gestaltung der Übergänge aus der Haft in die Freiheit ist, wenn die (Re-) Integrationsleistung als kooperativer Prozess verstanden um umgesetzt wird.
Der letzte Teil des Buches widmet sich den Perspektiven des Case Managements. Peter Löcherbach befasst sich mit dem Anforderungsprofil eines/einer Case ManagerIn. Er vermittelt, was von Case ManagerInnen auf verschiedenen Ebenen an unterschiedlichen Kompetenzen erwartet wird. Für das Programm und das Verfahren lässt sich ein mehrdimensionales Qualifikationsprofil darstellen, das neben dem beruflichen Selbstverständnis die Bereiche Sach- und Systemkompetenz, Methoden- und Verfahrenskompetenz, Soziale Kompetenz sowie Selbstkompetenz umfasst. Die Ausführungen machen deutlich, wie wichtig gezielte Aus- bzw. Fortbildungsangebote für diesen Bereich sind. Eine Analyse der zertifizierten Weiterbildungsangebote verdeutlicht die Relevanz verbindlicher Standards und deren Entwicklung in Deutschland, der Schweiz und Österreich. Er schließt den Beitrag und den Band mit einem Ausblick auf die Zukunft von Case Management ab.
Die Darstellungen zeigen, wie und bei welchen Problemsituationen Case Management sinnvollerweise als Verfahren konkret angewandt werden kann und wo eine weitere Qualifizierung der Praxis und Forschung notwendig ist. Der Stand der Dinge ist das eine; dass sie sich ändern, das andere und ein Motiv für methodische und organisatorische Entwicklungsarbeit. Methodische und organisatorische Entwicklungsarbeit ist gefragt. Wir wünschen uns, dass die Diskussion über interessante und fruchtbare Anwendungen und die weitere Ausgestaltung von Case Management im Sozial- und Gesundheitswesen mit diesem Buch fortgesetzt wird.
In die vorliegende 5. Auflage wurden die Texte von Claus Reis und Wolfgang Wirth und Birgit Grosch neu aufgenommen. Im Übrigen haben die Autoren Verbesserungen und Ergänzungen vorgenommen, ohne die wesentlichen Aussagen ihres Beitrags und den Charakter des Buches gegenüber vorherigen Auflagen zu ändern. Das Programm des Case Managements bleibt ein „work in progress“, und dieser Status sei dem Buch mit auf den Weg gegeben.
Um eine bessere Lesbarkeit zu gewährleisten, wird in diesem Buch nicht an allen Stellen durchgängig gegendert. Es sind jeweils alle Geschlechter gemeint.
Mainz, im Juni 2018
Die Herausgeber
Grundlagen
Case Management
Stand und Positionen in der Entwicklung von Programm und Verfahren
Von Wolf Rainer Wendt
Im Sozialwesen und Gesundheitswesen in Deutschland, Österreich und der Schweiz sowie international ist von Case Management viel – und immer mehr – die Rede. Es geht um die Optimierung von Prozessen der humandienstlichen Versorgung, um Prozessverantwortung und Fallführung, um Aktivierung von Selbsthilfe und um Durchsichtigkeit des Verfahrens für alle Beteiligten. Aber oft ist dort, wo Case Management drauf steht, Case Management nicht drin. Seine Einführung bedeutet und verlangt eine Systemveränderung; erfolgt sie nicht, setzt sich das Case Management als Programm und als Verfahren nicht wirklich durch. Allein mit dem Einsatz eines Case Managers oder einer Case Managerin wird das Handlungskonzept nicht systematisch und erfolgreich realisiert.
In der Systematik seines Verfahrens zielt das Case Management auf eine integrierte Versorgung bei Nutzung formeller und informeller Ressourcen. Im zeitlichen Ablauf soll eine bruchstückhafte Versorgung vermieden und eine rationelle Leistungserbringung erreicht werden. Dem Case Management wird Zweckmäßigkeit und Wirksamkeit an jeder Stelle abverlangt, und das Vorgehen soll für alle Beteiligten geklärt sein. Die Durchsichtigkeit ist eine Bedingung dafür, dass Maßnahmen in ihrem Nacheinander aufeinander abgestimmt werden können und dass sich in einem Verbundsystem kontrollieren und evaluieren lässt, was wann wo geschieht oder geschehen ist. Nicht zuletzt ist man in der heute verlangten Qualitätssicherung und bei der Qualitätsentwicklung in Sozial- und Gesundheitsdiensten darauf angewiesen, die Wege, Ansatzpunkte und Entscheidungen im Einzelfall verfolgen, prüfen und bewerten zu können.
1Organisation und Handeln
Unterschieden werden muss zwischen Case Management als methodischem Konzept auf der personalen Handlungsebene und Case Management als Organisations- oder Systemkonzept in administrativer Funktion. Hier wie dort geht es um die wirksame Handhabung und Gestaltung von Prozessen. Aber wer auf der Organisationsebene von Case Management spricht, meint nicht ohne weiteres die professionelle Methodik und den Handlungsablauf im Management eines Einzelfalles, worin bei möglichst weitgehender Abstimmung mit den NutzerInnen planmäßig, koordiniert und kontrolliert vorgegangen wird. Hat man andererseits die personenbezogene Methode Case Management im Blick, ist zu bedenken, dass sie in Humandiensten nur dann erfolgreich eingesetzt werden kann, wenn sie mit einer Organisationsentwicklung verbunden ist, welche die Strukturen der humandienstlichen Versorgung auf die prozessualen Anforderungen des Case Managements abstimmt und ihm das Netzwerk zur Koordination und Kooperation der beteiligten Stellen und Fachkräfte schafft.
Da sich die Gegebenheiten und Aufgaben in den einzelnen Handlungsfeldern unterscheiden, ist das Programm des Case Managements in Varianten ausgeprägt, u. a. unterscheidet man:
Disease Management-Programme für chronisch Kranke
Versorgungs- und Entlassmanagement bei stationärer Krankenbehandlung
Teilhabemanagement in der Hilfe bei Behinderung
Beschäftigungsorientiertes Fallmanagement zur Integration in Arbeit
Besorgungsmanagement in der rechtlichen Betreuung
Straffälligen- und Übergangsmanagement bei Sozialdiensten der Justiz.
Das Grundmuster des Verfahrens wird als bekannt vorausgesetzt. Das Case Management ist zunächst als Arbeitsweise in der professionellen Sozialarbeit rezipiert worden. Hier wird primär das nutzer- und ressourcenorientierte Vorgehen bei der Unterstützung im Einzelfall ins Auge gefasst und systematisch in den Dimensionen/Schritten/Stadien ihrer Ablauforganisation bedacht. Ein individuelles Case Management erfolgt in der direkten personenbezogenen Arbeit. Es beginnt mit der Entscheidung über das Engagement in einem Fall, verläuft über die Situations- und Bedarfsklärung, die Planung des Vorgehens, ihre koordinierte und kontrollierte Umsetzung und endet nach Vereinbarung mit der abschließenden Feststellung des Erfolgs der gemeinsamen Bemühungen. Allerdings kann sich ein/eine einzelne/r SozialarbeiterIn in einem Dienst oder in einer Einrichtung nicht für das Case Management als „ihre“ Methode entscheiden: die Organisationsstruktur muss das zulassen. Nur wenn der/die SozialarbeiterIn selbstständig in freier Berufsausübung tätig und der Einsatz mithin identisch ist mit dem Dienstbetrieb, kommt das Systemkonzept Case Management unmittelbar überein mit dem methodischen Konzept des personenbezogenen professionellen Arbeitens.
Zum Verständnis dieses individualisierten Managements in einem Versorgungsregime ist zu bemerken (und kann nicht oft genug betont werden), dass „case“ hier nicht für den Menschen steht, sondern für seine problematische Situation, die es – im Ganzen und im Detail – zu bewältigen gilt. Sie „ist der Fall“ und Gegenstand der ziel- und lösungsorientierten professionellen Bemühung. Sie ist auch Gegenstand des Bewältigungsverhaltens (coping behaviour) und der Selbsthilfe der zu versorgenden Person, seiner Angehörigen und der Mitwirkung von anderen HelferInnen. Im ganzen Verlauf des personbezogenen Case Managements wird die subjektive Fallauffassung von Betroffenen mit der mehr oder minder objektiven Fallauffassung beteiligter Fachkräfte abgeglichen. Die gemeinsame Reflexion und Verständigung darüber, „was der Fall ist“, führt zur Zusammenarbeit der Beteiligten. Man verstieße gegen die Autonomie einer Person und missachtete ihre Selbstsorge und mündige Mitwirkung, betrachtete man die Person als „Fall“. Im Case Management wird der Prozess der Bewältigung bzw. der Weg zur Lösung einer Problematik gemanagt. Was der Fall ist, lässt sich immer nur ad hoc feststellen und bleibt individuell.
Im Rahmen der Gesundheitsreformen hat dagegen ein „Fallmanagement“ in das stationäre und ambulante Medizinsystem und neuerdings in die „integrierte“ Versorgung von Kranken und Pflegebedürftigen Einzug gehalten, mit dem überindividuell ein effektives und effizientes Vorgehen erreicht werden soll. Hier geht es vornehmlich um die Systemsteuerung (Optimierung der Versorgungsstrukturen und -prozesse). Dafür ist eigentlich eher der – oft mit Case Management gleichgesetzte – Begriff „Care Management“ angebracht. Er bezeichnet die überindividuelle Versorgungssteuerung und Versorgungsgestaltung als administrative Aufgabenstellung. Für die Steuerung der Gesundheitsversorgung hat überdies der amerikanische Begriff „Managed Care“international Verbreitung gefunden. Er wird auch für die „integrierte Gesundheitsversorgung“ – seit längerem schon in der Schweiz (Müller 1997; Finsterwald 2004) und nach und nach in Deutschland – in Anspruch genommen (Wiechmann 2003; Amelung 2011; Weatherly 2016). Managed Care ist ein Konzept, zu dem Case Management im Gesundheitssektor oftmals in Beziehung gesetzt wurde und wird. Im deutschsprachigen Raum kann auf die Publikationen des Bundesverbandes Managed Care e.V. und auf „Care Management. Zeitschrift für Managed Care, Qualität und E-Health“ im Schweizerischen Ärzteverlag EMH verwiesen werden.
Ein wesentlicher Fortschritt im Verständnis und in der Anwendung von Case Management besteht nun darin, die Steuerung der humandienstlichen Leistungserbringung (als Versorgungsmanagement) auf die Steuerung des Prozesses der Aufgabenbewältigung im Einzelfall (als methodischem Case Management einzelner professionell Handelnder) abzustimmen. Informationstechnologisch sind hier die Software-Anbieter zur Stelle. Sie nennen ihre Programme „Case Management“ oder „Case Manager“, mit denen der Dienst die Verwaltung der Daten in den Griff bekommt und sie auf der Organisationsebene verfügbar hält. Diese Art „Fallführung“ entlastet die tatsächliche Systemsteuerung, ändert sie aber nicht. Zum Beispiel bleibt die Verteilung von Zuständigkeiten auf viele Stellen wie sie ist, wenn der Datenfluss zwischen ihnen programmiert und beschleunigt wird.
Eine Strukturveränderung wird indes unabdingbar, wenn wir die Nutzerorientierung radikaler begreifen. Die Adressaten von Humandiensten sind für ihr Ergehen erst einmal selbst verantwortlich und potenziell Case Manager in eigener Person, insbesondere wenn sie von sich aus das Leistungssystem in Anspruch nehmen. In der Komplexität heutiger Lebensführung wird das Zurechtkommen einer Person oder Familie zu einer Managementaufgabe: Das formelle Management der Unterstützung oder Behandlung muss an das informelle life management oder Selbstmanagement derjenigen, die Humandienste in Anspruch nehmen, anschlussfähig sein. Oft ist die Entwicklung des Selbstmanagements sogar das Ziel des Verfahrens, etwa bei chronisch Kranken, die mit ihrer Situation zurechtkommen müssen (Rantz/Scott 1999). In anderen Fällen ergänzt und stärkt das formelle Case Management von der Systemseite her die informellen Bewältigungsbemühungen. Das Verfahren setzt auf Kompetenz und Partizipation. Die NutzerInnen bestimmen mit und stimmen ab. Ihr Gegenüber sind regelmäßig verschiedene Professionelle, Leistungsträger und Leistungserbringer, die bei integrierter Versorgung Abstimmungsbedarf haben – und Case ManagerInnen für die Koordination untereinander und die Kooperation mit dem/der NutzerIn einsetzen.
Eine funktionale Verknüpfung von allen Dimensionen des Case Managements auf der Ebene der Systemsteuerung (Zugang und Auslese der Klientel, Bedarfserhebung im Sozialraum, Versorgungsplanung, Kontrolle der Durchführung, Evaluation und Rechenschaftslegung) mit allen Dimensionen von Case Management auf der Ebene des Handelns im Einzelfall (Fallaufnahme, Bedarfsklärung, Hilfe- und Behandlungsplanung, Begleitung bei der Leistungserbringung, Evaluation und Dokumentation) erfolgt allerdings noch selten. Oft werden nur einzelne Schritte in der Versorgungssteuerung vollzogen. Man wählt aus den Dimensionen des Verfahrens „Schlüsselprozesse“ aus, um Abläufe in den Diensten zu verbessern, etwa indem man den Zugang zu Humandiensten „niedrigschwelliger“ gestaltet, die Bedarfsklärung im Assessment optimiert, es in die Planung von Hilfen einbezieht und den Prozess der Hilfeplanung so mit deren Umsetzung und Kontrolle verbindet, dass dieser Prozess sich zum Case Management der Stelle ausweitet, die für die Planung zuständig ist. Öfter finden wir die einzelnen Schritte aber auf verschiedene Dienste verteilt, so dass kein durchgehendes Case Management stattfindet und keine einheitliche Fallführung gegeben ist. Neue gesetzliche Regelungen – insbesondere zum Verhältnis Leistungsträger-Leistungserbringer-Leistungsnehmer – dürften uns hier mit der Festlegung von Zuständigkeit und der Zuweisung von Verantwortung weiter bringen.
2Zuständigkeit und Fallführung
In der Fallführung spielen Case ManagerInnen eine unterschiedliche Rolle, je nachdem, wer sie zu welchem Zweck einsetzt. Der Autor hat die Rollen von Case ManagerInnen (1) als SystemagentInnen, (2) als KundenanwältInnen, (3) als VersorgungsmanagerInnen und (4) als DienstemaklerInnen beschrieben (Wendt 2015, 190ff.). Praktisch kommt vor allem die Rolle als „VersorgungsmanagerIn“ zum Tragen. Im Gesundheitswesen sind seit Ende der 1990er Jahre die Leistungsträger unter der Devise „vom Payer zum Player“ mit der Anwendung des Case Managements vorangegangen, um zumindest in kostenintensiven Fällen die Fäden in der Hand zu haben und den Aufwand zu reduzieren. Die Rede ist vom Fallmanagement (oder von Fallsteuerung) der Krankenkassen. Sie nennen es auch gerne „Gesundheitsmanagement“, „Gesundheitscoaching“ oder „Patientenbegleitung“ und stellen dafür Fachkräfte ein, die sie intern schulen. Man legt Wert auf gute Zusammenarbeit mit den Leistungserbringern. Optimiert werden soll die Kommunikation zwischen Klinik und Kasse.
Der Kostenträger hat ein ökonomisches Interesse an der Optimierung von Versorgungsverläufen und der Vermeidung andauernder oder wiederholter stationärer Unterbringung bzw. der Chronifizierung von Leiden. Er übernimmt deshalb eine Versichertenbetreuung per „Krankenhausberatung im Vorfeld“ (über Versorgungsalternativen), „administrative Unterstützung während des Krankenhausaufenthaltes“ und „Hilfe für den Versicherten nach der Krankenhausbehandlung“. So begann etwa die BARMER Ersatzkasse schon 1997 damit, ihre Krankengeldausgaben „fallbezogen zu managen“. Wie das geschieht, erläuterte die Kasse in ihren Internet-Informationen seinerzeit an folgendem Beispiel:
BEISPIEL
„Eine Kindergärtnerin im öffentlichen Dienst war in den letzten Jahren immer wieder arbeitsunfähig. Die Erkrankungen wechselten, zunächst eine Grippe, dann Gastritis, Erschöpfungszustände sowie weitere krankhafte Symptome folgten. Von Mal zu Mal dauerte die Arbeitsunfähigkeit länger. Die BARMER schaltete den Medizinischen Dienst der Krankenkassen ein, dessen Gutachter darauf hinwies, dass möglicherweise psychosoziale Probleme die eigentliche Ursache der immer wiederkehrenden Krankschreibung sein könnten.
Eine Vermutung, die sich im Gespräch mit der Versicherten bestätigte: Sie werde von den Kolleginnen in ihrem Kindergarten gemobbt, die große psychische Belastung führe zu körperlichen Beschwerden, die Arbeitsunfähigkeit folgt da schon fast zwangsläufig. Am Ende des Gespräches stand ein Angebot: Die BARMER versucht im Gespräch mit dem Arbeitgeber, der Kindergärtnerin einen Wechsel in einen anderen Kindergarten zu ermöglichen. Der Wechsel klappt, der Kreislauf von Mobbing und Krankheit ist gestoppt. Hätte die BARMER nicht steuernd eingegriffen, würde die Kindergärtnerin wahrscheinlich heute noch unter ihrer Situation leiden, würde die BARMER immer wieder Krankengeld zahlen, würde am Ende vielleicht eine Frührente stehen“ (www.barmer.de).
Ein Versorgungsmanagement übernehmen die Kassen in solchen Fällen auch, wenn die unmittelbaren Dienstleister, die ÄrztInnen, kein Case Management betreiben, also dem Fall über ihr diagnostisch-therapeutisches Handeln und die Bescheinigung der Arbeitsunfähigkeit hinaus nicht nachgehen.
Mit der mangelnden Versorgungsintegration hat sich seinerzeit (2001) der Sachverständigenrat für die Konzertierte Aktion im Gesundheitswesen im Band III seines Gutachtens „Bedarfsgerechtigkeit und Wirtschaftlichkeit“ unter dem Titel „Über-, Unter- und Fehlversorgung“ befasst (Sachverständigenrat 2001). Der Rat kommt im Vergleich der vorgefundenen Verhältnisse mit den Erfordernissen zu „Neuen Regeln für das System der Gesundheitsversorgung“, die als ein Rahmenwerk für den Einsatz von Case Management gelesen werden können (Tab. 1).
Tab. 1: Neue Regeln für das System der Gesundheitsversorgung im 21. Jahrhundert
Gegenwärtiger Ansatz
Neue Regeln
Umsetzungsmöglichkeiten
Die Versorgung basiert primär auf Besuchen.
Die Versorgung basiert auf dauerhaften Heilbeziehungen(healing relationsships).
Langzeitbetreuung; Sicherung der Rehabilitationserfolge; verhaltensbezogene Maßnahmen der Risikomodifikation
Die professionelle Autonomie verursacht eine Variabilität der Versorgung.
Die Versorgung ist auf die Bedürfnisse und Werte des Patienten zugeschnitten.
Individuelle Behandlungspläne; Berücksichtigung der lebensweltlichen Bezüge; mein breites, flexibles und differenziertes Versorgungsspektrum
Die Professionen kontrollieren die Versorgung.
Der Patient kontrolliert die Versorgung(source of control).
Patient als selbstverantwortlicher Manager seiner Krankheit und kompetente-Nutzer des Systems; Partizipation
Die Information ist eine Akte (retrospektiv, archiviert, passiv, unbeweglich).
Wissen wird geteilt. Es besteht ein freier Informationsfluss.
Information und Schulung; evidenz basierte Patienteninformationen, Nutzung neuer Informationstechnologien
Die Entscheidung basiert auf Training und Erfahrung.
Die Entscheidung ist evidenzbasiert.
evidenzbasierte Medizin, evidenzbasierte Leitlinien; Health Technology Assessment; Entscheidungsanalysen, Versorgungsforschung
Die Vermeidung von Schädigungen liegt im Bereich der individuellen Verantwortlichkeit.
Sicherheit wird als Systemeigenschaft betrachtet.
Qualitätsmanagement, mRisk Management
Heimlichkeit ist notwendig
Transparenz ist notwendig.
zertifizierte und öffentlich zugängiche Leistungs- und Qualitätsberichte; Aufklärung
Das System reagiert auf Bedürfnisse.
Bedürfnisse werden antizipiert.
umfassendes, individuelles Assessment; Erhebungen zu Präferenzen der Bevölkerung bzw. der Versicherten, Needs Assessment
Es wird eine Kostenreduktion angestrebt.
Verschwendung (Überversorgung) wird kontinuierlich abgebaut.
Qualitätssicherung, Leitlinien, evidenz basierte Medizin, Vergütungssysteme
Die Rollenbilder der Gesundheitsberufe sind wichtiger als das System.
Die Kooperation zwischen den Leistungserbringern/Professionen hat Priorität.
Integration, Vernetzung, Inter-/Multidisziplinaritätsystem
Der Patient wird „als selbstverantwortlicher Manager seiner Krankheit“ gesehen; die Versorgung soll sich flexibel und evidenzbasiert darauf einlassen. Bei chronisch Kranken kann man sich im Fallmanagement auf die Standards beziehen, die für die jeweilige Krankheit dem disease management vorgegeben werden. Die Patientenbetreuung seitens der Krankenkasse hat ja nicht den Charakter einer Behandlung, sondern zieht medizinisches, möglichst evidenzbasiertes, Wissen heran, um Behandlungen zu prüfen. Strittig bleibt, wie weit die Kontroll- und Steuerungsbefugnisse eines fallbezogenen „Gesundheitsmanagements“ der Kassen reichen. Die Stellung der Kassen ist durch Neuregelungen, z.B. durch das „Gesetz zur Reform des Risikostrukturausgleichs“ gestärkt worden, das seit 2002 zur besseren Versorgung chronisch Kranker Disease Management-Programme vorsieht, für die sich Versicherte bei ihrer Kasse entscheiden können. Weitere Wirkungsmöglichkeiten ergeben sich aus dem Anspruch von Versicherten auf ein „Versorgungsmanagement“ gemäß § 11 Abs.4 SGB V.
Das Problem der Kompetenzverteilung und der Zusammenführung von Zuständigkeit ergibt sich auch im Management beruflicher Rehabilitation seitens der Bundesagentur für Arbeit und der Dienste von anderen Rehabilitationsträgern. Jeder Dienst beansprucht zunächst aus seiner Handlungsperspektive die Fallführung. So bietet z.B. die Bundesagentur für Arbeit seit längerem Case Management als Unterstützung von Menschen mit Behinderung zur Teilhabe am Arbeitsleben nach § 19 SGB III an:
BEISPIEL
„Der Case Manager des Arbeitsamtes fungiert als Vermittler zwischen Rehabilitand, Arbeitgeber und Rehaträgern wie Rentenversicherungsanstalt (BfA, LVA), Berufsgenossenschaft, Hauptfürsorgestelle. Er pflegt Kontakte mit den Medizinischen Diensten der Krankenkassen, dem Ärztlichen Dienst (ÄD), dem Psychologischen Dienst (PD) des Arbeitsamtes sowie Betriebsräten, Schwerbehindertenvertrauensleuten, Betriebsärzten, Arbeitsassistenten und Bildungsträgern. In Abstimmung mit allen Beteiligten wird festgelegt, welche Hilfen der Rehabilitand benötigt. Case Management verlangt von allen Beteiligten den Willen, einen Arbeitsplatz zu erhalten, Flexibilität und Kreativität, um schnelle und unbürokratische Entscheidungen treffen und diese dann zügig umsetzen zu können. Der Behinderte gibt eine schriftliche Einverständniserklärung ab, daß er mit einer Intervention des Case Managers bei seinem Arbeitgeber einverstanden ist.“ (www.arbeitsamt.de/nuernberg/information/casemanagement.html)
Für die Bahnung der Fallführung hat die Reform des humandienstlichen Leistungssystems wiederholt neue Vorgaben mit sich gebracht. Ein Schritt in der Gestaltung der Rehabilitation bei Behinderung war die Schaffung von „Gemeinsamen Servicestellen“ (im SGB IX)zur trägerübergreifenden Begleitung von Leistungsberechtigten. Die Servicestellen behielten jedoch die Fäden nach Beratung, Bedarfsermittlung und Planung nicht in der Hand – und konnten mithin auch nicht verfolgen und evaluieren, was erreicht wird. Das deutsche Bundesteilhabegesetz ersetzt nun die Servicestellen durch „Ansprechstellen“; eine „ergänzende unabhängige Teilhabeberatung“ kommt hinzu. Für die berufliche Eingliederung haben die Integrationsfachdienste ein Mandat, im weiteren Gang der Dinge ein Case Management zu übernehmen.
Die Abkoppelung vom weiteren Vorgehen ist ein allgemeines Problem von Beratungsstellen, die Hilfen nachweisen und sie personbezogen zusammenführen sollen. Seit Anfang der 1990er Jahre hat man das Case Management in der Pflege mittels einer Clearing- oder Koordinierungsstelle (Ambulantes Hilfezentrum, Beratungs- und Koordinierungsstelle, Informations-, Anlauf- und Vermittlungsstelle) in mehreren Bundesländern zu realisieren versucht. Man ist dabei jedoch nicht sehr weit gekommen. Denn weder die Leistungserbringer und ihre Träger noch die Pflegekassen als Leistungsträger wollten sich ihre Handlungsmöglichkeiten durch eine unabhängige Beratung und Begleitung der NutzerInnen beschneiden lassen. Die Idee eines „one desk service“, der für den/die BürgerIn alle erforderlichen Hilfen erschließt, bündelt und bereitstellt, hat sich deshalb bisher selten realisieren lassen. Der Ansatz der Pflegeberatung, mit oder ohne Ansiedelung in Pflegestützpunkten (Frommelt et al. 2008), hat zumindest die Fallführung bei häuslicher Pflege vorangebracht.
Die Beschränkung der Zuständigkeit war auch ein Problem bei der Einführung der Soziotherapie für Menschen, die wegen schwerer psychischer Erkrankung nicht in der Lage sind, ärztliche oder ärztlich verordnete Leistungen selbstständig in Anspruch zu nehmen. Nach § 37 a SGB V umfasst die Soziotherapie nur „die im Einzelfall erforderliche Koordinierung der erforderlichen Leistungen sowie Anleitung und Motivation zu deren Inanspruchnahme“. Die Begleitung bei der Inanspruchnahme ist nicht genannt, so dass ein rehabilitatives Case Management, wie es nach Modellversuchen empfohlen worden ist, kaum geleistet werden kann.
Die Lotsenfunktion, die einem/einer Case ManagerIn zugeschrieben wird, weitet sich zu einer Fallführung aus, wenn der „Lotse“, um im Bilde zu bleiben, während der ganzen Fahrt nicht von Bord geht. Gatekeeping im Hausarztmodell ist besonders in der Schweiz verbreitet: Der/die HausärztIn lotst den/die PatientIn möglichst kostengünstig durch das medizinische Versorgungssystem. Die gleiche Funktion übernimmt eine Patientenleitstelle in Ärztenetzen. Es liegt im Interesse der AllgemeinärztInnen, mit der Lotsenfunktion insbesondere ihre chronisch kranken PatientInnen, die auch fachärztlich versorgt werden müssen, „bei der Stange“ zu halten. Der BDA (Bundesverband der Allgemeinärzte Deutschlands) hat mehrere „Case Management-Manuale“ (bei Asthma, Diabetes, Demenz) herausgegeben, die den HausärztInnen bei der Zusammenarbeit mit beteiligten FachärztInnen, Kliniken, Pflege- und Sozialdiensten zur Hand gehen. Ein solches Manual ist auch für die „perioperative Patientenbetreuung“ bei Adipositas vorhanden (Dörr-Heiß/Wolf 2014).
Die Zuständigkeit für die einzelnen Dimensionen im Case Management, die nacheinander und nebeneinander wahrzunehmen sind, kann in einem Leistungsverbund geteilt werden, sollte aber nicht voneinander isoliert werden. Es liegen praktische Erfahrungen mit einer Funktionsaufteilung bei gleichzeitiger computergestützter Vernetzung vor. Hier hilft die Informationstechnologie mit spezieller Software. Problematisch wird es, wenn die Organisationsaufgabe von der Zuständigkeit im Verfahren abgehoben wird. So hat man Koordinatoren (als Netzwerker im regionalen Versorgungssystem) und Case ManagerInnen (als Lotsen) im Bundesprojekt „Nachgehende Sozialarbeit bei chronisch mehrfach beeinträchtigten Abhängigen“ (durchgeführt von FOGS, Köln) eingesetzt, womit die Position der SozialarbeiterInnen im Verfahren schwach blieb (s. den Beitrag von Martina Schu in diesem Band).
3Case Management in der Erbringung von Komplexleistungen
Komplexe Problemlagen bei Menschen erfordern ein Case Management. Humandienste haben sich in den vergangenen Jahren darauf eingestellt, dass ihnen immer öfter komplexe Lösungen, zugeschnitten auf den/die NutzerIn und seine/ihre Situation, abverlangt werden, wozu die Erbringung von Einzelleistungen nacheinander und nebeneinander nicht ausreicht. Bei einer chronischen Problematik liegt es auf der Hand, ihren inneren und äußeren Zusammenhängen nachzugehen, nachdem Teillösungen sichtlich nicht zum Erfolg führen. Aber auch im akuten Fall liegt oft im Hintergrund eine Verstrickung vor, die aufzulösen eine komplexe Aufgabe darstellt. Man wird deshalb bei psychosozialen Krisen nicht bloß momentan intervenieren und in schwierigen Fällen nacheinander verschiedenen Fachstellen konsultieren, sondern die Krisenintervention möglichst von vornherein mehrdimensional und systematisch beginnen. Zur Krisenintervention in der Sozialen Arbeit schreibt Manfred Neuffer:
„Unerläßlich erscheint eine ordnende Hand. Sie trägt zumindest für die Zeit der Krisenintervention die Verantwortung für das Fallgeschehen anhand eines in einem Arbeitsfeld abgestimmten Konzeptes und betreibt insofern Krisen-Case Management. Case Manager müssen bei der Krisenintervention auf zwei Ebenen ihre Arbeit entfalten. Sie benötigen eine enge Beziehung zu den Klienten, um deren spezifische Situation berücksichtigen zu können und so schnell wie möglich ihr Vertrauen zu gewinnen. Sie müssen personale und institutionelle Strukturen entschlüsseln können, fallumgebende Systeme handlungsfähig machen im Sinne bestmöglicher Kooperation, und diese entsprechend kommunikativ in die Krisenintervention einbinden“ (Neuffer 2001, 146).
Die interdisziplinäre Abstimmung ärztlicher, psychotherapeutischer, (heil)pädagogischer und sozialarbeiterischer Leistungen führt zunächst einmal zu einer Statik von Verabredungen. Für die ablauforganisatorische Prozessführung wird ein Case Management gebraucht, das in seiner Anwendung gegenüber den Besonderheiten des jeweiligen professionellen Handelns neutral bleibt und deren Beiträge in eine ganzheitliche Wirkungsorientierung (z.B. der Frühförderung von Kindern mit Behinderung oder von Behinderung bedrohter Kinder, Sohns 2000; Pretis 2005) einzubinden versteht. Im stationären Behandlungsregime haben die diagnosebezogenen Fallgruppenpauschalen nach Diagnosis Related Groups (DRGs) für die Krankenhausbehandlung seit 2003 den Einsatz des Verfahrens gefördert. Medizinische und paramedizinische Einzelleistungen werden in Komplexleistungen einbezogen, für deren Erbringung ein interdisziplinäres behandlungsorientiertes Prozessmanagement angebracht ist, das sich an klinische Behandlungspfade (clinical pathways) hält.
In einem ganz anderen Handlungsfeld ist die „Komplexleistung Resozialisierung“ zu erbringen (Maelicke/Wein 2016). Sozialdienste in der Justiz müssen intern und extern mit anderen Diensten, Arbeitgebern und freiwillig Helfenden fallweise zusammenwirken, um eine Wiedereingliederung von Straftätern zu erreichen (s. den Beitrag von Wolfgang Wirth und Birgit Grosch in diesem Band). Für ein durchgehendes Case Management in diesem Bereich gibt es international viele Beispiele, insbesondere in Form des National Offender Management Service (NOMS) in England (Wendt 2015). Eine Voraussetzung hierfür ist, dass die strukturelle und ideologische Trennung zwischen Bestrafung und Strafvollzug einerseits und helfenden Diensten andererseits überwunden wird. Dann verbinden sich im Einzelfall die Komponenten der Strafe mit den Komponenten der Wiedereingliederung, so dass der Strafvollzug und die Bewährung mit dem Vollzug der Resozialisierung zusammenfallen.
In der Psychiatrie erstreckt sich die zur klinischen Behandlung komplementäre, gemeindenahe Versorgung auf die soziale (Wieder-)Eingliederung, das Wohnen und die Arbeit. Verschiedene Dienste, Stellen und freiwillig Helfende werden einbezogen, wozu das Case Management in koordinierender, vernetzender und den Fall steuernder Funktion angewandt wird, beispielsweise bei Psychiatrischen Institutsambulanzen (nach § 118 SGB V) zur Erbringung der „ambulanten Komplexleistung“.
4Fall und Feld
In der Praxis, insbesondere der Jugendhilfe, wird zunehmend nach dem sozialräumlichen Handlungsansatz verfahren. Er rückt das Feld der Problementstehung und der Ressourcen, um sie zu lösen, in den Fokus der Interventionsstrategie. Die Anbieter von Diensten wollen im Sozialraum flexible, maßgeschneiderte Hilfen anbieten, wozu sie zunächst fallunspezifisch auf vorhandenen Hilfemöglichkeiten im lokalen Umfeld sehen und diese Ressourcen systematisch zu erschließen trachten. Die Losung „vom Fall zum Feld“ (Hinte et al. 1999) bedeutet dabei nicht, dass man die personenbezogene Lösung hintanstellt. Im Gegenteil, eine vorhandene Problematik soll nicht als „Fall für“ das eine oder andere Leistungsangebot von diesem vereinnahmt werden, sondern im Umfeld vorhandene Hilfen sollen auf die Kontingenz des Einzelfalls zugeschnitten werden. Sarkastisch hat Wolfgang Hinte zur bisherigen Struktur in der Jugend- und Sozialverwaltung festgestellt, sie fördere „die Fachkräfte als Einzelkämpfer/innen und damit eine besonders schwere Form professionellen Suchtverhaltens, nämlich die Fallsucht“ (Hinte et al. 1999, 87). Die vorgehaltene Angebotspalette der spezialisierten Hilfen verführe die Fachkräfte dazu, „eben bezogene auf diese Hilfen die Kinder und Jugendlichen in ihren Defiziten zu beschreiben“ (Hinte et al. 1999, 88). Wichtig wäre demgegenüber, dass die Fachkräfte einen Bedarf mit den im Lebensfeld nutzbaren informellen und formellen Hilfen abzudecken verstehen. Bedarf dürfe nicht bestimmt werden anhand
„einer gerade vorgehaltenen Hilfeart, sondern anhand dessen, was die Familie will (gleichsam ein ‚Maßanzug‘). Und wenn die Familie Bedarf an einer Putzhilfe hat, dann ist das der Bedarf und nicht ‚sozialpädagogische Familienhilfe‘“ (Hinte et al. 1999, 92).
Als KundIn von Dienstleistern und als Leistungsberechtigte/r gegenüber amtlichen Stellen besitzt der/die BürgerIn Souveränität. Auch wenn er/sie sie nur unzulänglich ausüben kann, sollte die Klienten- bzw. Patientensouveränität stets beachtet werden. Sieht man BürgerInnen mehr als Case ManagerInnen in eigenen Angelegenheiten und bestärkt man sie in dieser informellen Rolle, müssen sich die Professionellen auf eine breitere Kooperation mit ihnen verlegen. Die Fachkraft agiert im sozialaktiven Feld, in dem eintritt, „was der Fall ist“, und in dem flexibel darauf reagiert werden kann. Die Sozialraumorientierung widerspricht nach allem nicht der Fallorientierung im Case Management. Die Gegenüberstellung von Fall und Feld missversteht das Case Management als eine sich in der Behandlung des Einzelfalls erschöpfende Methode. Als Systemkonzept hat das Case Management gerade das Feld der formellen und informellen Ressourcen im Blick, deren Heranziehung zu koordinieren und auf das Handeln im Einzelfall abzustimmen ist.
5Einzelne Anwendungen
Die Neutralität des Konzepts gegenüber der Spezifik persönlicher, sozialer und gesundheitlicher Probleme bringt mit sich, dass ein Case Management grundsätzlich in allen humandienstlichen Bereichen erfolgen kann (vgl. die Beschreibung der Einsatzgebiete in Wendt 2015, 215ff.). In dem im Jahr 2001 herausgegebenen „Curriculum“ der Case Management Society of America werden aus berufspraktischem Interesse besonders die folgenden Formen erörtert: Workers‘ Compensation Case Management, Disability Case Management, Occupational Health Case Management, Behavioral Health Case Management, Maternal-Infant Case Management, Pediatric Case Management, Geriatric Case Management (Powell/Ignatavicius 2001).
Zum seitherigen Einsatz von Case Management in einzelnen Feldern des Sozial- und Gesundheitswesens in Deutschland, auch in Österreich und der Schweiz, wird im Folgenden ein Überblick gegeben, der aber nicht den Anspruch erhebt, vollständig zu sein.
Case Management in der Altenpflege
In der Altenhilfe wird mit dem Case Management in erster Linie angestrebt, durch einen individuellen Zuschnitt vorwiegend ambulanter Dienstleistungen die Selbständigkeit und Selbstversorgung alter Menschen bei eingetretener oder vorauszusehender Pflegebedürftigkeit möglichst zu erhalten (s. die vergleichende Studie von Engel/Engels 1999 und den zugehörigen Materialband: Case Management 2000), speziell auch in der geriatrischen Versorgung (Döhner et al. 1999).In Zusammenhang mit der zunehmenden Bedeutung der Pflege im demographischen Wandel und aufgrund der längeren Lebenserwartung, ist dieses Handlungsfeld zu einem Hauptanwendungsgebiet des Case Managements geworden.
Um dem Prinzip „ambulant vor stationär“ und der Förderung häuslicher Pflege zu entsprechen, kommt es auf ein rechtzeitiges und umfassendes Assessment unter Einbeziehung von Angehörigen und auf eine mit den Beteiligten abgestimmte Hilfeplanung an, und zwar vor Inanspruchnahme einzelner Dienste. Pflegefachdienste mit einem breiten Leistungsangebot wenden das Case Management an, um ihre Leistungserbringung mit den NutzerInnen fortlaufend abzustimmen und um die Qualität der Pflege anforderungsgerecht und kosteneffizient zu sichern. Dabei wird das Case Management oft mit dem Prozessmanagement der fachlichen Pflege gleichgesetzt, ohne darüber hinaus die Lebensgestaltung von Pflegebedürftigen und soziale Fragestellungen einzubeziehen. Man beschränkt sich auf die fallbezogene Optimierung der Organisation und der Abläufe des pflegerischen Handelns und bedient sich des Case Managements zum Ausweis einer qualifizierten Arbeitsweise. Generell kann man sagen, dass sich die professionelle Pflege hierzulande die Methodik analog ihrer Verbreitung im nursing case management in den USA aneignet (Ewers/Schaeffer 2000).
Von den Koordinationsbemühungen in der Altenhilfe ist bekanntlich in den 1990er Jahren die Einrichtung von Stellen ausgegangen, die bürgernah über Dienstleistungen informieren und für eine Vernetzung der Leistungserbringer sorgen (Wendt 1993). Während die Entwicklung dieser Stellen in Deutschland wegen mangelnder Förderung und Umfirmierung bis zu den Neuregelungen durch die Pflegestärkungsgesetze stagnierte, ist man in Österreich mit den (Integrierten) Sozial- und Gesundheitssprengeln in Tirol besser vorangekommen. Ihre Aufgabe ist die gemeindenahe flächendeckende und bedarfsgerechte Versorgung mit sozialen, pflegerischen und medizinischen Diensten, insbesondere ambulanten Angeboten, durch zweckmäßige Information der BürgerInnen einerseits und Koordination der Dienstleister bzw. der Bedarfsdeckung durch sie andererseits. Um diese Aufgabe erfüllen zu können, ist in den Sprengeln in Österreich (und analog in Südtirol) das Case Management eingeführt. Interessant ist die hier (in Innsbruck) getroffene Unterscheidung zwischen einem „Externen Case Management“, in dem der Dienst im Sozialraum auf Hilfebedürftige zugeht und die Versorgung für sie koordiniert, und einem „Internen Case Management“, in dem der Sprengel als Anbieter von Altenhilfe, Hauskrankenpflege und Haushaltshilfen seine Arbeitsweise nach dem Case Management ausrichtet (Saischek 2000). In Wien hat der Dachverband Wiener Pflege- und Sozialdienste 1998 ein Konzept für das Case Management in den „Sozialen Stützpunkten“ für das System der ambulanten Pflege und Betreuung in der Stadt entwickelt. Hier wird unterschieden zwischen dem Case Management der Sozialen Stützpunkte, das die Koordination des Pflege- und Betreuungsprozesses bis zur Weiterleitung des Antrags an eine Anbieterorganisation umfasst, und dem Care Management der Anbieterorganisationen, das die Koordination des Pflege- und Betreuungsprozesses nach der Übernahme des Auftrags vom Sozialen Stützpunkt umfasst (Schrems 2001).
In Deutschland wurde mit den Revisionen des SGB XI ein Fallmanagement in die Versorgung Pflegebedürftiger eingeführt (Klie et al. 2018). Dadurch wurden Funktionen in der Pflegeberatung und in wohnortnahen Pflegestützpunkten übernommen, in welche auch frühere Informations- und Koordinierungsstellen überführt wurden (Frommelt et al. 2008). Eine Hauptaufgabe von Case Management zur Pflege besteht in der Schaffung und Aufrechterhaltung von Arrangements, in denen betroffene Menschen und ihre Angehörigen in ihrer Lebensführung mit den Erfordernissen der Versorgung zu Hause zurechtkommen können.
Sozialhilfe und Unterstützungsmanagement
Nicht erst seitdem PolitikerInnen hierzulande dem Komplex Sozialhilfe und Arbeitslosigkeit mit der Einheit von Fördern und Fordern beikommen wollen, wird in der Sozialverwaltung mit den Elementen des Case Managements experimentiert. Kontrollierter als zuvor soll die Sozialverwaltung ihre Mittel einsetzen. Dafür hat die Kommunale Gemeinschaftsstelle für Verwaltungsmanagement ein Prozessmodell der Steuerung der Sozialhilfe entworfen (KGSt 1997). Es sieht für eine effektive und effiziente, zielgenauere Gestaltung der Sozialhilfe eine
qualifizierte Zugangsprüfung,
individuelle Fallanalyse und Hilfeplanung,
Heranziehung von Transferleistungen und Verselbständigungshilfen
vor. Notwendig sei, so hieß es damals, insgesamt ein „Philosophiewechsel“ von der „auf Rechtmäßigkeit konzentrierten Verwaltung der Sozialhilfe hin zu einem aktiven und auf ‚Hilfe zur Selbsthilfe‘ gerichteten Fallmanagement“. Dabei wird auf gute Erfahrungen in der Jugendhilfe mit der Erstellung, Umsetzung und Erfolgskontrolle fallbezogener Hilfepläne nach § 36 SGB VIII verwiesen (KGSt 1997, 26). Bei der Gewährung von Sozialhilfe beschreiten seitdem einzelne Sozialämter vermittels Hilfeplanung den Weg einer „aktivierenden Sozialhilfe“. Beispielhaft hat man das im Projekt „Sozialbüro“ in Nordrhein-Westfalen versucht (Reis 2004). Die Ämter ziehen dazu im örtlichen Hilfenetz vorhandene Dienste, Einrichtungen und Personen heran (Kuntz 1999; Kuntz 2000).
Schon bevor die Hartz-Gesetze für junge Arbeitslose eine rasche Vermittlung in Beschäftigung vorgesehen haben, wurden Jugendliche, die in Köln Sozialhilfe beziehen wollten, dort seit 1999 an die „Jobbörse Junges Köln“ verwiesen, wo ihnen in einer Bürogemeinschaft von Sozialamt und Arbeitsamt Beschäftigung vermittelt wurde. Bei Schwierigkeiten übernahmen Fallmanager des Sozialamts Klärungs-, Hilfeplanungs- und Kontrollaufgaben. Durch das Kooperationszentrum konnte die Zahl der auf Sozialhilfe angewiesenen jungen Arbeitslosen zwischen 16 und 24 Jahren in kurzer Zeit drastisch gesenkt werden. EmpfängerInnen von laufender Hilfe zum Lebensunterhalt per Case Management (wieder) zu befähigen, ohne Sozialhilfe auszukommen, hat man sich in vielen Kommunen vorgenommen.
Das nordrhein-westfälische Sozialministerium begann zum Ausbau der Zusammenarbeit von Arbeitsämtern und Sozialämtern 2001 ein „Modellprojekt Sozialagenturen“, in dem die Sozialhilfe mit Angeboten der Arbeitsverwaltung und weiteren sozialen Dienstleistungen, wie Wohnungshilfe, Suchtberatung, Schuldnerberatung, Familienberatung, Kinderbetreuung usw., verbunden wurde, um SozialhilfeempfängerInnen einzelfallbezogen dahin zu bringen, wieder unabhängig von der Unterstützung zu werden und insbesondere zurück ins Erwerbsleben zu finden. Das Leistungsspektrum der Sozialagenturen sollte
intensive Beratung und Einzelfallanalysen,
Auskunft über alle sozialen Hilfen,
einen persönlichen Unterstützungsplan,
Arbeitsvermittlung,
zielgenaue Qualifizierungs- und Beschäftigungsmaßnahmen
umfassen. Die individuelle Beratungsarbeit rückte die Abwicklung von Zahlungsvorgängen in den Hintergrund. Das Ministerium sprach von der Etablierung eines „individuell maßgeschneiderten Case Managements“, durchzuführen von MitarbeiterInnen, die sich als „soziale Assistenten“ verstehen und für die Menschen in prekären Lebenslagen eine Lotsenfunktion übernehmen. Das Konzept des Ministeriums „Sozialagenturen – Hilfe aus einer Hand“ nimmt das Case Management in Anspruch, um über die Sozialagentur einen „final ausgerichteten Leistungsprozess“ zu steuern, der „gemeinsam von mehreren Akteuren realisiert“ wird. Die Agentur hat danach folgende konkrete Aufgaben:
Aufklärung über das zur Verfügung stehende Leistungsangebot,
Anspruchsprüfung,
Beratung,
Erstellung einer problemorientierten Diagnose,
Entwicklung einer von beiden Seiten (Beratung, Rat Suchende) getragener Hilfeplanung,
Erstellung und Umsetzung eines Hilfeplans,
Vermittlung in konkrete Hilfeangebote,
Steuerung des Einzelfalles,
Entwicklung und Akquise konkreter Hilfeangebote und
Einzelfallübergreifende Angebots- und Maßnahmensteuerung.
Die Sozialagentur gestaltet somit zusammen mit den Adressaten eine Leistungskette und sorgt für eine effektive Koordination, Kooperation und Vernetzung. Diese innovative Organisation ist ein Beispiel für die Verbindung von Mikrosteuerung per Case Management mit einer entsprechenden Makrosteuerung in einer neustrukturierten Arbeits- und Sozialverwaltung (Trube 2001).
Case Management in der Jugendhilfe
In der Jugendhilfe ist es Sache des Jugendamtes bzw. des Allgemeinen Sozialdienstes, über die Hilfeplanung gemäß § 36 SGB VIII und Flexibilisierung der Erziehungshilfen im Sozialraum für ein Management der personenbezogenen Sozialpädagogik zu sorgen. Eine Steuerung des Hilfeverlaufs kann softwarebasiert erfolgen (Arnold et al. 2011). Einer kontinuierlichen Prozessverantwortung stehen allerdings in Deutschland die überkommenen Delegationsmechanismen zwischen öffentlicher Jugendhilfe und den Diensten und Einrichtungen in freier Trägerschaft entgegen. In der Praxis sind die Zuständigkeiten in der Steuerung der Maßnahmen und damit im Case Management zwischen dem amtlichen Leistungsträger und den Leistungserbringern nicht so klar abgegrenzt, wie es gesetzlich vorgesehen ist.
Hilfen zur Erziehung sind nach dem Kinder- und Jugendhilferecht darauf anzulegen, dass sie dem Kindeswohl und dem Unterstützungsbedarf der Eltern entsprechen. Diese komplexe Aufgabe wird oft pädagogisch verkürzt, indem einzelne Maßnahmen aus dem Repertoire von der Erziehungsberatung bis zur Intensiven Sozialpädagogischen Einzelhilfe ergriffen werden. Typisch ist hier der Umgang mit der Hilfeplanung: Nach einer Entscheidung über die Leistungsgewährung im Jugendamt wird oftmals der ausführenden Stelle, also einem Heim, einer teilstationären Einrichtung, dem Betreuten Wohnen oder einem Erziehungsbeistand die weitere, nicht selten erst die eigentliche detaillierte Hilfeplanung überlassen, bei der dann weniger die gesamte Lebenssituation eines jungen Menschen und seiner Familie im Blick ist, sondern mehr die Anwendung des sozialpädagogischen Handlungsrepertoires in der jeweiligen Hilfe zur Erziehung. Darauf verengt, lässt sich vom Case Management kaum sprechen – und man versteht, warum von ihm im weiten Feld der Jugendhilfe weniger die Rede ist, von einigen guten Beispielen abgesehen (Löcherbach et al. 2009).
Schwierige Fälle, bei denen die üblichen Maßnahmen nicht greifen, nötigen indes dazu, die Schnittstellen, an denen der Hilfeprozess immer wieder abbricht, zu übergreifen und Case ManagerInnen zu benennen, die für Kontinuität, die Einhaltung von Vereinbarungen, multidisziplinäre Beratung und gegebenenfalls für unkonventionelle Lösungen sorgen. Neue Möglichkeiten für den Einsatz von Case Management eröffnen sich (wie bereits im Abschnitt 4 erörtert) mit der sozialräumlichen Umstrukturierung der Jugendhilfe, insofern hier versucht wird, generell eine die einzelnen Leistungsbereiche der Jugendhilfe übergreifende, im Einzelfall flexible, auf die Problematik und Lebenssituation des Kindes oder Jugendlichen und seiner Familie zugeschnittene Leistungserbringung zu erreichen, also etwa die offene Jugendarbeit, eine Tagesstätte und ambulante Erziehungshilfen in koordinierter Weise für ein Kind oder einen Jugendlichen heranzuziehen.
Eine zentrale Rolle spielte das Case Management im 2008 gestarteten Programm „Kompetenzagenturen“(Bundesministerium 2013). Die etwa 200 geförderten Agenturen übernahmen für junge Menschen mit multiplen Problemen eine Wegleitung im Übergang von Schule in Ausbildung und Beruf. Die Kompetenzagenturen sorgten mit einer „maßgeschneiderten“ Abfolge von Hilfen und per Koordination verschiedener Institutionen und Akteure in Zuständigkeit für die Eingliederung der benachteiligten Jugendlichen. Die Lotsenfunktion erfüllen viele Agenturen auch weiterhin (u. a. gefördert im Programm „Jugend stärken im Quartier“). Analog basiert seit 2012 die Maßnahme „Jugendcoaching“ für ausgrenzungs- und schulabbruchgefährdete Jugendliche in Österreich auf dem Case Management und wird mit dafür ausgebildeten Fachkräften durchgeführt.
Case Management in der Suchtkrankenhilfe
In der Drogenhilfe hat man in Deutschland insbesondere bei chronisch mehrfach beeinträchtigten Abhängigkeitskranken gute Erfahrungen mit dem Einsatz von Case ManagerInnen gemacht (s. den Beitrag von Martina Schu in diesem Band). Hier ist das Kooperationsmodell nachgehende Sozialarbeit des Bundesministeriums für Gesundheit von 1995–2000 einschlägig (Engler/Oliva 1997). Das Modell setzte Koordinatoren ein für die Vernetzung der lokalen Dienstleister neben den personbezogen agierenden Case ManagerInnen. Ihnen wurde im Modellprojekt die Aufgabe zugeschrieben, die Betroffenen zunächst durch direkte Ansprache vor Ort zu erreichen, sie und ihre Angehörigen zu beraten und ihnen Hilfen zu vermitteln oder diese (bei der Wohnungssuche, bei der Schuldenregulierung, bei Beziehungsproblemen, bei der Tagesstrukturierung usw.) zu leisten. Das aufsuchende Vorgehen der Case ManagerInnen im Projekt führte dazu, dass viele Abhängige erstmals von der Suchthilfe erreicht wurden. Die Planung und Dokumentation der Hilfen trugen zur Verbindlichkeit bei. Diese wurde von den NutzerInnen positiv geschätzt. Nicht wenigen von ihnen gelang mit Hilfe des Case Managements der Ausstieg aus der Drogenabhängigkeit. Zu den Resultaten des Projekts gehört die Empfehlung, bei einer derart schwierigen Arbeit eine Relation von etwa 16 KlientInnen pro Case ManagerIn vorzusehen. Neben den positiven Erfahrungen, die sie machten, beklagten allerdings viele Case ManagerInnen im Projekt, dass ihnen ein „Mandat“ fehle, um mit Leistungsanbietern fallbezogen verbindliche Absprachen zu treffen und deren Einhaltung zu kontrollieren (Schu et al. 2001).