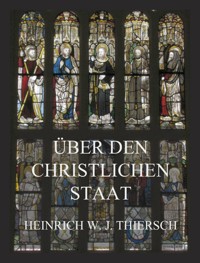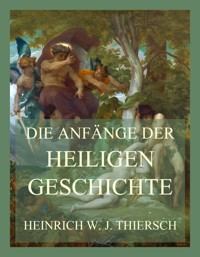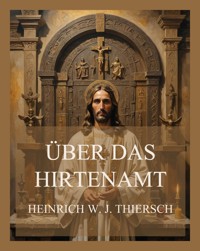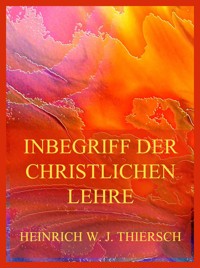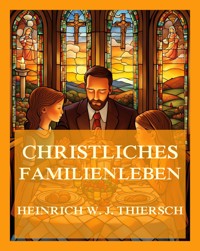
4,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Jazzybee Verlag
- Kategorie: Religion und Spiritualität
- Sprache: Deutsch
Wie für die Natur, so bestehen auch für die moralische Welt göttliche Gesetze und Anordnungen, von denen sie getragen wird und innerhalb welcher sie sich zu bewegen und zu entwickeln hat. Zwar folgt die Natur den göttlichen Bestimmungen mit Notwendigkeit, in der sittlichen Welt dagegen sollen sie nicht anders als mit Freiheit ergriffen und festgehalten werden; dennoch stehen sie für dieses Gebiet so fest wie für jenes, und machen sich ungeachtet anscheinender Vereitelung geltend. Unabänderlich, wie der Gang der Gestirne, ist auch der göttliche Entwurf, nach welchem die Menschenwelt der moralische Kosmos sich zu gestalten hat. Seine Grundgesetze sind so wenig bloße Worte oder tote Vorschriften, wie jene Kräfte, die den Himmel bewegen und den Umschwung der Sphären bedingen. Gerade wenn der Mensch meint, sich über sie wegsetzen zu können, wird er der Realität der Sittengesetze inne; sie geben sich dem Gehorsamen als schützende und segnende Mächte kund, dem Widersetzlichen als zerstörende und vernichtende. Wie das Schöpfungswort und die Schöpfungstat denn beide sind eins fortwirkt und alle Dinge trägt bis auf diesen Tag, so wirkt in den menschlichen Verhältnissen das göttliche Stiftungswort und die Stiftungstat, wodurch sie geordnet sind, bis in die Ewigkeiten fort. Von allen solchen Stiftungen ist die Familie die älteste und die umfassendste. Ihre Grundgesetze: die Treue, die Liebe, die Aufopferung, der Gehorsam, sind die mächtigen und unverwüstlichen Grundlagen alles menschlichen Wohles. Gedeihen und Segen ist an sie geknüpft, im Festhalten an ihnen gibt es allein eine sittliche Entwicklung und einen Fortschritt zur Vollkommenheit. Der Mensch kann an den wohltätigen Banden, die ihn hier umfangen, rütteln, aber er kann sie nicht zerreißen; versucht er es, so wird er zu seinem Unheil ihrer Festigkeit inne. Er kann diese Verhältnisse entstellen und verdunkeln, ja es ist im Fortschritt des menschlichen Verderbens alles geschehen, um sie zu zerrütten, und doch steht allenthalben und zu allen Zeiten die ursprüngliche Stiftung und Anordnung noch in Kraft. In dreifacher Weise macht sie sich geltend: einmal als ein wunderbar fortdauernder Halt des Guten auch in den schlimmsten Zeiten; dann in Gestalt des Fluches für jeden, der an ihrer Zerstörung sich versucht; endlich aber, indem sie nach langer Verkennung und Verdunklung wieder hervortritt, im Bewusstsein der Menschen aufs Neue den Sieg gewinnt, ihre volle Verwirklichung erreicht und sogar in einer verklärten höheren Gestalt als anfangs zur Erscheinung kommt.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 215
Veröffentlichungsjahr: 2024
Ähnliche
Christliches Familienleben
HEINRICH W. J. THIERSCH
Christliches Familienleben, H. W. J. Thiersch
Jazzybee Verlag Jürgen Beck
86450 Altenmünster, Loschberg 9
Deutschland
ISBN: 9783988681348
Textquelle: "Edition Albury Sammlung Peter Sgotzai des Netzwerks Apostolische Geschichte e.V.", bei der wir uns sehr für die freundliche Genehmigung der Nutzung des Textes bedanken.
www.jazzybee-verlag.de
admin@jazzybee-verlag.de
INHALT:
Vorwort zur vierten Auflage (1859)1
Vorwort zur sechsten Auflage (1871)3
Einleitung. 4
I. DIE EHE.. 6
2. DIE UNAUFLÖSLICHKEIT DER EHE.. 15
3. DER EINTRITT IN DIE EHE.. 23
4. DER HAUSGOTTESDIENST.. 41
5. DIE ERZIEHUNG... 44
6. DIE KINDLICHE PFLICHT.. 82
7. DAS GESINDE.. 86
8. DIE SONNTAGSENTHEILIGUNG.. 90
9. DIE GESELLIGKEIT.. 93
10. DER TOD DER ANGEHÖRIGEN UND WITWENSTAND.. 95
Endnoten. 99
Vorwort zur vierten Auflage (1859)
Mit aufrichtigem Dank erkenne ich es an, dass diese Schrift eine so erfreuliche Aufnahme gefunden hat, welche die Ursache ist, dass es gegenwärtig zum vierten male erscheint. Auch ist ohne mein Zutun eine dänische, eine holländische und eine englische Übersetzung herausgekommen.
Das dachte ich nicht, als ich im Frühjahr 1854, in einer hurten Zeit, da mir manche Hoffnung zunichte geworden und persönliche Wirksamkeit in meiner Umgebung fast gänzlich versagt war, diese Betrachtungen in erzwungener Zurückgezogenheit niederschrieb.
In der Hauptsache habe ich nichts geändert, denn ich gebe denen nicht Recht, welche meinen, die Forderungen seien hier zu hoch gestellt. Für die christliche Moral ist die Bergpredigt Christi als Vorbild gegeben, und verlangt Er daselbst nicht Vollkommenheit? Nur wenn uns Seine Gebote in ihrer ganzen Größe entgegentreten, werden wir lernen, unser ganzes Vertrauen auf Ihn zu setzen, der sie in uns erfüllen will.
Dagegen sind einige Härten im Urteil über Erscheinungen unserer Zeit gemildert worden. Ich habe eingesehen, dass Plato nicht ohne Grund sagt, die Einsamkeit mache den Menschen schroff. Findet man auch so noch einiges zu hart, so kann ich nicht helfen. Ich mache das Recht der Individualität geltend. Diese zu bewahren, erscheint mir für einen jeden nicht nur als erlaubt, sondern als Pflicht, und dies um so mehr, je weniger ein solches Recht in der Gegenwart anerkannt ist. Überdies möge man bedenken, dass bei dem Gewirre und Getöse der Stimmen auf dem literarischen Markt der Einzelne, wenn er Gehör finden will, so laut sprechen muss wie er kann.
Gleichzeitig mit diesem Büchlein über christliches Familienleben erschien das Werk von W. H. Riehl: `Die Familie’ (Stuttg. 1855). Ich las es bald mit, heiterem Behagen, indem mich die Übereinstimmung der Grundgedanken mit einem unabhängig davon entstandenen Schriftchen überraschte, bald wieder mit Wehmut, indem mir entgegentrat, wie viel von dem wahren Familienleben uns verloren gegangen ist.
Ich habe weniger Hoffnung für Deutschland und für dieses Weltalter überhaupt als Riehl.
In jenem Buch findet sich manche köstliche Erläuterung zu den hier ausgesprochenen Prinzipien. Hier geht die Betrachtung vom Mittelpunkt, dort von der Peripherie aus. Hier beginnt man mit dem einen Notwendigen und sucht von dem göttlichen Gesetz aus den Weg zu der uns umgebenden Wirklichkeit; dort wird die Geschichte mit ihren mannigfachen Einzelheiten ins Auge gefasst und den sittlichen Grundgedanken, welche darin ausgeprägt sind, nachgespürt. Hier ist strenge Konzentration vorwaltend, dort anmutige Breite der Darstellung.
Die große Bedeutung des Werkes von Riehl sehe ich darin, dass er uns erinnert, in wie reichem Maße christliches Familienleben in der älteren deutschen Sitte schon verwirklicht war, und, soweit diese noch fortlebt, verwirklicht ist. Es zeigt uns, wie sich durch Rückkehr zu den echten Grundlagen der Familie unser Leben zugleich christlich und wahrhaftig deutsch gestalten würde.
Ein Abschnitt meines Schriftchens, welcher die Überschrift trug: `Die Ersatzmittel der inneren Mission’, ist schon in der vorigen Ausgabe weggelassen worden. Es tut mir leid, dass ich damit solche betrübe, die mir ehrwürdig und teuer sind. Durch Übergehung dieser Frage, welche eigentlich nicht hierher gehört, hat das Büchlein nichts verloren.
Dagegen habe ich mich bemüht, es in den Anmerkungen durch einige Zitate und Auszüge zu bereichern.
Marburg, den 1. Februar 1859 Heinrich Thiersch
Vorwort zur sechsten Auflage (1871)
In der fünften Ausgabe (1864) erhielt dieses Schriftchen eine Ergänzung durch den Abschnitt: Über den Tod der Angehörigen und den Witwenstand. Diesmal sind einige Zusätze in den Anmerkungen beigefügt worden, und ich bitte um besondere Aufmerksamkeit für das, was über die Unauflöslichkeit der Ehe und über die Ehe mit der Schwester der verstorbenen Frau gesagt ist.
Augsburg, den 7. November 1871
Der Verfasser
Einleitung
Wie für die Natur, so bestehen auch für die moralische Welt göttliche Gesetze und Anordnungen, von denen sie getragen wird und innerhalb welcher sie sich zu bewegen und zu entwickeln hat. Zwar folgt die Natur den göttlichen Bestimmungen mit Notwendigkeit, in der sittlichen Welt dagegen sollen sie nicht anders als mit Freiheit ergriffen und festgehalten werden; dennoch stehen sie für dieses Gebiet so fest wie für jenes, und machen sich ungeachtet anscheinender Vereitelung geltend. Unabänderlich, wie der Gang der Gestirne, ist auch der göttliche Entwurf, nach welchem die Menschenwelt der moralische Kosmos sich zu gestalten hat. Seine Grundgesetze sind so wenig bloße Worte oder tote Vorschriften, wie jene Kräfte, die den Himmel bewegen und den Umschwung der Sphären bedingen. Gerade wenn der Mensch meint, sich über sie wegsetzen zu können, wird er der Realität der Sittengesetze inne; sie geben sich dem Gehorsamen als schützende und segnende Mächte kund, dem Widersetzlichen als zerstörende und vernichtende. Wie das Schöpfungswort und die Schöpfungstat denn beide sind eins fortwirkt und alle Dinge trägt bis auf diesen Tag, so wirkt in den menschlichen Verhältnissen das göttliche Stiftungswort und die Stiftungstat, wodurch sie geordnet sind, bis in die Ewigkeiten fort.
Von allen solchen Stiftungen ist die Familie die älteste und die umfassendste. Ihre Grundgesetze: die Treue, die Liebe, die Aufopferung, der Gehorsam, sind die mächtigen und unverwüstlichen Grundlagen alles menschlichen Wohles. Gedeihen und Segen ist an sie geknüpft, im Festhalten an ihnen gibt es allein eine sittliche Entwicklung und einen Fortschritt zur Vollkommenheit. Der Mensch kann an den wohltätigen Banden, die ihn hier umfangen, rütteln, aber er kann sie nicht zerreißen; versucht er es, so wird er zu seinem Unheil ihrer Festigkeit inne. Er kann diese Verhältnisse entstellen und verdunkeln, ja es ist im Fortschritt des menschlichen Verderbens alles geschehen, um sie zu zerrütten, und doch steht allenthalben und zu allen Zeiten die ursprüngliche Stiftung und Anordnung noch in Kraft. In dreifacher Weise macht sie sich geltend: einmal als ein wunderbar fortdauernder Halt des Guten auch in den schlimmsten Zeiten; dann in Gestalt des Fluches für jeden, der an ihrer Zerstörung sich versucht; endlich aber, indem sie nach langer Verkennung und Verdunklung wieder hervortritt, im Bewusstsein der Menschen aufs Neue den Sieg gewinnt, ihre volle Verwirklichung erreicht und sogar in einer verklärten höheren Gestalt als anfangs zur Erscheinung kommt.
Wer kann verkennen, dass dies im Grunde die Geschichte aller Heiligtümer ist, welche dem Menschengeschlecht in alter Zeit anvertraut wurden? Sie sind verwahrlost, verkannt und entweiht worden. Sie haben dennoch an sich den unvertilgbaren Charakter der Heiligkeit behalten, die Möglichkeit ihrer Wiederaufrichtung ist geblieben, endlich beansprucht Gott das Seine; was vergessen war und für immer verdorben schien, bringt Er wieder ans Licht und richtet es noch herrlicher als es je zuvor war ins Werk. Dergestalt ist auch das Schicksal der Ehe und Familien gewesen. Auf ihre Stiftung im paradiesischen Stande folgte ihr Verfall durch die Verfinsterung der Heiden und durch die Herzenshärte der Juden, hierauf endlich ihre Wiederherstellung und höhere Verklärung in der christlichen Kirche. Nach dieser erneuerten Stiftung ist sie aufs neue von den Menschen entstellt und herabgewürdigt worden; aber der in der Christenheit stets gegenwärtige Geist Christi arbeitet dem Verderben entgegen und strebt nach vollkommener Durchführung des von Gott stammenden sittlichen Israels.
Heinrich W. J. Thiersch, 1854
I. DIE EHE
1.1 Ihre ursprüngliche Würde
Das Wesen der Ehe ist so vielseitig und reich, wie das Wesen des Menschen selbst. Auch sie hat eine natürliche, eine moralische und eine religiöse Seite, und diese drei Momente zusammen gehören zur Verwirklichung ihrer Idee. Das natürliche ist dem geistigen untergeordnet, wird aber durch das geistige nicht ausgelöscht und vernichtet. Wie dem Menschen überhaupt nicht die Aufgabe gestellt ist, die Natur zu verneinen, sondern sie in den Dienst des erleuchteten und geheiligten Geistes zu bringen, so ist es auch in diesem besonderen Verhältnis. Auch hier besteht das Natürliche fort, aber nur als Voraussetzung für das Höhere, und dem Höheren dienstbar soll es in der sittlichen vollkommenen Ehe fortbestehen. Eben darum hat die Ehe zwar einen höchsten Zweck, aber nicht nur einen Zweck, und keine Definition, die nur eine Bestimmung hervorhebt, ist genügend. Die verschiedenen Definitionen ordnen sich nach einer Stufenfolge, je nachdem sie der moralischen und der religiösen Bedeutung der Ehe sich nähern oder von ihr fern bleiben. Diese Verschiedenheit in der Auffassung ruht auf einer Verschiedenheit der gesamten sittlichen Bildungsstufe der Menschen, und so genau ist dieser Zusammenhang, dass man an den unwürdigen oder edlen Vorstellungen von der Ehe den sittlichen Wert oder Unwert eines Menschen mit Sicherheit messen kann.
1.2 Entweihung im Heidentum
Die Ehe war schon am Anfang des Menschengeschlechts kraft ihrer Stiftung nicht ein bloß natürliches, sondern ein sittliches Verhältnis. Es ist nicht wahr, was die Naturalisten meinen, sie sei erst nach und nach aus ursprünglicher Rohheit zur sittlichen Würde emporgehoben worden. So wenig als der Mensch sich aus einem Stand der Tierheit allmählich zur Menschheit hinaufgearbeitet hat, ebenso wenig ist dies mit dem wichtigsten aller menschlichen Verhältnisse der Fall gewesen. Wie der Mensch, so ist auch die Ehe nachher entweiht worden, ja an ihr ist die allertiefste Herabwürdigung des Menschen zur Erscheinung gekommen.
· „... aber von Anfang an ist es nicht so gewesen“ (Matth. 19,8c),
sagt Christus, und zu dem Zeugnis der heiligen Schrift treten bestätigend die Gesetze und Sitten der ältesten Völker: Erinnerungen aus der besseren Urzeit. Nicht allein bei den Germanen war der Ehebund heilig und unauflöslich, bei den Römern kam in den ersten Jahrhunderten ihres Staatslebens kein Ehebruch vor, und selbst bei den Griechen waren die ursprünglichen Grundsätze so rein und streng, wie die alte deutsche Sitte1. Noch am späten Abend der alten Weltzeit, als bereits Auflösung und Verderben alles zu verschlingen drohte, hat Plutarch in seinen `Vorschriften für den Stand der Ehe2 einen Überrest echter sittlicher Grundsätze aufbewahrt, wogegen selbst manches, das christliche Theologen geschrieben haben, niedrig und unwürdig erscheint.
1.3 Unvollkommenheit im Alten Bund
Die unzähligen Widersprüche gegen die sittliche Bedeutung der Ehe im Leben und in den Vorstellungen der Heidenwelt sind nicht für das Ursprüngliche, sondern für spätere Entartung zu halten. So sind auch die im Alten Bund vorkommenden befremdenden Erscheinungen: Polygamie bei den Patriarchen und Erlaubnis der Ehescheidung im mosaischen Gesetz, nicht als das Uranfängliche, nicht als eine notwendige Vorstufe der christlichen Ehe, sondern nur als Ausnahmen zu betrachten und aus der Nachsicht gegen das bereits tief gesunkene Menschengeschlecht zu erklären. Denn nicht erst Christus, sondern schon das Alte Testament selbst gibt zu verstehen, dass jene Dinge im Widerspruch standen mit dem, was Gott gefällt. Als Abraham die Hagar zum zweiten Weib nahm, geschah es, weil Sarah an der Verheißung nicht festhielt und auf unrechtmäßigem Weg den Sohn zu bekommen suchte, durch den alle Völker gesegnet werden sollten (1. Mose 15,4.5; 16,1.2). Salomos Polygamie wurde durch sein Versinken in Abgötterei gerichtet. Und als ein merkwürdiges Zeugnis gegen diese Entartung steht in einem salomonischen Buch (Spr. 31,10-31), jenes Bild der Hausfrau, welches nahe an die christliche Idee angrenzt und nur im unauflöslichen Bund der Monogamie verwirklicht werden kann. Die mosaische Erlaubnis zur Entlassung des Weibes, wie wenige oder wie viel der Fälle gewesen sein mögen, wo sie Anwendung fand, war eben nur eine Erlaubnis „um der Härte der Herzen willen“ (5. Mose 24,1 / Matth. 19,8). Denn mit dem Sinken der Menschenwürde war auch die Würde des Ehestandes gesunken, oder richtiger das Bewusstsein und Verständnis war in dieser zwiefachen Hinsicht verdunkelt und die Reinheit des sittlichen Gefühls war abgestumpft, so dass zur Verhütung noch größerer Übel und zum Zeichen des herabgekommenen Gesamtzustandes ein solches Zugeständnis stattfinden konnte.
Denn die Monogamie, und zwar die allein durch den Tod auflösbare, ist ein im wahren Wesen des Menschen begründetes Urgesetz. So erscheint sie nicht nur in der biblischen Schöpfungsgeschichte; dass es so ist und so sein muss, leuchtet selbst aus dem natürlichen Sittengesetz und auf dem Standpunkt der allgemein menschlichen Moralität ein. Denn wenn irgendein Gebot auch dem gefallenen Menschen noch ins Herz geschrieben ist und nur durch persönliche Versündigung aus seinem Inneren ausgelöscht werden kann, so ist es das der Schamhaftigkeit. Sie ist der letzte Hort, in dem sich das Bewusstsein ursprünglicher Würde und höherer Bestimmung des Menschen zurückzieht und den es aufs äußerste zu behaupten sucht. Nun aber steht mit diesem mächtigen moralischen Prinzip die Monogamie in so innigem Zusammenhang, dass sie nur zugleich mit der Schamhaftigkeit aufgehoben werden kann. Denn die Monogamie ist die einzige mögliche moralische Form der Verbindung zwischen Mann und Frau. Es ist von Gott in das Herz des Menschen geschrieben, dass eine Hingebung, wie die des Gatten an den Gatten, nur dann mit der persönlichen Würde der beiden besteht, wenn sie ausschließlich Hingebung ist, von vollkommener Treue getragen und mit ewigem Verzicht auf gleiche Vertraulichkeit gegen eine andere Persönlichkeit verbunden. Zerstörung der Menschenwürde in beiden, welche sündigen, ist der Fluch, der jede andere Verbindung der Geschlechter verfolgt.
1.4 Erhebung im Christentum
Diesen Fluch hatte die Heidenwelt in vollem Maße erfahren, als Christus erschien. Er stellte die Menschenwürde wieder her, und eben damit war auch die Würde der Ehe wieder hergestellt. Er erhob die menschliche Natur zu einem Adel und einer Verklärung, wozu sie zwar von Ewigkeit bestimmt, aber noch nie wirklich gelangt war. Denn so rein und herrlich wir uns den Menschen im Paradies zu denken haben, so befand er sich doch nicht auf jener Stufe der Gemeinschaft mit Gott, in die wir in Christo schon versetzt sind, und noch weniger auf jener Höhe der Verklärung, zu der wir in Christo einst gelangen sollen. So ist denn auch die Ehe in der christlichen Kirche mit einer Weihe und einer Bedeutung ausgestattet worden, welche dem Menschengeschlecht der Vorzeit verborgen geblieben war. Die verkannte Würde der Frau wurde ans Licht und zur Geltung gebracht. Im römischen und selbst im mosaischen Recht waren ihr nicht gleich große und heilige Rechte wie dem Manne standen; nach christlicher Idee hat die Frau die selben Ansprüche auf vollkommene Treue des Mannes, wie der Mann auf vollkommene Treue der Frau. Zugleich ist sie nicht mehr nur die Gehilfin des Mannes für das zeitliche Leben, sondern die Miterbin des ewigen Lebens. Und noch mehr als dies alles. Die höchste Liebe Gottes zu den Menschen war in der Aufopferung Christi erschienen. Seine Kirche entstand, und zwischen ihr und dem himmlischen Haupt besteht ein Bündnis, so heilig, zart und fest, wie noch nie eines zwischen Gott und den Menschen gewesen war. Nun erschloss sich für Mann und Frau die Aufgabe, auf Erden ein Abbild dieser vollkommensten Aufopferung, Hingebung und Geisteseinheit darzustellen. War die Ehe schon vorher ein sittliches Verhältnis gewesen, so musste nun in der christlichen Ehe etwas noch heiligeres, ein Mysterium erkannt werden.
Es hatte sich in den letzten Zeiten des alten Bundes nach langer Läuterung des jüdischen Volkes in anspruchslosen Kreisen ein Familienleben entfaltet, so schuldlos und mit jeglicher Tugend geschmückt, dass seine Darstellung in der Kindheitsgeschichte Christi noch jetzt auf jedes Gemüt einen rührenden und reinigenden Einfluss ausübt. Doch war das höchste Urbild, dem die christliche Ehe ähnlich werden soll, selbst damals noch nicht in die Wirklichkeit getreten. Erst als die Kirche Christi da war, konnte gesagt werden:
· „Der Mann ist des Weibes Haupt, gleich wie Christus das Haupt ist der Gemeinde, und Er ist Seines Leibes Heiland. Wie die Kirche sich Christo unterordnete, so auch die Frauen ihren Männern in allen Stücken. Ihr Männer liebet eure Frauen, gleich wie auch Christus die Kirche geliebt und sich selbst für sie hingegeben hat, damit Er sie heiligte“ (Eph. 5,23-26a).
Nun wurde aus dem verfallenen Stoff der heidnischen Menschheit die Ehe als ein Heiligtum wieder aufgebaut. Noch fanden sich einzelne Erscheinungen in der Heidenwelt, aus denen Ernst, Treue und sittliche Würde hervorleuchtet, wie in Brutus und Porcia, Arrhia und Pätus. Aber es waren doch nur Anknüpfungspunkte, an welche sich die christliche Idee anschließen konnte. Die christliche Ehe ist ein bis in das innerste Leben hineinreichender Bund, und dieses Innere ist tiefer als das Innere der vorchristlichen Menschen. Eine Weihe und Fürsorge höherer Art tritt ein. Nicht in romantischer Vorstellung, sondern in der Wirklichkeit besteht nun ein Adel der menschlichen Natur und eine darauf gegründete wechselseitige Achtung, von deren Zartheit das frühere Geschlecht nichts wusste.
Nun erscheint das Familienleben nicht mehr, wie es dem düsteren Ernst neoplatonischer Weisen vorkam, als ein Widerspruch gegen die geistige Bestimmung des Menschen, nicht, wie es manche streng Gesinnte in Israel die Essäer bereits ansahen, als ein Hindernis der Vorbereitung für das Himmelreich. Die christliche Familie gestaltet sich zum Abbild des künftigen Reiches Gottes, in welchem der Wille des Höchsten auf Erden geschehen wird, wie er im Himmel geschieht. Sie ist nicht allein die Vorschule des Himmelreichs, sie ist in gewissem Sinne das vorweggenommene Reich Gottes selbst.
Im eigentlichen Sinne darf dies allerdings nur von der christlichen Kirche ausgesagt werden. Sie ist wirklich das im Mysterium schon vorhandene Himmelreich. Sie wird nicht verschwinden, sondern ihre verborgene Herrlichkeit wird hervorbrechen und ewig leuchten. Die Familie wird verschwinden, die Ehe wird in der zukünftigen Welt nicht mehr sein. Dennoch ist es die Ehe und die Familie, innerhalb welcher sich das Reich Gottes schon im Voraus an dem irdischen Stoff und an den vergänglichen Verhältnissen ausprägen soll. Hier soll im Kleinen schon jetzt jene Weisheit und Milde des Herrschens, jene Willigkeit des Gehorsams, jene Einigkeit im festen wechselseitigen Vertrauen erscheinen, lauter Tugenden, welche die Grundtöne der Harmonie des vollendeten Reiches Gottes bilden werden. Darum, wenn gleich die Kirche das Höhere ist als die Familie, gibt es doch keine Erbauung der Kirche ohne Heiligung des Familienlebens. An geheiligten Familien soll man den Segen erkennen, den Gott durch die Kirche über die Menschenkinder ausgießt. In geheiligten Familien wiederum soll die Stärke der Kirche bestehen. Daher kommt es, dass der Apostel, nachdem er im Brief an die Epheser das Größte über den Ratschluss Gottes mit der Kirche, über ihre himmlische Herkunft und ihre ewige Bestimmung gesagt hat, zu jenen Geboten, welche das Hauswesen umfassen und ordnen, herabsteigt oder vielmehr nicht herabsteigt, sondern, bei seinem Gegenstand beharrend, enthüllt, wie sich im Familienleben der Christen das Wachstum der Kirche und ihre Annäherung an das Ziel der Vollkommenheit zeigen muss.
1.5 Die Ehe zugleich ein natürliches und sittliches Verhältnis
So hoch steht der Zweck und so ideal ist die ganze Auffassung der christlichen Ehe, dass hiermit ihre Naturseite einen störenden Widerspruch zu bilden scheint.
Noch tragen wir alle, wenn wir gleich Ein Geist mit Christo sind, das Bild des irdischen und zwar des gefallenen Menschen an uns. Es gibt mannigfaltige Mahnungen an den gesunkenen Zustand unser aller. Aber zwei von ihnen sind die mächtigsten und ernstesten. Die eine ist der Tod, die andere liegt in der Beziehung des Mannes zum Weibe. Auch stehen beide, Zeugung und Tod, in tiefem Zusammenhange unter sich. Zugleich sind sie eingetreten und zugleich werden sie aufhören.
· „In jener Welt werden sie nicht freien, noch sich freien lassen, denn sie können nicht mehr sterben, da sie Söhne der Auferstehung sind“ (Luk. 20,35.36).
Liegt im Tod etwas demütigendes für den Christen, so auch, und noch mehr im Verhältnis der Geschlechter. Nicht ohne Grund ist diesem Gebiet ein so tief gewurzeltes sittliches Gefühl zum Wächter gesetzt, wie die Schamhaftigkeit. Indem sie uns gebietet, diese Seite unseres Daseins mit Nacht zu bedecken, erinnert sie uns, dass hier eine Entweihung stattgefunden hat, dass hier etwas Heiliges zu Grunde lag, das entweiht worden ist, dass eine weitere Entweihung unseren innersten Wesenskern antasten und uns in das ewige Verderben ziehen würde, und dass dies Gebiet von der heiligsten Scheu umgeben werden muss, wenn wir nicht unsere Christenwürde verleugnen, unsere Erstgeburt verkaufen, den Geist Christi verscheuchen, und einen verzehrenden Fluch auf uns herabziehen wollen.
Die Verbindung von Mann und Frau darf unter den Christen fortbestehen, doch nur umgeben von der strengen Obhut der Schamhaftigkeit und getragen von dem steten Bewusstsein der persönlichen Würde, die der Christ in sich selbst und in dem Gatten anzuerkennen hat. Wie unser Leib, wenn er auch der Leib des Todes genannt wird, von uns nicht vernichtet, sondern gezüchtigt und zum folgsamen Werkzeug der Vernunft und des geheiligten Willens gemacht werden muss, ähnlich verhält es sich auch hier. Die Ehe als natürliches Verhältnis wird durch die religiöse Weihe, die sie empfängt, nicht verneint oder aufgehoben. Baut doch Gott allenthalben auf dem verdorrten Boden des Naturlebens durch Seine Gnade das Paradies einer sittlichen Weltordnung auf; so auch hier. Die Naturseite der Ehe soll fortbestehen, so lange dies zeitliche Leben währt. Im ewigen Leben wird sie nicht mehr sein. Mit der Auferstehung erreicht sie ihr Ende für immer. Aber vor der Auferstehung im irdischen Dasein sie vernichten zu wollen, ist nicht das Gebotene. Doch nur untergeordnet und dienend gegen das Höhere soll sie noch währen. Nicht als Selbstzweck, sondern um eines besseren Zieles willen. Dies festzuhalten, ist die Aufgabe der christlichen Ehe, und hiermit ist eine Askesis oder Übung der ernstesten Art gefordert. Auch hier soll nicht die Vernunft der Natur, sondern die Natur der Vernunft folgen, und durch Selbstzüchtigung muss die Macht der gewaltigsten Leidenschaft dem erleuchteten und geheiligten Willen unterworfen werden.
Die Schrift stellt nicht eine Kasuistik auf, die wir im Gedächtnis herumzutragen hätten, sondern sie gebietet uns, vom Geiste Christi uns leiten zu lassen. Und indem Christus die Kirche stiftete, ihr Seinen Geist mitgab und Seine Diener ihr zu Führern setzte, hat Er die Ratlosen und im Gewissen Bekümmerten an eine lebendige Quelle gewiesen, wo sie Seinen Rat und Trost suchen und finden sollen.3
1.6 Der Zölibat. Altchristliche, römischkatholische und protestantische Ansicht
Betrachtet man die Familie in dem idealen Licht, welches im Brief an die Epheser über sie ausgegossen ist, so kann man es kaum Verstehen, wie nach solchen Aufschlüssen in der Kirche frühzeitig eine so entschiedene und verbreitete Hinneigung zum Zölibat entstehen konnte, welche von einer gleichen Schritt haltenden Abneigung gegen die Ehe kaum zu trennen ist und auch wirklich damit verbunden war. Doch muss man sich hüten, die ganze asketische Stimmung des christlichen Altertums mit voreiligem Urteil für eine Abirrung zu erklären. Denn wer kann verkennen, dass die Ausgangspunkte für sie ebenfalls bereits im Neuen Testament zu finden sind?
Christus musste von der heiligen Jungfrau geboren werden, und während Er die anderen Lebensverhältnisse durchlebte und durch Sein Vorbild heiligte, hat Er für den ehelichen Stand kein Vorbild gegeben. Seine ersten Jünger wandelten, wie Paulus, fast alle auch in dieser Hinsicht in Seinen Fußstapfen.4 In der Offenbarung Johannes (14 Vers 4) wird die Jungfräulichkeit vielleicht nur als Bild, aber doch als Bild der allerhöchsten Reinheit aufgestellt und dadurch selbst zum Gegenstand der Bewunderung und der Nacheiferung gemacht. Man sollte es nie übersehen haben, dass es Menschen gibt, welche zur Führung eines fleckenlosen Zölibats bestimmt, berufen und befähigt sind, wenn gleich solche die Ausnahme bilden. Und warum sollte sich nicht diese Bestimmung in einer wahrhaft heiligen Sehnsucht kundgeben, welche die innere Ruhe und den rechten Wirkungskreis nicht im Ehestand, sondern im jungfräulichen Stand suchen zu müssen glaubt? Der Ledige kann, wie die Erfahrung zeigt, nicht allein die Verfolgung besser ertragen, sondern zu jeder Zeit im Dienst Christi mehr leisten als der Verheiratete. Und nicht nur dies, auch die innere Gemeinschaft mit Christo wird leichter im einsamen Stand ungestört festgehalten als unter den zur Erde niederziehenden Sorgen und Arbeiten des Hausstandes. Ein Zölibat ohne Reinheit des Herzens steht zwar tief unter dem christlichen Ehestand, selbst in dessen minder vollkommener Gestalt, aber niemand sollte leugnen, dass es auch einen reinen Zölibat gibt. Es gibt Menschen, in denen wirklich durch die Liebe Christi und durch die Betrachtung Seiner Leiden die irdische Liebe erloschen ist. Es gibt eine eigentümliche Gabe der Enthaltung, welche Paulus hatte, und wie kann man übersehen, dass er den Besitz und die Bewahrung dieser Gabe höher stellt, als die Führung eines tadellosen Ehestandes, und dass er dem Streben nach dieser Gabe seine Gutheißung und Aufmunterung werden lässt? (1. Kor. 7,8.26.27.3236.38.40).
Dies wurde von Luther, mehr noch von seinen Anhängern verkannt. In der ganzen altprotestantischen Ansicht spricht sich eine voreilige Verzweiflung an der Möglichkeit eines geheiligten Zölibats aus. Diese Verirrung muss gerügt werden, doch dürfen wir dabei keinen Augenblick vergessen, dass sie durch eine andere Verirrung hervorgerufen war. Denn ohne allen Zweifel bedurfte die Askese und das herrschende Urteil über Zölibat und Ehe, wie es sich schon in den ersten Jahrhunderten gestaltet und in der römi
schen Kirche gesteigert hatte, eine moralische Berichtigung. Tief hatte sich das Vorurteil eingenistet, als wenn im Ehestand kein völliger Friede mit Gott und kein wahres Wachstum in allen Tugenden möglich wäre, so dass der Verheiratete stets auf einer niederen sittlichen Stufe bleiben müsse. So war in den einen die Einbildung der Heiligkeit, in den anderen der erschlaffende Wahn, dass von ihnen keine Vollkommenheit gefordert werde, genährt. Durch den Glanz falscher Heiligkeit war der Sinn für die häuslichen Tugenden geschwächt und zugleich der Friede des Gewissens, die Grundbedingung alles christlichen Lebens, gestört. Wie auch die Reformatoren in ihrem Verfahren gegen die kirchlichen Ordnungen gefehlt haben mögen, das war Luthers nie genug zu preisender Verdienst, dass er Unzähligen zum Frieden des Gewissens im Ehestand wieder verholfen und die Familie als Pflanzstätte aller christlichen Tugenden zu erhöhter Anerkennung gebracht hat. Zwar zeigt das sechzehnte Jahrhundert eine große Verwilderung der Sitten, die man übrigens nicht so sehr der Reformation zurechnen, sondern für den Ausbruch vorhandener, alter, gemeinsamer Schäden erkennen sollte.5 Doch ist nicht zu leugnen, dass daneben durch die evangelische Lehre und ihre Nachwirkung auch eine Reinigung des Familienlebens stattgefunden hat und dass gerade in diesem Stück römisch-katholische Länder nicht im Vorzug gegen die protestantischen sind.
Mit Recht erkannte man die Familie wieder als die rechte Schule der unscheinbarsten, aber köstlichsten Tugenden, eine ununterbrochene Übung der Milde, des Gehorsams und der Geduld, welche kein Kloster ersetzen kann. Man sah die vielen Selbsttäuschungen, denen das kontemplative Leben ausgesetzt ist; im aktiven Leben werden sie abgestreift und hier bestehen nur echte Tugenden die Probe.
Jener Irrtum in der altprotestantischen Anschauungsweise, als ob ein reiner Zölibat nicht möglich wäre, hing damit zusammen, dass man überhaupt den Glauben an die Möglichkeit einer wahren Heiligung des Menschen im Diesseits hatte sinken lassen. Dies Verzagen entsprang aus einem aufrichtigen Geständnis allgemeiner trauriger Erfahrungen. Diese Erfahrungen aber legen das betrübendste Zeugnis von dem herabkommenden Gesamtzustand der Christenheit ab. Es war ein Mangel an Glaube, dass man die Tatsache zum Maßstab des Erreichbaren macht. Dadurch ließ man sich das Ziel verrücken, welches dem Christen gesteckt ist, denn dies Ziel heißt Vollkommenheit. Es ist wahr und gewiss, dass wir durch den Glauben gerecht werden. Nicht zu viel Kraft haben die Reformatoren dem Glauben zugeschrieben; sie haben ihm noch zu wenig zugetraut. Du glaubst, dass Christus alle deine Schuld getragen hat. Du tust wohl daran; taue aber auch dies Ihm zu, dass Er dir den Sieg über die Sünde und die Kraft zu wahrer Heiligkeit geschenkt hat.
In den unsicheren Vorstellungen von der Heiligkeit zeigt sich die Schwäche des alten Protestantismus. Nach allen Seiten entfaltet diese Schwäche ihren nachteiligen Einfluss; auch in den Vorstellungen über die Ehe ist sie eingedrungen. Man sollte erwarten, dass das ideale Vergleichen des Ehebundes mit dem Bündnis zwischen Christo und der Kirche den Text der protestantischen Betrachtung der Ehe bilden würde. Aber weit entfernt davon, lässt schon Luther vielmehr hervortreten, was Paulus im ersten Brief an die Korinther (Kap. 7), mit Herablassung zu dem tadelnswerten Zustand jener Gemeinde, über den Gegenstand gesagt hat. Hierbei ist die Moral und das Kirchenrecht allzu sehr stehen geblieben. So kommt es, dass neben vielem trefflichen und tröstlichen, was im Protestantismus über die Ehe als einen Gott gefälligen Stand gesagt worden ist; doch eine allzuniedrige Vorstellung von ihrer Bedeutung und ihrem Zweck sich hindurchzieht, worüber die Theologen verdiente Zurechtweisung von den Juristen bekommen haben.6 Diese niedrige Auffassung hat sich in der Beurteilung der zweiten Ehe, weit auffallender aber, tiefer greifend und erfolgreicher in der Verneinung des sakramentalischen Charakters der Ehe an den Tag gegeben.
1.7 Die zweite Ehe
Tausende von E-Books und Hörbücher
Ihre Zahl wächst ständig und Sie haben eine Fixpreisgarantie.
Sie haben über uns geschrieben: