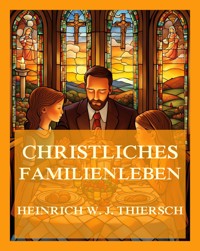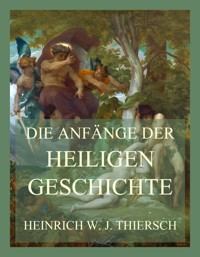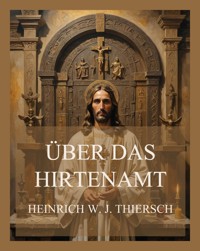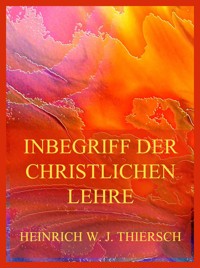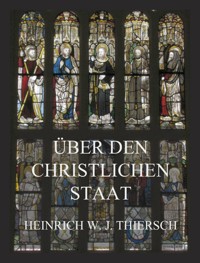
8,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Jazzybee Verlag
- Kategorie: Religion und Spiritualität
- Sprache: Deutsch
Sicher eines der bemerkenswertesten unter den Büchern, die Heinrich W. J. Thiersch verfasst hat. Die sechzehn Probleme, die er erörtert, umfassen das gesamte Gebiet der manchmal durchaus fragwürdigen Beziehungen des Christentums zum Staat, zur Monarchie, zum Republikanismus, zur Gewissensfreiheit, zu anderen Religionen, zu den Rechten des Einzelnen, zu den Strafen, zu den Pflichten der Untertanen und der Herrscher. Prägnant und stilistisch hervorragend verfasst.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 419
Veröffentlichungsjahr: 2024
Ähnliche
Über den christlichen Staat
HEINRICH W. J. THIERSCH
Über den christlichen Staat, H. W. J. Thiersch
Jazzybee Verlag Jürgen Beck
86450 Altenmünster, Loschberg 9
Deutschland
ISBN: 9783988681041
Textquelle: "Edition Albury - Sammlung Peter Sgotzai des Netzwerks Apostolische Geschichte e.V.", bei der wir uns sehr für die freundliche Genehmigung der Nutzung des Textes bedanken.
www.jazzybee-verlag.de
INHALT:
Vorwort.1
I. Das Wesen des christlichen Staates.5
II. Das Christentum in seinem Verhältnis zur bestehenden Obrigkeit und zu den verschiedenen Staatsformen.8
III. Das Christentum und die unumschränkte Monarchie.14
IV. Das Christentum und die modernen Freiheitsbestrebungen.24
V. Die weltliche und die geistliche Gewalt.33
VI. Gemeinsame Gebiete: Volkserziehung und Ehe.42
VII: Die Staatskirche. Die Gewissensfreiheit. Christliche und unchristliche Toleranz.46
VIII. Die Emanzipation der Juden.59
IX. Trennung von Kirche und Staat.68
X. Der christliche Staat gegenüber der Kirchenspaltung und den Sekten.77
XI. Der christliche Staat gegenüber den päpstlichen Ansprüchen.85
XII. Die Aufgabe des christlichen Staates in Beziehung auf den vierten Stand.98
XIII. Das Strafrecht im christlichen Staat.123
XIV. Der Krieg und das Völkerrecht.145
XV. Die Pflichten der Untertanen.154
XVI. Die Pflichten der Fürsten.162
Endnoten. 178
Vorwort.
Vor zwanzig Jahren ließ ich eine Schrift über christliches Familienleben erscheinen, und ich habe Ursache, dankbar zu sein für die freundliche Aufnahme, welche sie gefunden hat. Die gegenwärtige Schrift ist mit jener verwandt. Auch diesmal ist es ein Abschnitt aus der christlichen Ethik, welcher behandelt wird. Die Anwendung der christlichen Grundsätze auf das Staats- und Volksleben soll gezeigt, die auf diesem Gebiet gegenwärtig hervortretenden Probleme sollen im Licht der christlichen Lehre betrachtet werden. Die Geltendmachung christlicher Grundsätze für den Staat ist ebenso berechtigt, ebenso notwendig, ebenso wohltätig, wie für die Familie.
Auch an eine noch frühere Arbeit, an meine Vorlesungen über Katholizismus und Protestantismus, die vor 30 Jahren erschienen sind, schließt dieser Versuch sich an. Überzeugt, dass die christliche Wahrheit in ihrer Fülle und Tiefe über dem Gegensatz der kirchlichen Parteien steht, suchte ich damals das Wahre und Berechtigte in den beiden Konfessionen hervorzuheben und auf Verständigung und Versöhnung hinzuwirken. Diesmal handelt es sich von der richtigen moralischen Würdigung der verschiedenen politischen und sozialen Parteien. Auch hier ist es meine feste Überzeugung, dass keine derselben unbedingtes Lob oder unbedingte Verwerfung verdient. Ich mache den Versuch, in den verschiedenen Systemen die berechtigten Momente hervorzuheben. Auch diese Schrift hat eine friedliche Tendenz.
Endlich ist sie bestimmt, ein kleiner Beitrag zur Verantwortung des christlichen Glaubens zu sein, und zur Zerstreuung der Vorurteile, die gegen ihn von seinen Widersachern in Umlauf gesetzt worden sind, zu dienen. Seit dem Antritt meiner Professur an der Universität Marburg (1843) war es mein Bestreben, in meinem geringen Teil mit Wort und Tat Zu zeigen, dass das christliche Bekenntnis kein Bundesgenosse des Despotismus ist. Auch bei der Herausgabe dieser Schrift wünsche ich die Aufmerksamkeit besonders auf jene Abschnitte zu lenken, in welchen nachgewiesen wird, wie die christlichen Grundsätze der Unterdrückung und dem Missbrauch der Gewalt entgegengesetzt, wie sie der Gewissensfreiheit, der bürgerlichen Freiheit, der geistigen und materiellen Hebung des Volkes günstig und förderlich sind. Wahre Freiheit und politisches Gedeihen ist durch gegenseitiges Vertrauen bedingt. Dieses aber wird dann erst sich befestigen, wenn die verschiedenen Glieder des Staats und der Gesellschaft von einander die Überzeugung gewinnen, dass sich ein jedes durch christliche Grundsätze bestimmen lässt.
Die Abfassung und Herausgabe dieser Schrift ist nicht ein Stück meiner amtlichen Tätigkeit. In der Ausübung meines Pastoralen Amtes bin ich verpflichtet, den Welthändeln und den politischen Streitigkeiten fern zu bleiben. In meiner Eigenschaft als Geistlicher habe ich nur die christliche Lehre zu verkündigen, und mich auf die Wahrheiten zu beschränken, die in dem göttlichen Wort unzweifelhaft enthalten sind. In der besonderen christlichen Gemeinschaft, zu der ich gehöre, wird mit Entschiedenheit darauf gehalten, dass die Politik nicht in das Heiligtum eingeschleppt werde. Wir missbrauchen weder Altar noch Kanzel, noch Seelsorge, um für eine Partei zu werben, oder auf die Wahlen einzuwirken. Als Geistliche haben wir über solche Gegenstände nichts zu sagen.
Doch löscht das geistliche Amt die sonstigen Eigenschaften, die Rechte und Pflichten eines Mannes nicht aus. In unserer Zeit ist jedem Staatsbürger die Befugnis zuerkannt, seine Meinung zu äußern, und von der Freiheit der Presse Gebrauch zu machen, wenn er glaubt dadurch dem Gemeinwohl zu dienen. Auch darf ich sagen, dass mir, während ich meine Staatsanstellung freiwillig aufgab, meine akademischen Grade geblieben sind. Die Verzichtleistung auf einen Gehalt ändert an der wissenschaftlichen Befähigung nichts. Jeden Tag könnte ich die venia docendi, welche ich mir in der philosophischen Fakultät erworben habe, oder meine Qualifikation zum Gymnasiallehreramt geltend machen. Ich darf mich noch zum Lehrstand rechnen, und mich bei einem Unternehmen wie dieses auf meinen Lehrerberuf stützen.
Die Natur des Gegenstandes bringt es mit sich, dass in der Erörterung desselben zwei Elemente zu unterscheiden sind. Einmal die allgemein gültigen Wahrheiten, z. B. der hohe Auftrag der Obrigkeit, ihre Verpflichtung zur Sorge für das Volkswohl, die Verpflichtung der Untertanen zur Treue, zur Ehrfurcht und zum Gehorsam, der Unterschied zwischen der geistlichen und weltlichen Gewalt, die Aufgabe, die ganze Gesetzgebung in Einklang mit den göttlichen Geboten zu bringen. Alle, die sich aufrichtig an die heilige Schrift und an die altchristliche Tradition halten, werden wohl in Beziehung auf diese Grundsätze einig, und sie zu vertreten bereit sein. Ein anderes Element bilden die Versuche, jene Grundsätze auf die geschichtlichen Erscheinungen anzuwenden. Hier ist genaue Kenntnis des Tatsächlichen, hier ist praktischer Verstand, und so zu sagen, Unterscheidung der Geister erforderlich. Hier mischt sich also individuelle Meinung mit ein. Solcher Art sind meine Ansichten über die unumschränkte Monarchie, über die modernen Freiheitsbestrebungen, über Recht und Unrecht in dem neuesten Kirchenstreit, über die soziale Reform, und über das Strafrecht. Dies alles sind gemischte und verwickelte Fragen, und es mag sein, dass über einige derselben sogar meine nächststehenden Amtsgenossen, ungeachtet der Übereinstimmung in den christlichen Prinzipien, anderer Meinung sind. Wir erfreuen uns der Gewissensfreiheit in Beziehung auf die Sympathie mit dieser oder jener politischen oder sozialen Partei. Es wäre also höchst unbillig, für meine besondere Überzeugung in solchen Dingen Andere, welche dieselben vielleicht gar nicht teilen, verantwortlich zu machen. Ich allein habe dafür einzustehen.
Es mag sein, dass bei der Vielseitigkeit des Gegenstandes hie und da eine Anspielung auf die Geschichte oder die Entlehnung eines Satzes aus den angrenzenden Wissenschaften einer Berichtigung bedarf. Solche werde ich mit Dank annehmen und mir zu Nutze machen. Jeder verständige Beurteiler wird aber auch einsehen, dass eine solche Korrektur an den Prinzipien nichts ändert. Die aus der christlichen Wahrheit geschöpfte Thesis bleibt wahr, wenn auch bei der aus der Geschichte entnommenen Hypothesis ein Versehen sich eingeschlichen haben sollte.
Gerne würde ich noch eine geraume Zeit anwenden, um den Gegenstand mit größerer Genauigkeit zu behandeln und dem Gesagten eine vollständigere Begründung zu geben. Aber die Zeit drängt zum Abschluss. Neben den Arbeiten meines anstrengenden Berufs konnte ich diese Schrift nur als ein Parergon in Angriff nehmen. Sie wurde im Lauf eines Jahres, vom 20. Januar 1874 bis zum 30. Januar 1675, nicht ohne Unterbrechungen geschrieben. Zögere ich noch länger, so laufe ich Gefahr von den Ereignissen überholt zu werden. Der Boden des alten Rechts ist nicht nur, wie im Jahr 1648, durchlöchert, er sinkt, unter unseren Füßen ein, und wird von den Meereswellen weggerissen. Wer sich gedrungen fühlt etwas zu tun zur Verteidigung der noch vorhandenen Reste eines christlichen Staatswesens, muss eilen.
Was ich hier darzubieten habe, ist großenteils ein Ergebnis der Erfahrung. Es werden Lebensfragen erörtert, über die sich ein Jeder aus eigenen Erlebnissen eine Überzeugung zu bilden sucht. Diese Fragen haben mich nicht erst seit gestern beschäftigt. Seit meiner ersten Anstellung im Lehramt, 1638, habe ich in der Schweiz, in Bayern, in Hessen, in Preußen und in England gelebt; überall suchte ich die Institutionen und ihre Wirkungen zu beobachten. Ich suchte von erfahrenen und erleuchteten Männern zu lernen. Ich studierte den Charakter der politischen, kirchlichen und sozialen Parteien und ich suchte den ethischen Gehalt einer jeden zu erkennen. Fünfundzwanzig Jahre der Seelsorge haben mich mit der Lage des Landvolks, der Armen und der Fabrikarbeiter bekannt gemacht. So reiften in mir die Ansichten, welche ich hier als eine Art Glaubensbekenntnis und Vermächtnis darzulegen suche.
Schon einmal in stürmischer Zeit, 1648, nahm ich das Wort über die Streitfragen der Gegenwart. Damals suchte ich durch Vorlesungen über das Behältnis der Theologie zu den Fragen der Zeit die Studierenden der Universität Marburg vor den Irreführungen des Atheismus und der Sozialdemokratie zu warnen und zu schützen. Wieder ist eine stürmische Zeit, eine Erschütterung anderer Art, gekommen. Ich finde in ihr eine Aufforderung nicht müßig zu stehen. Die geistige Noch der verworrenen Gegenwart drängt mich zu diesem, ich weiß es wohl, gewagten Unternehmen. Ich wünsche eine Pflicht gegen meine ehemaligen Zuhörer, gegen meine Söhne und ihre Altersgenossen zu erfüllen, indem ich ihnen einige Ergebnisse meines Lebens mitteile. Ich tue es in der Hoffnung, dass diese Darlegung meinen jüngeren Freunden eine Hilfe zur Orientierung sein könnte. Wenn es gelingt, wenigstens Einigen den Charakter zu stärken, und sie gegenüber dem schlaffen und gesetzlosen Geiste der Zeit in der Richtung des Willens auf das Sittengesetz und im Festhalten an der Lehre Christi zu kräftigen, so werde ich mich reichlich belohnt finden und Gott dafür danken.
Augsburg den 1. März 1875.
Der Verfasser.
I. Das Wesen des christlichen Staates.
Die Gesetzgebung und die gesamte Lebensordnung in unserem Vaterland ist erschüttert und wir befinden uns in einer Zeit des Übergangs, deren zukünftiges und letztes Ergebnis noch in Dunkel gehüllt ist. Es gab eine Zeit, wo die besten Kräfte daran gesetzt wurden ein christliches Staatswesen zu verwirklichen. Jetzt ist es anders, und nicht allein aus Ermüdung, sondern mit Bewusstsein und Vorbedacht wird jene Aufgabe bei Seite gesetzt und anderen Zielen nachgestrebt. Wie am Ende des vorigen Jahrhunderts die öffentliche Meinung in Frankreich sich zu der überspannten Behauptung verirrte: Der Staat ist ein Atheist und er muss ein solcher sein, L'état est athée et doit l'étre, so findet man jetzt in deutschen Blättern die verwegene Äußerung: Der christliche Staat ist utopisch womit alle, die nach Verwirklichung des Ideals streben, der Torheit beschuldigt werden. Jedoch angenommen, mit den vorhandenen Mitteln und Materialien sei die hohe Aufgabe nicht vollkommen zu lösen seit wann gilt der Grundsatz, dass man wegen der Unerreichbarkeit des Ideals auch das Ringen nach einer wenigstens annähernden Darstellung desselben im Leben unterlassen solle? Wäre man berechtigt, das Staatsleben ohne Rücksicht auf die christlichen Grundgedanken zu gestalten, so könnte mit demselben Recht jeder Einzelne das Streben nach Verwirklichung der Tugend fahren lassen, denn auch diese ist, in ihrem vollen Sinne genommen, ein Ideal, das hoch über der alltäglichen Wirklichkeit schwebt.
Die Anwendung des abstrakten Begriffes Staat erschwert die Lösung der Frage. Man kommt der Wirklichkeit und. ihrem Verständnis näher, wenn man das Volk, das ist die Nation, und die für dasselbe bestehende Obrigkeit, d. h. die Träger der für ein Gemeinwesen unentbehrlichen Autorität, ins Auge fasst. Die Nation mit ihrem Oberhaupt, zu welchem Alle, die an der bürgerlichen Autorität Anteil haben, zu rechnen sind, bildet eine Körperschaft. Ähnlich wie ein Hausstand, aus Kindern, Dienstboten und Insassen bestehend, mit Vater und Mutter an der Spitze, bildet auch die unter einer Obrigkeit zusammengefasste Nation ein Ganzes, ein Rechts-Subjekt, eine moralische Persönlichkeit.
Wer getraut sich zu leugnen, dass eine Familie nach christlichen Grundsätzen geleitet und geordnet werden soll? Jedes einzelne Glied und ebenso die Familie als Einheit hat den Beruf und die Verpflichtung, sich in ihrem ganzen Verhalten nach christlichen Grundsätzen zu richten. Derselbe Beruf, dieselbe Verpflichtung tritt ein, wenn eine Nation als solche, d. h. in der Mehrheit ihrer Mitglieder und unter Mitwirkung ihrer Obrigkeit, die christliche Religion annimmt und sich zu derselben bekennt. Dies ist geschehen. Es ist nicht eine Vermutung oder Voraussetzung, es ist eine große unumstößliche geschichtliche Tatsache. Jede der noch bestehenden Nationen Europas, mit Ausnahme der Juden, die als Fremdlinge unter uns wohnen, und der Osmanen, die als Eindringlinge hereingekommen sind, hat diesen Schritt getan. Jede europäische Nation hat das christliche Bekenntnis und den christlichen Kultus mit Beseitigung des alten Heidentums zu dem ihrigen gemacht. Indem die Einzelnen die Tauft annahmen, hat auch das Ganze, das aus diesen Einzelnen besteht, die christliche Weihe empfangen. Unverkennbar sind die Wohltaten, welche dadurch einer jeden Nation, allen ihren Ständen und den Einzelnen zugeflossen sind. Mit den Wohltaten des Christentums übernimmt man aber zugleich seine Verpflichtungen. Das Bekenntnis zu Christus schließt notwendig auch das Gelübde, die Gebote Christi zu halten, in sich. Christlicher Glaube ohne christliche Gesittung verfällt dem Verwerfungsurteil, welches Christus mit den Worten ausgesprochen hat: „Warum heißet ihr mich Herr, und tut nicht, was ich euch gebiete?“ Wird aber hiermit Ernst gemacht, die Gesetze des Landes, die öffentlichen Institutionen, die Handlungsweise der Obrigkeiten, und das Volksleben mit den Geboten Christi in Einklang zu bringen, was ist dies anders als das Streben nach Verwirklichung des christlichen Staats?
Diesem Bestreben verdanken wir es, dass bei uns lein rechtloser Sklavenstand, kein unsittlicher Kultus, dass Fürsorge für die Noch der Armen, für die Pflege der Kranken, dass eine öffentliche Erziehung der Jugend besteht, dass die durch das Christentum bestätigte und geadelte Menschenwürde anerkannt wird.
Jene Tugenden, welche auch in den Staaten des heidnischen Altertums, z. B. in den besseren Zeiten der römischen Republik blühten, die Eidestreue, die Gerechtigkeit der Richter, die Unbestechlichkeit der Beamten und die Aufopferung für das Vaterland, haben durch das Christentum eine neue Bürgschaft und eine höhere Sanktion als zuvor bekommen. Zu den höchsten Wohltaten, die den Völkern durch die christliche Religion zugekommen, ist der Grundsatz zu rechnen, dass vor Gott kein Ansehen der Person ist. Während das ganze heidnische Altertum zur Vergötterung der Könige hinneigte und dadurch die verderblichste« Ausartungen begünstigte, gilt für alle Bekenner des Christentums der göttliche Grundsatz, dass die Vornehmsten im Volke für ihre Taten dem himmlischen Richter ebenso verantwortlich sind, wie die Geringsten, und dass Ein Sittengesetz für Alle gilt.
Es wäre unerklärlich, wie Jemand dem Grundsatz, dass der Staat sich christlich gestalte« soll, widersprechen konnte, wenn in den Zeiten, wo dieser Grundsatz das öffentliche und allgemeine Bekenntnis; war, kein Missbrauch und keine Entartung sich eingeschlichen hätte. Aber so ist es geschehen; riesengroß steht diese Tatsache vor uns. Schon durch das ganze Mittelalter zieht sich der Widerspruch zwischen christlichem Bekenntnis und unchristlichem Leben hindurch. Das ausgesprochenste Bekenntnis zu Christus in öffentlichen Kundgebungen, feierlichen Handlungen und Gesetzesvorschriften, daneben Ungerechtigkeit, Gewalttat, unreines Leben, Grausamkeit und Verfolgungssucht. Einen noch gefährlicheren Charakter nahm dies alte Übel in den despotisch regierten Staaten an, nach der Reformation, unter dem alten Regime. Seit der Kirchenspaltung suchten die verschiedenen Parteien, jede auf ihre Art, durch Betonung ihrer besonderen Orthodoxie und durch die damit verbundene Unduldsamkeit, das christliche Bekenntnis gleichsam auf die Spitze zu treiben. Indem gleichzeitig das Volksleben vernachlässigt wurde und das Verderbnis in den höchsten Ständen überhandnahm, potenzierte sich gleichsam die Unwahrheit und der innere Widerspruch, woran schon die christlichen Staaten des Mittelalters krankten. Dass wir Alle verpflichtet sind, den christlichen Staat anzustreben, ist eine unvergängliche sittliche Wahrheit, dass aber der christliche Staat unter einem Heinrich dem VIII., Iwan dem Schrecklichen, Philipp dem II., Ferdinand dem II., oder Ludwig dem XIV. verwirklicht worden sei dies zu behaupten, wäre eine ungeheure Lüge.
Das Beste wird, wenn es ausartet, zum Schädlichsten. Coruptio optimi pessima. Die Unwahrheit des angeblich christlichen Staatswesens hat nicht nur aufhaltend und störend, sondern zersetzend gewirkt. Das Rühmen des christlichen Staats und die gleichzeitige Nichtbefolgung der höchsten Gebote Gottes ist Heuchelei; Heuchelei aber ruft den gerechten Widerspruch der besseren Elemente in der menschlichen Brust hervor. Dieser Widerspruch wird nun nicht allein gegen die Entstellung, sondern gegen das Prinzip selbst gerichtet. Die schlechtesten Elemente der menschlichen Gesellschaft bemächtigen sich dieser Bewegung. Unter dem Vorwand sittlicher Entrüstung wird ein Widerstand organisiert, bei dem es nicht darum zu tun ist, mit der Tugend Ernst zu machen, sondern die Wirksamkeit christlicher Grundsätze aus dem Leben des Volkes und der Einzelnen vollends hinwegzuschaffen. So haben die Untugenden der Geistlichen, die von ihnen gegebenen Ärgernisse nicht allein den Glauben der Völker geschwächt, sondern dem Irrglauben und den Lästerungen die Türe geöffnet; so ist durch Unsittlichkeit und Tyrannei der Herrscher, welche den Namen Christi im Munde führten, das Feuer des Hasses, der Empörung und der Zerstörungswut in den Völkern angezündet worden. Wer nun nach dem allen für die Herstellung des christlichen Staates das Wort nimmt, hat gegen das Vorurteil zu kämpfen, als wollte er die Missbräuche und Entstellungen, mit denen die alte Ordnung behaftet war, wieder herbeiführen. Möchte es gelingen zu zeigen, dass der christliche Staat, recht verstanden, alle Bedingungen des öffentlichen Wohles in sich trägt. Mag er noch so sehr unter den Händen des Menschen entwürdigt worden sein, die Aufgabe steht fest und die Verpflichtung Aller, nach einer besseren Lösung derselben als die frühere war, zu streben, ist unumstößlich.1
II. Das Christentum in seinem Verhältnis zur bestehenden Obrigkeit und zu den verschiedenen Staatsformen.
Als die christliche Religion im römischen Reich zur Geltung gelangte, als sie unseren germanischen Vorfahren verkündigt wurde, da fand sie in beiden Fällen ein geordnetes Staatswesen schon vor. Die Verkündiger des Evangeliums brauchten ein solches nicht erst zu schaffen; und gesetzt, es hätte sich, ihnen Gelegenheit dazu geboten, so fehlte ihnen gänzlich Auftrag, Vollmacht und Berechtigung zu einem solchen Unternehmen. Dies geht mit Klarheit aus dem Verhalten Christi selbst und Seiner Apostel hervor. Während sie die bestehende Obrigkeit anerkennen, schreiben sie sich selbst keine weltliche Gewalt zu und leiten aus ihrem höheren Beruf keinen Anspruch auf Mitwirkung in der Gesetzgebung, der Rechtsprechung oder Staatsverwaltung ab. Die Geschichte des Lebens Christi auf Erden beginnt damit, dass dem Imperator Augustus der Zensus entrichtet wird. Während die orthodoxen Juden es für ungeziemend erachteten, einem heidnischen Gewalthaber die Steuer zu bezahlen, sagte Christus: «Gebet dem Kaiser, was des Kaisers ist.“ Christus unterschied aufs bestimmteste Seine Diener von den weltlichen Herren. Als Petrus gegen die Häscher, die an den Gerechten Hand anlegten, das Schwert zog, tat Christus ihm Einhalt mit den Worten: „Stecke dein Schwert in die Scheide, denn wer das Schwert nimmt, soll durchs Schwert umkommen.“ Als Christus vor dem Tribunal des Pilatus stand, erkannte er dessen Richteramt und die ihm verliehene Macht über Leben und Tod feierlich an. So hat Er das Schwert aus der Hand Seines Dieners Petrus genommen; dem Diener des Tiberias hat Er es gelassen. Hiermit war die Grundlage gegeben, auf welche sich die Unterweisung in den Briefen der Apostel über die von Gott verordnete Obrigkeit stützt.
Es ist höchst merkwürdig zu beobachten, wie weit die Apostel davon entfernt waren, die Rechtmäßigkeit der bestehenden Ordnungen im römischen Reich in Zweifel zu ziehen. Der Ursprung derselben war in vieler Hinsicht mit Schuld behaftet, das System, wonach die Provinzen regiert wurden, war drückend. Schon zeigte sich in den ersten Anfängen der Missbrauch der Staatsgewalt zur Verfolgung der Christen. Bei dem allen wird keine Einsprache gegen den bestehenden Reichsorganismus laut, die Christen beteiligen sich weder an dem jüdischen Krieg noch an irgendeinem Aufstand, und während der grausamen Verfolgungen ereignete sich niemals der Fall, dass die Christen, um ihren Leiden ein Ende zu machen, einer revolutionären Bewegung sich angeschlossen hätten.
Als das Evangelium bei den germanischen Völkern Aufnahme fand, trat es in eine Sphäre ein, wo edlere Verhältnisse bestanden. Es traf mit dem germanischen Königtum zusammen. Hier waltete nicht der auf Usurpation und Eroberung gegründete Despotismus. Hier hatte jeder der deutschen Stämme einen König aus seiner Mitte und diesem wohnte zwar im Krieg beinahe unumschränkte, aber im normalen Zustand des Friedens eine gemäßigte Gewalt bei. Auch dem deutschen Königtum und dem deutschen Recht gegenüber verhielt sich das Christentum anerkennend. Wiewohl die alte Kirchengeschichte keinen Fall aufweist, wo das Christentum in eine Republik, wie vor Zeiten die griechischen Republiken gewesen waren, eintrat, so können wir doch nach dem allgemeinen Verhalten mit Bestimmtheit schließen, dass auch eine schon vorhandene republikanische Staatsordnung auf Anerkennung voll Seiten der Diener Christi zu rechnen hatte.
Die Frage, welche von den verschiedenen Staatsverfassungen den christlichen Prinzipien am besten entspreche, lag für das Mittelalter noch in der Ferne. Erst in den Bewegungen der neueren Zeit, welche in der englischen Revolution ihren Anfang nahmen, trat diese. Frage in den Vordergrund. Seitdem haben sich entgegengesetzte politische Parteien auf die christliche Lehre berufen, und jede von ihnen wollte behaupten, dass die von ihr angestrebte Staatsordnung durch die von Gott geoffenbarte Heilswahrheit empfohlen sei. Die englische Geschichte gewährt die lehrreichste Illustration. Dort sind die beiden Extreme, ein jedes mit diesem kühnen Anspruch auf eine göttliche Legitimation, hervorgetreten.
Nachdem die königliche Prärogative von Karl I. und Lord Strafford aufs höchste gesteigert worden war, verfocht im Interesse des Stuartischen Königtums Filmer die Theorie von der Machtfülle des Königs, der gegenüber keine Privilegien des Parlaments, keine Rechte des Volks geltend gemacht werden dürfen.2 Solche bestehen zwar, aber sie seien nichts Ursprüngliches und Selbstständiges, sondern Gnadengeschenke des Königs, die er in seiner Machtvollkommenheit gegeben habe, die er aber, wenn er es für heilsam erkennt, auch wieder beschränken und zurücknehmen könne. Diese unveräußerliche Macht sei ihm von oben verliehen. Das durch keine andere Gewalt eingeschränkte Königtum sei die von Gott verordnete, die dem christlichen Prinzip entsprechende Staatsverfassung.
Die entgegengesetzte Vorstellung wurde von Oliver Cromwell und seinen Anhängern vertreten. Die Republik sei die einzige christliche Staatsform. Das Königtum, von den Tudors und Stuarts missbraucht, war für jene ernsten Männer ein Gegenstand des Misstrauens und Abscheus geworden. Von dieser Seite sei für das Volk und für die Herstellung eines christlichen Volkslebens nichts zu hoffen. Das Volk selbst müsse die Sache in die Hand nehmen, und nur in Gestalt einer christlichen Demokratie könne das Reich der Gerechtigkeit, der Gottesfurcht und der reinen Sitte hergestellt werden. Unter Karl II. wurden Unglückliche hingerichtet, weil sie von keinem anderen König außer Jesus etwas wissen wollten.
Als die Stürme der ersten und zweiten Revolution in England vorüber waren, ermäßigten sich die Ansichten der beiden Parteien. Die politischen Systeme der Tories und der Whigs wurden ausgebildet. Die Formel, in welche sie ihre Ansicht zusammenfassten, lautete bei den einen: Die Obrigkeit ist von Gott, bei den anderen: Die Obrigkeit ist um des Volkes willen da. Diese Schlagwörter dienen noch heute als treffende Bezeichnung des Grundgedankens beider Parteien.
Offenbar stehen sie in keinem kontradiktorischen Gegensatz. Ist der eine dieser Sätze begründet, so wird dadurch die Richtigkeit des anderen nicht ausgeschlossen und in der Tat enthält jeder von beiden eine moralische Wahrheit, keiner lässt sich von christlichem Standpunkt aus bestreiten, und gerade die Synthese von beiden dürfte als ein treffender Ausdruck der christlichen Anschauung dienen. Die Obrigkeit ist von Gott verordnet, und die göttliche Absicht dabei ist Förderung und Sicherung des Volkswohles. Das ganze obrigkeitliche Wirken soll dem Volke zum Besten dienen; eben damit wird die göttliche Absicht, die der Stiftung der Obrigkeit zu Grunde liegt, erfüllt. Die Behauptung der Whigs ist christlich und das Losungswort der Tories ist christlich, so lange beide in einfach bejahender Weise ausgesprochen werden. Unrichtig aber und in den Folgerungen dem christlichen Prinzip widersprechend wäre es, wenn eine oder die andere Behauptung in verneinender und ausschließlicher Weise aufgestellt würde. Zu sagen: die Obrigkeit ist nicht um des Volkes willen da, oder: die Obrigkeit ist nicht von Gott verordnet, wäre beides entschieden falsch.
Der Kampf, welchen man in England praktisch ausfocht, wurde von scharfsinnigen Denkern auf dem Kontinent philosophisch gefasst, und auf die Erörterung über die ersten Anfänge des Staatslebens und über den Ursprung der obrigkeitlichen Gewalt zurückgeführt. Hier sind es zwei wissenschaftliche Auffassungen, die einander bis auf diesen Tag bestreiten.
Die eine Lehre geht von der Annahme einer ursprünglichen Gleichheit und Gleichberechtigung aller Volksgenossen aus; sie nimmt einen Naturzustand dieser Art als Erstes an, der aber nicht fortdauern konnte, weil ihm jede Organisation fehlte. Für ein gesichertes Zusammenleben war eine bestimmte Ordnung, eine schützende Gewalt erforderlich. Durch einen freiwilligen Vertrag hätten nun die Vielen einen Teil ihrer Rechte an die Wenigen abgetreten, welche aus Auftrag der Gesamtheit Leben und Eigentum schützen: und die gemeinsamen Angelegenheiten verwalten sollen. Auf solche Art sei die Obrigkeit entstanden. Es ging alles ganz natürlich und menschlich zu, wie wenn heutzutage in Kalifornien eine Masse von Ansiedlern und Goldgräbern sich als ein notdürftiges Gemeinwesen konstituiert. Der Staat, aus menschlichem Willen aufgebaut, ist nach dieser Vorstellung nur eine gegenseitige Versicherungsanstalt für das Leben und den Besitzstand der Beteiligten. Die Lehre vom status naturalis haben Grotius und Puffendorf ausgebildet. Rousseau hat in seinem Contrat social die letzten Folgerungen gezogen und seine Lehre wurde das Programm der Bewegungspartei in ganz Europa und Amerika.3 Gegenüber der Einseitigkeit und Flachheit dieser Theorie stützen sich nun die Verteidiger der Autorität und der althergebrachten Ordnung umso nachdrücklicher auf das entgegengesetzte Prinzip. Die Familie, so sagt man, ist das Erste, und in der Familie die väterliche Autorität. In dem Vater, der die Seinen zu ernähren, zu schützen und zu verteidigen, der im Kreis seiner Familie Friede und Eintracht, Recht und Sitte zu erhalten verpflichtet ist, wurzelt die Obrigkeit. Aus der väterlichen Gewalt ist die obrigkeitliche herzuleiten. Die Familie erweiterte sich in uralter Zeit durch Hinzutreten der Dienstboten, der Leibeigenen, der Schutzbefohlenen, bei umfassendem Grundbesitz und zunehmendem Wohlstand, zum primitiven Staate. Hiob und Abraham stehen schon als Könige da, ähnlich wie auch bei Homer der große Grundbesitzer als König erscheint, der auf sein Szepter gestützt den Arbeiten der Pflüger zusieht und ihnen den erfrischenden Becher darreicht. Der ursprüngliche Staat war der patriarchale.
Wie nun die väterliche Gewalt in der Familie gewiss nicht auf menschlicher Erfindung, nicht auf einem Gesellschaftsvertrag der Kinder und einer Abtretung ihrer Rechte beruht, sondern auf einer göttlichen Stiftung und Gesetzgebung, welche dem Dasein aller Einzelnen vorangeht und über die Willkür der Menschen erhaben ist, so sei es auch mit der obrigkeitlichen Autorität. Von dem Patriarchalstaate kommen die späteren Staatsformen her; den Zusammenhang mit demselben müsse man festhalten; die ganze Auffassung und Gestaltung des Staatslebens müsse sich jenem Vorbild anschließen.
Hat der Naturzustand so wie hier vorausgesetzt und beschrieben wird, je existiert? Die Erfahrung und die Vernunft sagt, dieser Zustand völliger Gleichheit und Gleichberechtigung aller Einzelnen hat nie existiert und konnte nicht existieren. Er selbst, wie der vermeintliche Übergang aus demselben in den Staat auf dem Wege des Vertrags, ist ein Phantasiegebilde, worauf sich nichts bauen lässt. Ludwig von Haller hat im ersten Bande seiner Restauration der Staatswissenschaft diese Annahme für alle Zeiten widerlegt. Andererseits stimmt es eben so wenig mit der Geschichte überein, alle Staatsordnungen aus der Patriarchaten Haushaltung herzuleiten. Gesetzt die alten despotischen Monarchien von Ninive und Babylon, von Ägypten und China wären auf solcher Grundlage erbaut und aus solcher Wurzel erwachsen, so zeigen sich doch in den europäischen Staatsverfassungen, den griechischen, der römischen und vor allem in denen des germanischen Mittelalters, noch ganz andere Ursprünge. Nicht die väterliche Gewalt eines Einzigen liegt zu Grunde, nicht eine alles andere niederhaltende Autorität, sondern neben der Würde des Staatsoberhauptes findet sich als zweite Voraussetzung ein Bund freier und selbstständiger Männer, geschlossen zu gemeinschaftlichem Schutz und Trutz. Die Urgeschichte Islands, wie sie uns Konrad Maurer beschrieben hat, ist wohl das merkwürdigste Beispiel Hiervon, wie ein Staatswesen aus dem freien Zusammentritt unabhängiger und gleichberechtigter Familienhäupter entstand4 In geschichtlichen Tatsachen solcher Art ist die Wahrheit zu erkennen, welche der von ihren Anhängern unglücklich dargestellten Lehre vom Naturzustand und dem Ursprung des Staats aus demselben zu Grunde liegt. Gerade an den edleren und lebensvolleren Staatengebilden lassen sich die Spuren beider Elemente erkennen, die man am kürzesten mit dem englischen Ausdruck headship und fellowship bezeichnen kann. Beide Ausgangspunkte waren in der Vorzeit gegeben. Auf dem Bestreben, beide Prinzipien in Tätigkeit zu erhalte« und in Einklang zu setzen, beruht das eigentliche Leben und Streben. Wo das Eine von dem Anderen verschlungen wird wenn dies überhaupt möglich wäre, denn vollständig wird es wohl nie gelingen da entstehen verkümmerte und unglückliche Staatsformen, sei es der leblose und starre Absolutismus, sei es eine ruhelose, wilde und sich selbst verzehrende Demokratie. Ist die Lehre richtig, dass die harmonische Bewegung der Himmelskörper auf zwei Kräften beruht, die einander beschränken, auf der Zentrifugal- und der Zentripetalkraft, so haben wir in der Natur die Analogie für die zwei Kräfte, welche den Bestand der gesellschaftlichen Ordnung bedingen, nämlich Freiheit und Autorität. Wo beide zur Entwickelung gekommen, wo durch die Erfahrung und Bemühung der Jahrhunderte beide befestigt und in Einklang gebracht worden sind, da wird sich die möglichst vollkommene und befriedigende Staatsverfassung finden. Diesem Ideal am nächsten steht die englische Verfassung. Bald wird sie uns von den Anhängern der Autorität, bald von den begeisterten Verehrern der Freiheit zur Nachahmung empfohlen, und gerade diese Bewunderung von Seiten beider Parteien dient der Tatsache zur Bestätigung, dass dort die beiden berechtigten Elemente des Staatslebens mehr als anderswo zur Geltung gekommen sind.
Diese Prinzipien, deren Wirken seit uralter Zeit im Leben der Völker zu spüren war, verkörpern sich in den beiden großen Parteien, deren Streit die Gegenwart erfüllt, deren eine die Erhaltung, die andere die Neuerung auf ihre Fahne geschrieben hat. So muss denn auch diesen Parteien ihre Berechtigung zugestanden werden. Es ist unstatthaft, von vornherein die eine für christlich im Prinzip, die andere für unchristlich zu erklären. In alle politischen Kämpfe mischt sich die Selbstsucht ein und keine Partei hält sich von Verwirrungen frei. Umso gefährlicher wäre es für die Sache des Christentums, wenn man es mit einer dieser Parteien identifizieren wollte, denn man würde es dadurch für die Exzesse derselben mit verantwortlich machen.
Will man zu einer gerechten sittlichen Würdigung der politischen Gegensätze unserer Zeit gelangen, so wird dies nie möglich sein, solange man nur zwei Parteien unterscheidet. Denn neben den besonnenen und gemäßigten Vertretern, sei es der Erhaltung oder der Neuerung, stehen die Extreme, welchen auf der einen Seite zähes Festhalten an althergebrachten und drückenden Missbräuchen, auf der anderen Seite pietätlose Zerstörungslust zur Last fällt. Man muss nicht zwei, sondern vier Parteien ins Auge fassen. Nur so wird eine gerechte Würdigung derselben und ihres Verhältnisses zum Christentum, nur so wird eine annähernde Verständigung zwischen den Streitenden möglich sein.5
Die Verkündiger der christlichen Wahrheit sollten sich hüten, bei dem Kampf zwischen Erhaltung und Neuerung sich in den Dienst der einen oder der anderen Partei zu stellen. Sie würden sonst, indem sie kurzsichtigerweise das eine Prinzip für christlich, das andere für unchristlich erklären, den Streit verbittern, anstatt, wie es ihr Beruf mit sich bringt, versöhnend zu wirken.
Das Christentum schafft keine Staatsverfassung und es hebt keine auf. Aber es trägt dazu bei, wo es Aufnahme findet und Einfluss auf die öffentliche Meinung gewinnt, dass die Härten und Einseitigkeiten gemildert werden, und Annäherung zu der möglichst vollkommen organischen Gestaltung sich wie von selbst ergibt. Die christliche Lehre wirkt sänftigend auf die Gesinnung und die Sitten. Sie erinnert die Mächtigen an ihre Abhängigkeit von Gott und an die Rechenschaft, die sie Ihm schuldig sind, sie sucht ihre Herzen zum Wohlwollen und zum Vertrauen gegen die Untergebenen zu stimmen. Gleichzeitig befestigt sie in den Untergebenen die Gefühle der Ehrfurcht. Sie bestätigt die Achtung vor den Gesetzen. Sie begabt die Wächter derselben mit einer höheren Weihe lauter Einwirkungen, vor welchen die Auswüchse des Despotismus so wie die der einseitigen Volksherrschaft verschwinden.6
III. Das Christentum und die unumschränkte Monarchie.
Ist das Gesagte richtig und verhält sich das Christentum gegen die verschiedenen Staatsformen, gegen die monarchische, aristokratische und die demokratische anerkennend, so ist zu erwarten, dass unter jeder dieser Formen die Verwirklichung des christlichen Staates möglich ist. Wie man im Blick auf das Volkswohl sagen kann: jede Regierung ist gut, wenn nur gut regiert wird, so wird auch der christliche Staat überall zu Stande kommen und gedeihen, wo die Herrscher, die Urheber und Handhaber der Gesetze sich an die Gebote Christi gebunden wissen und sich von christlichen Grundsätzen leiten lassen. Die Geschichte hat dies bestätigt. Wenn gleich das Ideal nirgends erreicht wurde, so hat doch ein christliches Staatsund Volksleben wie in Monarchien, so auch in Republiken, z. B. in Genf, in Holland und in den Neuenglandstaaten geblüht. Diese Sätze, die zur Beruhigung und Mäßigung der Leidenschaften geeignet sind, scheinen allbekannt und selbstverständlich zu sein, und doch ist zu ihrer Begründung eine Polemik notwendig, deren wir uns nicht entschlagen können. Denn die älteren unter den Zeitgenossen wissen aus Erfahrung genug zu sagen von der gewaltigen Tätigkeit einer Partei, welche den christlichen Staat auf ihre Fahne geschrieben hatte und zu seiner Verwirklichung allein die unumschränkte Monarchie für geeignet hielt. Diese sei vor allen anderen die von Gott gewollte, die mit den christlichen Grundsätzen harmonierende Staatsform. Zwar seien die Rechte ständischer Korporationen, wie solche im Mittelalter bestanden, unter dieser Monarchie zulässig, aber alle modernen Freiheitsbestrebungen, die seit 1789 hervorgetreten sind, und die hieraus hervorgegangenen Verfassungen seien verwerflich. Der Christ also müsse sich für die unumschränkte Fürstengewalt und gegen das konstitutionelle System erklären. Es ist das System der Contre-Revolution, welches nach Napoleons Fall nahezu fünfzig Jahre bei den großen und kleinen Mächten des Kontinents gegolten hat. Die Exzesse der Demokratie in der französischen Staatsumwälzung und die Leiden, welche das in seinem Wesen revolutionäre Kaiserreich des ersten Napoleon über Europa verhängte, riefen diese Rückwirkung hervor. Die Woge der Freiheitsbewegung, welche Europa überflutet hatte, wälzte sich zurück, und bei der Wiederaufrichtung des alten monarchischen Systems glaubte man sich des Bündnisses mit den neubelebten christlichen Ideen rühmen zu dürfen und durch diese die ganze rückläufige Bewegung rechtfertigen zu können. Graf Joseph de Maistre, der römisch-katholische Diplomat, war es, der dem von Metternich und Gentz vertretenen System eine religiöse Färbung verlieh. In Preußen kleidete es sich in das Gewand evangelischer Frömmigkeit. Es wurde üblich, mit Zitaten ans den messianischen Psalmen das preußische Königtum zu verherrlichen. Es schien, als wenn man dort den zwölf Artikeln des apostolischen Symbolum einen dreizehnten zugefügt hätte, den Glaubenssatz von der Machtfülle des Königs. Vilmar verlangte, dass jeder Christ und insbesondre jeder deutsche Christ ein politisches Glaubensbekenntnis ablege und für dasselbe einstehe, das Bekenntnis zu der Vollgewalt des Fürstentums und gegen das konstitutionelle Prinzip.7 Die neue preußische Zeitung brachte folgende Verfassungsurkunde in Vorschlag:
§ 1. Der König befiehlt.
§ 2. Das Volk gehorcht.
Wir haben es hier allein mit der Behauptung zu tun, dass dies System das eminent christliche sei. Man kann sich nicht ohne Bedauern entschließen, gegen solche anzukämpfen, die doch noch den christlichen Staat wollten. Lieber würden wir es unterlassen, eine Richtung zu bestreiten, deren Stern ohnehin im Erbleichen ist, wäre nur nicht der geistige Schaden so groß, welcher durch die Vermengung der heiligen Sache des Christentums mit der Sache der vielfach entweihten unumschränkten Monarchie angerichtet worden ist. Durch diese Vermischung wurde der christliche Glaube kompromittiert. Das Vorurteil ist riesengroß geworden, als ob jedes entschieden christliche Bekenntnis mit dem Despotismus im Bunde stünde, und die rechtgläubige Lehre selbst eine Erfindung im Interesse der Tyrannen zur Zähmung der Völker wäre. Die christliche Sittenlehre ist verfälscht worden durch die Behauptung, dass die Fürsten sich über die Gesetze wegsetzen und die gegebenen Zusagen zurücknehmen dürften. Wer heutzutage für den christlichen Staat das Wort nimmt, muss befürchten, vor der öffentlichen Meinung als ein Mitschuldiger jener schweren Verirrungen und als ein Verbündeter volksfeindlicher Mächte zu erscheinen. So ist es denn Pflicht, den christlichen Staat gegen seine Verehrer und Freunde zu verteidigen und jeder tut etwas Gutes, welcher dazu beiträgt, einen so verhängnisvollen Irrtum zu widerlegen und die Sache Christi von der Sache der Despoten zu isolieren.
Ist die unumschränkte Monarchie vor anderen Verfassungsformen in den biblischen und christlichen Lehrsätzen begründet oder doch durch dieselben empfohlen?
Sie kommt in der Bibel vor, die Vorstellung von einer willkürlichen und über die Gesetze erhabenen Königsmacht; aber wie kommt sie vor?
Es ist Nebukadnezar, der Herrscher des babylonischen Weltreichs, von dem gesagt wird: „Er tötete wen er wollte, er schlug wen er wollte, er erhöhte wen er wollte, er demütigte wen er wollte.“ Eine solche Gestalt hatte die Königsmacht auf dem Boden des heidnischen Orients angenommen. Aber sie wird fürwahr nicht als das Nichtige und Wünschenswerte hingestellt. Im Gegenteil eine ganz andere Bestimmung wurde für das Königtum unter dem Volke Israel getroffen. Denn so heißt es im mosaischen Gesetz: „Wenn er nun“, der von Gott erwählte König, der Gesalbte, welchen Niemand antasten darf, „wenn er sitzen wird auf dem Stuhle seines Königreiches, soll er das Gesetz von den Priestern nehmen und auf ein Buch schreiben lassen; das soll bei ihm sein und er soll darin lesen alle Tage seines Lebens, auf dass er lerne fürchten den Namen des HErrn seines Gottes, dass er halte alle diese Worte des Gesetzes, und diese Rechte, dass er darnach tue. Er soll sein Herz nicht erheben über seine Brüder“, (die Untertanen seine Brüder!) „und soll nicht weichen von dem Gebote, weder zur Rechten noch zur Linken, auf dass er seine Tage verlängere auf seinem Königreiche, er und seine Kinder in Israel“ Deut. XVII, 14-20.
Dieser Gegensatz zwischen dem heidnischen und dem israelitischen Königsrecht tritt noch deutlicher ans Licht in der Geschichte des Königs Ahab. Der König will den Weinberg Naboths, der neben dem Palaste liegt, ankaufen und sich einen Kohlgarten daraus mache. Naboth weigert sich, indem er sich auf das Recht eines jeden israelitischen Hausvaters stützt, dass das Erbe seiner Väter seinen Kindern erhalten bleiben soll. Da kam Ahab heim, unmutig und zornig und legte sich auf sein Bett und aß kein Brot. Da kam zu ihn: hinein Isebel sein Weib, die heidnische Königstochter von Tyrus, die eifrige Verehrerin des Baal; und als sie die Ursache des Unmutes erfragt, sprach sie: „Was wäre für ein Königreich in Israel, wenn du so tätest? Stehe auf und iss Brot und sei gutes Mutes; ich will dir den Weinberg Naboths verschaffen.“ 1. Könige XXI. Es war der heidnisch-orientalische Begriff von der königlichen Gewalt, den die Phönizierin vom Hofe zu Tyrus mitgebracht hatte und in Israel geltend machen wollte. Das wäre kein Königtum, wenn Gesetze und Privatrechte eine unübersteigliche Schranke bilden sollten für den Willen des Herrschers!
In den Psalmen und in den Schriften der Propheten wird das messianische Königreich angekündigt. Der Herrscher desselben erscheint mit göttlicher Macht, Gerechtigkeit und Weisheit ausgerüstet. Aber solche Stellen weisen auf Christus und Sem künftiges Reich. In Ihm wohnt die Fülle der Gottheit, und Sein Walten wird in der Tat den Schilderungen der Propheten entsprechen. Wollte man jene Aussagen auf einen sterblichen Herrscher, sei es nun David oder Salomo oder ein christlicher König, beziehen, so wäre es Abgötterei. Wer darf die messianischen Weissagungen ans gleiche Stufe mit der Apotheose des Augustus durch den Horatius stellen! Nichts wird in der ganzen Heiligen Schrift mit solchem Ernst und Abscheu zurückgewiesen, als die Menschenvergötterung.
Es ist wahr, dass sich in dem christlichen Königtum etwas voll dem königlichen Walten Christi abspiegeln soll; der christliche König soll in seiner Würde und in seiner Wirksamkeit ein Abbild Christi sein. Wohl; nur vergesse man nicht: dieses Bild ist von Ton. Mit Beziehung auf den 82. Psalm sagt Bacon in seinen Essays: «Gin König ist ein sterblicher Gott auf Erden, welchem der lebendige Gott Seinen Namen und einen Anteil an Seiner Ehre geliehen hat. Aber zugleich hat Er ihm gesagt, er werde sterben wie ein Mensch, damit er nicht stolz sei und sich schmeichle, als hätte Gott ihm mit Seinem Namen auch Sein Wesen mitgeteilt.“
Es ist wahr, die Heilige Schrift gebietet uns in dem fürstlichen Amt einen göttlichen Auftrag anzuerkennen und zu ehren. Aber zugleich wird so gewaltig wie in keinem anderen Buche der Welt die Hinfälligkeit, Ohnmacht, Unwürdigkeit und Nichtigkeit des Menschen in der Bibel hervorgehoben. Es wäre ein ungeheurer Trugschluss, wenn man aus dem göttlichen Auftrag folgern wollte, dass dem Fürsten zugleich eine mehr als menschliche Weisheit und Einsicht mitgeteilt sei. So gewiss als der König nicht unsterblich und nicht allmächtig ist, ist er auch nicht allwissend. Im Gegenteil, er wird mit denselben geistigen und leiblichen Schwachheiten wie alle anderen Sterblichen geboren. Ein Unterschied besteht allerdings, nämlich dieser, dass ein Fürst seine Hilfsbedürftigkeit tiefer als alle anderen Menschen empfinden sollte, weil seine Aufgabe so groß ist, und der Versuchungen, die ihn umgeben, ist so viel.
Nicht genug, dass er wie alle anderen an die ewigen Gesetze der Gerechtigkeit, Wahrheit und Liebe gebunden und die damit gesetzten Schranken einzuhalten verpflichtet ist, was nur ein Gottloser in Frage stellen kann, auch innerhalb dieser Grenzen ist er in der Ausübung seiner Macht durch seine menschliche Unvollkommenheit beschränkt. Gerade die christliche Erkenntnis wird ihn in dem Bewusstsein dieser Beschränkung befestigen. Es sind hauptsächlich zwei Erwägungen, die von verschiedenen Punkten ans zu demselben Ergebnis führen.
Der König bedarf Weisheit und er wird sie von Gott suchen, wie der Jüngling Salomo, der bei seiner Thronbesteigung nicht um Reichtum, Ehre und Sieg über seine Feinde betete, sondern um ein gehorsames und weises Herz, damit er fähig sei, Gottes Volk zu regieren. Doch nicht allein nach oben wird er blicken, um diese Weisheit zu erlangen, er wird sich auch auf Erden nach ihr umsehen. Denn wenn auch die Entscheidung in allen wichtigen Angelegenheiten ihm zusteht, so wohnt doch die Einsicht nicht bei ihm allein. Die weisesten Fürsten dürfen, wie Bacon sagt, es nicht für eine Schmälerung ihrer Größe oder einen Abbruch ihrer Tüchtigkeit ansehen, sich auf Rat zu stützen. Das folgenreichste, was ein König tun kann, ist die Verkündigung eines Gesetzes. Hier vor allem ist umfassende Kenntnis der Verhältnisse und die Erfahrung der Jahrhunderte notwendig. So wird das Verständnis seiner Aufgabe den christlichen Fürsten bestimmen, den Rat seiner Untergebenen zu suchen. Den besten Rat, der bei seinem Volke zu finden ist, den möglichst vielseitigen, unparteiischen und uneigennützigen Rat wird er verlangen. Es ist ein gerechtfertigtes Begehren der Völker, den Herrscher mit den bewährtesten Ratgebern umgeben zu sehen, damit ihm die Leiden und die Wünsche des Volkes nicht verborgen bleiben und damit es weder der Gerechtigkeit noch der Barmherzigkeit an einem Anwalt fehle. Angenommen es bestände in einem Staat keine gesetzliche Bestimmung, welche den König bei der Aufstellung neuer Gesetze an die Zustimmung seiner Ratgeber bindet und ihm eine entgegengesetzte Entscheidung verbietet, so besteht doch eine moralische Verpflichtung, und diese wird bei einem christlich gesinnten Herrscher eine ganz ähnliche Wirkung haben, wie eine verfassungsmäßige Beschränkung seiner Gewalt.
Die andere Erwägung ist diese. Das Privateigentum steht unter göttlichem Schutz. Nicht nur der Landesherr, auch der Hausvater, der Grundeigentümer und jeder Besitzende hat innerhalb seiner Sphäre ein Recht von Gottes Gnade. In der Geschichte des Volkes Israel ist es ersichtlich, dass diese Rechte sogar früher da waren, als das Recht des Königs. Sie sind ebenso gut wie dieses durch eine göttliche Sanktion verbürgt. Nun bringt es das Wesen der Volksgemeinschaft und des Staates mit sich, dass jeder Einzelne etwas von seinem Recht und Besitze zum Wohl des Ganzen aufopfern muss. Die Obrigkeit bedarf zur Ausrichtung ihres Berufes der Steuern und der persönlichen Dienste des Volkes. Mit neuen Aufgaben und neuen Gesetzen treten auch neue Anforderungen an das Abgaben zahlende Volk hervor. Da nun aber Besitz und Leben jedes Einzelnen geheiligt ist, so wird der christliche Herrscher die Leistungen seines Volkes nur so weit in Anspruch nehmen, als es in der Tat zum Wohl der Gesamtheit notwendig ist. Dies zu beurteilen, ist aber auch wieder ein Gegenstand für die weiseste Überlegung. Der christliche Fürst wird auch hierüber nicht einseitig bestimmen. Sein Gewissen wird ihn bewegen, den Rat seines Volkes, und bei Auflegung neuer Lasten die Zustimmung der dabei Beteiligten zu suchen. Das Mehr oder Weniger in der Teilnahme des Volkes an der Gesetzgebung, die Art und Weise, wie die Nation über neue Steuern zu fragen sei, wird durch geschichtlich gewordene Gesetze geregelt. Das Prinzip selbst folgt aus den christlichen Grundbegriffen von Fürst, Volk, Obrigkeit, Staat und Recht.
Sollte die unumschränkte Monarchie, die dem Christentum am besten entsprechende Staatsform sein, so müsste sich an ihr eine Ähnlichkeit mit der Verfassung und dem Wesen der christlichen Kirche bemerken lassen. Aber in Wirklichkeit ist das Gegenteil der Fall. In der christlichen Kirche treten ganz andere Grundgedanken hervor.
Die Herrschaft Christi ist anderer Art als die der Despoten des heidnischen Altertums. Zwar Er ist König und Herr im vollsten Sinne des Wortes. Aber Er ist derselbe, der sich für Sein Volk geopfert hat, und der eine jede einzelne Seele, auch die des Ärmsten und Geringsten, teuer achtet. In Seinem Walten als Haupt der Kirche achtet Er auf die Leiden Seiner Untergebenen, Er vernimmt die Stimme Seines Geistes in den Gebeten der Hilfesuchenden. Er richtet die Übertreter Seiner Gebote; aber die Huldigungen, die Er erwartet, sind freiwillige, und selbst in Seinen Züchtigungen tut Er dem freien Willen der Menschen nicht Gewalt an.
Durch die Erscheinung Christi auf Erden ist das Herrschen ein anderes geworden, das die Welt zuvor nicht kannte. Nun ist jede Teilnahme an der Herrschaft zur Förderung des Wohles der Untergebenen bestimmt. Nun ist das Herrschen, wie Franz von Baader sagt, eigentlich ein Dienen und das Beherrschtwerden ein Sichbedienenlassen.
In der christlichen Kirche erscheinen die beiden Prinzipien der Autorität und der Freiheit verschmolzen. Unverkennbar trat in den Aposteln und in den durch sie eingesetzten Bischöfen und Ältesten ein höherer Auftrag, eine ehrfurchtgebietende Autorität hervor. Das christliche Amt trat nicht als ein Erzeugnis der Gemeinde ins Leben; es war vor ihr schon da. Anderseits wird in jedem Gemeindeglied die Christenwürde aufs Höchste anerkannt und geehrt. Das Wohl der Gemeindeglieder ist Endzweck der religiösen Gemeinschaft; und die Autorität existiert, um diesen Zweck zu verwirklichen. Zwar im Laufe der Zeit ist dieser Einklang der beiden Prinzipien allerdings gestört, und auf der einen Seite die Autorität des Amtes, auf der anderen die Freiheit und das Recht der Gemeinde übertrieben worden. Aber auch so hat die Kirche durch die in ihr immer noch wahrnehmbare Verbindung der beiden Elemente eine befriedigende Entwicklung des Staatslebens gefördert. In ihrer ursprünglichen, reinen, von Gott gegebenen Ordnung ist sie der vollkommenste aller Organismen. Im Hinblick auf sie sollten diejenigen, welche eine einseitige Staatsverfassung als vorzugsweise christlich rühmen, sich beschämt fühlen.
Blicken wir auf die sichtbare Gestaltung der einzelnen Gemeinde, so ist die ursprüngliche Einrichtung, von der man nie hätte abweichen sollen, diese. Ein Bischof steht an der Spitze, der das Ganze zu leiten hat; unter ihm ein Kollegium von Ältesten oder Priestern, die ihm mit Rat und Tat beistehen, unter diesen die Körperschaft der von der Gemeinde erwählten Diakonen, durch welche der Bischof und' die Ältesten die Wünsche der Laien vernehmen. Wer kann hier die Analogie mit der organischen Ordnung des Staates verkennen, in welchem der König, gleichsam der weltliche Bischof und Hirte seines Volkes, wirklich regiert, dem Kollegium der Ältesten der Senat oder das Haus der Pairs, dem Kollegium der Diakonen die Volksvertretung oder das Haus der Gemeinen entspricht? Von allen Seiten betrachtet, gereicht der nach göttlichen Gedanken gestaltete Organismus der christlichen Kirche einer gemäßigte:: Monarchie zur Empfehlung, nicht einer unumschränkten.
Kann man im Ernst behaupten, dass die unumschränkte Monarchie germanisch sei, dass sie dem deutschen Geist und der deutschen Überlieferung entspreche? Widerlegung bedarf eine solche Vorstellung eigentlich nicht, doch mag es gut sein zur Beleuchtung des ganzen Gegenstandes hier an einige geschichtliche Tatsachen zu erinnern.
Tacitus hat die Grundzüge des alldeutschen Königtums gezeichnet.8 Die Könige wurden aus den vornehmen Familien genommen ; die Gefolgschaften bewiesen die höchste Treue gegen den Fürsten, entschlossen für ihn und mit ihm zu sterben. Ihn zu verteidigen und zu beschützen, durch die eigenen Heldentaten ihn zu verherrlichen, ist die heilige Pflicht seiner Mannen. Für jeden ist, wenn sein König fällt, lebend aus der Schlacht zurückzukehren, Schmach für Lebenszeit. Dies ist die eine Seite. Andererseits bezeugt Tacitus, dass über wichtige Sachen nicht die Fürsten allein zu beraten hatten, sondern die Volksversammlung aller Freien; und wenn in dieser der König selbst das Wort nahm, so suchte er ihren Entschluss mehr durch überzeugende Rede, als durch das Machtwort des Befehls zu bestimmen. Tacitus hat in seiner Germania, durch die Hervorhebung der edlen Eigenschaften unsrer Vorväter, den Römern seiner Zeit einen Spiegel vorhalten wollen. Und so geschah es wohl mit einem strafenden Seitenblick auf die Allgewalt der römischen Imperatoren, als er diese Worte über das deutsche Königtum niederschrieb: Nec regibus infinita aut libera potestas. Zwar in der besseren Zeit war auch den Römern, wie einst den Spartanern, das Gesetz ihr König. Aber in den schlimmen Tagen des Kaisertums kam es dahin, dass die römischen Juristen den Satz aufstellten: Imperator legibus non tenetur.
Während des Mittelalters behielt das deutsche Königtum im Wesentlichen seine ursprüngliche Gestalt. Die Frankenkönige hatten im Frieden eine sehr beschränkte, im Kriege, wie es die Notwendigkeit der Lage mit sich bringt, eine fast unumschränkte Gewalt. Am schönsten sind in der altenglischen Überlieferung die beiden Grundgedanken ausgeprägt. Es soll kein anderer Mensch über dem König stehen. Der König bestätigt das Gesetz und ohne seine Sanktion. kann kein Gesetz zu Stande kommen. A Deo rex, a rege lex. Aber er allein kann die Gesetze nicht schaffen, er hat vielmehr die Obliegenheit, ehe er ein Gesetz verkündigt, den Rat der Stände zu hören und ihre Zustimmung zu gewinnen. Das Gesetz wird verkündigt mit der normannischen Formel: Le roi le veut.9 Ist es aber verkündigt, dann bindet es den König selbst. Er ist vor allen anderen verpflichtet, die Gesetze zu halten. Er muss einstehen für den alten Grundsatz: Nolumus leges Angliae mutari. In dem römischen Reich deutscher Nation war der Kaiser seinem Beruf und seinem Krönungseide nach der höchste Beschützer der Rechte und Wahrer der Gesetze.
In allen christlichen Staaten des Mittelalters, in den romanischen sowohl als in den germanischen, findet sich dies wieder, dass bei der Gesetzgebung auch die Nation zu Worte kommt, wenn auch in verschiedener Weise, sei es durch zwei Stände wie in Frankreich, oder durch drei wie in England, oder durch vier wie in Schweden.
Erst nach der Kirchenspaltung folgten die bösen Zeiten, wo durch den wachsenden Despotismus der spanischen und französischen Könige und durch die usurpierte Landeshoheit der deutschen Reichsfürsten, die altständischen Rechte unterdrückt, und die Schranken der fürstlichen Macht zerstört wurden. Die Fürsten rissen die ganze gesetzgebende Gewalt an sich. Seit 1614 wurden in Frankreich die états généraux nicht wieder einberufen, bis zum Ausbruch der großen Revolution. Doch war die bessere Überlieferung unverwüstlich, insoweit wenigstens, dass sie durch bedeutende Schriftsteller immer noch zu Worte kam. Unter Philipp III. von Spanien hat Mariana, unter Ludwig XIV. hat Duguet den richtigen Satz aufrecht erhalten, dass der König in seinem Gewissen an die Gesetze des Landes gebunden ist, welche er bei seiner Thronbesteigung als bestehende vorgefunden hat; und nicht minder an die, welche er selbst seinem Volke gegeben.10
Die Vorstellung, gegen die wir streiten, ist nicht auf deutschem Boden heimisch. In anderen Umgebungen hat sie sich entwickelt und tiefe Wurzeln geschlagen. Der altorientalische Despotismus hatte im byzantinischen Reich christliche Formen angenommen, und als das Christentum von Byzanz zu den slavischen Völkern überging, traf es bei diesen mit einer Geistesrichtung zusammen, welche den despotischen Anschauungen des Morgenlandes urverwandt war. So entwickelte sich, mit dem Nimbus einer vermeintlich göttlichen und ausschließlichen Sanktion umgeben, die russische Autokratie.
Iwan der Schreckliche ließ ohne Ursache 70,000 Einwohner von Nowgorod umbringen, ohne auf den geringsten Widerstand zu stoßen. Denn, so sagt der russische Chronist jener Zeiten, nichts kam der Grausamkeit des Zaren gleich, außer die Geduld seiner Untertanen. Wer durch den Willen des Zaren stirbt, so lehrten die russischen Geistlichen, gelangt wie die Märtyrer der Vorzeit unmittelbar in den Himmel.
Wenn je das Verlangen sich äußerte, dass die Magnaten: einen Anteil an der Staatsgewalt bekommen sollten, so erklärte die Geistlichkeit jeden solchen Gedanken für manichäische Ketzerei. Es war Manes, der zwei ewige Urwesen lehrte. Desselben Irrtums mache sich schuldig, wer neben der Gewalt des Zaren noch von einer anderen Gewalt im Staat rede. So wird das Königtum, welchem allerdings etwas von der Ehre und Majestät des ewigen Königs mitgeteilt ist, mit der Gottheit verwechselt, als eine auf Erden sichtbare Gottheit hingestellt und zum Abgott gemacht. Allerdings, es ist nur Ein Gott, und von diesem haben die Könige ihre Würde, aber derselbe, der ihnen diese Würde verliehen, hat auch ihre Macht eingeschränkt. Durch göttliche Anordnung ist der Monarch beschränkt in seiner Lebensdauer, beschränkt in seinem Wissen, warum nicht auch beschränkt in seiner Macht?
Heute noch spricht der russische Zar: „Ich halte alle Russland in meiner Hand.“ Diese seine Stellung befähigt ihn, wenn er edlen Antrieben folgt, Gutes im größten Styl zu tun. So vermochte Alexander II. durch persönlichen Entschluss die Leibeigenschaft in ganz Russland aufzuheben. Die Treue und Ergebung der Russen gegen ihren gemeinsamen Vater hat etwas Rührendes und Ergreifendes. Dennoch ist das ganze Verhältnis etwas Abnormes; es darf nicht für andere Völker zur Nachahmung aufgestellt werden. Kaiser Alexander I., der menschenfreundliche Herrscher, meinte, seine Russen brauchen keine Garantien für ihre Rechte und gegen den Missbrauch der kaiserlichen Machtfülle. Madame de Stael bemerkte ihm hierauf mit Recht: Sire, Vous n'êtes qu'un heureux.
Wie der unglückliche Karl I. von England vor seinen Richtern fest darauf bestand, es sei unmöglich und unzulässig, dass die Regierten zugleich regieren, so hat Kaiser Nikolaus von Russland erklärt, die reine Demokratie könne er begreifen und sich mit ihr verständigen, aber die beschränkte Monarchie erscheine ihm völlig unvernünftig und verwerflich. So fern lag beiden der. Gedanke an ein organisches Zusammenwirken der verschiedenen Glieder des Staates. Dies aber ist gerade der Grundgedanke des germanischen Staatslebens von Anfang an.
Lasse man jedem seinen Geschmack und seine Neigungen, nur höre man auf zu behaupten, dass die anorganische Vorstellung die spezifisch christliche sei.
Die Gefahr der Gegenwart besteht nicht in der Aufrichtung oder Ausbreitung einer russischen, auf alte einseitige kirchliche Traditionen gestützten und mit christlichem Nimbus umgebenen Autokratie. Dieses Jahrhundert hat den Despotismus in einer anderen gefährlicheren Gestalt kennen gelernt. Es ist der Despotismus, der sich auf die demokratische Grundlage und auf die Revolution stützt; der aufgeklärte Despotismus, der sich fremd und gleichgültig gegen die christliche Religion verhält, und sie nur als Dekoration des Thrones und des Szepters einstweilen noch bestehen lässt; es ist der militärische, der bonapartische Despotismus, von welchem gilt, was der römische Dichter von Achilles sagt: Jura negat sibi nata, nihil non arrogat armis.
Wie nun, wenn die Freunde einer unumschränkten Monarchie durch ihre Bestrebungen, ohne es zu wollen, diesem System und seinem Siege vorgearbeitet hätten? Dies ist die Befürchtung, welche in uns die Übertreibungen und Missgriffe der Verehrer des vermeintlich christlich-monarchischen Prinzips hervorrufen mussten.
Diese Besorgnisse reichen noch weiter; denn der bonapartische Despotismus könnte der Vorläufer eines noch viel schlimmeren Systems werden, welches hervorzutreten droht, wenn erst die Entfremdung vom Christentum unter den Völkern noch größere Dimensionen angenommen hat. Ein genialer Staatsmann unserer Zeit, Donoso Cortes, der Spanier, hat diese Gefahr deutlich erkannt und wie ein politischer Prophet auf die Schrecken eines künftigen Ereignisses hingewiesen, das seine düsteren Schatten schon in die Gegenwart wirft.
Nach den prophetischen Andeutungen der Heiligen Schrift haben wir gegen das Ende des jetzigen Weltalters einen großen Tyrannen zu erwarten, welcher sich über alle göttlichen und menschlichen Rechte hinwegsetzen und für sich göttliche Attribute und Ehren in Anspruch nehmen wird. Es ist nicht zu vermuten, dass der Antichrist in Gestalt einer wilden kommunistischen Rotte, vielmehr dass er in der Person und mit dem Prästigium eines weltbeherrschenden Monarchen auftreten wird. Seine Vorläufer sind auf der Schaubühne der Weltgeschichte scholl vor Zeiten sichtbar geworden. Es waren die alten assyrischen und babylonischen Tyrannen, und die von den Gesetzen gelösten Imperatoren des heidnischen Roms.