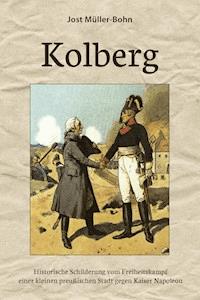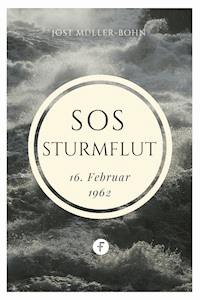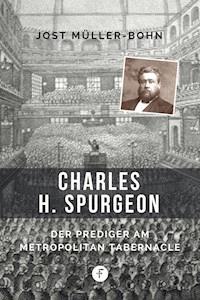Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Folgen Verlag
- Kategorie: Religion und Spiritualität
- Sprache: Deutsch
„Stasi und kein Ende“ – Auch Jahrzehnte nach dem Fall der Mauer sind die Wunden der totalen Überwachung in der DDR noch nicht verheilt. Menschen, die unter dem repressiven Regime eines allgegenwärtigen Geheimdienstes leben mussten, tragen bis heute die seelischen Narben dieser traumatischen Erfahrung. Oft entsteht in der öffentlichen Debatte der Eindruck, dass Christen in der DDR entweder schweigende Mitläufer des sozialistischen Systems oder gar willige Helfer der Staatssicherheit waren. Doch wie war es wirklich? Getrieben von diesen Fragen begab sich Jost Müller-Bohn auf eine Reise durch die neuen Bundesländer. Er sprach mit Männern und Frauen aus verschiedenen Kirchen und Freikirchen, die ihm offen von ihrem Leben unter staatlicher Kontrolle berichteten. Wie haben sie ihren Glauben bewahrt? Welche Entscheidungen mussten sie unter Druck treffen? Und welche Konsequenzen hatten sie zu tragen? Dieses eBook versammelt eine Auswahl dieser bewegenden Lebensgeschichten – authentische Zeugnisse von Mut, Standhaftigkeit, aber auch inneren Konflikten. Es gibt denjenigen eine Stimme, die oft übersehen oder missverstanden werden, und bietet einen eindrucksvollen Einblick in die Realität christlichen Lebens in der DDR.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 222
Veröffentlichungsjahr: 2015
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Christus-Botschaft unter Stasiterror
Tatsachenberichte
Jost Müller-Bohn
Impressum
© 2015 Folgen Verlag, Wensin
Autor: Jost Müller-Bohn
Cover: Eduard Rempel, Düren
Lektorat: Mark Rehfuss, Schwäbisch Gmünd
ISBN: 978-3-944187-82-2
Verlags-Seite: www.folgenverlag.de
Kontakt: [email protected]
Dieses eBook darf ausschließlich auf einem Endgerät (Computer, eReader, etc.) des jeweiligen Kunden verwendet werden, der das eBook selbst, im von uns autorisierten eBook-Shop, gekauft hat. Jede Weitergabe an andere Personen entspricht nicht mehr der von uns erlaubten Nutzung, ist strafbar und schadet dem Autor und dem Verlagswesen.
Inhalt
Vorwort
Seht, man musste sie begraben
Kurier des Königs aller Könige
»Jawohl, Genosse Major, ich bin ein Christ!«
Er hetzte, indem er Vorbild war
Vom Parteisekretär zum Christusjünger
Gott liebt auch Stasi-Offiziere
Ein missionierender Bausoldat
Die vereitelte Flucht und Zuchthauserlebnisse
Die Mauer ist gefallen
Vorwort
Nach dem Zusammenbruch des »ersten deutschen Arbeiter- und Bauernstaates« und der Öffnung der Mauer wurden in bundesdeutschen Zeitungen Kommentare veröffentlicht, die den Anschein erweckten, als wären die meisten Christen in der ehemaligen DDR passive Mitläufer des sozialistischen Systems und aktive Informanten des berüchtigten Ministeriums für Staatssicherheit gewesen.
Da ich einst selber in der Hochburg des Kommunismus, und zwar in den Verwaltungs-Dienststellen von Berlin-Pankow, mehrere Jahre tätig war und dort mit der Hilfe Gottes das Zeugnis des Evangeliums vor allerhöchsten Staatsfunktionären weitergeben konnte, war ich wegen dieser Berichterstattung geradezu empört. Ich wusste aus eigenem Erleben, dass unzählige treue Zeugen Jesu Christi in den gut 40 Jahren des Gewaltregimes unerschrocken von der Realität der Auferstehung Jesu Christi Zeugnis gegeben haben.
Um allen Lesern von dieser Tatsache einen vielsagenden Eindruck zu vermitteln, habe ich im Frühjahr 1991 eine Besuchsreise durch die neuen Bundesländer unternommen.
Mitglieder der verschiedenen Kirchen und Freikirchen aus dem östlichen Teil Deutschlands, aber auch viele treue Einzelkämpfer berichteten mir von dem Wirken Gottes in der Zeit der Zwangsherrschaft dieses totalitären SED-Staates. Eine kleine Auswahl dieser Erlebnisberichte gibt uns Aufschluss darüber, wie viel Glaubensmut das Christsein in den damaligen Tagen erforderte.
Wie zwiespältig und wie willkürlich die Arbeit der Justiz wie auch des berüchtigten Ministeriums für Staatssicherheitsdienst war, zeigt, dass ein Ingenieur aus Freital bei Dresden zu fünf Jahren Zuchthaus ohne Bewährung verurteilt wurde, weil er Traktate und geistliche Schriften aus der BRD im Bekanntenkreis verteilt hatte, während einem anderen Laienprediger durch Stasi-Offiziere die neuesten Traktate und christlichen Broschüren aus der BRD zum eigenen Gebrauch aus Stasi-Dienststellen frei Haus geliefert wurden.
Vielleicht kann diese kurze Abhandlung die Aufmerksamkeit vieler erwecken, um später dann eine umfassendere Dokumentation von Lebenszeugnissen unerschrockener Christen geben zu können, die sich dem System des Unrechtsstaates und der Ideologie des Atheismus nicht anpassten.
Ich möchte allen denen, die mir ihre Zeit zur Verfügung stellten, aus ihrem Leben zu erzählen, recht herzlich danken.
Leider hatte ich für diese Fahrt nur wenig Zeit, weil ich durch andere evangelistische Dienste bereits lange vorher terminlich festgelegt war.
So gilt mein besonderer Dank auch allen meinen Mitarbeitern, die mir durch ihre opferbereite Hilfe ermöglichten, diese Schrift in so kurzer Zeit zu verfassen.
Mit dem Wort des erhöhten Herrn Jesus Christus möchte ich diese Berichte auf die Reise schicken:
»Ich weiß deine Werke. Siehe, ich habe vor dir gegeben eine offene Tür, und niemand kann sie zuschließen; denn du hast eine kleine Kraft und hast mein Wort behalten und hast meinen Namen nicht verleugnet.
Weil du bewahrt hast das Wort von meiner Geduld, will ich auch dich bewahren vor der Stunde der Versuchung, die kommen wird über den ganzen Weltkreis, zu versuchen, die da wohnen auf Erden.
Siehe, ich komme bald; halte, was du hast, dass niemand deine Krone nehme!« (Offb. 3, 8. 10. u. 11)
Seht, man musste sie begraben
Seht, man musste sie begraben, die der Welt Gebote gaben, und ihr Wort hat nicht Bestand. Ihre Häuser wurden Trümmer, ihre Münzen gelten nimmer, die man in der Erde fand.
Ihre Namen sind verklungen, ihre Lieder ausgesungen, ihre Reiche menschenleer, ihre Spiegel sind zerbrochen, ihre Sprache ungesprochen, ihr Gesetz gilt längst nicht mehr.
Jesu Name wird bestehen, Jesu Reich nie untergehen. Sein Gebot gilt allezeit.
Kurier des Königs aller Könige
Im wunderschönen Monat Mai des Jahres 1991 nach Christi Geburt, fahre ich durch meine altvertraute Heimat – so komme ich durch das wiedervereinigte Berlin, – Stadt meiner Jugend –, vorbei am ehemaligen Kontrollpunkt »Drei Linden«. Die verwitterten Gebäude mit den Hallen der großen, schrecklichen Verhör- und Schnüffelanlagen stehen noch. Flott geht es über die Avus durch den Grunewald, vor mir taucht der alte Funkturm auf, ein Wahrzeichen des Freien Berlin.
Über die Stadtautobahn gelange ich zum Kaiserdamm, fahre an der Deutschen Oper und dem Schillertheater vorbei – ordne mich am Ernst-Reuter-Platz in Richtung der Straße des 17. Juni ein, und über die breite Prachtstraße geht es weiter an der Siegessäule vorbei in den Kreisverkehr am Großen Stern. Das wiedereröffnete Brandenburger Tor ist für den allgemeinen Straßenverkehr noch gesperrt, deshalb biege ich ab, drängle mich an der neuen Philharmonie vorbei, erreiche den Platz der berühmten alten Philharmonie an der Bernburger Straße und wende mich dann in Richtung »Checkpoint-Charly«, dem weltbekannten Kontrollpunkt der ehemaligen zweigeteilten Stadt, bis ich jenseits des Brandenburger Tores am »Gendarmenmarkt« mit der herrlichen Kulisse des »Königlichen Schauspielhauses« und dem Französischen Dom ein wenig pausiere. Ich genieße den Anblick dieser stilvollen, alten Bauten und erinnere mich an vergangene Zeiten.
Später holpert mein Wagen über die stark ramponierten Straßen Ost-Berlins bis nach Berlin-Pankow, dem traurig bekanntgewordenen Stadtteil im Norden der ehemaligen Reichshauptstadt, vorbei an dem Regierungsgebäude des ehemaligen Schreckensregimes des sogenannten »Sozialismus des ersten deutschen Arbeiter-und Bauernstaates«, dem Spuk von gestern, wo ich in den Fünfzigerjahren meine Berufsausbildung erhielt.
Düstere Erinnerungen steigen in mir auf, Erinnerungen an all die Bespitzelungen und Verhöre durch Stasi und andere Polizeikräfte.
Dann fahre ich über die Reichsstraße 109 zum Stadtrand nach Schönerlinde. Dort kehre ich im alten Schützenhaus ein, forsche nach ehemaligen Freunden aus der Volksschule und mache noch einen Kurzbesuch bei dem letzten Mitschüler aus meiner Klasse, der noch in dem Dorf wohnt.
Hier in meinem Heimatdorf steht ein Haus, in dem vor Jahren noch eine Bäckerei existierte. Dort habe ich 1948 das Wort Gottes zum ersten Mal gehört und mein Leben voll in die Hand Jesu gelegt. Nun bin ich auf dem Weg, um Berichte aufzunehmen von Menschen, die während der letzten 40 Jahre in besonderer Weise ein Zeugnis gegeben haben von dem Herrn Jesus gegenüber den sowjetischen Machthabern.
Darum geht es jetzt weiter in Richtung Norden, vorbei am Gorinsee durch die weiten Wälder des ehemaligen Kreises »Niederbarnim«. In meinem Herzen klingt es aus alten Zeiten, und dann beginne ich zu singen:
»Märkische Heide, märkischer Sand sind des Märkers Freude, sind sein Heimatland. Fliege hoch, du roter Adler, hoch über Sumpf und Sand, hoch über dunkle Kiefernwälder, heil dir, mein Brandenburger Land.«
Am verträumten Werbellinsee halte ich. Eine kurze Pause tut mir gut. Dieser von dunklen Wäldern umgebene See ist die Perle aller märkischen Gewässer.
»Wie ein Gottesauge glänzet, drüber Abendwolken glühn, liegt, von Berg und Wald umkränzet, märchenhaft der Werbellin.«
Doch fort, ihr alten Lieder – weiter geht es über die Autobahn und die verwahrlosten Landstraßen nordwärts; durch Prenzlau, vorbei am wuchtigen Mitteltorturm und der großen Marienkirche, eine der schönsten, gotischen Backsteinbauten der Mark Brandenburg, bis nach Anklam, der kleinen Kreisstadt im Bezirk Neubrandenburg.
Um 1283 war die Stadt Mitglied der Hanse. Hier wurde am 23. Mai 1848 Otto Lilienthal, der Pionier der deutschen Luftfahrt, geboren. Auf dem Marktplatz ragt ein großes Denkmal für den berühmten Sohn der Stadt zum Himmel empor. Doch ich suche den ehemaligen »Kurier des Königs aller Könige« in der Leipziger Allee.
»Wer ist der König der Ehre? Es ist der Herr, stark und mächtig, mächtig im Streit. Machet die Tore weit und die Türen in der Welt hoch, dass der König der Ehre einziehe! Wer ist der König der Ehre? Es ist der Herr Zebaoth; er ist der König der Ehre«
(Psalm 24, 8-10).
Nun sitze ich Herrn Simmrow, dem ehemaligen »Abgesandten des Königs aller Könige« gegenüber. Von seinem bewegten Leben berichtet er mir:
»Im Herbst 1950 lernte ich Jesus Christus kennen. Während einer Großevangelisation erging an mich der Ruf: ›Heute, wenn ihr seine Stimme hören werdet, so verstocket eure Herzen nicht‹ (Hebr. 3, 7.8).
Noch an demselben Abend beugte ich meine Knie vor diesem himmlischen König und bekannte ihm meine Schuld. Von diesem Zeitpunkt an erhielt ich das herrliche Bewusstsein: ›Ich bin von neuem geboren.‹
Dies geschah im gleichen Jahr, als ich meine Lehre als Großhandelskaufmann in Anklam begann. Dort habe ich auch meine Frau kennengelernt, die mir ihr Zeugnis von Jesus Christus mitteilte.
Ich selbst kam aus einem ungläubigen Elternhaus. Wir waren typische Namenschristen. Wohl wurde ich 1949 konfirmiert, innerlich aber war ich Atheist. So trat ich noch vor meiner Hinwendung zu Jesus in die FDJ ein. Ich sah darin eine fantastische Möglichkeit, durch Politik im beruflichen Leben weiterzukommen. Während wir, meine spätere Frau und ich, im September 1950 in der Berufsschule in Ahlbeck, einem Seebad an der Ostsee, weilten, lud mich meine Frau zu einer Bibelstunde ein. Von dem, was damals in der kleinen Gemeinde geredet wurde, habe ich geistlich gesehen überhaupt nichts verstanden. Es war die Zeit, als man in der sowjetisch besetzten Zone noch viele Stromsperren hatte, also äußerlich gesehen dunkel und finster, aber in mir selbst sollte bald das Licht des Evangeliums leuchten. Mich beeindruckten die vielen Jugendlichen, die am Abend am Strand der Ostsee spazieren gingen und christliche Lieder sangen:
›Ich bete an die Macht der Liebe, die sich in Jesus offenbart; ich geb’ mich hin dem freien Triebe, mit dem ich Wurm geliebet ward; ich will, anstatt an mich zu denken, ins Meer der Liebe mich versenken.‹
Beim Rauschen des Meeres spürte ich, diese jungen Menschen hatten etwas, was ich nicht kannte. Diese fröhlichen, befreienden Lieder beeindruckten mich sehr:
›Ich will von meinem Jesus singen, von seiner Gnade, Lieb und Treu, von seinem bittern Kreuzesleiden, von seiner Blutskraft, die macht frei.
Singt, o singt von meinem Jesus von seiner Gnade, Lieb und Treu, von seinem bittern Kreuzesleiden, von seiner Blutskraft, die macht frei!‹
Seit dieser Zeit zog ich mich von meinen alten Kameraden und Freunden zurück. Einer meiner ehemaligen Freunde riet mir, das Mädchen, das ich nun kennengelernt hatte, von ihrem christlichen Glauben abzubringen, sonst würde ich in der Ehe viele Schwierigkeiten bekommen.
Durch meine Hinwendung zu Jesus Christus hielt ich mich zur Brüdergemeinde in Anklam. Zunächst hatte ich im Betrieb wegen meines Glaubens noch keine Schwierigkeiten. Bei einer späteren Überprüfung wegen der FDJ-Mitgliedschaft bat ich um meine Entlassung aus dieser Gruppe, was mir aber verweigert wurde.
Meinen Kollegen gab ich stets ein Zeugnis vom Evangelium und hielt mich von allen weltlichen Festen und Feiern fern. Es waren vor allem ältere Kollegen, die den christlichen Glauben lächerlich machen wollten.
›Es gibt überhaupt keinen Gott! – Das ist alles nur Einbildung‹, so lästerten sie.
Meine Ausbildung absolvierte ich in der Verwaltungslehre, wurde Großhandelskaufmann und widmete mich später speziell dem Rechnungswesen.
Nach meiner Verwaltungsprüfung wurde ich dann zu einer Finanzschule geschickt. Auch hier war ich ein Außenseiter der Gesellschaft, weil ich mein Zeugnis vom Heil durch Jesus Christus weitergab. Ich hatte dort einen Christen von der katholischen Kirche kennengelernt, mit dem ich geistliche Gemeinschaft pflegte. Er war ein überzeugter Jünger des Herrn, aber er gab sein Zeugnis nicht öffentlich bekannt.
Als ich von der Finanzschule zurückkam, wurde ich als Instrukteur für Rechnungswesen beim Konsum eingestellt. Meine Aufgabe bestand darin, dem Oberbuchhalter bei den Jahresabschlüssen zu helfen. Das war für mich eine neue, sehr interessante Tätigkeit. So fuhr ich mit dem Fahrrad durch den Kreis Anklam von einer Filiale zur anderen, um diese Abschlüsse zu tätigen. Nach einem Jahr wurde ich dann selbst als Hauptbuchhalter in der Kreiskonsumgenossenschaft eingesetzt.
In meinem Kreis gab es 35 Verkaufsstellen, die ich zu betreuen hatte. Im Jahre 1951 wurde ich zum Gemeindeleiter der Brüdergemeinde berufen. Nun begann eine von Jahr zu Jahr stärker werdende Auseinandersetzung mit den örtlichen Behörden. Hauptsächlich ging es darum, eine Druckgenehmigung bekommen zu können. In den Fünfziger- bis Sechzigerjahren mussten alle Einladungszettel oder Schriften, die man drucken lassen wollte, vom Rat des Kreises genehmigt werden, und zwar von der »Abteilung für Inneres«. Später pflegten wir einen sehr intensiven Briefwechsel mit Gläubigen aus der Sowjetunion. Wir begannen, zahlreiche Literatur nach Russland zu senden.
Im Jahre 1970 trat ich meine erste Reise in die Sowjetunion an, da mir von meinem Betrieb eine Auszeichnungsreise zuerkannt worden war. Dabei schleusten meine Frau und ich die ersten, in die russische Sprache übersetzten Bibeln in das Riesenreich ein. Auf unseren späteren Touristenreisen schmuggelten wir immer wieder auf gefahrvollen Wegen viele Bibeln und christliche Literatur in die Sowjetunion. Aufgrund dieser Aktionen, die natürlich nicht ganz verborgen blieben, begann für uns eine besonders strenge Überwachung durch den Staatssicherheitsdienst. Bei Verhören wurden wir immer wieder gefragt: »Woher kommt diese Literatur? Woher haben Sie die Anschriften? Wohin bringen Sie diese Bücher?«
Es war verboten, christliches Schriftgut in das sozialistische Ausland zu schicken, das nicht in der DDR gedruckt wurde. Da wir jedoch damals alle russischen Bibeln und Schriften aus dem Westen erhielten, mussten wir sie uns auf illegalen Wegen beschaffen, und wie man das bewerkstelligte, wusste niemand von uns. Man glaubt, dass der größte Teil der Literatur mit den Warenlieferungen und Ausstellungsgütern für die Leipziger Messe waggonweise in die DDR geschickt wurde.
Das ging dann so vonstatten: Plötzlich klingelte das Telefon, und irgendjemand erkundigte sich: ›Bist du dann und dann zu Hause?‹
Und bald darauf wurden uns zwei Zentner Bibeln gebracht.
Diese Kuriere, die die christliche Literatur weitertransportierten, nannten nie einen Namen. Dies war wichtig, falls es zu einem Verhör kam, damit man nicht zu lügen brauchte oder andere Christen in Gefahr bringen musste. Es wurden auch oft Bibeln mit der Bahn in großen Paketen zu uns gesandt, die man schon an einem Ort irgendwo in der DDR abgeladen hatte und deren Inhalt nur die Kuriere kannten.
Ich hatte immer eine gewisse Angst, wenn diese Bibeln in meiner Wohnung lagen. So stellte ich sie stets in die zweite Reihe meiner Bücherschränke und Bücherregale, so dass sie durch die deutsche Literatur in der vorderen Reihe verdeckt waren. Es kam auch vor, dass ich einige Koffer mit Bibeln in die Garage brachte. Aber immer beschlich mich eine gewisse Furcht, dass man eines Tages einbrechen und dieses geheimnisvolle Gut finden könnte. Viele Bibeln habe ich dann auch an andere Kuriere weitergegeben, die diese christliche Literatur in die ›sozialistischen Bruderländer‹ weitertransportierten.
Auf den Touristenreisen oder auf meinen Dienstreisen wurde ich nie, weder von den deutschen noch von den russischen Zöllnern, kontrolliert. Das war für mich eine wunderbare Führung und Bewahrung Gottes.
Meistens trennten wir uns kurzfristig von der Reisegruppe, um in Moskau, Leningrad, Riga, Stalingrad oder in Kiew die Gemeinden oder einzelnen Mitglieder der Gemeinden aufsuchen zu können.
Einmal fuhren wir mit der Bahn durch Russland. Später reisten wir nur noch mit dem Flugzeug. Bei unserem ersten Besuch 1970 in Moskau lernten wir die dortige Gemeinde kennen und bekamen Kontakt zu einigen Gläubigen, die uns ansprachen und voller Dank die Bibeln entgegennahmen, um die sie schon so lange gebetet hatten.
Durch den regen Adressenaustausch erhielten wir ständig neue Kontakte und konnten auf diese Weise ein richtiges Netz aufbauen.
Während unserer zweiten Reise ereignete sich ein sehr mysteriöser Zwischenfall in Moskau. Wir wollten zu der Hauptgemeinde gehen, um dort unsere christliche Literatur zu hinterlassen. Ich erklärte meiner Frau, erst einmal allein zu erkunden, ob jemand im Büro der Gemeinde anwesend sei. So ließ ich sie im Park hinter der Metrostation mit den Taschen voller Bibeln allein zurück. Indessen wartete sie auf einer Parkbank auf mich.
Die russische Schwester, die wir von unserem ersten Besuch her kannten, war leider nicht im Büro der Gemeinde. Zwei ältere Brüder aber nahmen mich in Empfang. Sie konnten sich erfreulicherweise sogar mit mir auf Deutsch verständigen. Voller Freude teilten sie mir mit, dass sie gern Bibeln entgegennehmen würden.
Plötzlich tauchte ein anderer Russe auf, ein starker, gutaussehender Mann, der äußerst gut gekleidet war. Die älteren Brüder gingen sofort zur Seite und setzten sich quasi von uns ab. Der stattliche Mann war ein sehr redegewandter Russe, der rücksichtslos das Gespräch an sich riss und erklärte, dass er jetzt die Sache mit den Bibeln übernehmen wollte.
Auffallend freundlich bot er mir daraufhin an, mich zu meinem Übernachtungsquartier zurückzufahren. Plötzlich wurde ich innerlich eindringlich gewarnt, mich diesem Mann nicht anzuvertrauen. Leider hatte ich ihm schon erzählt, dass meine Frau im Park hinter der Metrostation auf mich warten würde. Zwangsläufig musste ich mich nun in seinen Wagen setzen. Wir fuhren zu dem Park, um meine Frau abzuholen, die dort geduldig mit den Taschen voller Bibeln ausharrte.
Als meine Frau in den Wagen stieg, gab ich ihr einen besonderen Wink, der bedeuten sollte: Vorsicht! – Achtung! Es ist Gefahr vorhanden!
Auf dem Rücksitz saß noch ein anderer Mann, der schweigend alles beobachtete. Wir mussten wieder zurück zu unserem Hotel, da die Reisegruppe programmgemäß weiterfahren wollte. Der mysteriöse Mann wollte uns unbedingt dort hinbringen. So ganz beiläufig fragte der Fremde nach meinem Namen und meiner Heimatanschrift. Vorsicht aber war das Gebot der Stunde, denn ich wusste, durch den Herrn geleitet: Diesem Mann kannst du nicht trauen.
Jetzt passierte mir etwas, was ich unter normalen Umständen nie getan hätte.
Als mich der Unbekannte aus angeblich ›rein verwaltungstechnischen Gründen‹ wegen des Bibeltransportes nach meinen Personalien fragte, nannte ich ihm einen falschen Namen und eine völlig andere Anschrift, so dass meine Frau mich von hinten anstieß. Sie war ganz entsetzt darüber, wie ich so etwas tun konnte. Wir ließen uns auch nicht vor unserem Quartier, sondern vor einem anderen Hotel in der Nähe absetzen, um ihnen zu entgehen. Schnell verschwanden wir um ein paar Ecken, bis wir dann unerkannt unser Hotel erreichten. Die drei Taschen mit den Bibeln mussten wir nun, ob wir wollten oder nicht, dem Unbekannten überlassen. Später wurde uns von den anderen Geschwistern bestätigt, dass Gott uns vor einem gefährlichen Spitzel gewarnt hätte, der, unter dem Vorwand, selbst ein Christ zu sein, viel Unheil in den Gemeinden anstiftete.
Als Gemeindeleiter bekam ich oft Besuch aus der Bundesrepublik Deutschland. Wenn diese Glaubensgeschwister in der Gemeinde öffentlich etwas aus ihrem Leben berichten wollten, mussten wir sogar für sie eine Redeerlaubnis von der politischen Behörde einholen. Wir waren aufgefordert, immer einen schriftlichen Antrag bei der ›Abteilung für Inneres‹ im Rat des Kreises einzureichen, denn man wollte genau wissen, welcher Gast da wäre und mit welchem Fahrzeug er angereist sei.
Anfang der Siebzigerjahre wurde uns diese Verordnung im Rat des Kreises erläutert. Wir wurden auf den Ernst der Forderung aufmerksam gemacht. Ich meldete mich zu Wort und sagte: ›In unseren Gemeinden ist es üblich, dass unangemeldete Gäste aus dem Ausland, z. B. aus der Sowjetunion, Kanada, Polen oder Westdeutschland, die uns einen Besuch abstatten, uns gerne ein Grußwort sagen, über das wir uns alle sehr freuen.‹
Der stellvertretende Ratsvorsitzende des Kreises antwortete großzügig:
›Selbstverständlich ist es gestattet, einen überraschend eingetroffenen Besucher einige Grußworte sagen zu lassen.‹
Ermutigt stellte ich sogleich die Frage: ›Gibt es ein Gesetz, nach dem das Grußwort zeitlich begrenzt ist?‹ Der Staatsfunktionär lächelte: ›Nein, solch ein Gesetz gibt es nicht.‹ So ließen wir dann stets unsere Besucher ein Grußwort sagen, das sich oftmals bis zu einer halben Stunde ausdehnte.
Wir standen mit vielen Russen in Verbindung, die häufig in die DDR kamen.
Eines Tages erhielt ich eine Einladung aus Berlin, an einer Arbeitstagung im Ministerium für Bauwesen teilzunehmen. Dieser Termin fiel zeitgleich zusammen mit dem Aufenthalt einer russischen Reisegruppe aus Riga, die nach Berlin gekommen war, um die Hauptstadt der DDR zu besichtigen und kennenzulernen. An dieser Studienfahrt nach Deutschland nahm auch Dimitri Roschior, ein bekannter Glaubensbruder aus Riga, teil. Er setzte sich in Ost-Berlin sogleich telefonisch mit mir in Verbindung. Ich verabredete mit ihm, ihn während der Arbeitstagung in einer Freistunde morgens im Hotel ›Stadt Berlin‹ aufzusuchen.
Am Vormittag des vereinbarten Tages trennte sich Dimitri von seiner Reisegruppe und blieb im Hotel zurück, um mich dort zu empfangen. Leider teilte er mit einem anderen Russen, der nicht gläubig war, dasselbe Hotelzimmer. Der Bruder aus Riga bat ihn darum, doch für eine Weile den Raum zu verlassen. Sein Reisebegleiter willigte ein, und so konnten wir ungestört miteinander sprechen und auch beten.
Dimitri war sehr ängstlich. Er erzählte mir, dass die Reiseleiterin sehr misstrauisch wurde, als er sie bat, ihm behilflich zu sein, eine Karte nach Anklam abzusenden, um mit mir einen Termin zu vereinbaren. Sie hatte ihm manchen Ärger bereitet. Er war aufgrund seiner Kontakte zu den Christen schon mehrfach negativ aufgefallen und wurde daher in der Reisegruppe besonders beaufsichtigt. Der russische Bruder war so verängstigt, dass er es nicht wagte, mir Schriften oder sonstige Literatur abzunehmen. Nur einige Traktate, besonders aber Kleidungsstücke nahm er gern in Empfang. Alles andere aber sei für ihn unmöglich, gab er mir zu verstehen.
Da ich die russischen Schriften nicht nach Anklam zurücknehmen wollte, ließ ich sie am Büchertisch in der Marienkirche in Berlin zurück. Nach Beendigung der Arbeitstagung im Ministerium für Bauwesen traf ich Dimitri dann noch einmal wieder, und wir besuchten gemeinsam das Pergamon-Museum. Es war ein bewegender und unvergesslicher Tag. Danach sahen wir uns nie wieder.
In Anklam wurde ich sehr oft von einem Stasi-Mitarbeiter besucht und verhört. Dieser Mann nannte sich Johannes Meirich und wohnte in Neubrandenburg. Er besuchte mich auch hin und wieder im Betrieb. Herr Meirich war etwa zehn Jahre älter als ich, sprach südländischen Dialekt, war immer höflich und niemals aufdringlich. Er stellte die typischen Fragen, die von Stasi-Mitarbeitern immer gestellt wurden:
›Kennen Sie Leute von den Zeugen Jehovas? – Kennen Sie Menschen in der DDR, die um ihres Glaubens willen im Gefängnis sitzen?‹
Er brachte oft Kalenderzettel oder auch Schriften aus der Bundesrepublik mit, die ich nicht kannte. Er fragte nach Hirtenbriefen der evangelischen oder katholischen Kirche oder nach Bibelzitaten aus verschiedenen Zeitschriften.
Wir behandelten nicht nur das Thema der Religionsfreiheit, sondern auch die politischen Gegenwartsfragen. Oft wusste man nicht, was dieser Mann eigentlich wollte. Er meldete sich stets telefonisch an und fragte mich, wann es mir zeitlich passen würde, um wieder einmal hereinzuschauen.
Im Betrieb raunte man dann: ›Bei Simmrows ist die Stasi.‹ Meine Sekretärin spöttelte: ›Ihr „Freund“ kommt wieder.‹
In den ersten Jahren seines Erscheinens war ich immer sehr aufgeregt. Aber man gewöhnt sich scheinbar an alles. Wir führten unsere Gespräche manchmal recht offen. Ich sagte ihm geradeheraus meine Meinung zur Staatsform und Gesellschaftspolitik der DDR sowie über die ganze Verlogenheit der Planwirtschaft. Unverblümt ließ ich ihn auch wissen, dass ich als Hauptbuchhalter doch nur ›amtiere‹, der Betrieb aber kein Entgegenkommen zeige, mich durch angemessene Aufgabenbereiche zu fördern.
›Das geht auch über mein Verständnis vom Sozialismus hinaus‹, bestätigte er heuchlerisch meinen Unmut über diese Zustände.
Oft äußerte ich mich auch zu seiner atheistischen Lebenseinstellung:
›Denke ich daran, dass wir alle einmal vor unserem Schöpfer stehen werden, gleichgültig, welche Glaubensauffassung wir hier auf Erden vertreten, dann bin ich froh, dass ich nicht in Ihrer Haut stecke.‹
Wenn ich mich von ihm verabschiedete, sagte ich wiederholt ganz offen zu ihm: ›Ich werde für Sie beten.‹
Während meiner Dienstreise nach Berlin zur Arbeitstagung im Ministerium für Bauwesen staunte ich nicht schlecht, als ich Herrn Meirich an einem Vormittag ›ganz zufällig‹ am Alexanderplatz wiedertraf. War es wirklich ein Zufall oder eine erfreuliche Begebenheit, war es Schicksal oder Vorsehung? – Nein, es war für mich der klare Beweis dafür, dass ich schon wieder beschattet wurde. Die Vermutung liegt nahe, dass das Telefongespräch mit meinem russischen Bruder Dimitri Roschior aus Riga abgehört wurde und Herr Meirich sofort vom Staatssicherheitsministerium den dienstlichen Reisebefehl erhielt, mir nach Berlin zu folgen, um dort alle meine Aktivitäten zu überwachen. Ja, der Arm der Stasi reichte weit über Anklam hinaus; diesem ausgeklügelten Spitzelnetz zu entfliehen, war kaum möglich.
Ende der Siebzigerjahre kamen einmal zwei Stasi-Leute zu mir in den Betrieb und wollten wissen, woher ich die russischen Schriften und Bibeln hätte. Als ich mich nicht bereit erklärte, ihnen darüber Auskunft zu erteilen, drohten sie plötzlich: ›Wir können Sie auch zu unserer Dienststelle mitnehmen.‹ (Gemeint war die Stasi-Dienststelle in Anklam.) Ich sagte zu diesen Herren: ›Ja, das weiß ich, aber, wenn ich mitkomme zu Ihnen, bin ich gewiss, dass viele für mich beten werden.‹ Die Stasileute fragten mich darauf: ›Woher wissen Sie das?‹ Ich entgegnete ihnen: ›Bevor Ihre Behörde mich zu sich bestellt, informiere ich alle Gemeindemitglieder und alle Christen in der Stadt, und die beten dann so lange für mich, bis Gott eingreift.‹
Sie fragten erstaunt und argwöhnisch zugleich: ›Das würden Sie wirklich tun?‹
»Jawohl, Genosse Major, ich bin ein Christ!«
Mit diesem ungewöhnlichen Satz begann für Christian Wabnitz die entschiedene Christusnachfolge. Gott gebrauchte einen Politoffizier für diese Entscheidung.
Christian selbst berichtet von sich:
Ich bin in einer christlichen Familie aufgewachsen und frühzeitig mit dem Evangelium vertraut gemacht worden. Mit meinen Eltern besuchte ich regelmäßig die Gottesdienste, ging in die Sonntagsschule und in die Kinderstunde und habe so die Entwicklung eines Kindes in einem gläubigen Elternhaus erlebt. Schon als Kind wusste ich: die guten Menschen kommen in den Himmel, die schlechten in die Hölle, so wenigstens hatte man mir das gesagt.
Mit elf Jahren bin ich zu einer Kinderbibelwoche gefahren. Dort wurden wir im Evangelium unterwiesen und nach einer gewissen »Seelenmassage«, so habe ich es wenigstens damals empfunden, zu einer Kinderbekehrung geführt.
Als ich 14 Jahre alt war, hatte ich aber ein einschneidendes Erlebnis. Mein kleiner Bruder, gerade dreieinhalb Jahre alt, wurde neben mir von einem Auto überfahren und war auf der Stelle tot. Mein Entsetzen war unbeschreiblich groß. Mein Leben wurde durch diesen schrecklichen Unfall sehr erschüttert. Für mich stellte sich die altbekannte Frage: »Wenn es einen Gott gibt, wie kann er so etwas zulassen? – Warum hat es mich nicht getroffen?« Von diesem Zeitpunkt an stellte ich alles Geistliche in Frage und ging nur noch widerwillig und sehr kritisch in den Gottesdienst. Es kam mit mir sogar so weit, dass ich mir die Frage stellte, ob es überhaupt einen Gott gibt.
Bald hatte ich völlig andere Interessen. Ich las am liebsten Krimis und bekam eine Idealvorstellung vom »harten Mann«, der sein Leben und seine Zukunft mit eigener Hand meistert. Natürlich kamen mir auch andere Gedanken: Wenn es nun Gott doch gibt, wenn er mich wegen meines ganzen Treibens, meiner Taten, Worte und Gedanken einmal zur Rechenschaft ziehen sollte – was dann?
Im Alter von achtzehn Jahren wurde ich mit der Frage konfrontiert, den Militärdienst entweder zu bejahen oder zu verweigern. Es war in der DDR so üblich, dass die überzeugten Christen zu den Bausoldaten gingen. Obwohl meine Eltern wussten, dass mein Glaube nicht mehr echt war, verlangten sie doch, dass ich auch zu den Bausoldaten ginge. Der Schock saß tief, als ich ihnen eröffnete: »Nein, das mache ich nicht, ich gehe zum richtigen Militär.« Ich wollte die Gelegenheit nutzen, mich aus der Gemeinde zurückzuziehen. Da ich mit Begeisterung Sport trieb und mir das Weltbild von einem harten, durchtrainierten Mann vorschwebte, wollte ich zu den Fallschirmjägern gehen. Ich kam aber zu meiner großen Enttäuschung nur zu einer Luftverteidigungseinheit, in der ich nur untergeordnete Dienste zu verrichten hatte.
Als ich das letzte Mal vor Beginn der militärischen Ausbildung zur Gemeinde ging, dachte ich so: »Das ist nun wohl der endgültige Schluss mit der Gemeinde; hier werden mich die Christen nicht wiedersehen.« Beim Packen meiner Sachen steckte ich aber doch meine Bibel, die ich anlässlich der Sonntagsschulentlassung bekommen hatte, in den Koffer. Damals wurde mir vom Gemeindeleiter gesagt: »Das Wort Gottes soll dein tägliches Kraftbrot sein.«
Am nächsten Morgen, als ich mit den anderen Rekruten auf dem Bahnhof stand, wurden unsere Taschen nach Alkohol durchsucht. Als ein Unteroffizier meine Bibel oben auf der Wäsche liegen sah, meinte er: »Na, zum Bibellesen werden Sie keine Zeit bei der Nationalen Volksarmee haben.«
Das reizte mich wieder zu einer Trotzreaktion, und ich dachte: »Aber nun erst recht!«
Aber der Unteroffizier hatte sehr recht, denn in den ersten acht Wochen der Grundausbildung gab es wirklich keine Zeit zum Bibellesen. Es ging alles mit militärischem Pfiff zu, wir mussten von früh bis spät exerzieren. Ich fühlte mich bei dem anstrengenden Dienst recht wohl, da ich körperlich in guter Verfassung war und mir diese Strapazen nichts ausmachten.
Alles änderte sich dann grundlegend, als wir in unsere Standorte verlegt wurden und mich der stupide Wachdienst frustrierte. Dort kam mir alles sehr sinnlos vor. Statt des abenteuerlichen Soldatendienstes, wie ich es mir gewünscht hatte, musste ich stundenlang Wache schieben. Wegen der nervenaufreibenden Monotonie dieses Kasernendienstes kam mir wieder meine Bibel in den Sinn. Ich dachte, vielleicht könnte ich einmal ganz unverbindlich die Bibel durchlesen, um auf andere Gedanken zu kommen und dürfte dann wohl fähig genug sein, mir selbst ein objektives Urteil zu verschaffen.
Ich überlegte mir: wenn ich täglich zwei Seiten lese, werde ich gut durch die ganze Heilige Schrift kommen, bevor mein Militärdienst zu Ende geht. Danach kann ich ja die Bibel in die Ecke schmeißen und allen sagen: »Ich habe mir meine eigene Meinung gebildet, und damit ist für mich die Sache erledigt.« Ich steckte mir also die Bibel in die Beintasche der Uniform und las täglich zwei Seiten.
Eines Tages, im Spätsommer, hatte ich an einem Tor im Wald Wachdienst. Durch das Tor führte eine Eisenbahnlinie für Munitionstransporte. Das ganze Gelände war durch einen Doppelzaun gesichert und mit einem Hochspannungskabel von tausend Volt umgrenzt. Ein Posten musste stets das Tor bewachen. Dies war der begehrteste Wachdienst, weil das Tor mitten im Wald lag und man es sich hier unbeobachtet recht bequem machen konnte. Wenn ein Unteroffizier oder ein wachhabender Offizier zur Postenkontrolle kommen wollte, führte sein Weg immer an der Hauptwache vorbei, so dass wir dann von unseren Kameraden sofort durch das Feldtelefon vorgewarnt werden konnten.
Wie gesagt, ich hatte also an jenem Tag Dienst am Eisenbahntor im Wald und freute mich schon darauf. So setzte ich mich an das Tor, legte meine Kalaschnikow (Maschinenpistole) neben mich, holte meine Bibel hervor und begann zu lesen.
Nach einer geraumen Zeit huschte plötzlich ein verdächtiger Schatten über mich. Fassungslos blickte ich mich um. Mir schien der Verstand stillzustehen. Wie aus dem Boden gestampft standen der Kommandeur und der Politoffizier vor mir. Diese beiden Majore hatten im nahegelegenen Sperrgebiet außerhalb des Lagers Pilze gesucht und mich ohne Vorwarnung bei meinem Bibelstudium überrascht.
»Menschenskind, sind Sie denn wahnsinnig geworden, sich hier hinzulegen, so eklatant ihren Postendienst zu vernachlässigen!«, schrie der Kommandeur. »Im Zweiten Weltkrieg wären Sie in solch einer Situation erschossen worden! Ist Ihnen das überhaupt klar?«
Zu Tode erschrocken sprang ich auf. Was nun geschah, kann ich mit Worten kaum beschreiben. Da ich ahnte, dass jetzt mit härtester Bestrafung zu rechnen war, schickte ich in meiner Ausweglosigkeit schnell einen Stoßseufzer zum Himmel und betete: »Jesus Christus, du bist mein Herr, hilf mir doch!« Während ich noch versuchte, meine Gedanken zu ordnen, trat der Politoffizier auf mich zu und nahm mir die Bibel aus den Händen. Ich sah, wie seine Stirn sich auf wenig schmeichelhafte Art in Falten legte und seine Lippen verächtlich zuckten, als er darin herumblätterte. Fieberhaft überlegte ich, wie ich mich aus dieser bedrohlichen Zwangslage herausreden könnte, als mir plötzlich die Worte in den Sinn kamen: »Ganz sein – oder lass es ganz sein! Ein halber Christ ist ein ganzer Unsinn.«
Da schaute der Major auf, sah mich durchdringend an und fragte misstrauisch: »Sie lesen die Bibel? – Sind Sie ein Christ?«
Augenblicklich wurde mir bewusst: »Jetzt gibt es kein Wenn und Aber mehr. Entweder – oder! Du musst dich jetzt entscheiden! Entweder du gehst den Weg des ewigen Lebens oder du lässt es ganz sein. Blitzschnell besann ich mich, traf die Entscheidung und antwortete mit fester Stimme:
»Jawohl, Genosse Major, ich bin ein Christ!«
Der Kommandeur reagierte darauf wütend und energisch: »Was das bedeutet, können Sie sich ja denken. Solch ein fahrlässiges Wachvergehen wird für Sie noch ein großes Nachspiel haben. Machen Sie sich jetzt zurecht, sie werden hier sofort abgelöst!«
Mit drohender Gebärde verschwanden die beiden ranghöchsten Offiziere des Standortes. Ganz verwirrt schaute ich ihnen nach. Es dauerte eine ganze Weile, bis ich mich wieder beruhigt hatte.
Jetzt, da ich die volle Entscheidung für Jesus Christus getroffen hatte, vernahm ich die klare Stimme des Heiligen Geistes, denn eine nie gekannte Freude zog in mein Herz. Ein sicheres Bewusstsein erfüllte mich: Das war der entscheidendste Moment deines bisherigen Lebens. Gottes Stunde, der Ruf Jesu: »Folge mir!« Ein wunderbarer Friede nahm mir die Angst vor allem, was nun kommen würde. Gott hatte seine Hand auf mein Leben gelegt, und diese Gewissheit gab mir Trost.
Die Majore gingen indessen gleich zur Hauptwache und stauchten den Unteroffizier vom Dienst zusammen, wie es möglich sei, dass ein Soldat während der Wache die Bibel liest. Nach kurzer Zeit wurde ich dann gegen einen anderen Wachposten ausgewechselt und musste zurück in die Kaserne. Es sprach sich nun gleich im ganzen Standort wie ein Lauffeuer herum, was geschehen war und was ich mir da geleistet hätte. Als ich zur Hauptwache kam, konnten meine Kameraden überhaupt nicht verstehen, dass ich in dieser doch für mich sehr peinlichen Situation noch so froh gelaunt sein konnte. Doch ich hatte Frieden mit Gott gefunden. Von dieser Zeit an bekannte ich mich zu meinem Glauben an Jesus Christus, meinen Erlöser und Erretter.
Natürlich hatte dieser Vorfall ein Nachspiel, aber ich handelte nach dem Wort des Herrn: »Wer nun mich bekennt vor den Menschen, den will auch ich bekennen vor meinem himmlischen Vater.«
Ich wurde bald vor die höheren Offiziere geladen und protokollmäßig vernommen. Freimütig konnte ich allen von Jesus Christus sagen, dass er der einzige Weg, die Wahrheit und das Leben überhaupt ist, dass niemand zum Vater kommt als nur durch ihn. Ich sagte ihnen, dass ich Frieden mit Gott hätte und den ganzen Weg mit Jesus Christus gehen wolle, und fügte hinzu: »Ich gerate auch immer wieder in Gewissensnot wegen irgendeines Schießbefehls. Ich kann aus Glaubensgründen auf niemanden schießen.«
Von Stund an wurde ich von allen Wachdiensten zurückgezogen, und man versetzte mich zum Küchendienst.
In jeder Einheit gab es einen Verbindungsoffizier zum Ministerium für Staatssicherheit. Nach drei Wochen erhielt ich den Befehl, mich bei diesem Offizier vorzustellen. Er war Oberleutnant und wollte mit mir ein Gespräch führen. Zu meinem großen Erstaunen verlief diese Unterredung sehr human, ganz anders, als ich es erwartet hatte. Er erklärte mir, dass es sich hier um eine rückwärtige Einheit handele, die einen wichtigen Dienst erfülle. Er fragte mich: »Wenn hier von feindlicher Seite ein Angriff erfolgt, können Sie es dann verantworten, das Leben Ihrer Kameraden aufs Spiel zu setzen? Sie können sich doch vorstellen, dass jeder, der sich dem militärischen Bereich nähert, nur schlechte Absichten im Schilde führt. Hier kann man doch seinen Feind nur mit der Waffe ausschalten.«
Es war schon Gnade, dass ich nicht schärfer bestraft wurde. Gleich nach dem schrecklichen Zwischenfall schrieb ich einen Brief an meine Eltern und schickte ihn in die Heimat:
Hallo, Ihr Lieben,
erst mal vielen Dank fürs Paket. Ich habe mich natürlich sehr gefreut, besonders über den Brief von Mutti. Nun liege ich schon den dritten Tag in der medizinischen Abteilung. Die Ursache sind Zahnschmerzen, eine dicke Backe. Aus diesem Grunde konnte ich leider nicht auf Urlaub kommen. Montag ging ich gleich zum Zahnarzt, und der hat mich dann in die medizinische Abteilung überwiesen. Wenn ich es recht bedenke, ist es eigentlich gar nicht so schlecht. Erstens habe ich den ganzen Tag absolute Ruhe, und es vergeht Zeit, was in meiner jetzigen Situation nicht unwichtig ist, denn es hat sich in der letzten Zeit etwas Entscheidendes bei mir getan. Angefangen hat es damit, dass ich vor etwa zwei Wochen wieder einmal unser Eisenbahntor bewachen musste. Ihr müsst wissen, da ist mitten im Wald ein Tor, und wenn ein Zug rein- oder rausfährt, wird es aufgemacht und wieder verschlossen. Dieses Tor muss bewacht werden. Eigentlich ist das der beste Wachpostendienst, den es gibt, denn man hat seine Ruhe und kann tun, was einem beliebt.
Man kann eigentlich auch nie erwischt werden, denn wenn wirklich jemand kontrollieren kommt, muss er an der Hauptwache vorbei, und die Kameraden dort rufen vorher über das Feldtelefon an. Deshalb habe ich mir auch gar keine Gedanken gemacht, als ich mir meine Bibel einsteckte, um dort darin zu lesen. Ich hatte mir nämlich vorgenommen, sie in 18 Monaten einmal ganz durchzulesen. Da habe ich mich ins Gras gesetzt und ganz vertieft gelesen. Als ich etwa eine Stunde gelesen hatte, stehen plötzlich unsere beiden Majors vor mir, der Leiter der Dienststelle und der Politstellvertreter, beide in Trainingsanzügen und mit Pilzkörben in den Händen. Die waren ins Sperrgebiet Pilze sammeln gegangen und sind zuvor von außen durchs offene Eisenbahntor gekommen und haben mich überrascht. Jedenfalls war mir nicht ganz wohl, als die so vor mir standen. Schließlich nahm der eine mir die Bibel aus der Hand, blätterte darin und fragte mich, ob ich ein Christ sei. Da habe ich gesagt: »Jawohl, Genosse Major!« Der andere hat was von »unverständlich« und »schwerem Wachvergehen« gesprochen und dass das noch ein großes Nachspiel haben würde. Dann haben sie meine Bibel eingesteckt und sind weitergegangen. Meine Gedanken liefen ziemlich durcheinander, als sie weg waren, aber ich musste immer an mein »Jawohl, Genosse Major!« denken, und dann fiel mir der Satz ein: »Entweder ganz sein, oder lass es ganz sein!«
Na ja, jedenfalls habe ich mich an dem Eisenbahntor echt bekehrt, und das hat mich auch so froh gemacht. Ihr wisst, dass mir sentimentale Regungen nicht liegen. Das ist vielleicht ein Grund gewesen, warum ich es so lange herausgeschoben habe. Aber nun bin ich ein echter Christ, und das ist auch gut so.
Seid alle recht herzlich gegrüßt von Eurem Christian.
P. S.: Bitte betet weiterhin für mich.
4. 10. 1985 Christian Wabnitz
Er hetzte, indem er Vorbild war
»Im Namen des Volkes ergeht folgendes Urteil:
Der Angeklagte Johannes Heinze, geb. am 16.7.1917, wohn-haft in Leipzig W 33, Holteistraße 12, wird als Leiter einer illegalen Organisation und wegen Verbreitung von Hetzschriften mit Boykotthetze gegen demokratische Einrichtungen und Organisationen des ersten deutschen Arbeiter- und Bauernstaates zu fünf Jahren Zuchthaus ohne Bewährung verurteilt. Wegen der Schwere und des Umfanges des begangenen Staatsverbrechens können dem Angeklagten keine mildernden Umstände zugesprochen werden«, verkündigte der Richter.
Von den Wänden des Bezirksgerichtssaales blicken aus den Bilderrahmen die politischen Götzen des kommunistischen Gewaltsystems, Marx, Engels, Lenin, Stalin und der berüchtigte Statthalter unter sowjetischer Gnade – Walter Ulbricht – herab.
Johannes Heinze, der eben verurteilte und gebrandmarkte »Staatsverbrecher«, steht bescheiden und gefasst vor seinem irdischen Richter. Sein menschliches Antlitz erinnert keinesfalls an einen gemeingefährlichen Verbrecher, im Gegenteil, er hat einen besonders freundlichen und demütigen Gesichtsausdruck.
Die Staatsanwältin begründet die Schwere seines Verbrechens mit dem lapidaren Satz:
»Er hetzte, indem er Vorbild war!«
Vorbild? In was oder worin?
Johannes Heinze ist ein überzeugter Christ und ein glühender Zeuge Jesu.
Seine ihm zur Last gelegte Schuld besteht darin:
Er betreut einen christlichen Hauskreis mit dem Evangelium.
Er verbreitet Schriften über das Heil Gottes und seinen Friedensfürsten Jesus Christus.
Er erzieht seine Kinder nach den Geboten Gottes.
Für diese »schwerwiegenden Delikte« muss ein unbescholtener Maschinenbauingenieur angeblich »im Namen des Volkes« des sogenannten ersten deutschen demokratischen Arbeiter- und Bauernstaates Deutschlands für fünf Jahre seines Lebens, also für 1825 Tage, hinter Zuchthausmauern verbringen, obwohl in der Verfassung dieses verbrecherischen Gewaltstaates Religionsfreiheit ausdrücklich festgelegt ist.
»Er hetzte, indem er Vorbild war!« – Worin ist wohl dieser sogenannte Staatsverbrecher Vorbild?
Johannes Heinze hatte versucht, Vorbild zu sein nach dem Wort des Apostels Petrus: »… dass ihr verkündigen sollt die Wohltaten dessen, der euch berufen hat von der Finsternis zu seinem wunderbaren Licht.«
Dem großen Vorbild Jesus Christus nachzufolgen nach den Worten:
»Denn dazu seid ihr berufen, da auch Christus gelitten hat für euch und euch ein Vorbild hinterlassen, dass ihr sollt nachfolgen seinen Fußstapfen, er, der keine Sünde getan hat, und in dessen Mund sich kein Betrug fand; der nicht wiederschmähte, als er geschmäht wurde, nicht drohte, als er litt. Er stellte es aber dem anheim, der gerecht richtet, der unsere Sünde selbst hinaufgetragen hat an seinem Leibe auf das Holz, damit wir, der Sünde abgestorben, der Gerechtigkeit leben« (1. Petr. 2, 21-24).
Im Staat der großen Ungerechtigkeit zu leben und dabei dem Vorbild Jesu Christi nachzueifern, bedeutet für ihn, Unrecht an sich zu erleiden. Johannes Heinze nimmt diese Strafe an in dem Bewusstsein:
»Denen, die da Gott lieben, müssen alle Dinge zum Besten dienen, denen, die nach seinem Ratschluss berufen sind … (Röm. 8, 28).«
»Alles sind Gottes Erziehungswege«, schreibt Johannes Heinze später und berichtet aus seinem Leben:
»Ich wurde am 16.7.1917 in Dresden geboren. Mein Vater war Kunstmaler. Seine größte Freude erlebte er, als er vor dem Ersten Weltkrieg die Decken- und Wandgemälde in der Erlöserkirche zu Jerusalem künstlerisch entwerfen und gestalten durfte und sie dann auch ausführte. Nach Kriegsausbruch musste er Palästina, das spätere Israel, verlassen. Er heiratete 1915 in Dresden.
Von meiner Mutter wurde ich im Glauben an Jesus Christus erzogen. Zu meinem Vater habe ich diese Verbindung nie gefunden, weil er sehr jähzornig war und deshalb auch sehr wenig Verständnis für seine Kinder hatte. Meine Mutter lebte mir aber den wirklichen Glauben vor.
Sie nahm mich 1926 in eine freikirchliche Versammlung mit. Meine erste Predigt, die ich hörte, beinhaltete das Thema des Ungehorsams. ›Ungehorsam ist Zaubereisünde‹, sagte der Prediger. Ich dachte: ›Du wirst jeden Tag wegen Ungehorsam von deiner Mutter bestraft. Das muss ja etwas Furchtbares sein, wenn du dadurch Zaubereisünde begehst.‹ Mir wurde klar, so kann es mit mir nicht weitergehen; es muss sich in meinem Leben alles grundlegend ändern. Deshalb trat ich vor den Altar Gottes, als alle aufgefordert wurden, sich Gott zu stellen, wenn sie ein neues Leben beginnen wollten. Ich weinte bitterlich über meine Sünden. Irgendwo hörte ich jemand sagen: ›Wenn solch ein kleiner Kerl so über seine Sünden weint, wie viel mehr müssten wir es tun.‹
Dieser Tag war ein tiefer Einschnitt in meinem Leben und ich nahm mir vor, mit aller Konsequenz dem Herrn Jesus Christus nachzufolgen.
Nach dem Abschluss meiner Schulzeit mit Abitur riet man mir, meine Dienstzeit beim Militär abzuleisten, ehe ich mein Studium zum Ingenieur an der Technischen Hochschule beginnen würde.
In meiner Grundausbildung beim Militär habe ich meinen Glauben an Jesus Christus nicht verleugnet. Gleich am ersten Abend kniete ich an meinem Bett nieder und betete. Ich war Gott sehr dankbar, dass ich in der Kaserne mit nur vier Mann in einem Zimmer untergebracht war. Ich dachte, je weniger im Zimmer sind, desto besser. Doch einer meiner Kameraden berichtete den anderen sofort: ›Was denkt ihr wohl, was wir für einen frommen Kameraden haben? Der kniet vor dem Bett nieder und betet.‹ So war es natürlich am nächsten Tage in aller Munde: ›Der Heinze ist ein ganz Frommer!‹ Zunächst dachte ich, das sei nur ein Nachteil. Aber bald meldeten sich andere Christen bei mir, die auch dem Herrn nachfolgten. So hatte ich mit ihnen geistliche Gemeinschaft.
Die anderen Kameraden konnten oft sehr gemein werden, ja, einige waren mir sehr feindlich gesonnen. Weil mich meine Zimmerkameraden aber beim Gebet derartig störten, kniete ich nicht mehr an meinem Bett nieder, sondern betete im Stillen, aber anhaltend auch für meine Gegner. Ich blieb weiterhin im Zeugnis treu und verließ grundsätzlich das Zimmer, wenn irgendwelche obszönen Geschichten erzählt oder anstößige Bilder herumgereicht wurden. Später war es so, dass sie in meiner Gegenwart keine zweideutigen Witze mehr erzählten. Ich wusste, wie wichtig mein Auftrag war:
›Ihr sollt meine Zeugen sein!‹ Das galt nicht nur für den weltweiten Missionsauftrag, sondern besonders für meine Nächsten.
In dem Beispiel vom barmherzigen Samariter führt Jesus uns vor Augen, was es bedeutet, Nächstenliebe zu üben. Es geht dem Sohn Gottes nicht um eine gewaltige ›ALL-Liebe‹, sondern um die Nächstenliebe. Eine berauschende ›Fern-Liebe‹ ist oft gar keine Liebe. Meist halten wir uns mit dieser großartigen ›ALL-Liebe‹ den Nächsten vom Leib. Die Liebe nähert sich stets dem Elenden, sie versucht, ihm echte Hilfe zu bringen. So formulierte es Schiller: ›Greif an mit Gott – dem Nächsten muss man helfen.‹
Schon die seelische Finsternis im Innern unseres Nächsten sollte uns Anlass geben, ihm ein Licht zu sein. Es geht um die Nächstenliebe, nicht um die Übernächstenliebe. Für Jesus sind wir heute und morgen immer der Nächste. Deshalb fühlte ich mich stets durch die Liebe Jesu für meinen Nächsten verantwortlich.
Als ich mein Studium aufnehmen wollte, brach der Krieg aus. Ich hatte nur zwei Monate Zeit, um mich zum Studium anzumelden und wollte Ingenieur werden. Dadurch kam ich aber beim Heer in die Feuerwerkerlaufbahn. Ich wurde wegen meiner technischen Begabungen als Arbeitsstellenleiter in der Munitionsfertigung eingesetzt. Oft hatte ich an die 600 Leute anzuleiten. Wir mussten damals auch viel erbeutete Munition sprengen.
Kurz vor Kriegsbeginn hatte ich mich mit meiner Sekretärin verlobt, obwohl Gott mich mehrmals eindringlich gewarnt hatte, dieses Mädchen zu heiraten. Meine Braut wusste von meinem Verhältnis zu Jesus. Sie selbst aber war keine Christin. Ich kannte das Wort des Apostels Paulus sehr gut:
Ziehet nicht am fremden Joch mit den Ungläubigen. Denn was hat die Gerechtigkeit zu schaffen mit der Ungerechtigkeit? Was hat das Licht für Gemeinschaft mit der Finsternis? Wie stimmt Christus mit Belial? Oder was für ein Teil hat der Gläubige mit dem Ungläubigen? Was hat der Tempel Gottes gemein mit den Götzen? Wir aber sind der Tempel des lebendigen Gottes; wie denn Gott spricht: ›Ich will unter ihnen wohnen und wandeln und will ihr Gott sein, und sie sollen mein Volk sein. Darum gehet aus von ihnen und sondert euch ab‹, spricht der Herr, ›und rühret kein Unreines an, so will ich euch annehmen und euer Vater sein, und ihr sollt meine Söhne und Töchter sein‹, spricht der allmächtige Herr (2. Kor. 6, 14-18).
Obwohl ich in meiner Bekehrung und in verschiedenen anderen Predigten schon mehrfach über den Ungehorsam, die furchtbare Zaubereisünde vor Gott, gehört hatte, beging ich nun diesen unverzeihlichen Fehler. Es ist ein Irrtum zu glauben, es handele sich um ein Kavaliersdelikt in der Gemeinde Jesu, nein, es gilt dann der Satz:
Irret euch nicht, Gott lässt sich nicht spotten. Denn, was der Mensch sät, das wird er ernten. Wer auf sein Fleisch sät, der wird von dem Fleisch das Verderben ernten (Gal. 6, 7.8).
Jahrzehnte meines Lebens musste ich die Frucht dieser Ernte an mir erfahren. Doch als junger Mensch achtete ich nicht auf die Gefahr der Sünde, die Gott durch seine Apostel sehr genau beschrieben hat und durch die er ständig davor warnt.
Als ich mich zum ersten Mal mit meiner späteren Frau traf, sie kam zu einem bestimmten Ort mit einer Taxe gefahren, sprach Gott sehr deutlich und unmissverständlich zu mir: ›Geh diesen Weg nicht! – Kehr um!‹ Ich war damals so töricht, dass ich dachte:
›Na, heiraten muss ich doch selbst, also ist das doch meine freie Entscheidung!‹ Ich war töricht zu glauben, Gott könnte mir einen schlechten Rat geben. Natürlich ist das unsere freie Entscheidung, aber sündhaft, wenn sie gegen den Willen Gottes steht. Es ist und bleibt die uralte Geschichte aus dem Garten Eden:
Aber die Schlange war listiger als alle Tiere auf dem Felde, die Gott, der Herr, gemacht hatte, und sprach zum Weibe: ›Ja, sollte Gott gesagt haben: „Ihr sollt nicht essen von allen Bäumen im Garten?“‹ Da sprach das Weib zu der Schlange: ›Wir essen von den Früchten der Bäume im Garten; aber von den Früchten des Baumes mitten im Garten hat Gott gesagt: „Esset nicht davon, rühret sie auch nicht an, dass ihr nicht sterbet!“‹ Da sprach die Schlange zum Weibe: ›Ihr werdet keineswegs des Todes sterben, sondern Gott weiß: an dem Tage, da ihr davon esset, werden eure Augen aufgetan, und ihr werdet sein wie Gott und wissen, was gut und böse ist‹ (1. Mose 3, 1-5).
Der Gegner Gottes schleicht sich ein in das Paradies – der fanatische Machtkampf zwischen Finsternis und Licht entbrennt. Es beginnt meist mit einer leisen, fast unauffälligen Zweifelsfrage: ›Ja, sollte Gott wirklich gesagt haben? Muss man denn seine Worte so genau nehmen?‹
Absichtlich übertreibt Satan: ›Wie bitte? – Ihr dürft von keinem Baum des Gartens essen?‹ – Er wusste genau, dass dem Menschen erlaubt war, von allen Bäumen zu essen. Trotzdem stellt er unweigerlich die nächste Frage: ›Seid ihr denn wie willenlose Marionetten des Schöpfers?‹
Die Stufenleiter der Verführung wird uns hier vor Augen gestellt – man könnte meinen, die Schlange habe Psychologie studiert. Nicht mit klingendem Spiel rückt sie an, sondern satanisch geschickt, sehr einfühlsam, ja, teuflisch überzeugend. Ich will es einmal in Zahlen ausdrücken:
›Von 999 Bäumen dürft ihr essen, nur von einem nicht? – Wie bitte?
Ein Tausendstel gönnt euch der großzügige, erhabene Schöpfer nicht? Da habt ihr aber Gott ganz falsch verstanden. Gott ist großzügig, nicht kleinlich, er ist tolerant und weitherzig! Seht, wie verschwenderisch und spendabel seine Schöpfungswerke sind: Nein, Gott ist kein Zahlenkrämer, er ist kein Federfuchser, er ist kein Kleinigkeitskrämer oder Haarspalter, kein engstirniger Bürokrat, sondern er weiß genau, wenn ihr dieses i-Tüpfelchen an Glückseligkeit bekommt, werdet ihr sein wie Gott.‹
Jetzt hörte auch ich auf die Stimme des Versuchers: ›Gerade diese eine Frau, sie gefällt deinen Augen doch so sehr, sie kann dich sehr glücklich machen. Du hast Gott missverstanden. – Gottes Gebote hemmen dich doch nur, zur richtigen Lebensentfaltung zu kommen – wer es mit Gott so genau hält, der kommt zu kurz im Leben. Setz dich nur einmal darüber hinweg, denn einmal ist keinmal.‹
So war es bei mir. Bald war ich der Verführung mit Haut und Haaren, mit Augen, Ohren, Phantasie und Sinneswelt der Lust verfallen. Gegenüber der Sünde gibt es keine Neutralität: Die Sünde hat die grausame Eigenschaft zu verlocken, zu versuchen, zu verblenden, zu verdrehen, zu verirren, zu verfinstern und zu verderben.
Was sich im Garten Eden abspielte, hat sich im Laufe der Menschheitsgeschichte milliardenfach wiederholt. – Am Anfang war die Lüge, sie führt in den Ungehorsam – dann in die Gewissensnot und in das Versteckenwollen. Alle Menschen sind in verhängnisvoller Weise in diese Versuchung aus dem Garten Eden verstrickt. Adam ist keine Märchenfigur des 20. Jahrhunderts, nein, Adam ist der Typ des 20. Jahrhunderts, der Mensch aller Zeiten und Perioden. Es ist eine Tatsache: ›Wo Adam ist, da ist auch die Schlange, und wo die Schlange ist, da lauert die Sünde des Ungehorsams – deshalb wird Ungehorsam vom Heiligen Geist auch Zaubereisünde genannt.‹
Jakobus schreibt:
›Selig ist der Mann, der die Anfechtung erduldet; denn, nach-dem er bewährt ist, wird er die Krone des Lebens empfangen, welche Gott verheißen hat denen, die ihn liebhaben. Niemand sage, wenn er versucht wird, dass er von Gott versucht werde. Denn Gott kann nicht versucht werden zum Bösen, und er selbst versucht niemand.
Sondern ein jeglicher wird versucht, wenn er von seiner eigenen Lust gereizt und gelockt wird. Danach, wenn die Lust empfangen hat, gebiert sie die Sünde, die Sünde aber, wenn sie vollendet ist, gebiert sie den Tod‹ (Jak. 1, 12-16).
Ich ließ mich täuschen und willigte in die Versuchung ein.
Wir wollen später meist die Verantwortung für diese Schuld auf andere abschieben. Darum sind wir alle miteinander perfekte Schieber. Nicht ich habe Schuld, sondern die Frau oder der Mann, das Elternhaus, die Umstände, die Freunde, der Nachbar, der Chef, der Charakter, die Verhältnisse, der Krieg, die Nachkriegszeit und alles andere hat Schuld, nur wir selbst nicht. Letztendlich wollen wir alles Gott in die Schuhe schieben mit dem makabren Satz: Warum lässt Gott das alles zu?
Deshalb erklärt Jakobus sehr eindeutig: ›Jeder ist für seine Entscheidung zwischen Gut und Böse selbst voll verantwortlich.‹ Jakobus zeigt uns das Gefälle der Sünde auf: die Begierde, die Gedankensünden, führen zur Tat, und die Verschuldung bringt dann den schleichenden Tod. Der Mensch ist niemals einem undefinierbaren Schicksal ausgeliefert, sondern er wird zum klaren ›Nein‹ gegen die Sünde aufgerufen.
Als ich in diesen ungeheuren Treuebruch eingewilligt hatte, schwieg Gott sieben Jahre lang. Ich hatte nie mehr diese innigste Verbindung zum Herrn wie vorher. Ich vernahm die Stimme des Herrn nicht, ich war vom direkten Gespräch mit Gott wie abgeschnitten.
Im Jahre 1940 heiratete ich, aber schon sieben Monate später schrieb meine Mutter aus der Heimat: ›Deine Frau geht hier lustig mit anderen Männern aus.‹
Zunächst wohnten wir in Torgau, weil sich dort meine Dienststelle befand, bis meine Frau und ich 1941 in das elterliche Haus nach Freital ziehen konnten. In dieser Zeit war ich in der Munitionsfertigung tätig. Ich war damals Offiziersanwärter, konnte aber kein offizieller werden, weil ich noch keine Frontbewährung hatte.
Ein Waffen- und Geräteoffizier, der als Schwerverwundeter in unserer Einheit diente, sagte eines Tages: ›Drückeberger gibt es überall. Hier in der Heimat werden die besten Männer zurückgehalten, die eigentlich gesund und kriegsverwendungsfähig sind. Der Heinze sollte auch mal an die Front gehen!‹
Er hatte dann meinen Oberst so lange bearbeitet, bis ich an die Front abkommandiert wurde. So kam ich nach Russland zum Auffrischungsstab der Heeresgruppe Mitte nach Mogilew. Aber auch dort arbeitete ich nur in technischen Bereichen. Ich danke Gott, dass ich nie auf Menschen schießen musste. Erst 1945 wurde ich zu einem sogenannten Schnellläuferlehrgang nach Berlin abberufen und legte dort meine Prüfung als Waffen- und Geräteoffizier ab. Damals kam ich zu einer Flakbatterie und geriet während der Panzerschlacht bei Halbe am 27.4.1945 in sowjetische Kriegsgefangenschaft.
Vom Sammellager Sagan wurden wir nach Heidekrug verlegt und kamen von dort nach Wilna in der Sowjetunion in ein stationäres Kriegsgefangenenlager. So begannen für mich die ersten fünf Jahre der Heimsuchung, denn Gott will uns nicht nutzlos strafen, sondern ist stets bemüht, sein verlorenes Kind ›heimzusuchen‹. Wir müssen bei den Erziehungsmethoden Gottes manche Plage, Prüfung, Last und Bürde, sehr viele Widerwärtigkeiten und Nöte auf uns nehmen. Deshalb kommen wir in Trübsale, Verzweiflung, Leid, Kummer und viele Traurigkeiten bis hin zur Mutlosigkeit und Schwermut.
Was es bedeutet, fünf Jahre in sowjetischer Kriegsgefangenschaft zu sein, kann man aus unzähligen Schilderungen und Tagebüchern ehemaliger Kriegsgefangener erfahren.
Doch hier will ich berichten, wie Gott mich in allen Anfechtungen und Prüfungen geführt hat und aus allerschwierigsten Situationen rettete.
Ich wurde schwer krank. Man schaffte mich aus dem Kriegsgefangenenlager, weil man den Ausbruch einer Seuche befürchtete. Völlig apathisch lag ich auf einer harten Liege. Ich war einfach lebensüberdrüssig, verzagt und mutlos, hoffnungslos dem Tode preisgegeben. Mein Körper war gefährlich ausgetrocknet und entsetzlich kraftlos, meine Zunge klebte mir am Gaumen. Einmal brachte man mir ein Geschirr mit Suppe. Weil ich tagelang nichts gegessen hatte, fehlte mir die Kraft, den Löffel zu halten. Ich war in erschreckender Weise lebensmüde und wünschte, endlich sterben zu können.
›Ich kann nicht essen‹, hauchte ich dem Sanitäter zu. Da nahm er den Löffel und fütterte mich. Mit jedem Löffel Suppe jedoch erwachte in mir neuer Lebensmut und Kraft. Schon nach wenigen Tagen wurde ich wieder in das Gefangenenlager zurückgetragen. Es war mir eine große Lehre: Man stirbt eben nicht in erster Linie an einer Krankheit, sondern dann, wenn es der Ratschluss Gottes ist.
Wir hatten in dem Kriegsgefangenenlager in Wilna weder einen Pfarrer noch einen Prediger. Es tat mir sehr weh, denn ich wusste nur zu gut, dass diese verzweifelten, verratenen und verurteilten Kriegsgefangenen, die innerlich so verbittert und verhärtet waren, unbedingt Trost für die Seele und Gottes Wort brauchten. So entschloss ich mich, die Genehmigung für einen Lagergottesdienst bei der NKWD (im übertragenen Sinne die »bolschewistische Gestapo« – geheime Staatspolizei) zu beantragen. Ein Offizier der berüchtigten Geheimpolizei fragte zynisch, was ich als Ingenieur denn wohl predigen wolle.
›Wenn ich das mit einem Satz sagen soll‹, sagte ich entschlossen, ›dann will ich über den Text aus dem Galaterbrief sprechen: Die Frucht des Geistes ist: Liebe, Freude, Friede, Geduld, Freundlichkeit, Gütigkeit, Glaube, Sanftmut, Keuschheit‹ (Gal. 5, 22.23).
Der Russe grinste mich frech an: ›Das wollen wir Kommunisten auch, wir haben dieselben Ziele wie Sie. Deshalb ist es nicht nötig, Ihnen eine Genehmigung für einen Lagergottesdienst zu geben.‹
›Wenn ich Sie also recht verstehe, gibt es demnach in der Sowjetunion, praktisch gesehen, keine Religionsfreiheit?‹, entgegnete ich ihm.
Der Geheimdienstoffizier wurde sehr ernst. Sofort nahm er mir den schriftlichen Antrag aus der Hand und erteilte mir die Genehmigung zum Gottesdienst im Lager. Von diesem Zeitpunkt an hatte ich natürlich auch ständig einen Spitzel um mich, der alle meine Gespräche und Predigten aufzeichnen musste, um sie dem Geheimdienst weiterzugeben. Gott, der treue Herr, gab mir aber viel göttliche Weisheit und bewahrte mich vor heimtückischen Anschlägen der Kommunisten.
Im Dezember 1948 wurde ich plötzlich in ein anderes Lager nach Cobryn verlegt. Wollte man vielleicht den unbequemen ›Prediger in der Wüste‹ loswerden?
Kurze Zeit nach meiner Ankunft in dem anderen Kriegsgefangenenlager kam ein Gefangener zu mir und lud mich ein, in eine Baracke zu kommen, wo der Pfarrer Kurt S. mit anderen Gläubigen eine wichtige Frage besprechen wollte.
Bald saß ich im Kreis von etwa 25 Kriegsgefangenen, die mich sehr freundlich begrüßten. Pfarrer S. begann mit folgenden Worten:
›Sie wissen, dass die vier Außenminister der Siegermächte ausgehandelt haben, dass alle Kriegsgefangenen aus der Sowjetunion bis zum 31.12.1948 entlassen werden sollen. Bis jetzt sind immer nur Kranke entlassen worden. Die meisten von uns sind nun schon vier bis fünf Jahre in sowjetischer Kriegsgefangenschaft. Der genannte Termin kann von den Russen überhaupt nicht eingehalten werden. Als Christ weiß ich, dass Gott immer einen Ausweg für seine Kinder hat. Wie wir es im Matthäusevangelium lesen:
„Wenn zwei unter euch eins werden, worum sie bitten wollen, das soll ihnen widerfahren von meinem Vater im Himmel. Denn wo zwei oder drei versammelt sind in meinem Namen, da bin ich mitten unter ihnen“ (Matth. 18, 19.20).
Wir haben bisher wohl jeder einzeln für sich gebetet, dass uns Gott wieder heimführen möge zu unseren Familien. Hier wird aber gezeigt, dass unser Gebet mehr Kraft hat, wenn wir miteinander eins werden, um für unsere Heimkehr zu bitten. Nun bitte ich um eure Stellungnahme.‹
Einer nach dem andern bekräftigte die Richtigkeit dieser Er-kenntnis und des Vorgangs. Ich hatte als Einziger nichts zu diesem Vorhaben gesagt, deshalb waren alle Blicke jetzt auf mich gerichtet. Als ich so beharrlich schwieg, forderte mich der Pfarrer auf, doch auch meine Meinung dazu zu sagen. Er stellte mich bei den Kameraden vor: ›Wir haben heute Bruder Johannes Heinze unter uns. Er hat in einem anderen Kriegsgefangenenlager Gottesdienste gehalten. Nun möchten wir gern noch seine Meinung hören.‹
Behutsam erklärte ich: ›Meine Meinung würde euch nicht gefallen, deshalb möchte ich lieber schweigen.‹
Pfarrer Kurt S. ließ nicht nach. ›Lieber Bruder Heinze, gerade deine Meinung würde uns interessieren.‹
Wieder begann ich behutsam: ›Bitte, versteht mich nicht falsch, liebe Glaubensbrüder. Ich bin nicht deshalb in Kriegsgefangenschaft geraten, weil Deutschland den Krieg verloren hat, sondern weil ich Gott so furchtbar ungehorsam gewesen bin. Deshalb möchte ich nicht eher entlassen werden, bis ich die mir von Gott auferlegte Lektion, nämlich geduldig auf seine Führung im Gehorsam zu warten, gelernt habe.
Dann führt Gott mich sowieso nach Haus. Ich muss also so lange im Kriegsgefangenenlager bleiben, bis ich diese spezielle Lektion gelernt habe.‹
Jetzt herrschte betroffenes, großes Schweigen. Ich bin davon überzeugt, dass die meisten dafür kein Verständnis hatten. Vielleicht hielten sie mich für einen Fanatiker, doch ich wusste um die Wahrheit seines Wortes: ›Der Vater, der in das Verborgene sieht, wird es euch vergelten öffentlich.‹ Offensichtlich vernahm Gott, mein Erbarmer, mein Gebet und die Änderung meiner Gesinnung.
Schon zu Jesaja redete der Heilige Geist:
›Und er spricht: Machet Bahn, machet Bahn! Bereitet den Weg, räumt die Anstöße aus dem Weg meines Volkes! So spricht der Hohe und Erhabene, der ewig wohnt, dessen Name heilig ist. Ich wohne in der Höhe und im Heiligtum und bei denen, die zerschlagenen und demütigen Geistes sind, auf dass ich erquicke den Geist der Gedemütigten und das Herz der Zerschlagenen. Denn ich will nicht immerdar hadern und nicht ewiglich zürnen; sonst würde ihr Geist vor mir verschmachten und ihr Lebensodem, den ich geschaffen habe. Ich war zornig über die Sünde ihrer Habgier und schlug sie, verbarg mich und zürnte. Aber sie gingen treulos die Wege ihres Herzens. Ihre Wege habe ich gesehen, aber ich will sie heilen und sie leiten und ihnen wieder Trost geben; und denen, die da Leid tragen, will ich Frucht der Lippen schaffen. Friede, Friede denen, die in der Ferne und denen in der Nähe, spricht der Herr; ich will sie heilen‹ (Jes. 57, 14-19).
Gott wird nicht müde, uns Menschen auf allen Wegen der Verirrungen und des Ungehorsams zu suchen. Das ist aber nicht selbstverständlich, sondern Gnade und Barmherzigkeit. Gottes Grundgesinnung ist stets erbarmende Liebe, die nicht anders kann, als zu warnen und zu mahnen und dem demütigen Menschen von Herzen zu vergeben.