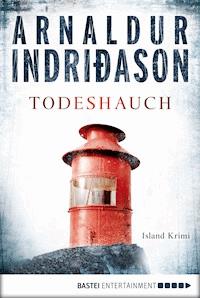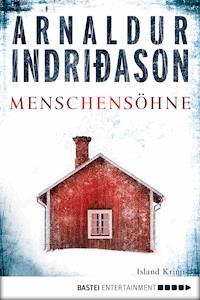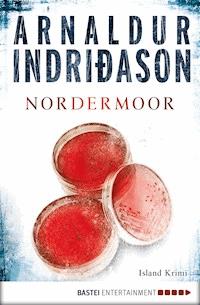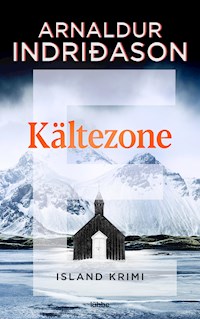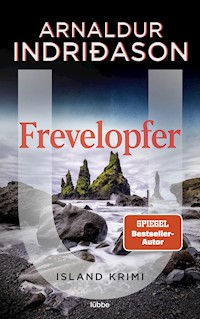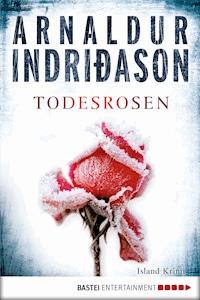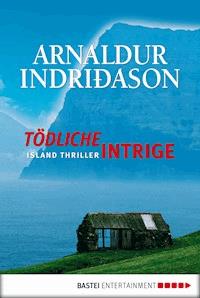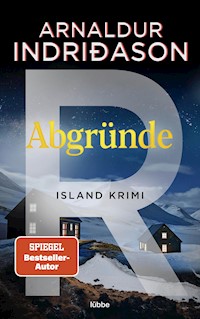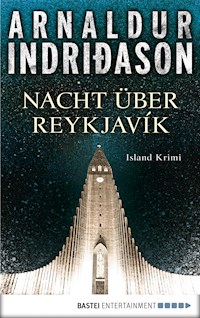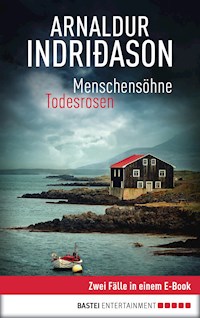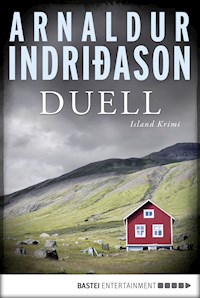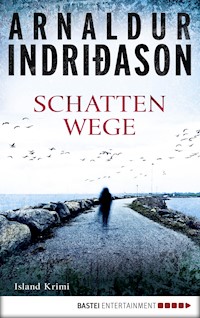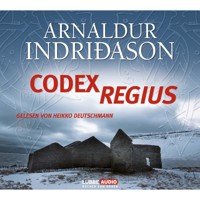
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Lübbe Audio
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Sprache: Deutsch
Kopenhagen in den 50er-Jahren: Die Begegnung mit seinem Professor stellt Valdemars bisher beschauliches Leben völlig auf den Kopf. Der junge Isländer war nach Dänemark gereist, um hier über die alten Pergamenthandschriften zu forschen. Er kommt dunklen Geheimnissen auf die Spur und macht sich zusammen mit dem Professor auf die Suche nach verloren gegangenen Manuskripten. Ihre Jagd führt die beiden durch halb Europa und nicht selten geraten sie dabei in große Gefahr - denn für diese wertvollen Kulturschätze sind andere bereit, über Leichen zu gehen ...
Das Hörbuch können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Zeit:4 Std. 41 min
Veröffentlichungsjahr: 2011
Ähnliche
Inhalt
Cover
Über den Autor
Titel
Impressum
Vorbemerkung
Widmung
Zitat
1863
1955
Eins
Zwei
Drei
Vier
Fünf
Sechs
Sieben
Acht
Neun
Zehn
Elf
Zwölf
Dreizehn
Vierzehn
Fünfzehn
Sechzehn
Siebzehn
Achtzehn
Neunzehn
Zwanzig
Einundzwanzig
Zweiundzwanzig
Dreiundzwanzig
Vierundzwanzig
Fünfundzwanzig
Sechsundzwanzig
Siebenundzwanzig
1971
Isländische Handschriften
Über den Autor
Arnaldur Indriðason, Jahrgang 1961, war Journalist und Filmkritiker bei Islands größter Tageszeitung. Er ist heute der erfolgreichste Krimiautor Islands. Seine Romane werden in mehr als zwanzig Sprachen übersetzt und sind mit international renommierten Krimipreisen ausgezeichnet worden − mit dem Gold Dagger Award, zweimal mit dem Nordischen Krimipreis (Glasnyckel), dem Grand prix de littérature policière, Prix du polar européen, dem Blóðdropinn u.v.a. Mit Arnaldur Indriðason hat Island einen prominenten Platz auf der europäischen Krimilandkarte eingenommen.
Arnaldur Indriðason lebt mit seiner Familie in Reykjavík.
Arnaldur Indriðason
CODEX REGIUS
Thriller
Aus dem Isländischen vonColetta Bürling
BASTEI ENTERTAINMENT
Vollständige E-Book-Ausgabe
des in der Bastei Lübbe AG erschienenen Werkes
Bastei Entertainment in der Bastei Lübbe AG
Titel der isländischen Originalausgabe: „Konungsbók“
Originalverlag: Forlagid, Reykjavík
Published by arrangement with Forlagið, www.forlagid.is
Für die deutschsprachige Ausgabe:
Copyright © 2008 by Bastei Lübbe AG, Köln
Titelillustration: © Atli Mar/getty-images
Umschlaggestaltung: Gisela Kullowatz
E-Book-Produktion: le-tex publishing services GmbH, Leipzig
ISBN 978-3-8387-1257-4
www.bastei-entertainment.de
www.lesejury.de
Vorbemerkung:
In Island duzt heutzutage jeder jeden. Man redet sich nur mit dem Vornamen an. Dies wurde bei der Übersetzung beibehalten.
Namen, Personen und Begebenheiten in diesem Roman sind frei erfunden. Ähnlichkeiten mit lebenden oder verstorbenen Personen sind nicht beabsichtigt und rein zufällig.
Zum Gedenken an meinen VaterIndriði G. Þorsteinsson
Da lachte Högni,als zum Herzen sie schnittendem kühnen Kämpfer,ihm fiel nicht ein zu klagen.Blutig auf einer Schalebrachten sie es Gunnar.
Aus dem Atli-Lied
1863
Der alte Bauer hörte durch das Toben des Unwetters hindurch ein dumpfes Geräusch und wusste, dass er auf den Sarg gestoßen war. Er stützte sich auf seinen Spaten und schaute zu dem Reisenden hoch, der am Rand des Grabes stand und ihn beobachtete. Der Mann schien plötzlich sehr erregt zu sein und befahl ihm, sich zu beeilen. Der Bauer setzte den Spaten wieder an und grub weiter – was schwierig war, denn das Regenwasser strömte unentwegt in das Grab, und er fand nur mit Mühe ein wenig Halt für seine Füße. Das Erdreich war steinig und schwer und das ausgehobene Loch eng. Der Bauer war nass bis auf die Haut, er fror und konnte kaum etwas sehen. Der Mann am Rand hielt eine kleine Laterne in der Hand, deren schwaches Licht unruhig über das Grab zuckte. Gegen Abend war eine dicke Wolkenwand näher gerückt, das Wetter hatte sich zusehends verschlechtert. Und jetzt stürmte es und goss wie aus Kübeln.
»Siehst du etwas?«, rief der Mann ihm zu.
»Noch nicht«, rief der Bauer zurück.
Sie hatten ein Grab auf dem Friedhof entweiht, aber der Bauer zerbrach sich deswegen nicht den Kopf. Er würde das schon wieder in Ordnung bringen, und von der Existenz dieses Friedhofs wussten sowieso nur wenige. Er wurde zwar in alten Schriften erwähnt, aber es war schon lange niemand mehr darauf bestattet worden. Der Reisende schien sich aber auszukennen und auch einiges über diejenigen zu wissen, die dort begraben lagen. Er weigerte sich jedoch, einen Grund dafür anzugeben, weshalb er das Grab öffnen wollte.
Dies geschah zu Beginn des Winters, wo man mit schlimmen Unwettern rechnen musste. Der Mann war wenige Tage zuvor ganz allein zum Hof hinaufgeritten gekommen und hatte um eine Unterkunft gebeten. Außer seinem guten Reitpferd hatte er noch zwei Tragpferde dabei. Gleich am ersten Tag war er zum alten Friedhof gegangen und hatte sich darangemacht, ihn zu vermessen. Er schien eine Beschreibung dabeizuhaben, wie der Friedhof früher ausgesehen hatte, und schritt ihn von einer imaginären Ecke aus ab, änderte dann die Richtung, ging nach Norden und anschließend nach Westen; er legte sich sogar ins Gras und hielt das Ohr an den Boden, als wolle er den Verblichenen lauschen.
Der Bauer selbst hatte keine Ahnung, wer da auf dem Friedhof ruhte. Er war vor vierzig Jahren mit seiner Frau, einer Magd und einem Knecht auf dieses abgeschiedene und schwer zu bewirtschaftende Anwesen gezogen. Seine Frau war vor fünfzehn Jahren gestorben. Kinder hatten sie keine gehabt, und das Gesinde war schon lange fort. Mit der Zeit war der Grund und Boden mit allen Rechten und Pflichten in ihren Besitz übergegangen. All das erzählte er dem Ankömmling. Der Hof hieß Hallsteinsstaðir und war der letzte bewohnte Hof auf dem Weg zum hochgelegenen Heideland; hierhin verschlug es nicht viele Gäste. Die Winter waren schneereich, und dann traute sich niemand hier hinauf. Der alte Mann schien Angst vor dem Winter zu haben. Er gab dem Ankömmling zu verstehen, dass er mit dem Gedanken spielte, diese Kötterwirtschaft dranzugeben und sich bei einem der Kinder seines Bruders aufs Altenteil zu setzen. Darüber sei bereits gesprochen worden. Er konnte die Schafe mitnehmen, um sich erkenntlich zu zeigen. Almosen wollte er nicht.
Wenn sie abends nach dem Essen in der Wohnstube saßen, lauschte der Gast dem Bauern geduldig, wenn der seine Geschichten erzählte. Bevor er sich am ersten Abend hinlegte, fragte er den Bauern, ob er Bücher besäße. Die waren jedoch kaum der Rede wert, er hatte einen alten Psalter, sonst fast nichts. Als der Mann sich weiter erkundigte, ob er etwas von Büchern verstehe, zuckte der Bauer nur mit den Schultern. Das Essen, das er dem Mann vorsetzte, war wohl sehr armselig für einen solchen Gast; morgens gab es einen Brei aus angerührtem isländischem Quark mit Flechten, abends einen Eintopf mit kleinen Fleischbrocken darin. Bestimmt hatte er in den Städten dieser Welt Besseres gegessen, dieser Mann, der behauptete, in Köln gewesen zu sein, wo man wieder am Dom baute.
Der Bauer fand, dass dieser Gast sich wie ein Mann von Welt gebärdete. Er war nach Art reicher Leute gekleidet, davon zeugten die silbernen Knöpfe und die Lederstiefel. Der Bauer wiederum war noch nie in seinem Leben gereist. Er hatte keine Ahnung, weshalb der alte Friedhof für jemanden, der von weit her kam, eine solche Bedeutung hatte. Er sah aus wie jeder andere vergessene Friedhof in Island, denn er bestand nur aus ein paar länglichen Grashügeln unterhalb eines Hangs. Der Gast erinnerte den Bauern daran, dass Hallsteinsstaðir früher ein Hof im Besitz der Kirche gewesen war. Ach ja, doch, natürlich erinnerte er sich an die Geschichte von der kleinen Kirche. Die war schon ziemlich baufällig gewesen, und dann brannte sie eines Tages nieder. Es hieß, dass das Feuer wegen einer Unachtsamkeit ausgebrochen war. Damals waren aber schon lange keine Gottesdienste mehr dort abgehalten worden, höchstens einmal im Jahr gab es einen, falls der versoffene Pfaffe in Melstaður sich dazu aufraffen konnte. In dieser Art redete der Bauer über dieses und jenes, jetzt, da er ja – was sonst selten der Fall war – einen Gast hatte. Manchmal kam den ganzen Winter über niemand. Der Ankömmling selbst war überaus wortkarg, was sein Vorhaben auf dem Friedhof und die Abmessungen betraf. Aus der Gegend stammte er angeblich nicht und hatte auch keine Verwandten in diesem Bezirk. Geboren in Island, sagte er, Jurastudium in Kopenhagen. Er hatte jahrelang dort und auch in Deutschland gelebt. Man hörte es an seiner Sprache. Er hatte einen seltsamen Tonfall, der ihn in den Augen des Bauern manchmal ein bisschen affektiert wirken ließ.
Der Mann hatte zwei große Reisekoffer dabei, in denen sich schön eingebundene Bücher und Kleidung befanden, außerdem Branntwein, Kaffee – und Tabak, den er dem Bauern schenkte. Er hatte noch anderen Proviant dabei, den er mit dem Bauern teilte, getrockneten Fisch, geräuchertes Lammfleisch und Aufstrich. Von den Büchern schien ihm am meisten eine Art Tagebuch am Herzen zu liegen, in das er sich immer wieder vertiefte. Dabei murmelte er leise vor sich hin, ohne dass der Bauer etwas verstehen konnte. Anschließend begab er sich meist auf den Friedhof. Der zutrauliche Hund des Bauern mit dem geringelten Schwanz gewöhnte sich an den Gast, der ihm hin und wieder ein Stück geräuchertes Lammfleisch oder Fischhaut zuwarf und ihn streichelte.
Manchmal hatte der Bauer Mühe, ein Gespräch mit dem Reisenden anzuknüpfen. Er spürte, dass dieser Mann nicht zum Zeitvertreib nach Hallsteinsstaðir gekommen war.
»Reden sie immer noch über den Blitz?«, fragte der Bauer. »Davon weiß ich nichts …«
»Drei Menschen wurden vom Blitz erschlagen«, sagte der Bauer. »Das war auf der Halbinsel Reykjanes, wie ich gehört habe. Ein Jahr ist das jetzt her.«
»Ich weiß nichts über einen Blitz«, entgegnete der Mann. »Ich bin erst im Mai mit dem Schiff nach Island gekommen.«
So vergingen drei Tage. Zum Schluss hatte es den Anschein, als sei der Gast zu einem Ergebnis gekommen. Tief in Gedanken versunken stand er bei einem dieser Grabhügel unter dem Hang und blickte auf, als der Bauer sich ihm näherte. Es wurde schon dunkel. Der Wind war stärker geworden, und es hatte angefangen zu regnen. Er beobachtete die Wolken. Wahrscheinlich würde es in der Nacht ein schlimmes Unwetter geben, der Himmel im Westen sah ganz danach aus.
Der Bauer hatte sich zu dem Gast auf dem Friedhof begeben, um mit ihm über das heraufziehende Unwetter zu sprechen. Er wusste nur zu genau, was zu erwarten war, wenn um diese Jahreszeit der Wind auf West drehte. Aber bevor er dies zur Sprache bringen konnte, hatte der Mann schon ein Anliegen vorgebracht, auf das sich der Bauer keinen Reim machen konnte.
»Könntest du hier für mich graben?«, fragte der Gast und deutete auf den Grashügel.
»Wieso das denn?«, fragte der Bauer, und seine Augen wanderten von dem Mann zu der niedrigen Erhebung.
»Ich muss hier graben«, sagte der Mann. »Ich bezahle dafür. Zwei Reichstaler dürften genug sein.«
»Wollen Sie das Grab hier ausheben?«, fragte der Bauer mit weit aufgerissenen Augen. Noch nie hatte er etwas dergleichen gehört. »Warum, wenn ich mir die Frage erlauben darf?«
»Es geht um Altertümer«, erklärte der Mann, zog zwei Reichstaler aus seiner Tasche hervor und reichte sie dem Mann. »Das ist mehr als ausreichend.«
Der Bauer starrte auf das Geld in seiner Hand. Es war lange her, seit er solche Münzen aus der Nähe gesehen hatte. Er brauchte eine ganze Weile, bis er im Kopf nachgerechnet hatte, dass die Bezahlung für diese Gefälligkeit dem Monatslohn eines guten Knechts entsprach.
»Altertümer?«, fragte der Bauer.
»Ich kann es auch selbst erledigen«, sagte der Mann und streckte seine Hand nach dem Geld aus.
»Sie brauchen aber meine Genehmigung, wenn Sie hier auf meinem Land graben wollen«, sagte der Bauer beleidigt und hielt die Taler fest umklammert.
Das Benehmen des Mannes hatte sich geändert. Bislang war er zwar wenig gesprächig, aber immer höflich und sogar liebenswürdig gewesen, hatte sich nach diesem oder jenem erkundigt, nach alten Verbindungswegen über die Berge, nach Verwandten und Besuchern, nach dem Wetter und nach der Anzahl der Tiere, die zum Hof gehörten. Nun hatte er einen völlig anderen Ton angeschlagen, er klang ungeduldig, sogar anmaßend.
»Es ist völlig überflüssig, so viel Aufhebens zu machen«, sagte der Mann.
»Aufhebens machen?«, fragte der Bauer. »Ich kann natürlich hier graben, wenn Sie es wünschen. Ich kann mich aber nicht an irgendwelche Altertümer erinnern. Wissen Sie denn, was für ein Grab das ist?«
Der Mann starrte den Bauern an. Dann wanderten seine Blicke zum schwer verhangenen Himmel im Westen, von wo sich das Unwetter näherte, und seine Miene wurde hart und entschlossen. Der Mann war groß und muskulös, und das schwarze Haar reichte ihm bis auf die Schultern. Unter der hohen Stirn, die ihn wie einen Gelehrten aussehen ließ, lagen die braunen Augen in tiefen Höhlen, sein Blick war unstet und forschend. Der Ring, den er trug, hatte gleich am ersten Abend die Aufmerksamkeit des Bauern auf sich gezogen, ein schwerer Siegelring mit einem seltsamen Symbol.
»Nein«, sagte er, »deswegen muss ich ja graben. Wirst du das übernehmen? Mir pressiert es.«
Der Bauer sah den Mann an, dann die beiden Reichstaler. »Ich hole die Gerätschaften«, sagte er dann und steckte die Münzen in die Tasche.
»Beeil dich!«, rief der Mann ihm nach. »Das Wetter gefällt mir nicht.«
Jetzt stand er oben am Rand des Grabes und spornte den Bauern an weiterzugraben. Das Wetter verschlimmerte sich zusehends. Der Sturm heulte, und der Regen prasselte auf sie herunter. Der Bauer schlug vor, am nächsten Tag weiterzumachen, in der Hoffnung, dass sich das Wetter bis dahin bessern würde und sie bei Tageslicht arbeiten konnten. Aber davon wollte der Mann nichts wissen. Er musste sein Schiff erreichen. Er war seltsam erregt und redete mit sich selbst über etwas, was der Bauer nicht verstand. Dauernd erkundigte er sich, ob der Bauer schon etwas sähe, ein Skelett oder irgendwelche anderen Gegenstände da unten im Grab.
Dem Mann ging es ganz offensichtlich um solche Gegenstände. Er wollte dem Bauern jedoch nichts Genaueres sagen. Ob es sich beispielsweise um einen oder mehrere Gegenstände handelte oder wieso er von ihrer Existenz auf diesem alten Friedhof wusste, auf dem seit mehr als hundert, wenn nicht zweihundert Jahren niemand mehr beerdigt worden war.
»Siehst du da etwas?«, rief er wieder durch das Toben des Unwetters.
»Ich kann überhaupt nichts erkennen«, rief der Bauer zurück. »Kommen Sie doch etwas näher mit dem Licht.«
Der Mann trat ganz bis an den Rand des Grabes und leuchtete mit der Laterne hinunter zu dem Bauern. Unten sah er Überreste des Sargs, der durch den Spaten beschädigt worden war, Holzstücke lagen verstreut herum. Etwas, das wie ein Stück Stoff aussah, war zu sehen, und er überlegte, ob die Leiche möglicherweise in ein Leinentuch gewickelt worden war. Dem Bauern hatte das Graben zugesetzt, und er schaufelte jetzt langsamer. Jedes Mal, wenn er den Spaten zum Grabesrand hob, war weniger Erde darauf.
»Was ist das da?«, rief der Mann und deutete auf eine Stelle vor ihm. »Grab dort!«
Der Bauer stöhnte.
»Komm raus!«, befahl der Mann. »Ich werde weitermachen. Komm hoch!«
Er reichte dem Bauern seine Hand, der froh war, sich ausruhen zu können. Der Mann zog ihn aus dem Grab und übergab ihm die Laterne. Dann kletterte er selbst in das Loch hinunter, warf die Holzplanken des Sargs nach oben und fing an, wie besessen zu schaufeln. Bald stieß er auf Knochen. Der Mann legte den Spaten zur Seite und grub mit den Händen weiter. Rippen- und Handknochen kamen in der Erde zum Vorschein, und schließlich konnte der Bauer auch einen Schädel erkennen. Ein Schauder überlief ihn, als er die leeren Augenhöhlen und das Nasenloch sah, aber keine Zähne.
»Wer liegt dort?«, rief er. »Wem gehört dieses Grab?«
Der Mann tat, als höre er ihn nicht.
»Ist das wirklich ratsam?«, flüsterte der Bauer. »Wir wollen doch keine Gespenster aufwecken! Die Toten müssen in Frieden ruhen dürfen!«
Der Mann beachtete ihn nicht, sondern fuhr fort, mit den Händen die Erde von den Knochen wegzukratzen. Der Regen, der immer heftiger auf sie niederprasselte, hatte das Grab in ein einziges Morastloch verwandelt. Plötzlich stieß er auf einen Widerstand. Er tastete sich vorsichtig vor und stieß einen leisen Schrei aus, als er sah, was es war. Er hatte einen Behälter aus Blei gefunden.
»Kann es denn wirklich wahr sein«, stöhnte er, und es hatte ganz den Anschein, als hätte er Ort und Zeit um sich herum vergessen. Er säuberte den zylindrischen Behälter und hielt ihn unter das Licht der Laterne.
»Haben Sie etwas gefunden?«, rief der Bauer.
Der Mann legte den Behälter auf dem Rand des Grabes ab und kletterte heraus. Die beiden Männer hatten sich von Kopf bis Fuß mit Erde besudelt und waren völlig durchnässt. Dem Gast schien das nichts auszumachen, aber der alte Bauer, der sich mit der Laterne in der Hand kaum bewegt hatte, fing an zu zittern. Sein fast zahnloser Mund wurde von einem weißen Bart umrahmt, unter der Mütze verbarg sich eine Glatze. Seine gebückte Haltung ließ auf ein beschwerliches Leben schließen. Er hatte dem Gast erklärt, dass er sich eigentlich darauf freute, bei seinen Neffen unterzukommen.
Der Mann hob den Bleibehälter auf und wischte die Erde von ihm ab.
»Lass uns ins Haus gehen«, sagte er und setzte sich in Bewegung.
»Das wird guttun«, sagte der Bauer und folgte dem Mann. Als sie im Haus waren, ging der Bauer sofort zur offenen Feuerstelle in der Küche und legte Holz nach. Der Ankömmling setzte sich mit dem Behälter hin, und nach einigen Anstrengungen gelang es ihm, ihn zu öffnen. Er fischte den Inhalt mit dem Zeigefinger heraus, betrachtete ihn eingehend und schien zufrieden zu sein mit dem, was er gefunden hatte.
»Die Leute im Tal werden staunen, wenn sie das hören«, sagte der Bauer und starrte auf den Inhalt.
Der Mann blickte hoch. »Was hast du gesagt?«
»Das ist der seltsamste Besuch, den ich je bekommen habe!«, erklärte der Bauer.
Der Mann stand auf. Die beiden standen einander in der kleinen Wohnstube gegenüber, und der Mann schien einen Augenblick zu überlegen. Der Bauer starrte ihn an und sah das regennasse, glänzende Gesicht und die braunen Augen unter der Hutkrempe, und plötzlich fiel ihm wieder die Geschichte ein, die ihm beim letzten Besuch im Handelsort zu Ohren gekommen war, über den Blitz, der die Männer auf der Halbinsel Reykjanes getroffen und auf der Stelle erschlagen hatte.
Nach der Schneeschmelze im folgenden Frühjahr drängte der Neffe des Bauern darauf, bei seinem Onkel nach dem Rechten zu sehen. Sie trafen niemanden an, der Bauer war nicht anwesend und schien auch den ganzen Winter über nicht auf seinem Hof gewesen zu sein. Es war lange kein Feuer gemacht worden, und auch einiges andere deutete darauf hin, dass monatelang niemand auf dem Hof gewesen war. Die Küche war ordentlich verlassen worden, alles stand an seinem Platz. Die Schlafplätze in der Wohnstube waren hergerichtet, und die Haustür war sorgfältig verschlossen worden. Der Hund des Bauern war nirgends zu finden, und auch im Tal war er nicht aufgetaucht. Beim Schafabtrieb im folgenden Herbst fand man seine Schafe, sie hatten den ganzen Winter und den Sommer im Freien verbracht.
Die Nachricht darüber, dass der Bauer verschwunden war und wie es auf dem Hof ausgesehen hatte, erregte einiges Aufsehen in der Gegend. Niemand wusste etwas über seinen Verbleib, er hatte sich auf keinem der Nachbarhöfe blicken lassen. Mit der Zeit glaubten die Leute, dass er während des Winters mit seinem Hund losgezogen war, vermutlich um die Weihnachtszeit, und wahrscheinlich in einem Unwetter den Tod gefunden hatte.
Als in dem Frühjahr eine Suche nach ihm durchgeführt wurde, fand man nicht die geringste Spur. Auch später tauchten keinerlei Überreste von dem Bauern und seinem Hund auf. Diejenigen, die nach Hallsteinsstaðir kamen, um die armseligen Hinterlassenschaften des Bauern unter sich aufzuteilen, nachdem kein Zweifel mehr bestand, dass er nicht mehr am Leben war, bemerkten die aufgewühlte Erde unweit des Hofes und gingen davon aus, dass der Bauer vor seinem Verschwinden damit begonnen hatte, die Grashügel in der Wiese unterhalb des Hangs einzuebnen.
1955
Eins
Ich hatte nicht die geringste Ahnung, dass mein Entschluss, Mitte der fünfziger Jahre das Studium der Nordischen Philologie an der Universität in Kopenhagen fortzusetzen, mich in derartige Abenteuer verstricken könnte. Am besten verrate ich gleich, dass mir in jenen Jahren kaum der Sinn nach Abenteuern stand, an denen ich selbst in irgendeiner Form beteiligt wäre; ich zog es vor, in Büchern über dergleichen zu lesen. Mein bisheriges Leben war ausgesprochen ruhig und friedlich verlaufen – bevor ich dem Professor begegnete. Entsprechend sah ich damals einer beschaulichen Zeit innerhalb von Bibliothekswänden entgegen. Man könnte sogar sagen, dass ich eine Art Geborgenheit zwischen all dem Alten und Vergangenen suchte. Ich machte mir Hoffnungen, dass es mir mit der Zeit gelingen würde, meinen Teil dazu beizutragen, die Kenntnis und das Wissen über unser kostbares nationales Erbe zu mehren. Das war mein zugegebenermaßen etwas romantisches Lebensziel. Seit jeher hatte ich eine Vorliebe dafür, in alten Büchern herumzustöbern, und nahm mir bereits in jungen Jahren vor, mein Leben in den Dienst der Forschung an mittelalterlichen isländischen Handschriften und ihrer Erhaltung zu stellen.
Aber sehr bald nachdem ich den Professor in Kopenhagen kennengelernt hatte, nahm vieles einen so ganz anderen Lauf als geplant. Meine Vorstellungen von der Welt änderten sich ebenso wie mein Selbstwertgefühl. Der Professor sorgte dafür, dass sich mein Weltbild rapider und gründlicher erweiterte, als ich es mir jemals hätte träumen lassen. Er stellte mein Leben auf den Kopf. Von ihm habe ich gelernt, dass nichts unmöglich ist.
Das alles brach unvermittelt über einen naiven jungen Mann von der Insel im hohen Norden herein. Im Nachhinein kommt es mir jedoch so vor, als hätte ich es auch gar nicht anders haben wollen.
In meinem Reisegepäck befand sich ein Empfehlungsschreiben eines Mentors von der Universität Islands. Dieser freundliche und überaus beschlagene Mann war drei Jahre lang mein Lehrer gewesen. Er hatte mich in die faszinierende Welt der Nordistik eingeführt, und man kann sagen, dass seine Ermutigung einer der Gründe für meinen Entschluss gewesen war, mich voll und ganz der Erforschung der isländischen Mittelalterliteratur zu widmen. Dr. Sigursveinn hatte einen sehr liebenswürdigen Empfehlungsbrief an den Professor in Kopenhagen geschrieben, den er persönlich kannte. Dieses Schreiben hütete ich auf der Überfahrt nach Dänemark wie meinen Augapfel. Ich kannte den Inhalt: Darin hieß es von mir, ich sei ein außerordentlich befähigter Student, der das Studium mit den besten Noten des Jahrgangs absolviert hatte und das Zeug dazu hatte zu promovieren. Ich war sehr stolz darauf und freute mich, es dem Professor in Kopenhagen aushändigen zu können. Ich fand, dass ich das Lob verdient hatte. In meiner Abschlussarbeit über die Eyrbyggja saga hatte ich neue Theorien über die Verbindung zwischen den einzelnen Fassungen der Saga aufgestellt, über die Datierung und den mutmaßlichen Autor. Ich konnte gute Gründe dafür anführen, dass kein Geringerer als Sturla Þórðarson der Verfasser war.
In meiner Jugend bin ich wahrscheinlich das gewesen, was man einen Bücherwurm nennt. Das Wort hat mir zwar nie gefallen, aber es fällt mir kein besseres ein, das mich als jungen Menschen beschreiben könnte. Zu Hause bei meiner liebenswerten Tante war ich ständig in irgendeine Lektüre vertieft; ich hatte nur wenige Freunde und verstand mich nicht auf die komplizierte Kunst, Freundschaften zu schließen. Doch für Bücher und Lesen interessierte ich mich seit meiner frühesten Kindheit. Das wurde von meiner Tante, Gott hab sie selig, sehr unterstützt, indem sie alle möglichen wichtigen Werke der Weltliteratur für mich beschaffte. Sie war es auch, die mich mit den isländischen Sagas vertraut machte, was dazu führte, dass ich eine ganz besondere Vorliebe entwickelte für diese großartigen Erzählungen von Helden, von Rache, Liebe, Ruhm und Ehre, von untadeligen Männern und bedeutenden Frauen, von hochspannenden Kämpfen und so heldenhaftem Sterben, dass mir beim Lesen die Tränen kamen.
Ich wuchs die meiste Zeit bei der Schwester meiner Mutter auf, die ich entweder Systa nannte, genau wie meine Mutter, oder einfach Tante, was ich eigentlich viel lieber mochte und sie auch. Sie war unverheiratet und kinderlos und war mir wie eine Mutter. Manchmal machte sie sich Sorgen darüber, dass ich so viel daheimsaß und diese großartigen Sagas von alten Helden verschlang, während sich die gleichaltrigen Kinder in den Westfjorden draußen trafen, mit Holzschwertern fochten oder Fußball oder Verstecken spielten. Später, als die Jungen in meinem Alter sich für Mädchen und Alkohol zu interessieren begannen, hatte ich bereits angefangen, alte Handschriften zu entziffern. Statt der üblichen vier Jahre Gymnasium bis zum Abitur brauchte ich nur drei, und ich war der beste Schüler auf dem sprachlichen Zweig; Latein wurde so etwas wie meine zweite Muttersprache. Ich immatrikulierte mich im folgenden Herbst an der Universität am Institut für isländische Philologie und lernte dort Dr. Sigursveinn kennen, mit dem mich schon bald aufgrund des gemeinsamen Interesses für unser isländisches Kulturerbe so etwas wie Freundschaft verband. Viele Stunden verbrachte ich bei ihm zu Hause mit intensiven Diskussionen über unser beider Lieblingsthema, die alten Handschriften. Meine Tante wollte unbedingt, dass ich in Kopenhagen weiterstudierte, und wir beschlossen im Grunde genommen gemeinsam, dass ich ins Ausland gehen sollte. Dr. Sigursveinn unterstützte das voll und ganz und ließ mich wissen, dass ich seiner Meinung nach früher oder später einen Lehrstuhl an der isländischen Universität erhalten würde. Am Tag meiner Abreise überreichte er mir das Empfehlungsschreiben. Er las es mir vor, bevor er den Umschlag verschloss, und erklärte, dass nichts als die lautere Wahrheit darin stünde, und mich durchströmten dankbare und ergebene Gefühle.
Eine Flugreise hätte ich mir nicht leisten können, aber ich bekam eine billige Passage mit einem unserer Frachtschiffe, das nach Kopenhagen fuhr. Dort traf ich Anfang September an einem schönen, sonnigen Morgen ein. Die Reise war sehr angenehm verlaufen, vor allem, nachdem mir etwas klar geworden war, wovon ich bis dato nichts gewusst hatte, nämlich dass ich überhaupt nicht unter Seekrankheit litt. Die Überfahrt war zudem ziemlich ruhig, wurde mir gesagt, und dieses leichte Schlingern in Kombination mit dieser Mischung aus Meeresluft und dem Geruch aus dem Maschinenraum bekam mir gut und bewirkte, dass ich jede einzelne Minute genoss.
Mit an Bord war ein junger Mann, der auf mich einen guten Eindruck machte. Er hatte vor, in Kopenhagen Ingenieurwissenschaften zu studieren. Sein Name war Óskar, er stammte aus Nordisland, und wir lernten uns im Laufe der Seereise ziemlich gut kennen. Wir teilten uns eine Kabine, und wenn wir abends im Bett lagen, unterhielten wir uns noch eine Weile. Ich erzählte ihm von meinem bisherigen Studium am Institut für isländische Philologie, und er schilderte mir die komischen Käuze aus seinem Dorf. Er war ein amüsanter Reisebegleiter, nahm das Leben nicht allzu ernst und hatte Sinn für Humor. Allerdings sprach er für sein Alter dem Alkohol etwas reichlich zu; er fand schnell heraus, wie man auf diesem Schiff an dänisches Bier herankommen konnte, und führte sich dies dann auch abends ausgiebig zu Gemüte. Andere Passagiere waren nicht an Bord.
»Und was ist mit dir?«, fragte er eines Abends mit einer Flasche Carlsberg Hof in der Hand, »willst du wirklich für den Rest deines Lebens in alten Handschriften herumschnüffeln?«
»Falls sich die Möglichkeit bietet, ja«, entgegnete ich.
»Was ist so interessant daran?«
»Was ist interessant daran, Ingenieur zu sein?«, fragte ich zurück.
»Die Kraftwerke, Mensch«, antwortete er. »Wir werden riesengroße Staudämme im Hochland bauen, um unsere Stromversorgung zu sichern, und zwar nicht nur für die Privathaushalte, sondern auch für die Schwerindustrie. Da werden grandiose Fabriken entstehen. Hast du nicht von den Möglichkeiten gehört, die die Aluminiumherstellung bietet?«
Ich schüttelte den Kopf.
»Wir verfügen über die billigste Energiequelle der Welt. Wir bauen Staudämme im Hochland und lassen Stauseen entstehen, und damit erzeugen wir Strom für die Fabriken, die überall aus dem Boden schießen werden. Elektrizität macht uns reich. Einar Benediktsson hat das ganz genau erkannt.«
»Willst du überall auf dem Land Fabriken errichten?«
»Was sonst? Das ist die Zukunft.«
»Und wer wird diese Fabriken besitzen?«
»Das weiß ich nicht, wahrscheinlich die Amerikaner. Die sind die Größten in Sachen Aluminium. Es spielt aber auch gar keine Rolle. Wir bauen die Staudämme und verkaufen ihnen den Strom. Meinethalben können sie sich daran dumm und dusselig verdienen.«
»Aber wird nicht mit all diesen Staudämmen das Hochland zerstört?«
»Das Hochland? Was meinst du damit? Wen interessiert schon das Hochland? Und was gibt‘s da überhaupt zu zerstören? Da ist doch nichts außer Steinen und Geröll.«
»Weideland für die Schafe.«
»Wer interessiert sich schon für Schafe?«
»Ich kümmere mich mehr um die Vergangenheit«, gab ich zu.
»Darin bist du bestimmt gut«, erklärte Óskar und trank einen ordentlichen Schluck aus der Flasche.
Ich war voll gespannter Erwartung, als das Schiff zwei Tage später am Asiatisk Plads in der Nähe der Strandgade anlegte. Ich sah dort unseren wunderschönen Passagierdampfer Gullfoss aus dem Hafen auslaufen. Ich erinnere mich, dass ich mir vorstellte, wie die Passagiere der ersten Klasse in eleganter Garderobe an Deck standen, die Männer mit Zigarren und die Frauen in langen Kleidern, und in die Abendstille hinein drangen die Klänge des Klaviers aus dem Rauchsalon. Ich hätte mir eine Passage mit diesem Luxusschiff niemals leisten können, noch nicht einmal in der dritten Klasse. Meine liebe Tante schuftete sich krumm, um mir das Studium zu ermöglichen, sie arbeitete vormittags bei der Post und nachmittags und abends in der Fischfabrik. Ich hatte während der Semesterferien im Sommer in den Westfjorden immer in einer Bücherei gearbeitet, mich aber ansonsten voll auf das Studium konzentriert. Nach dem Abitur erhielt ich wegen meiner guten Leistungen dann ein Stipendium, das mir das Studium erleichterte.
Ich weiß nicht, wie ich die Empfindungen beschreiben soll, die ich damals als unerfahrener junger Mensch hatte, als ich zum ersten Mal in eine ausländische Hauptstadt kam, und noch dazu in eine so prachtvolle und liebenswerte wie Kopenhagen, die jahrhundertelang die kulturelle Hauptstadt Islands gewesen war. Das Reisen war ich nicht gewöhnt, denn ich war jung und stammte aus keiner wohlhabenden Familie. Auslandsreisen waren ein Luxus, den sich nicht jeder leisten konnte. Ich hatte mich den ganzen Sommer darauf gefreut, und ich kann mich noch ganz genau an die erwartungsvolle Spannung erinnern, die sich meiner bemächtigte, als ich von Bord ging und meine Füße den Boden der Stadt am Sund betraten. Vor den Augen eines Hinterwäldlers breitete sie sich mit ihren mächtigen Bauten aus, mit alten historischen Gebäuden, mit Restaurants und Kneipen, breiten Alleen und engen Gassen, die mir aus den Berichten von Studenten und Dichtern früherer Zeiten vertraut waren. Ich erinnere mich an den schweren Duft der üppigen Vegetation, an das Rattern der Straßenbahnen und der Kutschwagen, die das Bier zu den Kneipen brachten, an die Limousinen, die an mir vorbeirauschten, an die Menschenmenge und den Verkehr auf Strøget und bei Kongens Nytorv. Ich hatte das Gefühl, die Stadt in gewissem Sinne zu kennen, als ich dort eintraf, und die Vorstellung, die ich von ihr hatte, passte erstaunlich gut zu dem, was ich an diesem meinem ersten Tag in Kopenhagen sah und erlebte. Sie war mehr als nur eine altehrwürdige europäische Stadt. Für den gebildeten Isländer war sie über viele Jahrhunderte hinweg das Zentrum isländischer Kultur und Bildung. Ich freute mich darauf, sie besser kennenzulernen, vor allem ihre Museen und die historischen Schauplätze, und nicht zuletzt wollte ich auf den Spuren der berühmten Isländer wandeln, die vor langer Zeit hier studiert hatten. Ich genoss den Gedanken an den bevorstehenden Winter.
In erster Linie war ich aber wegen meiner einzigen wahren Leidenschaft nach Kopenhagen gekommen, wegen der isländischen Handschriften aus dem Mittelalter. Zu dieser Zeit wurden unsere kostbarsten Schätze alle in der Königlichen Bibliothek und im Handschrifteninstitut aufbewahrt, das nach Árni Magnússon benannt war; es war damals in der Universitätsbibliothek untergebracht. Dort befanden sich Flateyjarbók, Möðruvallabók, der Codex Regius mit den Eddaliedern, die Njáls saga und viele, viele andere Manuskripte. Es war schon seit langem mein Traum gewesen, diese alten unschätzbar wertvollen Pergamente berühren zu dürfen, die durch die Hände von vielen bedeutenden Männern gegangen waren, durch die von Bischof Brynjólfur Sveinsson, Hallgrímur Pétursson und Árni Magnússon bis hin zu Jónas Hallgrímsson und Jón Sigurðsson, um nur einige zu nennen. In diesen Jahren unternahmen wir große Anstrengungen, um diese Handschriften wieder nach Island zu holen, wo sie nach Ansicht aller redlichen Menschen auch hingehörten, doch die Dänen sträubten sich, uns das Nationalerbe zurückzugeben. Damit wäre unser Kampf um die Unabhängigkeit wirklich zu einem Abschluss gekommen, den man vielleicht als einen späten Triumph über die alte Kolonialmacht auslegen konnte. Der Widerstand in Dänemark war stark, unter anderem argumentierte man damit, dass das britische Empire auch keinen Grund sah, all die Schätze nach Ägypten zurückzuschicken, die dort aus dem heißen Wüstensand ausgegraben worden waren.
Über all das grübelte ich um die Mitte des Jahrhunderts, als junger Student ganz auf mich gestellt, in Kopenhagen. In den neuen Schuhen, die meine Tante mir besorgt hatte, tat ich die ersten Schritte in ein neues Leben und wusste nicht, was mich in der großen, weiten Welt erwartete. Einerseits war ich etwas beklommen, andererseits brannte ich aber darauf, mich in das Studium der Nordischen Philologie zu stürzen. Ein gewisses Selbstvertrauen verlieh mir die Tatsache, dass ich es aus eigener Kraft geschafft hatte, nach Kopenhagen zu kommen: dank meiner Fähigkeiten und dem unlöschbaren Wissensdurst, der wie ein heißes Feuer in mir loderte.
Auf dem Hafenkai verabschiedete ich mich von Óskar und versprach, mit ihm in Verbindung zu bleiben. Mit Hilfe von Dr. Sigursveinn hatte ich ein kleines Mansardenzimmer in der Skt. Pedersstræde gemietet, nicht weit von Jónas Hallgrímssons letzter Wohnung und dem alten Universitätsgelände. Ganz in der Nähe war die Øster Voldgade, wo das Haus von Jón Sigurðsson steht. Und in der Tat galt mein erster Besuch in dieser Stadt seinem Haus; ich saugte alles in mich auf, was ich dort sah. Ich versuchte, mich in die Zeit hineinzuversetzen, als Jón noch in dem Haus gelebt und gewirkt hatte, um für Islands Unabhängigkeit zu kämpfen. Damals war das Haus noch nicht in isländischem Besitz. Ich erklomm die Treppe zum zweiten Stock und atmete den Geist des Hauses ein. Am Abend unternahm ich einen Spaziergang am Kongens Nytorv, trank einen Krug Bier im Skinnbrogen und beobachtete die Menschen auf der Straße. Ich ging früh zu Bett und vertraute meinem Tagebuch an, dass ich nunmehr in Kopenhagen eingetroffen sei und mich darauf freuen würde, spannende wissenschaftliche Aufgaben in Angriff nehmen zu dürfen.
An diesen ersten Tag habe ich wehmütig süße Erinnerungen; alles wirkte so neu und fremd und geheimnisumwoben auf mich. Der Geschmack des Biers im Skinnbrogen. Die Menschenmenge auf Kongens Nytorv. Die Septembersonne auf meinem Gesicht. Die selbstbewussten Mädchen auf ihren schwarzen Fahrrädern.
Am Tag nach meiner Ankunft in der Stadt sollte ich meinen zukünftigen Professor in der Abteilung für Nordische Philologie treffen. Diese Begegnung mit ihm sollte einschneidenden Einfluss auf mein Leben haben. Wenn ich zurückdenke, taucht der Professor immer so vor meinem geistigen Auge auf, wie er war, als ich ihn in meinen ersten Tagen in Kopenhagen kennenlernte.
Nichts hätte mich auf diese Begegnung vorbereiten können.
Zwei
An meinem ersten Morgen in Kopenhagen wachte ich früh auf und ging zu Fuß von meiner Unterkunft in der Skt. Pedersstræde zum Universitätsgelände bei der Vor Frue Kirke. In der Nacht hatte es geregnet, aber jetzt war ein schöner Spätsommertag angebrochen, mit strahlend blauem Himmel und schneeweißen Wolkentürmen im Osten. Die Bäume standen nach einem sonnenreichen Sommer immer noch in vollem Laub. Es war sehr warm – solche Temperaturen hatte ich zu dieser Jahreszeit noch nie erlebt. Hitze vertrug ich schlecht, und ich besaß überhaupt keine Sommerkleidung, sondern nur warme Hosen, lange Unterhosen, Strickpullover und -westen und einen ziemlich abgetragenen Anzug für besondere Gelegenheiten. Meine Tante machte sich Sorgen, dass ich den ganzen Winter frieren würde, und hatte mir ans Herz gelegt, mich immer warm anzuziehen und darauf zu bestehen, dass in meinem Zimmer nicht an der Heizung gespart würde.
Das Büro des Professors lag im ersten Stock eines alten Gebäudes in der Skt. Kannikestræde, nicht weit von der Universitätsbibliothek. Als ich die alte Holztreppe hinaufging, knarrten die Stufen anheimelnd. Kurz darauf klopfte ich wohlerzogen an die Tür, an der sich ein kleines Messingschild mit seinem Namen befand. Er wusste von meinem Kommen. Dieser Termin war schon vor längerer Zeit festgesetzt worden, die Begegnung war eigentlich nur eine Formsache, denn meine Bewerbung um die Aufnahme in die Fakultät war schon längst angenommen worden. Ich klopfte ein weiteres Mal, diesmal etwas fester. Ich warf einen Blick auf die Armbanduhr, die meine Tante mir zum Abschied geschenkt hatte. Es war Punkt neun Uhr; damals gab ich mir alle Mühe, pünktlich zu sein, denn ich hielt das für wichtig.
Ich stand ziemlich verloren auf dem Flur herum, und die Zeit verging. Es war fünf nach neun, dann Viertel nach, und schließlich waren fünfundzwanzig Minuten vergangen, ohne dass der Professor aufgetaucht wäre. Ich kam zu dem Schluss, dass er unsere Verabredung vergessen haben musste, und war halbwegs sauer darüber. Aber nur halbwegs. Wegen des Rufs, in dem der Professor stand, hatte ich nämlich auch etwas Bammel vor dieser Begegnung gehabt. Studenten, die nach Beendigung ihres Studiums nach Island zurückgekehrt waren, hatten Geschichten von ihm erzählt, die keineswegs dazu angetan waren, ihm einen Heiligenschein zu verleihen. Trotzdem hatten sie alle uneingeschränkten Respekt vor dem Professor, das stand außer Zweifel. Soweit ich wusste, verwies er Studenten, die einen schläfrigen oder unkonzentrierten Eindruck machten, einfach aus seinen Seminaren. Es war sehr ratsam, gut vorbereitet zum Unterricht zu erscheinen, denn falls er die geringste Nachlässigkeit bei den Studenten gewahr wurde, konnte es passieren, dass er sich weigerte, sie weiter zu unterrichten. In den Prüfungen ließ er die Leute gnadenlos durchfallen, wenn es ihnen an Auffassungsgabe und Arbeitseifer mangelte, und bei mündlichen Prüfungen legte er es geradezu darauf an, schlecht vorbereitete Studenten aus der Fassung zu bringen und sie zu verunsichern, wie seine ehemaligen Studenten erzählten.
Auf diese Weise siebte er diejenigen aus, die ihm nicht in den Kram passten oder seiner Meinung nach nichts in dieser Wissenschaft verloren hatten. Wenn er aber wirklichen Forscherdrang und Talent zu erkennen glaubte, war er sehr darum bemüht, solche Studenten zu fördern. Sein Gedanke dabei war der, dass nur die Besten das Vorrecht genießen durften, unsere kostbarsten Schätze in den Händen zu halten, die Pergamenthandschriften.
Das alles ging mir durch den Kopf, während ich da auf dem Korridor stand und die Zeit verstrich. Es war jetzt halb zehn. Ich hatte noch einige Male ergebnislos angeklopft und mich mehrmals vergewissert, dass dies der richtige Tag und die richtige Uhrzeit war. Schließlich riskierte ich es, die Klinke herunterzudrücken, aber das Büro war verschlossen.
Ich gab auf, aber just in dem Augenblick, als ich mich umdrehte und den Korridor zurückgehen wollte, kam es mir so vor, als hörte ich ein leises Stöhnen aus dem Büro. Das konnte aber auch eine Täuschung gewesen sein. Ich legte das Ohr an die Tür und lauschte eine Weile, doch nichts geschah.
Ich war also gezwungen, unverrichteter Dinge abzuziehen. Auf dem Korridor kam mir ein Mann entgegen, der offenbar zu seinem Büro wollte, und ich fragte ihn nach dem Professor. Mein Schuldänisch war passabel, doch während der ersten Zeit hatte ich einige Probleme, schnell sprechende Dänen zu verstehen. Der Mann schüttelte den Kopf und erklärte, der Professor sei völlig unberechenbar. Er erkundigte sich, ob ich mit ihm verabredet gewesen sei, und grinste, als ich das bejahte. Er meinte, dass er wahrscheinlich noch gar nicht in seinem Büro erschienen sei. Es hörte sich so an, als sei das nichts Ungewöhnliches.
Ich verbrachte den Morgen damit, mir das Universitätsgelände anzusehen, schlenderte durch die Krystalgade und Fiolstræde mit dem Runden Turm und stand ehrfürchtig vor den Kirchen in der Altstadt: der Trinitatiskirke, der Skt. Petri Kirke, Helligåndskirke und nicht zuletzt vor der Vor Frues Kirke mit den Aposteln des Bildhauers Bertel Thorvaldsen zu beiden Seiten. Dr. Sigursveinn hatte mir ans Herz gelegt, die Vor Frues Kirke gleich nach meiner Ankunft zu besuchen, und mir einen langen Vortrag über die interessante Tatsache gehalten, dass Judas sich nicht in der Schar der Jünger befand, sondern durch den Apostel Paulus ersetzt worden war. Ich verspürte Lust auf einen Kaffee, ging vorbei am Hauptgebäude der Universität beim Frue Plads zurück und suchte mir einen freien Tisch im Lille Apoteket in der St. Kannikestræde. Von dort aus ging ich zu dem berühmten Wohnheim Studiegården und ruhte mich auf der Bank unter der Linde aus. Auf dem Weg zu meiner Unterkunft in der Skt. Pedersstræde kam ich am Haus Nr. 22 vorbei. Zwischen den Fenstern im ersten Stock war eine Tafel angebracht, die an Jónas Hallgrímsson erinnerte. Ich starrte zum obersten Stockwerk hoch, wo Jónas zuletzt gewohnt hatte. Von dem Augenblick an, als sich mir die Zaubermacht seiner Poesie erschlossen hatte, hatte Jónas in meinen Gedanken einen quasi göttlichen Status erhalten. Ich weiß, dass es vielen Isländern so geht. Als ich jetzt vor diesem Haus stand, bemächtigte sich meiner ein seltsames Gefühl der Trauer, aber auch der Verehrung für diesen Dichter, der vor langer Zeit mit gebrochenem Bein unter der schrägen Wand in der dänischen Mansarde lag und seinem Schicksal furchtlos und seltsam gefasst entgegensah.
Ich hatte unrealistische Vorstellungen von der Großartigkeit der Handschriftensammlung gehabt. Sie machte auf mich alles andere als einen prächtigen Eindruck, als ich sie auf meinem Bummel durch die Stadt zum ersten Mal sah. Ich betrat die Universitätsbibliothek, ein mächtiges Gebäude an der Fiolstræde, wo die Handschriftensammlung von Árni Magnússon an der Nordwand des Hauses verstaut worden war. Spaßeshalber versuchte ich, die Länge der Wand in Schritten abzumessen, und zählte achtzehn Meter. Zu beiden Seiten des Raumes waren undichte Fenster. Dr. Sigursveinn hatte mir gesagt, dass es dort im Winter furchtbar kalt sei, die Temperaturen gingen zeitweilig sogar bis auf frostige vierzehn Grad herunter. Zwei Drittel der Wand waren mit Regalen bedeckt, in denen sich die Manuskripte befanden. Außerdem war dort das Arbeitszimmer von Jón Helgason, dem Direktor des Instituts. Nur ganz wenige Handschriften befanden sich in Schaukästen unter Glas. Die meisten waren mit Einbanddeckeln versehen und standen aufrecht im Regal. Auf den Pergamentseiten hatte sich Staub abgesetzt. Eine Aufsichtsperson gab es nicht, und der Schlüssel für das Schnappschloss hing an einem Haken bei der Eingangstür zu der Sammlung, das war alles.
Der Gedanke, wie viel vom historischen Erbe Islands in Kopenhagen zu finden ist, beschäftigte mich sehr. Nicht nur die alten Handschriften, sondern auch jener bedeutsame Teil der isländischen Geschichte, der direkt mit der Stadt Kopenhagen verbunden ist. Schon immer fand ich, dass er gewaltig unterschätzt wurde. Hier gab es so viele für Island historisch bedeutsame Straßen und Plätze, denen wir keine weitere Beachtung schenkten. Hier standen immer noch die Häuser, in denen die Vorkämpfer unserer Unabhängigkeit gelebt hatten, hier war das Heim von Jón Sigurðsson. Hier war die Universität, die all diese Männer und viele andere Isländer im Laufe der Jahrhunderte ausgebildet hatte, und das Studentenwohnheim Studiegården, wo die größten isländischen Gelehrten ihre Zuflucht gehabt hatten. Hier befanden sich der Runde Turm und die Trinitatiskirke, in der in früheren Zeiten unsere kostbaren Handschriften aufbewahrt wurden. Hier lagen die Kerker, in die wir gesteckt worden waren, die Kanäle, in denen wir uns ertränkt hatten. Die Restaurants und Kneipen, die wir angeheitert bevölkert hatten. Wo gibt es etwas Vergleichbares in Island? Es durfte nicht in Vergessenheit geraten, dass die Hälfte der isländischen Geschichte mit dieser Stadt verbunden war, mit ihren Pflastersteinen und Straßenecken, mit den Lokalen und den Fenstern der Häuser, in denen sich immer noch die Jahre und die Männer spiegelten, die uns in diesem fernen Land zu einer unabhängigen Nation gemacht hatten.
Mir kam die Idee nachzusehen, ob der Professor vielleicht um die Mittagszeit in seinem Büro erschienen war. Ich machte mir keine sonderlichen Hoffnungen, als ich noch einmal den Korridor zu seinem Büro entlangging, sah aber zu meiner Erleichterung, dass die Tür zu seinem Arbeitszimmer einen Spalt offen stand. Ich wollte anklopfen und eintreten, doch ich hörte Stimmen aus dem Raum und hielt an der Tür inne.
Von diesem Standort aus konnte ich nur eine Wand des Zimmers sehen, die über und über mit Büchern bedeckt war. Was ich hörte, ging mich nicht das Geringste an, und ich schämte mich zwar für meinen Lauscherposten, traute mich aber nicht, mich von der Stelle zu rühren.
»… kann es nicht weitergehen«, erklang eine tiefe Stimme, die ich nie zuvor gehört hatte. Sie klang, als ob sie zu einem großgewachsenen Mann gehören würde, der Macht und Einfluss ausstrahlte. Er sprach Dänisch.
»Das ist doch blühender Unsinn, und das weißt du ganz genau«, wurde geantwortet, und ich vermutete, dass das der Professor war. »Du solltest nicht auf solches Geschwätz hören, sondern dich stattdessen darauf konzentrieren, diese Fakultät zu leiten.«
»Genau in dieser Eigenschaft bin ich hier«, sagte die tiefe Stimme.
Es kam mir so vor, als müssten die beiden da drinnen in dem Schweigen, das seinen Worten folgte, meine Atemzüge hören können. Ich war wie gelähmt und wusste nicht, was ich mehr befürchtete – dass man mich entdeckte oder dass ich etwas hörte, was ich nicht hören sollte und nicht wissen wollte. Ich befand mich in einer furchtbaren Zwickmühle, machte aber keinen Versuch, das Zimmer zu betreten und dieses Gespräch zu unterbrechen, was wahrscheinlich das Ehrenhafteste gewesen wäre.
»Das ist kein Unsinn!«, erklärte der Mann mit der tiefen Stimme. »Du glaubst wohl, dass ich nicht weiß, was los ist? Du glaubst wohl, dass mir keine Geschichten über dich zu Ohren kommen? Alle hier klagen über dich, am meisten über deine Trinkerei, aber auch Begriffe wie Arroganz, Unverschämtheit und Starrsinn fallen. Du brauchst mich nicht als deinen Feind zu betrachten, das bin ich nämlich nicht. Wenn ich nicht immer wieder für dich eingetreten wäre, hättest du hier an der Universität schon längst den Hut nehmen können.«
Der andere Mann, den ich für den Professor hielt, schien keine Antwort auf diese Vorwürfe seines Gegenübers zu wissen.
»Der Alkohol ist aber das Schlimmste«, sagte der mit der tiefen Stimme, »das kann ich nicht länger ignorieren.«
»Scher dich zum Teufel!«, sagte der Professor. »Ich bin nie alkoholisiert zum Unterricht erschienen. Nie!«
»Du warst den ganzen Sommer über betrunken!«
»Das ist eine Lüge, und außerdem geht dich … Es geht dich überhaupt nichts an, was ich in meiner freien Zeit mache.« »Hast du vergessen, wie du dich im Frühjahr aufgeführt hast? Ich weiß, dass du Probleme hast, aber …«
»Hör bloß auf, mich zu bemitleiden«, knurrte der Professor. »Und schmeiß mich ruhig raus, wenn du willst. Das ist besser, als sich diesen elenden Quatsch von dir anhören zu müssen.«
»Wann wirst du endlich mit der neuen Ausgabe fertig sein?«
»Das geht dich nichts an«, erklärte der Professor. »Und jetzt verschwinde! Hau ab, und verschwende dein Mitleid auf jemand anderen! Ich brauche dich nicht, genauso wenig, wie ich diese Universität brauche. Schert euch doch meinetwegen alle zum Teufel!«
»Sie wird wieder in der Königlichen Bibliothek benötigt«, sagte der Mann mit der tiefen Stimme, der sich von den Worten des Professors nicht beirren zu lassen schien. »Du kannst sie nicht jahrelang bei dir aufbewahren. Das geht einfach nicht, Forschung hin, Forschung her.«
Ich hörte, wie sich die Stimmen auf einmal der Tür näherten, machte einen Satz zurück und war die Holztreppe hinuntergesaust, bevor mich jemand sehen konnte. Mein Herz hämmerte wie wild, und mein Atem ging stoßweise, als ich endlich unten auf der Straße ankam und es wagte, mich umzusehen. Niemand hatte mich bemerkt.
Da stand ich nun in der dänischen Spätsommersonne. Das Gespräch, das ich mit angehört hatte, ging mir während des ganzen Heimwegs nicht aus dem Kopf. Die Stellung des Professors an der Philosophischen Fakultät schien aufgrund seiner Alkoholprobleme ziemlich wackelig zu sein. Abends aß ich ganz allein in einem kleinen Restaurant am Rathausplatz dänische Frikadellen mit Spiegelei. Anschließend ging ich früh zu Bett und sah mir die beiden neu erschienenen Romane an, die ich aus Island mitgenommen hatte, sie hießen Taxe 79 und Das Uhrwerk.
Am nächsten Morgen machte ich einen weiteren Vorstoß bei dem Professor und stand zur gleichen Zeit wie am Tag zuvor auf dem Flur vor seinem Büro. Ich klopfte an, doch von drinnen war keine Reaktion zu hören. Ich klopfte noch einmal und dann ziemlich energisch ein drittes Mal. Nichts geschah, und allmählich gelangte ich zu der Überzeugung, dass ich diesen Mann wohl niemals treffen würde.
Unruhig trat ich auf dem Flur von einem Fuß auf den anderen, bevor ich mich aufraffte und ausprobierte, ob die Tür verschlossen war. Zu meiner Verwunderung war sie das nicht. Vorsichtig öffnete ich die Tür und wagte mich einen Schritt über die Schwelle. Es schien niemand da zu sein. Ich blickte wieder auf meine Armbanduhr, es war schon nach neun.
Ich fühlte ein weiteres Mal an der Brusttasche meines Jacketts, um mich zu vergewissern, dass ich das Empfehlungsschreiben dabeihatte, und beschloss, im Büro zu bleiben und dort eine Weile zu warten, in der Hoffnung, dass der Professor sich irgendwann blicken lassen würde. Im Zimmer war es dunkel. Schwere Vorhänge hielten das Tageslicht draußen, und ich konnte nirgends einen Lichtschalter entdecken. Als sich meine Augen an das schummrige Licht gewöhnt hatten, erblickte ich eines der chaotischsten Büros, die mir je untergekommen sind. Enorme Stapel von Papieren und Büchern lagerten auf dem Boden vor den Bücherregalen, die wiederum sämtliche Wände bedeckten und ihrerseits von Büchern und Papieren überquollen. Auf die Bücher waren waagerecht in sämtliche vorhandenen Lücken weitere Bücher gestopft worden, vom Fußboden bis zur Decke. Stapel mit Dokumenten und Aktenordnern standen oder lagen allenthalben herum, vor allem auf dem Fußboden. Ein kleiner Rauchtisch bog sich unter der Last von Büchern. In diesem Chaos gab es keinerlei Anzeichen für irgendeine Ordnung, und ich konnte mir nicht vorstellen, dass es möglich war, da drinnen irgendetwas wiederzufinden. Auf dem Schreibtisch am Fenster gab es noch mehr Bücher und Papierkram, aber dort stand auch eine vorsintflutliche Schreibmaschine und daneben eine halb volle Flasche mit isländischem Brennivín, die sicher jemand aus Island dem Professor mitgebracht hatte. Ein penetranter Geruch von Schnupftabak lag in der Luft, und in einer Keramikschale auf dem Schreibtisch sah ich mehr Schnupftabaksdosen, als ich auf die Schnelle zählen konnte. Einige davon waren versilbert und wiesen Initialen auf, aber es gab auch schlichte Blechdosen mit der Aufschrift des isländischen Importeurs. Der Herr Professor schien eine ausgesprochene Vorliebe für isländischen Schnupftabak zu haben.
Bei näherem Hinsehen entdeckte ich plötzlich, dass auf dem Fußboden hinter dem Schreibtisch jemand lag. Zunächst sah ich nur die abgelaufenen Sohlen von braunen Schuhen und schrak zusammen. Dann stellte ich aber fest, dass sie an zwei Beinen steckten, die unter dem Schreibtisch verschwanden, und ich trat näher heran. Ich hatte nicht den geringsten Zweifel, dass es sich um den Professor handelte. Zuerst fürchtete ich, er hätte einen Herzschlag bekommen und wäre tot. Doch dieser Sorge war ich enthoben, als ich seine schweren Atemzüge vernahm. Ich bückte mich und berührte seine Stirn, sie war heiß. Er hielt eine Flasche mit billigem Branntwein umklammert und trug einen grauen, fadenscheinigen Anzug, darunter eine Strickweste und ein weißes Hemd mit Krawatte.
Ich stieß ihn leicht mit dem Fuß an, aber das brachte nichts. Auch als ich mich niederbeugte und ihn rüttelte, wollte er nicht aufwachen. Ich überlegte, was zu tun war. Am liebsten hätte ich mich ganz einfach aus dem Staub gemacht und ihn da in seinem Rausch liegen lassen. Es war ja wohl kaum meine Aufgabe, dem Professor in einer derartigen Situation zu Hilfe zu kommen. Vermutlich hatte er sich die ganze Nacht volllaufen lassen und war gegen Morgen einfach umgefallen. Vielleicht hatte er ja auch schon viele Tage lang in seinem Büro gesoffen. Ich erinnerte mich an das Stöhnen, das ich gehört zu haben glaubte, als ich tags zuvor angeklopft hatte. Der Professor war augenscheinlich zu sehr mit anderen Dingen beschäftigt, um sich mit neuen Studenten abzugeben.
Es gab in dem Büro auch ein verschlissenes Sofa, und ich versuchte, den Professor dorthin zu zerren. Er war schwer, und ich war nicht sehr kräftig, deswegen blieb mir nichts anderes übrig, als ihn über den Boden zu schleifen. Irgendwie gelang es mir, ihn aufs Sofa zu bugsieren, wo ich ihn, so gut ich konnte, zurechtlegte. Die Branntweinflasche hielt er immer noch so fest umklammert, als sei sie sein einziger Kontakt zur Außenwelt. Ich hielt Ausschau nach etwas, womit ich ihn zudecken konnte, fand aber nichts. An einem Haken bei der Tür hing ein großer brauner Ledermantel, den ich über den Professor breitete, der in seinem Rausch irgendetwas Unverständliches murmelte.
Als ich mich in seinem Büro umsah, fiel mein Blick auf ein kleines Büchlein auf dem Schreibtisch, das an der Titelseite aufgeschlagen war. Ich wollte keineswegs herumspionieren, aber trotzdem reckte ich den Kopf, um zu sehen, was das für ein Buch war. Ich las den Titel: »Die Edda. Volksausgabe«. Und darunter stand: »Sonderausgabe für die Hitlerjugend. Nicht zum Verkauf.«
Plötzlich schien der Professor zu sich zu kommen. Er richtete sich auf und starrte mich mit tränenverschleierten Augen an.
»Gitte?«, sagte er.
Ich bewegte mich nicht und sagte nichts.
»Bist du das, Gitte?«, fragte er. »Liebste Gitte …«
Im nächsten Moment war er wieder eingeschlafen.
Ich verließ das Zimmer leise und schloss die Tür hinter mir.
Ich wusste nicht, was ich mit diesem angebrochenen Tag anfangen sollte. Dr. Sigursveinn von der Isländischen Abteilung daheim hatte mir versichert, dass der Professor mich gut in Empfang nehmen würde, er hatte sich nämlich meinetwegen mit ihm in Verbindung gesetzt. Er würde mir bestimmt helfen, mich in alles hineinzufinden, wie Dr. Sigursveinn sich ausdrückte. Er meinte damit das Studium, das Universitätsleben und die Stadt, wenn ich ihn richtig verstanden hatte. Als einsamer Student der Altnordistik in einer Riesenstadt, der nie zuvor im Ausland gewesen war und keine anderen Angehörigen hatte als eine arme Tante in Island, hatte ich einige Hoffnung auf den Professor gesetzt.
Ich vertrödelte den halben Tag. Die Dame, die mir das Zimmer in der Skt. Pedersstræde vermietete, stand in der Tür, als ich nach ziellosem Bummeln durch die Stadt nach Hause kam. Sie überreichte mir einen Brief von Dr. Sigursveinn, der mir freundlicherweise einen Willkommensgruß nach Kopenhagen gesandt hatte und der Hoffnung Ausdruck gab, dass ich Spaß am Weiterstudium haben und gut vorwärtskommen würde. Den Professor erwähnte er mit keinem Wort. Ich setzte mich sofort hin, um ihm zu antworten und ihm für seinen Brief zu danken. Die Probleme, die ich auf mich zukommen sah, ließ ich unerwähnt. Ich wollte meinen Aufenthalt in Kopenhagen nicht damit beginnen, einen Klagebrief zu schreiben.
Drei
Am späten Nachmittag steckte ich das Empfehlungsschreiben ein weiteres Mal in meine Jackentasche und machte mich auf den Weg. Die ursprüngliche Zeitvereinbarung war sowieso hinfällig, nun wollte ich es einfach darauf ankommen lassen. Die Tür zum Büro des Professors war wieder unverschlossen, aber diesmal sah ich keine Alkoholleiche auf dem Fußboden, als ich einen Blick in das Zimmer warf. Ich beschloss abzuwarten, ob der Professor auftauchen würde, und betrachtete unterdessen die Bücherregale. Erwartungsgemäß fand sich dort eine interessante Lektüre, Bücher aus der ganzen Welt und in allen Sprachen, auch auf Griechisch und Latein. An einigen Stellen lugten Flaschenhälse hinter den Büchern hervor, die unverkennbar Zeugnis davon ablegten, auf welche Irrwege der Professor geraten war. Auf dem Boden in einer Ecke des Zimmers befand sich ein feuerfester Geld- oder Aktenschrank, und ich nahm an, dass der Professor dort die wertvollsten Handschriften aufbewahrte, an denen er forschte.
»Wer zum Teufel bist du?«, donnerte plötzlich eine sonore Stimme auf Dänisch hinter mir los. Mein Herz setzte einen Schlag aus, und ich schrak heftig zusammen. Als ich mich umdrehte, sah ich, dass der Professor sein Büro betreten hatte, und es hatte ganz den Anschein, als wolle er auf mich losgehen.
»Bist du ein Einbrecher?«, rief er drohend, noch bevor ich Zeit hatte zu antworten, und fuchtelte mit seinem Stock in meine Richtung. »Willst du mich bestehlen?«
Dann sagte er etwas auf Deutsch, was ich nicht richtig verstand.
»Entschuldigen Sie«, setzte ich an, aber weiter kam ich nicht.
»Ach so, ein Isländer«, sagte er.
»Ja«, sagte ich, »ich bin …«
»Ich habe gedacht, du wolltest hier etwas klauen«, sagte der Professor, jetzt sichtlich beruhigt.
»Nein«, sagte ich, »ich … ich bin kein … Dieb.«
»Diese verdammten Wagneriten!«, schrie er mich an. »Kennst du die? Hast du von denen gehört? Diebesgesindel der schlimmsten Sorte, alle miteinander!«
»Nein«, erklärte ich wahrheitsgemäß. Diese Bezeichnung hatte ich nie in meinem Leben gehört, und ich hatte auch keine Ahnung, was darunter zu verstehen war. Der Professor klärte das im nächsten Satz in gewisser Weise auf.
»Das ist das widerlichste Gesocks, das man sich vorstellen kann. Banditen und Mörder alle miteinander! Banditen und Mörder, so wahr ich hier stehe!«
»Die … die kenne ich nicht.«
»Was willst du von mir?«, fragte er. »Wer bist du überhaupt? Raus mit der Sprache! Steh hier nicht so rum wie ein Ölgötze!«
»Die Tür stand offen, und ich …«
Mit einem Mal kriegte ich kein einziges Wort mehr heraus, so ein ungehobeltes Benehmen machte mir Angst. Dieser unbeherrschte Mensch schien keinerlei Manieren zu haben. Er sah im Übrigen auch alles andere als vertrauenerweckend aus, wie er mir da gegenüberstand; das weiße Haar stand wild in alle Richtungen, und das Funkeln der Augen erinnerte an glühende Kohlen. Dieser schlanke, hochgewachsene Mann mit den weißen Bartstoppeln sah zudem erstaunlich rüstig und kräftig aus, obwohl er auf die siebzig zuging und einen ziemlich ausschweifenden Lebenswandel führte, soweit ich das beurteilen konnte. Er hinkte etwas und ging deswegen am Stock, einem schönen Exemplar aus Ebenholz mit Silberknauf und Stahlspitze. Er trug einen schwarzen Anzug mit Weste, und die Kette seiner silbernen Uhr verschwand in der Westentasche.
»Also jetzt raus mit der Sprache«, sagte er und sprach jetzt Isländisch. »Was willst du von mir?«
Er ging zu seinem Schreibtisch, zog die Vorhänge auf und öffnete das Fenster. Dann nahm er auf dem verschlissenen Schreibtischstuhl Platz und zog eine Tabaksdose aus seiner Tasche hervor. Das Chaos in dem Raum wurde durch das Sonnenlicht keineswegs gemildert, aber die frische Luft tat gut. Ich überlegte, ob ich ihm sagen sollte, dass wir uns bereits begegnet wären, denn davon hatte er offensichtlich überhaupt nichts mitbekommen, aber ich fand es nicht ratsam, seinem Gedächtnis auf die Sprünge zu helfen.
»Ich heiße … Valde … mar«, stammelte ich, »und ich bin für den nächsten Winter hier an im Institut für Nordische Philologie eingeschrieben.«
»Na, da schau her.«
»Ich … Ich bin schon gestern hierhergekommen … aber …« »Ja, was denn?«
»Sie kennen meine Tante«, rutschte es mir heraus.
Die Tante hatte mir aufgetragen, ihm Grüße auszurichten. Ich wusste nicht genau, ob sie sich wirklich kannten; sie hatte nur angedeutet, dass sie entfernt verwandt seien. Ich erzählte ihm von meiner Tante in den Westfjorden, er hörte mir interessiert zu und erklärte, er wisse, wer sie sei, aber er habe sie nie persönlich getroffen. Das konnte stimmen, denn auch meine Tante hatte mir gesagt, dass sie nie miteinander gesprochen hätten.
»Und wie geht es deiner Tante?«, fragte er.
»Eigentlich gut, danke der Nachfrage. Sie bat mich, Ihnen Grüße auszurichten«, fügte ich verlegen hinzu.
»Und jetzt bist du also hier?«, sagte er und sah mich prüfend an.
»Es sieht so aus«, sagte ich und versuchte zu lächeln.
Auf einmal erinnerte ich mich an das Empfehlungsschreiben. Ich zog es aus der Jackentasche und überreichte es dem Professor.
»Hier habe ich … Ich habe hier ein Empfehlungsschreiben von Dr. Sigursveinn. Er war mein Mentor an der Universität daheim.«
»Ein Empfehlungsschreiben?«
Er schaute mich plötzlich an, als hätte er eine seltsame Kreatur vor sich, die sich irgendwie in sein Büro verirrt hatte. Vielleicht war ihm nicht klar, wie schüchtern und nervös ich war. Der Professor war einer der kompetentesten Handschriftenexperten unseres Landes und galt als überragend scharfsinniger Geist. Irgendwie fühlte ich mich schrecklich klein und unbedeutend und hatte weiche Knie. Das gute und konstruktive Selbstvertrauen, das ich in mir aufgebaut hatte, weil ich es aus eigener Kraft heraus geschafft hatte, dieses Ziel zu erreichen – es war wie weggeblasen. Er nahm den Umschlag mit dem Schreiben von meinem Lehrer entgegen. Statt ihn zu öffnen, knüllte er ihn zusammen und warf ihn aus dem Fenster.
»Weshalb stotterst du?«, fragte er.
Ich traute meinen Augen nicht. Er warf das Empfehlungsschreiben weg, ohne es eines Blickes zu würdigen! Einen Augenblick lang überlegte ich, ob ich nach unten laufen sollte, um den Brief zu retten. All diese wunderbaren Worte, die Dr. Sigursveinn über mich geschrieben hatte! Dieser Mann behandelte sie wie Müll!
»Ich … Ich … stottere nicht«, sagte ich stattdessen.
»Was hast du gesagt, wie du heißt?«
»Valdemar. Ich soll bei Ihnen Nordische Philologie studieren. Ich bin vor einigen Tagen nach Kopenhagen gekommen. Sie hatten sich mit mir verabredet. Sie haben das vielleicht … Vielleicht haben Sie das vergessen?«
Er sah mich verständnislos an, und ich rekapitulierte im Geiste das, was ich da von mir gegeben hatte, und begriff mich selbst nicht: Sie hatten sich mit mir verabredet! Was hatte ich da gesagt? Ich wusste, dass ich durchaus in der Lage war, mich sehr viel gewandter auszudrücken, aber irgendwie hatte der Professor von Anfang an diese Wirkung auf mich, dass mir die Worte im Halse stecken blieben, sobald ich ihm gegenüberstand.
»Ich meine, dass …«
»Valdemar, du musst lernen, etwas gelassener an die Dinge heranzugehen«, erklärte er, und es kam mir fast so vor, als schmunzelte er dabei. »Dein Name kommt mir bekannt vor. Deine Tante hat mir geschrieben. Du sagst, wir waren verabredet? Das hatte ich total vergessen.«
Endlich schien er zu begreifen, was ich hier in seinem Büro wollte.
»Es war nicht abgeschlossen«, sagte ich und sah dabei zum Fenster, durch das das Empfehlungsschreiben hinausgeflogen war. »Sie müssen entschuldigen, ich dachte, Sie hätten vielleicht mein Klopfen nicht gehört …«