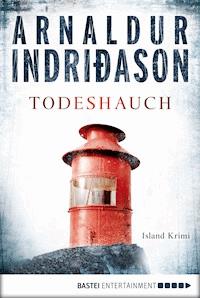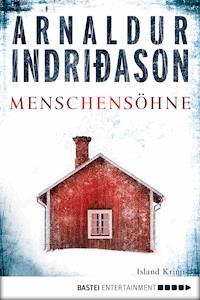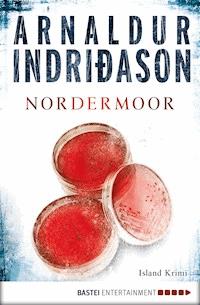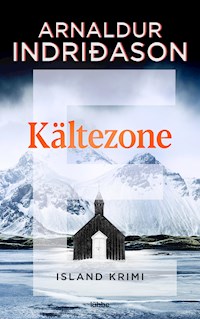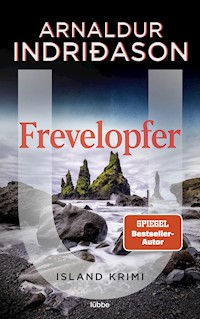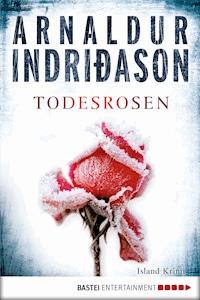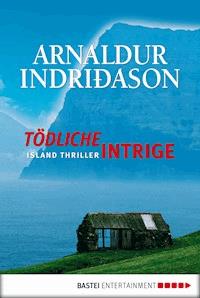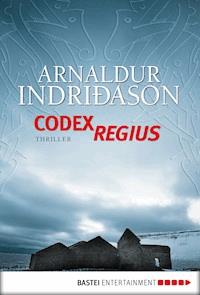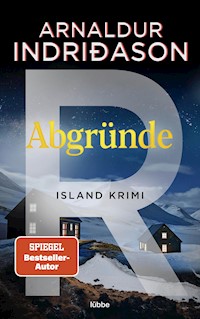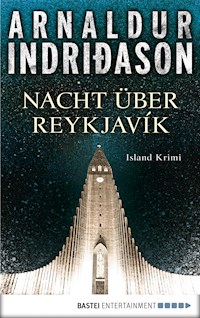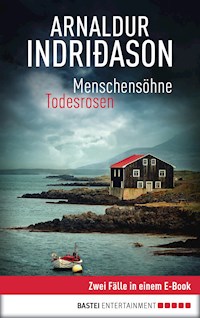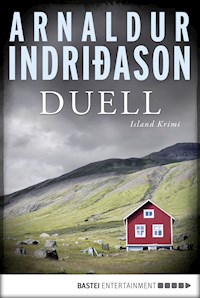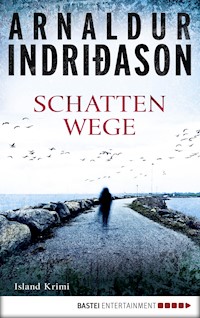9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Lübbe
- Kategorie: Krimi
- Serie: Der junge Erlendur
- Sprache: Deutsch
Der junge Kommissar Erlendur ermittelt - dort, wo sich heute die Blaue Lagune befindet ...
*Island 1978. Ein Toter wird in einem Gewässer mitten in einem Lavafeld entdeckt. Kommissar Erlendur nimmt zusammen mit Marian Briem die Ermittlungen auf. Eine Spur führt zur nahe gelegenen US-Militärbasis. Dort scheint niemand mit der isländischen Polizei zusammenarbeiten zu wollen. Wurde dem Toten womöglich ein Militärgeheimnis zum Verhängnis?
Erlendur beschäftigt zudem das mysteriöse Verschwinden eines jungen Mädchens vor mehr als zwanzig Jahren, und er ermittelt auf eigene Faust. Das Mädchen war damals auf dem Schulweg an dem berüchtigten Camp Knox vorbeigekommen ...
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 454
Veröffentlichungsjahr: 2017
Ähnliche
Inhalt
Über den Autor
Arnaldur Indriðason, 1961 geboren, graduierte 1996 in Geschichte an der University of Iceland und war Journalist sowie Filmkritiker bei Islands größter Tageszeitung Morgunbladid.
Heute lebt er als freier Autor mit seiner Familie in Reykjavik und veröffentlicht mit sensationellem Erfolg seine Romane. Arnaldur Indriðasons Vater war ebenfalls Schriftsteller.
1995 begann er mit Erlendurs erstem Fall, weil er herausfinden wollte, ob er überhaupt ein Buch schreiben könnte. Seine Krimis belegen allesamt seit Jahren die oberen Ränge der Bestsellerlisten. Seine Kriminalromane »Nordermoor« und »Todeshauch« wurden mit dem »Nordic Crime Novel’s Award« ausgezeichnet, darüber hinaus erhielt der meistverkaufte isländische Autor für »Todeshauch« 2005 den begehrten »Golden Dagger Award« sowie für »Engelsstimme« den »Martin-Beck- Award«, für den besten ausländischen Kriminalroman in Schweden.
Arnaldur Indriðason ist heute der erfolgreichste Krimiautor Islands. Seine Romane werden in einer Vielzahl von Sprachen übersetzt. Mit ihm hat Island somit einen prominenten Platz auf der europäischen Krimilandkarte eingenommen.
ARNALDURINDRIÐASON
Tage der Schuld
Island Krimi Aus dem Isländischen von Coletta Bürling
BASTEI ENTERTAINMENT
Vollständige eBook-Ausgabe
des in der Bastei Lübbe AG erschienenen Werkes
Bastei Entertainment in der Bastei Lübbe AG
Titel der isländischen Originalausgabe: »Kamp Knox«
Namen, Personen und Begebenheiten in diesem Roman sind frei erfunden. Ähnlichkeiten mit lebenden oder verstorbenen Personen sind nicht beabsichtigt.
In Island duzt heutzutage jeder jeden.
Man redet sich nur mit dem Vornamen an.
Dies wurde bei der Übersetzung beibehalten.
Für die Originalausgabe:
Copyright © 2014 by Arnaldur Indriðason
Published by arrangement with Forlagið, www.forlagid.is
Für die deutschsprachige Ausgabe:
Copyright © 2016 by Bastei Lübbe AG, Köln
Textredaktion: Anja Lademacher, Bonn
Umschlaggestaltung: Johannes Wiebel | punchdesign, München, unter Verwendung eines Motivs von © shutterstock/Cardaf
eBook-Produktion: Dörlemann Satz, Lemförde
ISBN 978-3-7325-2949-0
www.bastei-entertainment.de
www.lesejury.de
Ist unser Land in deren Augen nicht nur ein einziges
großes Barackenviertel?
Ein einziges großes … Camp Knox?
Erlendur Sveinsson
Eins
Ein scharfer Wind blies über Reykjanes. Er strich von Norden her über das Hochland und wühlte das Meer in der Faxaflói-Bucht auf, bevor er die karge, flache Halbinsel erreichte und über die kahlen Hügel mit ihrer niedrigen Vegetation hinwegfegte. Die kümmerlichen Pflanzen ragten kaum aus dem steinigen Boden heraus, sie schienen sich vor dem Wetter zu ducken. Die ganze Landschaft war dem offenen Meer und dem Nordwind schutzlos ausgesetzt, die Pflanzenwelt kämpfte einen harten Kampf gegen die Naturgewalten, und so behaupteten sich dort auch nur die widerstandsfähigsten Arten. Der hohe Zaun auf dem höchsten Punkt der Halbinsel, der das Gelände des amerikanischen Stützpunkts von der Umwelt abriegelte, gab seltsam quietschende Geräusche von sich, wenn der Wind sich hindurchzwängte, um anschließend gegen die riesigen Wände eines Hangars zu prallen. Dass das enorme Gebäude ihm Widerstand bot, brachte ihn nur noch mehr auf. Für ihn war es ein störendes Hindernis, denn er musste vorwärtskommen auf seinem Weg durch die Finsternis.
Die Geräusche des Sturms drangen auch in die riesige Halle hinein. Der Hangar war eines der größten Gebäude auf Island, dort waren die Aufklärungsflugzeuge der Iceland Defense Force untergebracht, ebenso wie die großen Radarkontrollanlagen, F-16-Fighter und riesige Hercules-Transportmaschinen. In diesem Hangar wurden sämtliche Militärflugzeuge gewartet, die auf der Basis in Keflavík stationiert waren. Mächtige Flaschenzüge hingen von den Querbalken an der Decke hinunter, mit denen große Flugzeugteile transportiert werden konnten. Der Hangar hatte eine Grundfläche von siebzehntausend Quadratmetern, die rückwärtige Seite war nach Norden ausgerichtet. An der Ost- und Westseite befanden sich gewaltige Schiebetore, durch die auch die größten Flugzeuge der Welt passten. Die Höhe bis zur Decke entsprach der eines achtstöckigen Hauses. In diesem Gebäude befand sich das logistische Schaltzentrum der siebenundfünfzigsten amerikanischen Flugdivision.
Zur Zeit konnte der Hangar kaum genutzt werden, weil ein neues Brandschutzsystem installiert wurde. Am Nordende des Gebäudes stand eine Hebebühne, deren Arbeitsplattform sich direkt unter der Decke des Gebäudes befand und wo das Sprinklersystem eingebaut worden war. Diese Baumaßnahme war wie so vieles im Zusammenhang mit dem Hangar 855 eine großangelegte Aktion. Entlang der Stahlträger an der Decke hatte man ein Leitungsrohrsystem verlegt, an dem im Abstand von einigen Metern die dazugehörigen Sprinkler befestigt waren.
Die Hebebühne nahm viel Platz ein und wirkte in dem Hangar wie eine fahrbare Insel auf Rädern. In der Mitte des Gerüsts führte eine Leiter nach oben. Es gab mehrere kleinere Zwischenplattformen, auf denen Installateure und Klempner arbeiten konnten. Röhren, Schrauben und Befestigungen aller Art standen kistenweise neben dem Gerüst, außerdem natürlich Werkzeugkästen und Rohrzangen in allen Größen und Ausführungen. Sie gehörten den isländischen Bauunternehmern, die mit der Installation beauftragt worden waren. Wie viele andere isländische Unternehmer profitierten sie enorm von der Anwesenheit des Militärs.
Abgesehen vom Wind war es still in dem Hangar. Doch plötzlich hörte man ein leises Geräusch von der Arbeitsplattform, und kurz darauf landete ein Rohrstück auf dem Boden, wo es eine Zeitlang scheppernd hin und her sprang. Kurze Zeit später gab es einen wesentlich dumpferen Aufprall, so als wäre ein schwerer Sack auf dem Boden gelandet. Das Geräusch war so gedämpft, als wäre etwas durch schweren Nebel von oben heruntergefallen. Dann wurde es wieder still – bis auf das Heulen des Windes draußen.
Zwei
Manchmal juckten die schorfigen Stellen so heftig, dass sie die Haut am liebsten aufgerissen und sich blutig gekratzt hätte. Die Schuppenflechte war bei ihr schon aufgetreten, als sie noch ein Teenager war. Zunächst hielt sie es nur für ein Ekzem. Weshalb sie davon betroffen war, konnte ihr niemand sagen. Der Arzt hatte etwas von schnelleren Zellteilungen in der Haut gesagt, die zu den roten, leicht erhabenen Flecken mit weißem Schorf führten. Sie machten sich vor allem an den Ellbogen und den Händen bemerkbar, aber auch an den Beinen und der Kopfhaut. Das war für jeden sichtbar und deshalb am schlimmsten für sie. Die Ärzte hatten ihr Medikamente und Salben verschrieben, um den Juckreiz und die Schorfbildung einigermaßen in Schach zu halten. Vor Kurzem erst hatte sie von ihrem Arzt von diesem Ort auf Reykjanes erfahren. Menschen mit Hautproblemen badeten in dem Wasser, da sich herumgesprochen hatte, dass es den Juckreiz minderte und allgemein Linderung verschaffte. Es lag an der Zusammensetzung des Wassers. Für das geothermale Kraftwerk, das dort mitten in der Lava stand, wurden Dampf und heißes Wasser zur Erdoberfläche gepumpt, um damit die Turbinen zu betreiben. Dieses Wasser enthielt Kieselerden und Algen, aber es war auch salzhaltig. Deswegen konnte es nicht direkt in die Rohrleitungen für die umliegenden Dörfer und den Flughafen eingespeist werden, sondern wurde einfach in das umliegende Lavafeld abgeleitet. Dank der Beschreibung des Arztes hatte sie den Ort schnell gefunden. Man konnte schon von der Straße aus sehen, wo sich das türkis-weißliche Wasser in der dick bemoosten Lava ausbreitete. Weißer Schlamm dichtete die normalerweise poröse Lava ab. Der Weg dorthin führte über ein unwegsames Lavafeld, und es kostete sie einige Mühe, zu dem See zu gelangen. Aber sobald sie in dem weichen Wasser lag und die befallenen Stellen an Armen und Beinen, im Gesicht und an der Kopfhaut mit dem Schlamm einrieb, ließ der Juckreiz spürbar nach. Schon nach dem ersten Besuch hatte sie beschlossen, dass es nicht ihr letzter sein würde.
Und daran hatte sie sich gehalten. Sie besuchte den warmen blauschimmernden See in unregelmäßigen Abständen und freute sich jedes Mal auf das Bad. Ihr wäre es unangenehm gewesen, wenn jemand sie beim Umkleiden hätte beobachten können, deshalb zog sie den Badeanzug immer schon zu Hause an und legte ihre Sachen und das mitgebrachte Badehandtuch in eine Lavamulde.
An dem Tag, als sie die Leiche fand, hatte sie sich, eingelullt von Wärme und Wohlbefinden, erst in dem seidenweichen Wasser treiben lassen und danach begonnen, die kranken Hautstellen mit dem weißen Schlick zu massieren, der angeblich sehr viele heilende Stoffe enthielt, Mineralien, Algen und Kieselerde. Ihr ging es aber nicht nur um das wunderbar warme Wasser, in dessen weichem Schlamm sich ihre Hautirritationen besänftigen ließen, sondern sie war auch fasziniert von dieser wunderbar einsamen und schönen Oase mitten in der Lava. Sie genoss jeden Augenblick. Der türkisblaue See war nirgendwo tief, sie konnte überall stehen. Sie genoss es, hier mit sich allein zu sein.
Auf dem Weg zurück zum Ufer sah sie etwas, das einem Schuh ähnelte, er ragte halb aus dem Wasser. Erst dachte sie, dass jemand das Ding achtlos in den See geworfen hätte, und das ärgerte sie. Doch als sie nach dem Schuh griff, um ihn zu entfernen, sah sie mit Entsetzen, dass sie an etwas anderem und sehr viel Größerem zog.
Der Verhörraum im Untersuchungsgefängnis Síðumúli war ebenso klein wie hässlich, und die Stühle waren unbequem. Die Brüder verweigerten immer noch jegliche Kooperation, und die Vernehmungen zogen sich wieder einmal in die Länge. Erlendur hatte nichts anderes erwartet. Ellert und Vignir waren bereits seit einigen Tagen in U-Haft. Schon früher waren sie wegen Alkohol- und Drogenschmuggels mit der Polizei in Berührung gekommen. Sie waren vor zwei Jahren aus dem Gefängnis Litla-Hraun entlassen worden, doch der Aufenthalt im Gefängnis hatte nichts gebracht, da die beiden offenbar danach unverzüglich wieder in ihrem alten Metier weitermachten. Einiges wies sogar darauf hin, dass sie bereits vom Gefängnis aus neue Geschäfte in die Wege geleitet hatten. Die Vernehmungen sollten das ans Licht bringen.
Ein anonymer Hinweis hatte dazu geführt, dass die Polizei die beiden wieder ins Visier genommen hatte. Und diesmal war einer der Brüder mit vierundzwanzig Kilo Hasch in einem Schuppen in den Schrebergärten bei Korpúlfsstaðir erwischt worden. Auf den Parzellen bauten die Besitzer vor allem Kartoffeln an, doch in dem bewussten Schuppen wurden auch zweihundert Liter amerikanischer Wodka in Gallonenbehältern und etliche Kartons mit Zigarettenstangen gefunden. Vignir bestritt hartnäckig, von dieser Schmuggelware gewusst zu haben. Wahrscheinlich habe man ihn mit dieser Bruchbude linken wollen. Jemand, dessen Namen er nicht nennen wolle, habe ihm von dem Schuppen erzählt und ihm gesagt, dass man dort problemlos Kartoffeln klauen könne.
Die Brüder waren in den Tagen vor der Festnahme observiert worden. Bei der Hausdurchsuchung hatte man Cannabisprodukte gefunden, die bereits für den Weiterverkauf abgepackt waren. Die Brüder hatten so gut wie gar nichts an ihren Methoden geändert, seit sie vor einigen Jahren unter ganz ähnlichen Umständen gefasst worden waren. Marian Briem gingen diese Vernehmungen auf den Nerv, denn die Brüder waren trotz allem letzten Endes nur erbärmliche kleine Ganoven.
»Mit welchem Schiff ist die Ware gekommen?«, fragte Marian. Dieselbe Frage hatte Erlendur bereits zweimal gestellt.
»Was für ein Schiff? Es gibt kein Schiff! Wer hat euch so einen Scheiß erzählt?«, ereiferte sich Vignir. »War das etwa Elliði, dieser Vollidiot?«
»Was ist mit dem Hasch? Ist das auch per Schiff gekommen, oder per Luftpost?«, fragte Erlendur.
»Ich hab keinen blassen Schimmer, wem der gehört!«, antwortete Vignir. »Ich hab keine Ahnung, wovon du redest! Ich hab nix mit diesem Schuppen zu tun. Ich wollte bloß ein paar Kartoffeln klauen. Wieso macht ihr deswegen so ein Tamtam?«
»An diesem Schuppen befinden sich zwei Vorhängeschlösser, und du besitzt Schlüssel für beide. Und trotzdem willst du uns weismachen, dass du nur Kartoffeln klauen wolltest und überhaupt nichts mit dem Vorratslager dort zu tun hast?«
Vignir gab keine Antwort.
»Wir haben dich auf frischer Tat ertappt«, sagte Marian. »Wahrscheinlich ist das bitter für dich, aber damit musst du dich abfinden. Also hör auf mit diesem idiotischen Kartoffelklaugeschwätz, damit wir Feierabend machen können.«
»Ich bin der Letzte, der euch hier festhalten will«, entgegnete Vignir. »Meinetwegen könnt ihr euch verpissen.«
»Da hast du recht«, sagte Marian und sah Erlendur an. »Am besten machen wir jetzt Schluss.«
»Wieso glaubst du, dass Elliði dich hintergehen will?«, fragte Erlendur. Er wusste, dass dieser Elliði manchmal gemeinsame Sache mit den Brüdern gemacht hatte. Er brachte den Stoff unter die Leute und trieb das Geld ein. Er war gewalttätig und mehrmals wegen gefährlicher Körperverletzung verurteilt worden.
»Also war er es doch?«, fragte Vignir.
»Nein. Wir wissen nicht, wer es war.«
»Doch, bestimmt wisst ihr das.«
»Elliði ist doch ein Freund von euch?«, fragte Erlendur.
»Er ist ein Vollidiot.«
In diesem Augenblick öffnete sich die Tür, und ein Kriminalbeamter steckte seinen Kopf herein. Da er anscheinend etwas Wichtiges zu melden hatte, ging Marian hinaus auf den Flur.
»Was ist los?«
»Ein Leichenfund«, sagte der Beamte. »Auf Reykjanes, in der Nähe vom Energiewerk in Svartsengi.
Drei
Die Frau, die die Leiche entdeckt hatte, war um die dreißig. Sie erklärte Marian und Erlendur gleich zu Anfang, dass sie an Schuppenflechte litt, und zeigte ihnen zum Beweis die schorfigen Stellen an der Kopfhaut, am Arm und vor allem am Ellbogen. Als sie ihnen auch noch andere Stellen zeigen wollte, befand Marian, es sei genug und winkte ab. Es war ihr offenbar ungeheuer wichtig zu erklären, dass sie nur wegen ihrer Hautkrankheit die Leiche an diesem bizarren und abgelegenen Ort gefunden hatte.
»Meist bin ich dort ganz allein«, sagte sie und blickte Marian an. »Aber anscheinend hat es sich doch schon herumgesprochen. Ich habe gehört, dass inzwischen auch andere hierherkommen, obwohl ich noch nie jemandem begegnet bin. Es gibt hier keine Umkleidemöglichkeiten, aber das macht nichts. Das Wasser hat einfach eine ideale Temperatur, und es tut wahnsinnig gut, darin zu baden.«
Marian und Erlendur hatten die Frau zu ihrem Dienstwagen mitgenommen, der an der Straße nach Grindavík stand. Erlendur saß vorne auf dem Fahrersitz, und Marian hatte sich mit der Frau hinten ins Auto gesetzt. Zwei Streifenwagen und ein Rettungswagen parkten vor und hinter ihnen an der Straße. Die Mitarbeiter der Spurensicherung waren bereits unterwegs. Außerdem hatten sich auch schon zwei Fotoreporter der Tageszeitungen eingefunden, denn die Nachricht vom Leichenfund hatte sich in Windeseile herumgesprochen. Es gab nicht einmal einen richtigen Weg zur Lagune, die sich vor etwa drei Jahren wegen des Abwassers aus dem geothermalen Energiewerk ganz in der Nähe gebildet hatte. In dem Energiewerk wurde sowohl Heizwasser als auch Strom für die umliegenden Ortschaften produziert. Die Frau hatte den westlichsten Teil des türkisblauen Warmwassersees für sich entdeckt, der von der Straße nach Grindavík aus nur zu Fuß über die mit dickem Moos bewachsene Lava zu erreichen war. An dieser Stelle war der künstliche See sehr flach. Die Frau hatte sich dort eine Stunde lang in dem warmen Wasser entspannt und sich mit dem Heilschlamm aus Kieselerde, Algen und Meersalz eingerieben. Die Tage waren kurz, und die Dämmerung hatte bereits eingesetzt, deswegen wollte sie zurück zum Auto. Bei ihrem letzten Besuch war es schon so dunkel gewesen, dass sie sich fast zu ihrem Auto hatte vortasten müssen. Das wollte sie diesmal um jeden Preis vermeiden.
»Für mich ist das hier ein wunderbarer Ort, auch wenn er ziemlich gespenstisch wirkt. Das liegt an dem Dampf, der von dem warmen Wasser aufsteigt. Man ist da ganz allein in dieser bizarren Lavalandschaft, und … Ihr könnt euch gar nicht vorstellen, wie fürchterlich erschrocken ich war, als ich … Ich hatte mich weiter hinaus in die Lagune gewagt als zuvor, und auf einmal ragte da ein Schuh aus dem Wasser. Erst hab ich natürlich gedacht, es sei einfach nur ein Schuh, den jemand verloren oder weggeworfen hat. Als ich aber danach griff, saß das Ding an irgendwas fest, und ich … ich war so blöd, noch etwas stärker daran zu ziehen. Und dann merkte ich, dass das Ding … dass zu dem Schuh noch ein Bein gehörte.«
Die Frau verstummte. Der Leichenfund hatte sie augenscheinlich sehr verstört, und Marian Briem ging behutsam vor. Die Zeugin hatte es, so gut es ging, vermieden, die Leiche anzusehen, als die Helfer sie zur Straße trugen. Sie tat sich schwer damit, den Kriminalbeamten ihr Erlebnis zu schildern.
Erlendur versuchte, sie zu beruhigen. »Du hast dich angesichts dieser schlimmen Entdeckung wirklich ganz richtig verhalten«, sagte er.
»Ihr könnt euch nicht vorstellen, wie entsetzlich es war. Ich war zu Tode erschrocken. Ich war ja auch ganz alleine.«
Eine halbe Stunde zuvor war Erlendur in eine Anglerhose gestiegen, um in Begleitung von zwei Mitarbeitern der Spurensicherung zu der Leiche zu waten. Marian hatte das rauchend vom Ufer aus verfolgt. Die Polizisten aus Grindavík waren zuerst am Fundort eingetroffen, hatten aber darauf geachtet, vor dem Eintreffen der Kollegen von der Kripo in Reykjavík nichts anzurühren. Die Kriminaltechniker fotografierten die Leiche und die unmittelbare Umgebung. Die Blitze der Kameras beleuchteten die beklemmende Szenerie. Auch ein Taucher war schon unterwegs, der den Boden des künstlichen Sees untersuchen sollte. Erlendur beugte sich über die Leiche und versuchte festzustellen, wie sie an diesen Ort gelangt sein konnte. Das Wasser reichte ihm bis zur Taille. Als die Techniker meinten, genug gesehen zu haben, hatten sie die Leiche aus dem Wasser gehoben und sofort etwas außerordentlich Seltsames bemerkt. Die Extremitäten wiesen an vielen Stellen Frakturen auf, der Brustkasten war eingedrückt, und anscheinend war auch das Rückgrat gebrochen. Die Leiche hing beim Tragen so schlapp herunter wie ein nasser Sack.
Auf einer Bahre war der Körper über die schroffe Lava zum Rettungswagen an der Straße getragen worden, um ihn von dort in die Pathologie des Nationalkrankenhauses in Reykjavík zu überführen. Vor der Obduktion musste sie von dem weißen Kieselschlick befreit werden. Der Abend war schon fortgeschritten, und mit ihm war die Dunkelheit gekommen. Man hatte von Dieselaggregaten betriebene Scheinwerfer aufgestellt, in deren grellem Licht noch besser zu erkennen war, in welch fürchterlichem Zustand sich der Körper des Toten befand. Das Gesicht war eingedrückt, die Schädeldecke war aufgebrochen. Nach der Kleidung zu urteilen, handelte es sich um einen Mann. Er hatte keine Papiere bei sich, anhand deren er identifiziert werden konnte. Wie lange der Mann im Wasser gelegen hatte, ließ sich noch nicht sagen. Der Dampf, der von der Lagune aufstieg, hatte das Seinige zu dem unheimlichen Szenario beigetragen. Es war aber zu dunkel gewesen, um festzustellen, ob noch jemand anderes in der Nähe gewesen war. Die eigentliche Spurensuche würde erst am nächsten Tag erfolgen können.
»Und danach hast du dich sofort an die Polizei gewandt?«, fragte Marian die Zeugin jetzt. Erlendur hatte sich aus der Wathose geschält, bevor er sich ins Auto setzte. Der Motor lief, im Auto war es warm, und die Scheiben waren von innen beschlagen. Scheinwerfer beleuchteten das Gelände, man hörte Stimmen und sah die Schatten von hin und her eilenden Menschen.
»Ich bin so schnell es ging zurück zu meinem Auto, und dann bin ich zur Polizeistation in Grindavík gefahren«, antwortete die Frau. »Dann sind zwei Polizisten mit mir zurückgefahren, ich musste ihnen den Weg zeigen. Dann sind noch mehr Polizeiautos gekommen. Und jetzt ihr. Ich kann bestimmt heute Nacht nicht schlafen. Und wahrscheinlich auch die nächsten Tage nicht.«
»Ja, es ist schlimm, in so eine Situation zu geraten«, sagte Marian in beruhigendem Ton. »Kennst du nicht jemanden, der heute Abend bei dir sein könnte? Damit du nicht ganz allein bist. Und damit du über das reden kannst, was du erlebt hast.«
»Hast du in der Nähe jemanden bemerkt, als du heute Abend hierhergekommen bist?«, fragte Erlendur.
»Nein, bestimmt nicht. Ich hab doch schon gesagt, dass ich hier noch nie andere Leute getroffen habe.«
»Und du kennst auch niemanden, der die Lagune aus denselben Gründen wie du besucht und hier badet?«, fragte Marian.
»Nein. Was ist denn eigentlich mit dem Mann passiert? Habt ihr gesehen, wie schrecklich er … Mein Gott, ich mochte gar nicht hinschauen.«
»Selbstverständlich nicht«, entgegnete Marian.
»Diese Hautkrankheit, diese Schuppenflechte, ist sie schlimm?«, fragte Erlendur.
Marian warf ihm einen raschen Blick zu.
»Es kommen immer mal wieder Medikamente auf den Markt, die diese Krankheit angeblich ein wenig in Schranken halten«, antwortete die Frau. »Aber mir haben sie kaum geholfen. Der Juckreiz ist schlimm, aber noch schlimmer sind all die Stellen am Körper, wo jeder sehen kann, dass ich krank bin.«
»Und es hilft dir, wenn du in diesem Wasser badest?«
»Ja, ich finde schon. Wissenschaftlich ist es wohl nicht erwiesen, aber mir tut es gut.«
Sie lächelte Erlendur an. Marian stellte der Frau noch ein paar Fragen im Zusammenhang mit dem Leichenfund, danach konnte sie gehen. Sie stiegen aus, und die Frau beeilte sich, zu ihrem Auto zu kommen.
Erlendur stand mit dem Rücken gegen den Nordwind und drehte sich zu Marian um. »Ist es nicht ziemlich offensichtlich, weshalb der Mann so übel zugerichtet ist?«, fragte er Marian.
»Du glaubst, dass ihn jemand zu Tode geprügelt hat?«
»Was denn sonst?«
»Ich weiß nur, dass er übel zugerichtet ist. Ja, vielleicht hat er sich hier mit jemandem getroffen, und dabei kam es möglicherweise zu Tätlichkeiten. Und dann sollte er wohl für immer und ewig in der Lagune verschwinden.«
»Irgendwas in der Art.«
»Klingt einleuchtend. Aber ich bin mir trotzdem nicht sicher, dass der Mann zu Tode geprügelt wurde«, entgegnete Marian und fügte hinzu: »Ich habe mir die Leiche angesehen, bevor sie abtransportiert wurde. Die Verletzungen rühren nie im Leben von einer normalen Schlägerei her.«
»Was meinst du damit?«
»Ich habe deformierte Körper gesehen, die aus großer Höhe auf dem Boden aufgeschlagen sind, und genau danach sieht es mir aus. Auch nach einem besonders schweren Verkehrsunfall könnte ein Körper so aussehen. Uns liegen aber keine Meldungen über einen Unfall vor.«
»Wenn es ein Sturz war, dann muss er tatsächlich aus sehr großer Höhe erfolgt sein«, sagte Erlendur. Er blickte sich um und sah zum schwarzen Himmel hinauf. »Es sei denn, er ist von da oben gekommen. Vielleicht ist er vom Himmel gefallen.«
»Um genau hier im See zu landen?«
»Ist das völlig abwegig?«
»Ich weiß nicht …«, entgegnete Marian.
»Es macht die Sache nicht besser, dass er wahrscheinlich schon einige Zeit in dieser komischen Brühe gelegen hat.«
»Da hast du recht.«
»Vermutlich ist er also nicht hier in der Lava brutal zusammengeschlagen worden«, sagte Erlendur. »Jemand hat die Leiche nur aus dem Grund hierher befördert, damit sie nicht so schnell gefunden wird. Das Opfer war bereits tot, als es in diesem seltsamen See landete.«
»Kein schlechteres Versteck als viele andere auch«, erklärte Marian.
»Vor allem, wenn die Leiche untergegangen wäre. Hier kommt ja außer dem einen oder anderen Kranken niemand hin.«
»Warum hast du sie dazu gezwungen, mit dir über ihre Krankheit zu sprechen?«, fragte Marian, als die Frau losgefahren war. »Du solltest es dir abgewöhnen, dich in die Privatangelegenheiten anderer Menschen einzumischen.«
»Sie fühlte sich nicht wohl, das hast du doch auch bemerkt. Ich wollte nur, dass sie sich wieder beruhigt.«
»Du bist bei der Kripo und kein Seelsorger.«
»Die Leiche ist nur deswegen gefunden worden, weil diese Frau wegen ihrer Schuppenflechte in diesem sonderbaren See gebadet hat«, sagte Erlendur. »Meinst du nicht auch, dass es …?«
»Ja, es ist ein ziemlich seltsamer Zufall.«
»In der Tat.«
»Aber es gibt wohl noch viel seltsamere Zufälle. Verdammte Kälte«, sagte Marian und öffnete die Wagentür.
»Weißt du zufällig, wie dieses Lavafeld heißt?«, fragte Erlendur und blickte zu dem Stationshaus des Heißwasserwerks hinüber, wo dicke Dampfwolken zum Himmel stiegen und sich in der nächtlichen Finsternis auflösten.
Die Antwort ließ nicht auf sich warten.
»Illahraun, die üble Lava«, sagte Marian und setzte sich wieder ins Auto. »Entstanden ist sie 1226.«
»Üble Lava?«, sagte Erlendur und öffnete seine Tür. »Das wird ja immer schöner.«
Vier
Am nächsten Tag bestätigte der Pathologe den Verdacht, dass keine Schlägerei, sondern nur ein Sturz aus großer Höhe als Todesursache in Frage kam. Der Arzt sagte, es sei nicht möglich gewesen, die genaue Zahl der Knochenbrüche festzustellen. Er ging davon aus, dass der Mann aus etlichen Metern Höhe gestürzt sein musste, und der Aufschlag sei frontal erfolgt. Die Knochenbrüche zeigten, dass er nicht mit den Füßen zuerst gelandet war. Der Arzt war sich außerdem ziemlich sicher, dass der Mann keine Zeit gehabt hatte, sich zum Schutz die Hände vors Gesicht zu halten. Allen Anzeichen nach war er der Länge nach auf einen extrem harten Untergrund geprallt. Nach den vorläufigen Untersuchungsergebnissen war es so gut wie ausgeschlossen, dass der Tote von einem Felsen oder einer Klippe auf Reykjanes abgestürzt war. Der Untergrund, auf dem er landete, war ganz flach gewesen. Außerdem gab es keine Anzeichen dafür, dass der Mann sich irgendwo oben in den Bergen oder an den Meeresklippen aufgehalten hatte. Seine Kleidung ließ zumindest nicht darauf schließen. Jeans und eine Lederjacke und darunter nur ein Hemd. Bei den Lederstiefeln mit schmaler Spitze, erhöhten Absätzen und Ziernähten handelte es sich um amerikanische Westernstiefel.
»Aus was für einer Brühe habt ihr den armen Teufel eigentlich rausgefischt?«, fragte der Pathologe und blickte abwechselnd Marian Briem und Erlendur an. »Sowas ist mir noch nie untergekommen.«
Der Arzt hatte nur noch wenige Jahre bis zur Pensionierung. Als er sich über die Leiche beugte, sah man ihm an, dass er nicht mehr der Jüngste war. Auf seiner Nase klemmte eine dicke Hornbrille, sein Haar war weiß geworden. Der hagere Mann trug einen Arztkittel mit einer Gummischürze. Die Leiche auf dem Obduktionstisch wurde von gleißendem, kaltem Licht beleuchtet. Diverse Messer und Zangen lagen auf einem Tablett. Der ganze Raum roch nach Formalin, nach Desinfektionsmitteln und geöffneten Menschenleibern. Erlendur fühlte sich unwohl. Er wusste, dass er sich an einen Ort wie diesen, einen Ort des Todes, niemals gewöhnen würde, und deshalb vermied er es, genauer hinzuschauen. Marian Briem hingegen hatte sich ein dickes Fell zugelegt und zeigte keinerlei Gemütsregung angesichts des Anblicks, der sich ihnen auf dem Seziertisch bot.
»Er wurde in Svartsengi gefunden, dort wird Abwasser aus dem Heißwasserkraftwerk in die Lava geleitet«, sagte Marian. »Es enthält enorm viele Kieselablagerungen, Algen und Mineralien, und die bilden den weißen Schlick. Er soll angeblich Heilkräfte besitzen.«
»Heilkräfte?«, wiederholte der Arzt verwundert.
»Angeblich hilft das Zeug bei Psoriasis«, sagte Erlendur.
»Man lernt nie aus«, entgegnete der Arzt.
»Gab es bei dem Toten Anzeichen für diese Krankheit?«
»Nein. Er ist auf keinen Fall wegen Psoriasis dort gewesen, Marian.«
»Könnte es sein, dass der Mann aus einem Flugzeug in die Lagune stürzte?«
»Aus einem Flugzeug?«
»Es ist nur eine Idee. In Anbetracht der Verletzungen muss die Fallhöhe doch sehr beträchtlich gewesen sein.«
»Ich kann nicht mehr sagen, als dass er aus sehr großer Höhe gefallen und auf einen extrem harten Untergrund geprallt sein muss«, erklärte der Arzt. »Ob aus einem Flugzeug, kann ich nicht sagen. Ich kann es aber auch nicht ausschließen.«
»Kannst du uns sagen, wie lange er in der Lagune gelegen hat?«, fragte Marian.
»Auf keinen Fall sehr lange«, antwortete der Pathologe. »Vermutlich zwei oder drei Tage. Ich gehe davon aus, dass der Sturz aus großer Höhe den sofortigen Tod des Mannes zur Folge gehabt hat. Und wenn ihr mich fragt, wann er gestorben ist, würde ich sagen, ebenfalls vor zwei oder drei Tagen. Ich bin noch nicht fertig mit meiner Arbeit, dies ist nur meine Einschätzung zum gegenwärtigen Stand der Dinge.«
»Einen Ehering trägt er nicht«, warf Erlendur nach einem Blick auf die Leiche ein. »Und es gibt auch keine entsprechenden Spuren an einem der Finger.«
»Nein«, entgegnete der Arzt. »Und auch sonst haben wir nichts bei ihm gefunden, womit man ihn identifizieren könnte, keine Brieftasche, keine Schlüssel oder dergleichen. Nichts, was uns Auskunft darüber geben könnte, wer dieser Mann ist. Seine Kleidung ist bei der Spurensicherung. An dem Corpus selbst habe ich keine großen Narben wie nach einem Unfall oder einer Operation feststellen können, und es gibt auch keine Tätowierungen.«
»Wie alt war er ungefähr?«
»Ein Mann im allerbesten Alter, würde ich sagen, so um die dreißig. Knapp eins achtzig groß, gut proportioniert, schlank und kräftig gebaut. Hat denn noch niemand nach dem Mann gefragt?«
»Nein«, sagte Erlendur. »Bislang hat ihn anscheinend noch niemand vermisst. Zumindest ist noch keine Anfrage bei der Polizei eingegangen.«
»Und es gibt keine Zeugen für einen Fall aus einer solchen Höhe?«
»Nein. Bis jetzt gibt es nichts, worauf wir uns stützen könnten.«
»Käme möglicherweise auch ein schwerer Verkehrsunfall in Frage?«, wollte Marian wissen. »Könnten die Verletzungen dadurch zustande gekommen sein?«
»Nein. Das kann ich ausschließen. Die Verletzungen dieses Mannes sind ganz anderer Art«, entgegnete der Arzt. Er sah von der Leiche hoch und schob seine Hornbrille, die ihm bis auf die Nasenspitze gerutscht war, wieder an ihren Platz. »Wir müssen davon ausgehen, dass er aus sehr großer Höhe gestürzt ist. Und wie bereits gesagt, der Mann hat keinen Versuch unternommen, sich gegen den Aufprall zu schützen. Er fiel einfach runter und landete aus irgendeinem Grund waagerecht und vollkommen flach auf dem Boden. Ich weiß nicht, ob euch das weiterhilft. Möglicherweise hat er keine Zeit gehabt, sich mit seinen Händen vor dem Aufprall zu schützen. Oder er wollte es nicht. Ein Fall aus einer so großen Höhe verläuft unglaublich schnell. Der Mann ist mit enormer Geschwindigkeit unten aufgeprallt.«
»Wenn er sich nicht einmal mit den Händen zu schützen versucht hat und einfach waagerecht auf den Boden aufgeschlagen ist, wie du sagst, käme dann möglicherweise auch ein Selbstmord in Frage?«, fragte Erlendur.
»Denkbar ist das«, antwortete der Arzt. Er musste wieder seine Brille hochschieben. »Ich weiß es nicht. Doch vielleicht sollte man auch diese Möglichkeit in Betracht ziehen.«
»Ist das denn nicht eher unwahrscheinlich?«, sagte Marian. »Wieso hätte dann jemand anderes die Leiche verstecken wollen?«
»Ich versuche nur, die Fragen im Hinblick auf die Frakturen zu beantworten«, sagte der Pathologe. »Ich werde das alles noch genauer untersuchen. Und damit werde ich beginnen, sobald ihr mir Zeit dazu lasst.«
***
Für die Kriminaltechniker von der Spurensicherung war es nicht leicht, in dem Lavafeld zwischen der Straße nach Grindavík und der Lagune nach Spuren oder Indizien zu suchen. In der Nacht nach dem Fund der Leiche hatte es geschneit, und der Schnee verdeckte nun sämtliche Spuren, die sich dort hätten befinden können. Außerdem war das Wasser im See so milchig, dass auch der Taucher keine Spuren in dem weißen Schlick finden konnte. Man suchte nach Zeugen, die an den Tagen vor dem Leichenfund auf der Straße nach Grindavík unterwegs gewesen waren, in der Hoffnung, dass jemand dort ein Auto oder etwas anderes Auffälliges bemerkt haben könnte. Niemand meldete sich.
Der Chef der Spurensicherung, ein Mann über sechzig, gab Erlendur die Hand. Er stand neben den Kleidungsstücken, die der Tote getragen hatte. Unterwäsche und Socken, Jeans und ein kariertes Hemd und außerdem eine Lederjacke und Westernstiefel. Die kriminaltechnische Abteilung befand sich in der obersten Etage des Gebäudes in Kópavogur, in dem die Kriminalpolizei untergebracht war. Sie war erst vor Kurzem in diese Räumlichkeiten eingezogen, nachdem das Landeskriminalamt gegründet worden war.
Erlendur hatte als normaler Polizist im Streifendienst angefangen und war erst vor ein paar Jahren zur Kriminalpolizei gewechselt. Immer noch lernte er neue Methoden und neue Kollegen kennen. Marian Briem stand in dem Ruf, die größte Erfahrung in der Abteilung zu haben, und hatte deswegen am häufigsten mit Erlendur zusammengearbeitet. Und ihn zu dem Schritt ermuntert, zur Kripo zu wechseln. Dennoch hatte er zunächst lange gezögert. Erst als ihn die tagtägliche Routine als Streifenpolizist zu langweilen begann, hatte er sich dazu entschlossen.
»Na endlich«, hatte Marian Briem gesagt, als er vorsprach. »Du wusstest doch die ganze Zeit, dass du eines Tages hier landen würdest.«
Erlendur konnte nicht leugnen, dass er sich schon seit langem für die Aufgaben der Kriminalpolizei interessierte. Er hatte vor einiger Zeit auf eigene Faust Nachforschungen zum Tod eines Stadtstreichers angestellt, dem er auf seinen Streifengängen mehrmals begegnet war. Angeblich war der Mann in einem Torfstichgebiet vor den Toren der Stadt ertrunken, doch Erlendur hatte nachweisen können, dass der Mann ermordet worden war. Marian Briem war damals sehr angetan davon gewesen, wie Erlendur den Fall ganz allein und ohne Unterstützung durch die Kriminalpolizei gelöst hatte, und hatte ihn dazu ermuntert, diesen Weg weiterzuverfolgen. Doch Erlendur hatte drei Jahre gebraucht, um sich endlich zu entschließen. Marian Briem hatte es also auf den Punkt gebracht, denn in der Tat hatte Erlendur schon immer gewusst, dass er eines Tages zur Kriminalpolizei wechseln würde.
Der weiße Schlick aus der Lagune war sorgfältig von der Kleidung des Toten entfernt worden. Alles, was dabei entdeckt worden war, wie Haare oder Flecken, hatte man genauestens untersucht.
»Das Auffälligste ist der Schlick aus diesem Gewässer«, sagte der Leiter der Spurensicherung. »Spontan kommt es mir so vor, als hätte man ihn in dieser Brühe versenkt, um etwas anderes zu überdecken.«
»Etwas an der Leiche?«
»Ja. Wir können aber kaum was Stichhaltiges finden. Die Kleidung sagt einem das ein oder andere. Sie stammt komplett aus den USA. Seine Jeans sind von einer sehr bekannten Firma, genau wie die Lederjacke. Das Hemd könnte allerdings auch aus diesem Laden für Arbeitsklamotten in der Hverfisgata kommen. Die Unterwäsche ist von einem amerikanischen Hersteller. Über die Socken wissen wir nichts, außer dass sie schwarz sind und nur wenig getragen wurden. Das älteste und am längsten getragene Kleidungsstück ist die Lederjacke, das kann man hier an den Ellbogen erkennen«, sagte der Chef der Spurensicherung und hielt Erlendur das Teil hin.
»Aber die hier könnten einen vielleicht weiterbringen«, fuhr der Mann fort und reichte Erlendur einen Westernstiefel. »Echtes Leder und ziemlich neu. Die werden nicht in vielen Läden geführt. Möglicherweise können uns Angestellte in Schuhläden weiterhelfen, sie kennen vielleicht sogar den Käufer mit Namen. Es gibt nicht viele Leute, die mit so etwas rumlaufen, oder sagen wir mal, nicht viele Isländer. Die Erde an den Sohlen wird noch untersucht, möglicherweise gibt uns das irgendwelche Hinweise. Leider hat aber der Schlamm aus der Lagune fast alles überdeckt.«
Erlendur warf einen Blick auf die Kleidung, die Jeans und das karierte Hemd und sah sich vor allem den Stiefel genauer an. Er war aus braunem Leder, die Sohle war etwas abgenutzt. Die Ziernähte an den Waden stellten ein Lasso dar.
»Kannst du sehen, woher diese Stiefel kommen? Wo sie hergestellt wurden?«
»Louisiana, hier innen sieht man das.«
»Ziemlich amerikanisch, das Ganze.«
»Vielleicht ist er ja erst vor Kurzem in Amerika gewesen. Das wäre durchaus denkbar.«
»Oder aber er ist Amerikaner«, entgegnete Erlendur.
»Ja, oder das.«
»Also jemand von der amerikanischen Basis?«
Ein Achselzucken war die Antwort. »Muss nicht sein, aber ausschließen können wir es nicht.«
»Leben dort nicht fünf- oder sechstausend Menschen, die Soldaten und deren Familien?«
»Etwas in der Art. Man kann zwar nicht behaupten, dass sich dieser See in unmittelbarer Nähe zur Basis befindet, aber trotzdem ist er nahe genug, um auch die Amis in Betracht zu ziehen.«
Fünf
Erlendur war lange nicht mehr durch diese Straße gegangen. Der Gedanke an das Mädchen Dagbjört, das hier früher einmal lebte, hatte ihn jedoch nie losgelassen. Vor einigen Jahren war er auf ihre Geschichte gestoßen. Sie war vor mehr als fünfundzwanzig Jahren eines Morgens spurlos verschwunden, und bislang hatte niemand eine Antwort auf die Frage gefunden, was aus ihr geworden war. Laut den Polizeiprotokollen hatte sie bei ihren Eltern in der Weststadt gelebt und das Mädchengymnasium besucht – doch an jenem Morgen schien sie der Erdboden verschluckt zu haben. Erlendur war etliche Male den Weg gegangen, den sie von ihrem Elternhaus zur Schule genommen hatte. Am ehemaligen Camp Knox vorbei, einem Barackenviertel aus der Kriegszeit, und über die Hringbraut in Richtung des Stadtteichs, vorbei am Fußballstadion Melavöllur und am alten Friedhof an der Suðurgata. Es kam immer wieder vor, dass Menschen auf unerklärliche Weise verschwanden und nicht gefunden wurden. Doch aus irgendwelchen Gründen hatte das Schicksal dieses Mädchens Erlendur besonders berührt. Er hatte sich alle verfügbaren Informationen verschafft, Polizeiberichte und Zeitungsmeldungen, und zudem war er auch sämtliche denkbaren Wege abgegangen, die sie von ihrem Zuhause auf dem Weg zur Schule hätte einschlagen können. Er hatte manchmal sogar überlegt, ob er ihre Angehörigen und ihre Freunde befragen sollte, aber es nie in die Tat umgesetzt. Viel Zeit war inzwischen verstrichen, und alles deutete immer noch nur auf eines hin – das Mädchen musste sich das Leben genommen haben. Trotzdem konnte sich Erlendur immer noch nicht von den Gedanken an ihr Schicksal lösen, auch wenn er versuchte, es zu verdrängen und den ganzen Fall zu vergessen. Das Mädchen verfolgte ihn sogar bis in seine Träume hinein, wie ein Gespenst aus einem kalten Grab. Und immer wieder passierte etwas, wodurch er auf irgendeine Weise an Dagbjört erinnert wurde.
Diesmal waren es die Nachrufe auf den Vater des Mädchens, die Erlendur morgens in der Zeitung gelesen hatte. Die Mutter war schon ein paar Jahre vorher gestorben. Es gab zwei Nachrufe, und in beiden wurde das unerklärliche Verschwinden der Tochter erwähnt, doch es wurde nicht in den Vordergrund gerückt. Einer stammte aus der Feder eines Mitarbeiters des Toten, der vor allem betonte, was für ein solider und verlässlicher Kollege der Verstorbene gewesen war und wie er es genossen hatte, nette Abende im Freundeskreis zu verbringen – auch wenn der Verlust der Tochter ihn für den Rest seines Lebens gezeichnet hatte. Der andere Nachruf stammte von der Schwester des Toten. Sie beschrieb, wie ihr Bruder in jüngeren Jahren gewesen war. Die Geschwister stammten aus einer kinderreichen Familie, in der alle immer eng zusammengehalten hatten. Doch ihr Bruder und seine Frau hatten auf eine ganz und gar unerklärliche Weise den Sonnenschein ihres Lebens verloren. In den Worten der Schwester glaubte Erlendur zwischen den Zeilen eine alte Bitterkeit herauszulesen. Er spürte, dass die Zeit es nicht geschafft hatte, den Schmerz zu lindern. Das tat sie ja ohnehin nur selten.
Es ging schon auf Mitternacht zu, als Erlendur endlich kehrtmachte und nach Hause ging. Das frühere Elternhaus des Mädchens stand jetzt leer, im Küchenfenster zur Straße hin hatte ein Immobilienmakler sein Schild platziert: ZU VERKAUFEN. Die Eigentümer waren allem Anschein nach ausgezogen. Der Wind kam immer noch aus dem Norden, und den Wetternachrichten war zu entnehmen, dass dies noch eine ganze Weile der Fall sein würde. Feines Schneegeriesel stob über die Bürgersteige, und Erlendur zog den Mantel enger um sich, als er die Straße entlangging.
Marian und er hatten den Großteil des Abends damit verbracht, über den Toten aus der Abwasserlagune des Kraftwerks zu sprechen. Ein ganzer Tag war seit dem Leichenfund verstrichen, aber noch immer hatte sich niemand gemeldet, der ihn vermisste oder von der Beschreibung her erkannt hatte, die in den Medien verbreitet worden war. Der Tote schien weder Familie noch Freunde gehabt zu haben. Marian hatte sich auf einer uralten Couch im Büro ausgestreckt, als Erlendur von der Besprechung mit der Spurensicherung zurückkehrte. Marian hatte darauf bestanden, das schäbige alte Möbel aus den früheren Räumlichkeiten der Kripo mitzunehmen.
»Ein Amerikaner?«, stieß Marian überrascht hervor, als Erlendur berichtete, was ihm der Chef der Spurensicherung gesagt hatte.
»Es ist zumindest eine Möglichkeit«, entgegnete Erlendur.
»Mit anderen Worten, ein Militärangehöriger?«
»Der Flugplatz in Keflavík ist auch ein internationaler Flughafen. Der Typ kann also auch aus ganz vielen anderen Ecken der Welt stammen. Jedenfalls muss es nicht unbedingt ein Isländer gewesen sein. Aber es kann auch nicht ausgeschlossen werden, dass er aus einem Flugzeug über der Lagune abgeworfen wurde. Und die Maschine hätte sowohl aus Reykjavík als auch aus einer anderen Richtung kommen können, nicht zuletzt von der Basis.«
»Was willst du mir damit sagen?«
»Wir sollten vielleicht mal den Flugverkehr über diesem Gebiet überprüfen, vor allem die kleinen Privatflugzeuge. Vielleicht sollten wir auch mal auf der Basis anfragen, ob die einen von ihren eigenen Leuten vermissen.«
»Weil er diese Cowboystiefel trug?«, fragte Marian.
»Alle seine Klamotten sind amerikanischer Herkunft, oder sagen wir mal, fast alle. Durchaus denkbar, dass man sowas alles auch hier in Reykjavík kaufen kann. Das allein beweist natürlich noch nichts.«
»Gibt es noch andere Gründe?«
»Die Nähe zum Stützpunkt.«
»Du willst also eine Verbindung zwischen der amerikanischen Kleidung und der amerikanischen Basis herstellen, um daraus zu folgern, dass unser Toter von dort kommt? Findest du nicht, dass das etwas weit hergeholt ist?«
»Ja, klar«, entgegnete Erlendur. »Aber mit Blick auf die Kleidung und die Nähe zum Stützpunkt ist es doch ganz normal, eine Anfrage an die offiziellen Stellen dort zu richten. Wenn sowas oben im Nordosten, sagen wir mal in Raufarhöfn, passiert wäre, würde ich vermutlich keinen Gedanken daran verschwenden. Aber da sich der Stützpunkt nun mal hier im Südwesten befindet, sollte man vielleicht auch die Frage stellen dürfen, ob dort jemand vermisst wird.«
»Die sind nicht verpflichtet, uns so etwas zu melden. Sowas machen die doch nur, wenn es ihnen in den Kram passt.«
»Wir hätten diese Möglichkeit dann aber immerhin abgecheckt.«
»Müssten die nicht inzwischen auch spitzgekriegt haben, dass nicht weit von der Basis eine Leiche gefunden wurde?«
»Selbstverständlich.«
»Hätten sie sich dann nicht von sich aus mit uns in Verbindung gesetzt, falls der Verdacht bestünde, dass es sich um jemanden aus ihren eigenen Reihen handelt?«
»Vielleicht«, sagte Erlendur. »Ich weiß es nicht. Ich weiß nicht, wie solche Typen denken. Die ziehen doch einfach ihr Ding durch, ohne sich Kopfzerbrechen über die Einheimischen zu machen.«
»Solche Typen?«, fragte Marian. »Hört sich an, als hättest du was gegen das Militär?«
»Spielt das eine Rolle?«
»Ich weiß es nicht«, erklärte Marian. »Hast du was gegen die Amis?«
»Ich bin einfach nur dagegen, dass es Militär auf Island gibt.«
Der Nordwind blies immer noch, als Erlendur sich dem Ort näherte, wo im Zweiten Weltkrieg das Camp Knox gestanden hatte. Island war zuerst von britischen Truppen besetzt worden, doch nach dem Eintritt der Vereinigten Staaten in den Krieg hatten die Amerikaner sie größtenteils abgelöst. Dort, wo sich Camp Knox befunden hatte, war jetzt das Schwimmbad im Reykjavíker Westend, und drum herum waren viele andere Gebäude errichtet worden, vor allem Wohnhäuser. Nichts erinnerte mehr an das Camp mit seinen Nissenhütten, in dem sich der Hauptsitz der Iceland Defense Force auf Island befunden hatte. Benannt war es nach Frank Knox, dem damaligen amerikanischen Marineminister. Das Camp hatte sich kaum von den etwa achtzig anderen Militärlagern unterschieden, die während des Krieges in Reykjavík entstanden waren, aber es war eines der größten gewesen. Diese Barackensiedlungen waren inzwischen allesamt dem Erdboden gleichgemacht worden, doch direkt nach Kriegsende hatten sie eine wichtige Bedeutung gehabt. Damals herrschte in der Hauptstadt akuter Wohnungsmangel, da sehr viele Menschen vom Land in die Stadt gezogen waren. Nach dem Abzug der Soldaten waren dort Isländer eingezogen. Als die Wohnungsnot am größten war, lebten nicht weniger als dreitausend Isländer in solchen primitiven Unterkünften.
Erlendur konnte sich an einige der Barackenviertel erinnern, die noch zu der Zeit existierten, als seine Eltern sich gezwungen sahen, in die Stadt zu ziehen. In diesen Camps hatte er mehr Armut gesehen als je zuvor in seinem Leben, die Barackenquartiere der Amerikaner waren nach dem Krieg zu regelrechten Armenvierteln für Isländer geworden. Die Nissenhütten bestanden aus Wellblech, dünnen Masonitplatten und Pappmaché. Kanalisation gab es keine, das Abwasser lief unter den Fußbodenplanken entlang – ein Tummelplatz für Ratten. Auch wenn dort viele anständige und ehrbare Leute lebten, hatten diese Viertel einen schlechten Ruf. Einerseits wegen der miserablen Wohnverhältnisse, aber nicht zuletzt auch wegen des berüchtigten, ausschweifenden Lebenswandels der Bewohner. Die Menschen, die dort lebten, wurden verächtlich »Camper« genannt. Für die sogenannte bessere Gesellschaft waren sie angeblich schon von Weitem an ihrem speziellen Camp-Mief zu erkennen.
Den Polizeiberichten aus jenen Jahren war zu entnehmen, dass der Schulweg das Mädchen wie jeden Morgen an der Barackensiedlung vorbeigeführt hatte. Bei der Fahndung nach ihr hatte man sich darauf konzentriert und versucht herauszufinden, ob sie das Viertel möglicherweise auch betreten hatte. Hausdurchsuchungen wurden in verschiedenen Baracken durchgeführt und auch in allen möglichen anderen Behelfsunterkünften in der unmittelbaren Umgebung. Viele von den Leuten, die befragt wurden, ob sie das Mädchen gesehen hatten, nahmen an der Suche teil. Aber genau wie bei all den anderen Suchaktionen kam nichts dabei heraus.
Camp Knox wurde von der Polizei vor allem deshalb ins Visier genommen, weil die verschwundene Dagbjört kurz vor ihrem Verschwinden einer Freundin gesagt hatte, dass sie einen jungen Mann kennengelernt habe, der dort lebe. Die Freundin hatte das so verstanden, als hätte sich Dagbjört in den Jungen verliebt.
Man hatte aber nie herausgefunden, wer dieser junge Mann war.
Sechs
Es war schon nach Mitternacht, und Marian Briem war auf der alten Couch im Büro eingeschlafen, als plötzlich das Telefon schrillte. Alle anderen hatten das Haus längst verlassen. Das Telefon klingelte so penetrant, dass Marian sich schließlich gezwungen sah aufzustehen, den Hörer abzunehmen und zu antworten.
»Was zum Kuckuck soll das? Weißt du nicht, wie spät es ist?«
»Marian?«
»Ja.«
»Entschuldige. Ist es wirklich schon so spät?«
Es war der Pathologe. Marian setzte sich an den Schreibtisch und sah auf die Armbanduhr.
»Hat es nicht Zeit bis morgen?«
»Möglich, ja«, sagte der Arzt. »Ich wollte dich wirklich nicht stören. Wie spät ist es eigentlich?«
»Mitternacht«, sagte Marian
»Oh Mann, das darf doch nicht wahr sein«, sagte der Arzt. »Ich hatte keine Ahnung, wie spät es ist. Ich ruf dich morgen Vormittag an, ich muss jetzt unbedingt nach Hause. Entschuldige bitte, ich habe wirklich überhaupt nicht auf die Zeit geachtet.«
Marion kannte den Pathologen. Er hieß Herbert und lebte seit dem Tod seiner Frau vor einigen Jahren allein. Kinder hatten sie nicht gehabt. Nach einer neuen Partnerin zu suchen wäre ihm nie eingefallen. Marian kannte den Mann ziemlich gut und hatte ihm das früher einmal bei einer Begegnung im Leichenhaus vorgeschlagen, aber dieser Ratschlag war nicht auf fruchtbaren Boden gefallen.
»Aber weswegen hast du angerufen?«, fragte Marian, inzwischen ein wenig wacher. »Gibt’s was Neues?«
»Soll ich dich nicht doch lieber morgen früh nochmal anrufen?«
»Nein. Jetzt rück schon damit raus, du hast mich ja ohnehin geweckt.«
»Der Mann hat abgekaute Fingernägel.«
»Der Tote aus der Lagune?«
»Die Nägel sind fast bis aufs Nagelbett runtergekaut. Höchstwahrscheinlich schon seit Kindertagen. Aber das hilft euch wohl auch nicht weiter.«
»Und warum erzählst du mir das?«
»Ach, weil ich dachte, man könnte da vielleicht etwas unter seinen Nägeln finden, falls es zu irgendwelchen Tätlichkeiten gekommen sein sollte.«
»Okay, verstanden.«
»Mir kommt es so vor, als sei er Handwerker gewesen. Als hätte er in einer Werkstatt gearbeitet. Das Wasser in diesem komischen See, oder was auch immer das ist, hat zwar eventuelle Schmutzspuren rings um die Nägel beseitigt, aber ich habe trotzdem Rückstände von Öl und Fett feststellen können. Und was anderes als ein Mechaniker und eine Werkstatt fallen mir dazu nicht ein.«
»Fett?«
»Ja. Nicht nur Dreck.«
Der Pathologe beschrieb Marian genau, was er analysiert hatte. Die Hände des Mannes waren über und über mit kleinen Wunden oder Schnitten bedeckt, alten und neueren. Außerdem wiesen die Schwielen an den Händen auf eine körperliche Tätigkeit hin. Er kannte derartige Verletzungen, weil seine beiden Brüder Automechaniker waren. Deswegen hatte es für ihn nahegelegen, dass der Mann von seiner Hände Arbeit gelebt hatte, dass er Handwerker oder ein einfacher Arbeiter gewesen sein musste. Der Tote konnte nicht älter als fünfunddreißig sein, und in seinem Mund gab es genügend Zähne, um sie mit zahnärztlichen Befunden zu vergleichen, falls es nicht möglich sein würde, die Leiche auf andere Weise zu identifizieren.
»Willst du damit vielleicht sagen, dass die Lagune Spuren dieser Art verdecken sollte?«, fragte Marian. »Dreck an den Händen? Kleinere Verletzungen?«
»Meiner Meinung nach sollte die Leiche ganz einfach in diesem See entsorgt werden, sonst nichts. Aber es steht mir nicht zu, daraus Schlüsse zu ziehen.«
»Hast du irgendwas bemerkt, was darauf hinweisen könnte, dass der Tote Amerikaner war? Ein Ausländer? Ein Ami von der Basis?«
»Ein Soldat?«
»Ja, möglich.«
»Er hat Westernstiefel getragen, aber …«
»Das reicht nicht. Hast du sonst noch was gefunden, was ihn mit dem Stützpunkt in Verbindung bringen könnte? Erlendur wollte auch diese Möglichkeit in Betracht ziehen.«
»Mir ist nichts dergleichen aufgefallen. Ich muss aber nochmal auf eines hinweisen«, sagte der Arzt. Es war ihm anzuhören, dass er müde war, es war ja auch schon reichlich spät.
»Auf was?«
»Dass der Mann nach einem Sturz aus sehr großer Höhe den Tod gefunden hat, darüber haben wir ja schon gesprochen. Wie gesagt, er muss auf einen flachen Untergrund aufgeprallt sein, auf einen Bürgersteig oder auf Asphalt, möglicherweise auch auf einen harten Steinboden.«
»Das hast du uns bereits gesagt.«
»Kann sein, dass ich mich wiederhole, aber bei diesem Toten ist einiges seltsam. Beispielsweise, dass er horizontal aufgeprallt ist, ohne sich schützend die Hände vor das Gesicht zu halten. Ihr habt auch die Möglichkeit einbezogen, dass er aus einem Flugzeug direkt in die Lagune gestürzt ist, aber daran glaube ich nicht. Das Wasser hätte den Aufprall gemildert. Dort, wo er abgestürzt ist, war der Untergrund viel härter.«
»Der Mann ist also aus großer Höhe abgestürzt«, sagte Marian gähnend. »Darauf deutet alles hin. Also Unfall, Selbstmord oder vorsätzlicher Mord. Falls es sich um einen Unfall oder einen Selbstmord handelt, ist es sehr merkwürdig, dass jemand die Leiche in diesem Schlammloch versteckt hat. Falls es sich um Mord handelt, ist es verständlich, dass jemand irgendwelche Spuren verwischen wollte. Ich denke, Selbstmord können wir ausschließen. Ein Unfall lässt sich wohl nicht ganz ausschließen, doch dann müssen wir herausfinden, weshalb nichts davon an die Öffentlichkeit gelangt ist. Mord ist für mich die einleuchtendste Alternative.«
»Genau deswegen wollte ich auch sofort wissen, was du von meiner Entdeckung hältst«, sagte der Arzt. »Ich habe im Nacken des Toten etwas gefunden, was sozusagen eindeutig erkennbar ist und nichts mit dem Sturz zu tun hat.«
»Und was ist das?«
»Eine hässliche Verletzung. Die habe ich nicht gleich bemerkt, weil sie durch sein Haar verdeckt war. Soweit ich sehen kann, hat der Mann einen schweren Hieb auf den Kopf bekommen.«
»Tatsächlich?«
»Da gibt es keinen Zweifel.«
»Es könnte wirklich nicht eine Folge des Sturzes gewesen sein?«
»Nein. Er landete mit dem Gesicht nach unten. Hier geht es um den Nacken.«
»Du bist dir da ganz sicher?«
»Ich weiß nicht, ob ich es mit weiteren Untersuchungen nachweisen kann«, sagte der Pathologe, »aber es besteht durchaus die Möglichkeit, dass der Mann zum Zeitpunkt des Absturzes bereits tot war.«
Sieben
Die Blicke von Marian und Erlendur waren auf den milchig trüben See gerichtet. Der Taucher, der hier zum zweiten Mal seiner Arbeit nachging, stieg ins Wasser. Beim ersten Versuch hatte er an der Stelle, wo die Leiche gelegen hatte, nichts gefunden. Marian hegte den Verdacht, dass es dem Mann darum ging, seine Einkünfte aufzubessern, sagte aber nichts. Der Taucher war Mitte vierzig und schon etliche Male in Seen oder Häfen für die Polizei im Einsatz gewesen. Von Beruf war er Tischler, in seiner Freizeit Mitglied einer Rettungsgesellschaft, und er war einer der erfahrensten Taucher in Island. Seine Stirnlampe leuchtete so hell, dass Marian und Erlendur all seine Bewegungen unter der trüben Wasseroberfläche mitverfolgen konnten, als er abtauchte.
Der Mann hatte den beiden erklärt, dass es wegen des weißen Schlicks nicht einfach sei, den Grund abzusuchen. Alles, was da möglicherweise versunken war, sei längst in der dicken Schlickschicht verschwunden. Erlendur und Marian standen ziemlich ratlos am Ufer. Mit derartigen Tatumständen waren sie nicht vertraut und wussten daher nicht, wie sie vorzugehen hatten. Den See leer zu pumpen war angeblich unmöglich. Schließlich hatte Erlendur darauf bestanden, den Boden der Lagune absuchen zu lassen, denn bislang hatte noch niemand eine bessere Idee gehabt.
Die Suche entlang des Ufers hatte nichts zutage gebracht. Weil es geschneit hatte, gab es keine Spuren mehr, die darauf hinweisen konnten, wie der Tote an diesen Ort transportiert worden war. Auch die Theorie, dass der Mann aus einem Flugzeug abgeworfen worden war, musste man immer noch im Auge behalten. Einiges deutete darauf hin, dass der Mann bereits vor dem Sturz tot gewesen war. In den Daten des Flugüberwachungsdienstes in Reykjavík gab es keine Anhaltspunkte dafür, dass in den vergangenen Wochen Flüge über diesem Gebiet stattgefunden hatten. Am Stadtflughafen in Reykjavík gab es etliche kleine Privatflugzeuge, und die Polizei hatte bereits angefangen, die Besitzer zu kontaktieren. Und genauso hatte man bei sehr viel kleineren Flugplätzen wie in Selfoss oder auf den Westmännerinseln nachgefragt. Derzeit fehlten nur noch die Angaben vom Flughafen in Keflavík zum Flugverkehr von Privatflugzeugen.
An dem Abend, als die Leiche gefunden wurde, hatte man keine Reifenspuren in der Nähe des Sees bemerkt. Nur wirklich starke Geländewagen konnten dorthin gelangen, und die hätten deutliche Spuren hinterlassen müssen. Man hielt es für das Wahrscheinlichste, dass die Leiche auf dem kürzesten Weg von der Straße nach Grindavík an den See getragen worden war, bis zu einer Stelle, wo das Wasser tief genug war, um die Leiche zu bedecken. Der Taucher hatte keine Anzeichen dafür bemerkt, dass sie mit irgendetwas beschwert worden war.
Marian Briem hatte Erlendur von dem Gespräch mit dem Pathologen am Abend zuvor berichtet und vor allem von der Verletzung im Nacken. Der Arzt hatte sich gegen Mittag noch einmal gemeldet und betont, dass das Opfer seiner Ansicht nach vor dem Sturz entweder bereits tot oder zumindest bewusstlos gewesen sei.
»Ist das die Erklärung dafür, dass er waagerecht aufgeprallt ist?«, fragte Erlendur und sah zu dem Taucher hinüber.
»Herbert glaubt das«, entgegnete Marian. »Er hielt es für die wahrscheinlichste Erklärung, dass der Mann durch den Schlag das Bewusstsein verloren hat.«
»Kann er sagen, womit der Schlag ausgeführt wurde?«
»Möglicherweise mit einem Felgenschlüssel oder einem Rohrstück, auf jeden Fall mit irgendeinem runden Gegenstand, meinte er. Aber es ist schwierig für ihn, Genaueres dazu zu sagen. Einen Hammer hält er eher für unwahrscheinlich, weil er keine Anzeichen von scharfen Kanten gefunden hat. Der Hieb hat keine offene Wunde hinterlassen, doch er muss ziemlich heftig gewesen sein.«
Der Taucher kam für einen Augenblick an die Wasseroberfläche, tauchte aber gleich wieder ab. Die Stirnlampe beleuchtete die Wasseroberfläche von unten, und durch die Temperatur des Wassers entstand Dampf, der mit dem Nordwind über den See trieb und sich schließlich auflöste. Erlendur mochte die Szenerie – an diesem Ort übten vulkanische Aktivitäten wie dampfendes Wasser und dick bemooste Lava eine bizarre Anziehungskraft aus.
»Der Mann hat also zuerst einen Hieb in den Nacken bekommen und wurde anschließend von irgendwo hoch oben runtergeworfen«, sagte er.
»Ja, denkbar.«
»Und es sollte so aussehen, als hätte er sich das Leben genommen.«
»Möglich.«
Marian und Erlendur hatten mit dem Leiter des Energiewerks in Svartsengi gesprochen. Der hielt es für ausgeschlossen, dass es sich um einen seiner Mitarbeiter handelte. Niemand wurde vermisst, alle waren zur Arbeit erschienen. Er wunderte sich sehr, dass die Leiche in der Überlauflagune gefunden worden war. Dorthin verirrten sich nur wenige. Er hatte aber gehört, dass es einige Menschen gab, die wegen ihrer Hauterkrankung den See besuchten. Das Wasser schien heilende Wirkung zu haben. Es gab sogar schon Pläne, in der Lava so etwas wie eine Badeanstalt zu errichten.