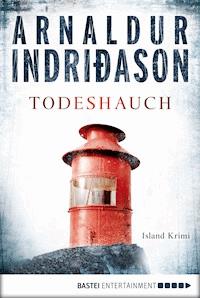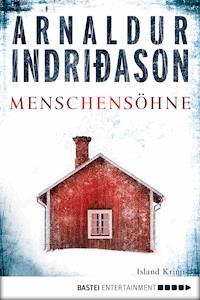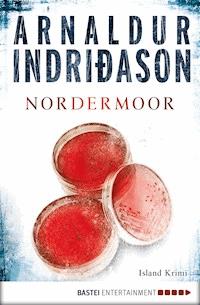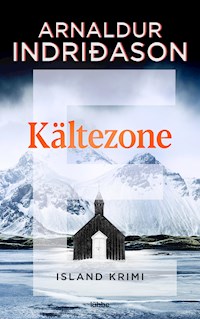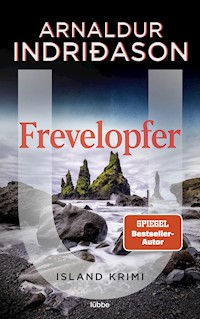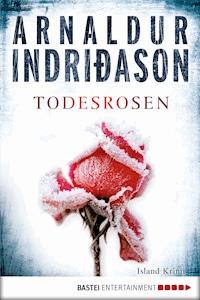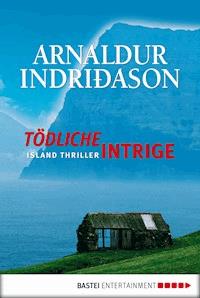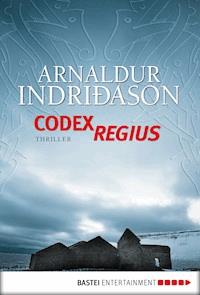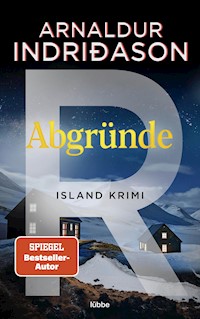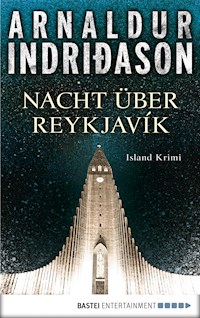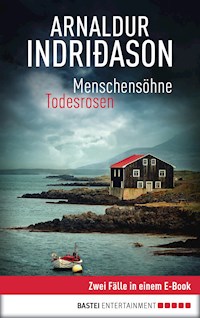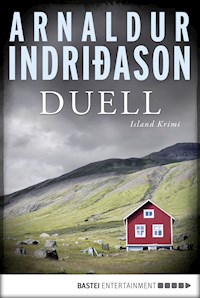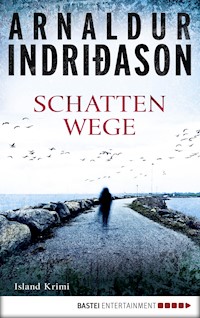9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Bastei Lübbe
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Serie: Kommissar Erlendur
- Sprache: Deutsch
An einem kalten Herbstabend wird an Islands geschichtsträchtigem See von Þingvellir die Leiche einer jungen Frau gefunden. Auf den ersten Blick ein Selbstmord, doch Kommissar Erlendur wird misstrauisch, als ihm der Mitschnitt einer Séance zugespielt wird: Kurz vor ihrem Tod hatte sich die Frau an ein Medium gewandt. Trotz seiner tiefen Skepsis gegenüber spiritistischen Praktiken geht Erlendur den Hinweisen nach und rührt dabei an ein gut gehütetes Familiengeheimnis, das die Jugend dieser Frau überschattet hat... Ausgezeichnet mit dem Blóðdropinn, dem Isländischen Krimipreis
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 445
Veröffentlichungsjahr: 2011
Sammlungen
Ähnliche
Inhalt
CoverTitelImpressumMottoMaríaEinsZweiDreiMaríaVierFünfSechsSiebenAchtMaríaNeunZehnElfZwölfDreizehnVierzehnMaríaFünfzehnSechzehnSiebzehnAchtzehnNeunzehnZwanzigEinundzwanzigMaríaZweiundzwanzigDreiundzwanzigVierundzwanzigFünfundzwanzigSechsundzwanzigMaríaSiebenundzwanzigAchtundzwanzigNeunundzwanzigDreißigMaríaEinunddreißigZweiunddreißigDreiunddreißigVierunddreißigFünfunddreißigMaríaSechsunddreißigSiebenunddreißigLeseprobe – DuellCoverEinsZweiDreiVierARNALDUR INDRIÐASON
KÄLTESCHLAF
Island Krimi
Übersetzung aus dem Isländischen von Coletta Bürling
BASTEI ENTERTAINMENT
Vollständige E-Book-Ausgabe
des in der Bastei Lübbe AG erschienenen Werkes
Bastei Entertainment in der Bastei Lübbe AG
Dieser Titel ist auch als Hörbuch bei Lübbe Audio lieferbar.
Titel der isländischen Originalausgabe: »Harðskafi«
Für die Originalausgabe:
Copyright © 2007 by Arnaldur Indriðason
Originalverlag: Vaka-Helgafell, Reykjavík
Für die deutschsprachige Ausgabe:
Copyright © 2009 by Bastei Lübbe AG, Köln
unter Verwendung eines Motivs von © Dirk Ott/shutterstock
Vovergestaltung: HildenDesign, München
E-Book-Produktion: Dörlemann Satz, Lemförde
ISBN 978-3-8387-1260-4
www.bastei-entertainment.de
www.lesejury.de
Der ältere Bruder erholte sich von seinen Erfrierungen, aber alle fanden ihn seit dieser Zeit eigen und teilnahmslos. Tragödie in den Bergen von Eskifjörður
María hatte bei der Beerdigung völlig abwesend gewirkt. Wie betäubt saß sie in der ersten Reihe, Baldvins Hand fest umklammmernd, und sie schien sich weder über den Anlass der Zusammenkunft noch die Umgebung bewusst zu sein. Die Ansprache des Pfarrers, die Leute, die zur Beerdigung erschienen waren, und der Gesang des kleinen Chorensembles, alles verschmolz zu einem einzigen Klang der Trauer. Der Pfarrer war zu ihnen nach Hause gekommen und hatte sich einige Punkte notiert, deshalb kannte sie den Inhalt seiner Rede. Es ging vor allem um Leonóras wissenschaftliche Karriere und die Tapferkeit, mit der sie den Kampf gegen die schlimme Krankheit aufnahm, um die vielen Freunde, die sie im Laufe ihres Lebens um sich geschart hatte, um sie selbst und um ihre einzige Tochter, die in gewisser Weise in die Fußstapfen der Mutter getreten war. Der Pfarrer erwähnte auch die herausragenden fachlichen Qualifikationen Leonóras und ihr Bedürfnis, Freundschaften zu pflegen, was man nicht zuletzt daran sehen konnte, dass so viele Menschen an diesem tristen Herbsttag zur Beerdigung gekommen waren. Die meisten von ihnen waren Akademiker. Leonóra hatte manchmal mit María darüber gesprochen, wie viel es ihr bedeutete, zu den gebildeten Kreisen zu gehören. In ihren Worten schwang dabei stets ein Anflug von Arroganz mit, was María aber geflissentlich überhörte.
Sie erinnerte sich an das herbstlich gefärbte Laub auf dem Friedhof und die gefrorenen Pfützen auf dem Kiesweg zum Grab und an das scharfe Knirschen, als das dünne Eis unter den Füßen der Sargträger brach. Sie erinnerte sich an die Kälte und das Kreuzzeichen, das sie über den Sarg ihrer Mutter schlug. Sie hatte sich bereits unzählige Male genau diese Situation ausgemalt, nachdem sich herausgestellt hatte, dass die Krankheit ihrer Mutter zum Tode führen würde, und nun war diese Stunde gekommen. Sie starrte auf den Sarg im Grab und verrichtete im Stillen ein kurzes Gebet, bevor sie mit ausgestreckter Hand ein Kreuzzeichen machte. Danach stand sie regungslos am Rande des Grabs, bis Baldvin sie wegführte.
Sie erinnerte sich an all die Leute hinterher beim Leichenschmaus, die zu ihr kamen und ihr Beileid ausdrückten. Einige boten ihre Unterstützung an, falls es etwas gäbe, womit sie helfen könnten.
Eins
Kurz nach Mitternacht ging bei der Notrufzentrale eine Meldung von einem Mobiltelefon ein. Eine aufgeregt klingende weibliche Stimme am anderen Ende der Leitung sagte:
»Sie hat sich … María hat sich umgebracht … Ich … Das ist grauenvoll … Grauenvoll!«
»Wie ist dein Name?«
»Ka… Karen.«
»Von wo aus rufst du an?«, fragte der Diensthabende beim Notruf.
»Ich bin im … Das ist … ihr Ferienhaus.«
»Und wo ist das?«
»… Am See von Þingvellir. In … in ihrem Ferienhaus. Beeilt euch … Ich … ich warte hier.«
Karen hatte ihre liebe Mühe und Not gehabt, das Haus zu finden. Es war so lange her, dass sie zuletzt dort gewesen war, beinahe vier Jahre. María hatte ihr zwar sicherheitshalber den Weg dorthin genau beschrieben, aber ihre Erklärungen waren Karen mehr oder weniger zum einen Ohr hinein- und zum anderen wieder hinausgegangen; sie glaubte, sich an den Weg dorthin ganz gut erinnern zu können.
Als sie Reykjavík abends um kurz nach acht verließ, war es stockfinster. Auf der Straße über die Mosfellsheiði war wenig Verkehr, nur die Scheinwerfer von ein paar Autos, die auf dem Weg in die Stadt waren, leuchteten ihr entgegen. Ein einziges Auto fuhr in dieselbe Richtung wie sie; sie hielt sich an die roten Rücklichter und war froh, dass noch jemand außer ihr unterwegs war. Sie fuhr ungern allein im Dunkeln und hätte sich liebend gerne früher auf den Weg gemacht, war jedoch aufgehalten worden. Sie arbeitete als PR-Referentin bei einer großen Bank, und die Besprechungen und Telefongespräche hatten an diesem Tag kein Ende nehmen wollen.
Sie wusste, dass Grímannsfell zu ihrer Rechten lag, obwohl sie den Berg nicht sehen konnte, und Skálafell zu ihrer Linken. Sie passierte die Abzweigung, an der die Straße nach Vindáshlíð, dem Ferienheim der CVJF, abging, wo sie als Kind zweimal vierzehn Tage im Sommerlager verbracht hatte. Die roten Rücklichter legten ein angenehmes Tempo vor, und sie folgte dem Wagen, bis die Abzweigung zum See kam. Dort trennten sich ihre Wege. Die roten Rücklichter entfernten sich rasch und verschwanden in der Dunkelheit.
Nachdem sie nach rechts abgebogen war, fuhr sie in völlige Dunkelheit hinein. Wegen der Finsternis hatte sie große Probleme, sich zu orientieren. Hätte sie schon vorher abbiegen sollen? War das der richtige Weg zum See hinunter? Oder war es erst die nächste Abzweigung? War sie zu weit gefahren?
Zweimal verfuhr sie sich und musste wenden. Es war Donnerstagabend, und die meisten Ferienhäuser standen leer. Sie hatte Proviant und Bücher zum Lesen mitgenommen. María hatte ihr außerdem gesagt, dass sie seit Kurzem auch einen Fernseher im Haus hätten. Sie wollte nichts sehnlicher, als viel schlafen und sich erholen. In der Bank war es nach einem Übernahmeversuch, den sie gerade abgewehrt hatten, zugegangen wie in einem Irrenhaus. Sie hatte es aufgegeben, die Auseinandersetzung zwischen den einzelnen Aktionärsgruppen, die sich gegen andere Gruppierungen zusammenschlossen, verstehen zu wollen. Pressemeldungen wurden im Zweistundentakt herausgegeben, und die Lage besserte sich nicht, als bekannt wurde, dass man mit einem der Bankdirektoren, den irgendeine Gruppe loswerden wollte, eine Abfindung in Höhe von hundert Millionen Kronen vereinbart hatte. Dem Bankvorstand war es damit gelungen, sich den Zorn der Öffentlichkeit zuzuziehen, und von Karen erwartete man, dass sie Mittel und Wege finden würde, die Wogen zu glätten. Damit war sie die gesamten letzten Wochen beschäftigt gewesen. Irgendwann reichte es ihr, und sie beschloss, aus der Stadt zu fliehen. María hatte ihr oft angeboten, das Ferienhaus zu nutzen. Als sie anrief, hatte María, ohne zu zögern, ja gesagt.
Karen fuhr im Schritttempo auf dem holprigen Seitenweg, der sich durch niedriges Gebüsch schlängelte. Endlich fielen die Autoscheinwerfer auf das Ferienhaus unten am See. María hatte ihr einen Schlüssel gegeben, aber auch erwähnt, wo sie einen weiteren Schlüssel aufbewahrte. Manchmal war ein Ersatzschlüssel in einem Versteck beim Haus sehr nützlich.
Sie freute sich schon darauf, am nächsten Tag in der herbstlichen Farbenpracht aufzuwachen, für die Þingvellir berühmt war. Seit sie sich zurückerinnern konnte, wurden jedes Jahr spezielle Fahrten zu den Herbstfarben im Nationalpark angeboten. An keinem anderen Ort waren sie schöner als an den Ufern des Sees, wo sich die roten, gelben und rostbraunen Farben der sterbenden Vegetation ausbreiteten, so weit das Auge reichte.
Sie begann damit, das Gepäck aus dem Wagen zu holen und es auf der Veranda vor der Tür abzustellen. Dann steckte sie den Schlüssel ins Schloss und tastete nach einem Lichtschalter. Das Licht im Flur zur Küche ging an, und sie brachte ihre kleine Reisetasche ins eheliche Schlafzimmer. Sie wunderte sich, dass das Bett nicht gemacht war. Das sah María nicht ähnlich. Im Bad lag ein Handtuch auf dem Boden. Bevor sie das Licht in der Küche anknipste, spürte sie eine seltsame Nähe. Sie fürchtete sich zwar nicht im Dunkeln, aber dennoch durchfuhr sie von oben bis unten ein unangenehmes Gefühl. Das Wohnzimmer mit dem fantastischen Seeblick lag völlig im Dunkeln.
Karen schaltete auch dort das Licht ein.
An der Decke befanden sich vier starke Querbalken, und an einem hing mit dem Rücken zu ihr ein menschlicher Körper.
Sie erschrak so sehr, dass sie rückwärts gegen die Wand taumelte und mit dem Kopf gegen die Holzverkleidung stieß. Ihr wurde schwarz vor Augen. Die Leiche hing an einem dünnen blauen Strick vom Balken herunter und spiegelte sich in den dunklen Fenstern des Wohnzimmers. Sie hatte keine Ahnung, wie viel Zeit verstrichen war, bevor sie sich endlich näher heranwagte. Die friedliche Umgebung am See hatte sich im Handumdrehen in ein Horrorszenario verwandelt, das sie nie wieder vergessen würde. Jedes kleinste Detail prägte sich ihr ein. Der Küchenhocker, der in dem stilreinen Zimmer wie ein Fremdkörper wirkte und umgekippt unter der Leiche lag. Das Spiegelbild im Fenster. Die Dunkelheit in Þingvellir. Der bewegungslose menschliche Körper an dem Balken.
Sie trat vorsichtig näher und blickte in das blau geschwollene Gesicht. Ihr schrecklicher Verdacht bestätigte sich. Es war ihre Freundin María.
Zwei
Ihr kam die Zeit, die von ihrem Anruf bis zum Eintreffen der Sanitäter, des Arztes und der Polizisten verging, erstaunlich kurz vor. Zuständig war die Polizei in Selfoss. Die Männer wussten, dass die Frau, die sich das Leben genommen hatte, aus Reykjavík stammte, im Grafarvogur-Viertel wohnte und verheiratet, aber kinderlos war.
Drinnen im Haus unterhielt man sich leise. Die Leute wirkten wie Fremdkörper in der unbekannten Wohnung, in der sich eine Tragödie zugetragen hatte.
»Bist du diejenige, die den Notruf verständigt hat?«, fragte ein junger Polizist.
Man hatte ihn an die Frau verwiesen, die die Leiche gefunden hatte. Sie saß mit gesenktem Kopf in der Küche und starrte auf den Fußboden.
»Ja. Ich heiße Karen.«
»Wenn du psychologische Betreuung brauchst, können wir …«
»Nein, ich glaube … Es geht schon.«
»Hast du sie gut gekannt?«
»Ich kenne María, seit wir Kinder waren. Sie hat mir das Haus hier zur Verfügung gestellt. Ich wollte übers Wochenende hierbleiben.«
»Du hast das Auto hinter dem Haus nicht bemerkt?«
»Nein. Ich ging davon aus, dass niemand hier ist. Allerdings fiel mir auf, dass das Bett nicht gemacht war, und als ich ins Wohnzimmer kam … Ich hab noch nie so etwas gesehen. Mein Gott, die arme María!«
»Wann hast du zuletzt mit ihr gesprochen?«
»Vor ein paar Tagen noch. Da haben wir wegen des Hauses miteinander telefoniert.«
»Hat sie erwähnt, dass sie auch da sein würde?«
»Nein, davon hat sie nichts gesagt. Sie hat nur gesagt, ich könnte selbstverständlich ein paar Tage in dem Haus verbringen. Das sei kein Problem.«
»Und war sie … guter Dinge?«
»Ja, es kam mir so vor. Als ich den Schlüssel bei ihr abholte, war sie so wie immer.«
»Sie wusste also, dass du hierherkommen würdest?«
»Ja. Was meinst du damit?«
»Sie hat gewusst, dass du sie hier finden würdest«, erwiderte der Polizist.
Er hatte sich einen Küchenhocker herangezogen und sich neben sie gesetzt, um mit ihr zu sprechen. Sie griff nach seinem Handgelenk und starrte ihn an.
»Willst du damit sagen, dass …?«
»Es könnte sein, dass du sie finden solltest«, entgegnete der Polizist. »Aber das weiß ich natürlich nicht sicher.«
»Weshalb sollte sie das gewollt haben?«
»Es ist nur eine Vermutung.«
»Aber es stimmt, sie wusste, dass ich das Wochenende hier verbringen wollte. Sie wusste, dass ich kommen würde. Wann … Wann hat sie das getan?«
»Wir haben noch keinen genauen Befund, aber der Arzt meint, es kann kaum später als gestern Abend gewesen sein. Wahrscheinlich ist es etwa vierundzwanzig Stunden her.«
Karen schlug die Hände vors Gesicht.
»O Gott, das ist so … Das ist alles so unwirklich. Hätte ich sie doch bloß nie um diesen Gefallen gebeten. Habt ihr schon mit ihrem Mann gesprochen?«
»Die Kollegen sind auf dem Weg zu ihm. Er wohnt in Grafarvogur, nicht wahr?«
»Ja. Wie konnte sie sich das antun? Wie kann ein Mensch so etwas machen?«
»So etwas macht man im Zustand äußerster Verzweiflung«, erklärte der Polizist und bedeutete dem Arzt, zu ihnen zu kommen. »Bei psychischen Problemen. Du hast nichts dergleichen bei ihr gemerkt?«
»Vor zwei Jahren hat sie ihre Mutter verloren. Das war ein furchtbarer Schlag für sie. Sie starb an Krebs.«
»Ich verstehe«, sagte der Polizist.
Karen brach in Tränen aus, und der Polizist fragte sie, ob sie vielleicht mit dem Arzt sprechen wolle. Sie schüttelte den Kopf und sagte, es sei alles in Ordnung mit ihr, aber sie habe den Wunsch, möglichst bald nach Hause fahren zu dürfen. Das wurde ihr sofort gestattet. Gegebenenfalls konnte man ja auch noch später mit ihr sprechen.
Der Polizist begleitete sie zu ihrem Auto vor dem Haus und öffnete ihr die Wagentür.
»Du bist dir sicher, dass alles in Ordnung ist?«, fragte er.
»Ja, ich denke schon«, antwortete Karen. »Vielen Dank.«
Der Polizist beobachtete, wie sie den Wagen wendete und davonfuhr. Als er das Haus wieder betrat, hatte man die Leiche abgenommen und sie auf den Fußboden gelegt. Er ging neben ihr in die Hocke. Die Frau hatte ein schmales Gesicht und dunkles, kurz geschnittenes Haar. Sie war schlank und trug ein weißes Polohemd und blaue Jeans, hatte aber keine Socken an. Er sah keinerlei Anzeichen von Gewaltanwendung, weder an ihrem Körper noch in dem Haus, nur den umgekippten Küchenhocker, den die Frau dazu benutzt hatte, den Strick am Balken zu befestigen. Ein blaues Seil dieser Art konnte man in jedem Baumarkt kaufen. Es hatte tief in ihren schmalen Hals eingeschnitten.
»Sauerstoffmangel«, sagte der Arzt, der sich mit den Sanitätern unterhalten hatte. »Sie hat sich nicht das Genick gebrochen, leider. Dann wäre es schnell vorbei gewesen. Sie ist erstickt, als der Strick sich um den Hals schnürte, und das hat einige Zeit gedauert. Sie fragen danach, wann sie die Leiche entfernen dürfen.«
»Wie lange hat es gedauert?«, fragte der Polizist.
»Zwei Minuten vielleicht, bis sie das Bewusstsein verloren hat.«
Der Polizist stand auf und sah sich in dem Haus um. Es kam ihm wie ein ganz normales isländisches Ferienhaus vor – eine Sofagarnitur aus Leder, ein beeindruckender Esstisch und eine ziemlich neue Kücheneinrichtung. Die Wände im Wohnzimmer waren vor lauter Büchern kaum zu sehen. Er ging zu einem der Regale und sah die gelbbraunen Lederrücken der Isländischen Volkssagensammlung von Jón Árnason in fünf Bänden. Gespenstergeschichten, dachte er. In anderen Regalen befanden sich isländische Romane und französische Literatur und dazwischen Kunstgegenstände aus Porzellan oder Keramik und gerahmte Fotos, drei davon zeigten dieselbe Frau in unterschiedlichem Alter, wie er zu erkennen glaubte. Wo Platz an den Wänden war, hingen Grafiken, kleine Ölgemälde und Aquarelle.
Der Polizist ging in das eheliche Schlafzimmer. Das Bett war auf der einen Seite niedergedrückt. An dieser Seite lagen Bücher auf dem Nachttisch, zuoberst ein Gedichtband von Davið Stefánsson. Ein kleiner Parfümflakon stand ebenfalls auf dem Nachtschränkchen.
Sein Gang durch das Haus geschah nicht aus reiner Neugier. Er suchte nach Anzeichen von Gewaltanwendung, auf Hinweise darauf, dass die Frau nicht aus eigenem Antrieb in die Küche gegangen war, den Hocker geholt und ihn unter den Balken gestellt hatte, auf ihn geklettert war und sich den Strick um den Hals gelegt hatte. Aber nichts deutete auf etwas anderes hin als auf eine stille, beinahe diskrete Todesstunde.
Sein Kollege aus Selfoss unterbrach ihn.
»Gibt es irgendetwas Verdächtiges?«, fragte er.
»Nichts. Das ist Selbstmord. Ganz klarer Fall. Es gibt keinerlei Anzeichen für etwas anderes. Sie hat sich selbst das Leben genommen.«
»Ja, es hat ganz den Anschein.«
»Soll ich den Strick vom Balken herunterschneiden, bevor wir das Haus verlassen? War sie nicht verheiratet?«
»Tu das. Ja, der Ehemann wird hierherkommen müssen.«
Der Polizist hob das Seil vom Boden auf und drehte es zwischen den Fingern. Keine sehr solide Ware, es war schlecht gedreht, und die Schlinge ließ sich schwer bewegen. Er dachte, dass er eine bessere Schlinge machen könnte, aber wahrscheinlich war von einer normalen Frau aus Grafarvogur nicht zu erwarten, dass sie imstande war einen perfekten Strang zu knüpfen. Es hatte nicht den Anschein, als hätte sie sich mit den technischen Details vertraut gemacht und den Selbstmord präzise vorbereitet. Wahrscheinlich handelte es sich um einen Anfall von geistiger Verwirrung und nicht um einen von langer Hand geplanten Akt.
Er öffnete die Tür zur Veranda. Von ihr führten zwei Stufen hinunter auf den Pfad, auf dem man mit nur ein paar Schritten zum Ufer des Sees gelangte. Es hatte in den letzten Tagen Nachtfrost gegeben, und eine dünne Eisschicht bedeckte das Wasser am Spülsaum. An einigen Stellen war es am Ufer festgefroren und sah aus wie hauchzartes Glas, unter dem das Wasser gluckerte.
Drei
Erlendur hielt bei einem schlichten Einfamilienhaus in Grafarvogur an, das etwas abseits am Ende einer Stichstraße mit schönen Bungalows stand. Die meisten Häuser hier sahen mehr oder weniger gleich aus, sie waren weiß, rot oder blau gestrichen und hatten jeweils zwei Garagen. Die Straße machte im Schein der Straßenbeleuchtung einen gepflegten Eindruck; an den gemähten Rasenflächen und beschnittenen Bäumen sah man, dass die Gärten gut in Schuss gehalten wurden. Rechtwinklig gestutzte Hecken, wo man auch hinblickte. Das allein stehende Haus schien älter zu sein als die anderen Häuser in der Straße, und es hatte einen etwas anderen Stil; es gab keine Bogenfenster oder prätentiös anmutende Säulen am Eingang und auch keinen Wintergarten. Es war weiß gestrichen und hatte ein Flachdach. Durch das große Wohnzimmerfenster schaute man nach Norden auf den Kollafjörður und das Bergmassiv der Esja. Der große und gut ausgeleuchtete Garten um das Haus herum wirkte überaus gepflegt, jemand schien sich akribisch um ihn zu kümmmern. Heckenrosen und Stiefmütterchen hatten aber mit dem Herbst das Zeitliche gesegnet.
Wegen des anhaltenden Zustroms von Polarluft war es ungewöhnlich kalt gewesen. Ein trockener Wind fegte das Laub die Straße entlang bis zum Ende der Sackgasse. Erlendur parkte das Auto, stieg aus und betrachtete das Haus. Er holte tief Luft, bevor er sich in Bewegung setzte. Dies war der zweite Selbstmord in einer Woche. Vielleicht hatte es etwas mit dem Herbst und dem Gedanken an den herannahenden langen, dunklen Winter zu tun.
Erlendur war die Aufgabe zugefallen, den Mann im Auftrag der Polizei offiziell zu benachrichtigen, so wie es üblich war. Die Kollegen in Selfoss hatten beschlossen, die Sache zur allfälligen Bearbeitung, wie es so schön hieß, nach Reykjavík weiterzuleiten. Der zuständige Seelsorger hatte sich bereits eingefunden; er und der Ehemann saßen in der Küche, als Erlendur eintraf. Der Pastor öffnete Erlendur die Tür und ging mit ihm in die Küche. Er sagte, er sei Gemeindepfarrer in Grafarvogur; María sei zwar woanders zur Kirche gegangen, aber ihre Pastorin wäre nicht zu erreichen gewesen.
Der Ehemann saß reglos am Küchentisch. Er trug ein weißes Hemd und Jeans und wirkte trotz seiner schlanken Figur kräftig. Erlendur nannte seinen Namen, und sie gaben sich zur Begrüßung die Hand. Der Mann hieß Baldvin. Der Pastor blieb in der Tür stehen.
»Ich muss nach Þingvellir fahren«, sagte Baldvin.
»Die Leiche ist …«, sagte Erlendur, kam aber nicht weiter.
»Mir wurde gesagt, dass …«, begann Baldvin.
»Wir können dich dorthin begleiten, wenn du möchtest. Die Leiche ist allerdings schon nach Reykjavík gebracht worden, ins Leichenschauhaus am Barónsstígur. Wir gingen davon aus, dass dir das lieber wäre, als sie ins Krankenhaus in Selfoss transportieren zu lassen.«
»Vielen Dank.«
»Du musst sie identifizieren.«
»Selbstverständlich. Natürlich.«
»War sie allein da in Þingvellir?«
»Ja. Sie ist vor zwei Tagen hingefahren, um dort zu arbeiten, sie wollte aber heute Abend nach Hause kommen. Ich wusste, dass sie spät kommen würde. Ihre Freundin hatte vor, das Wochenende dort zu verbringen. María hatte mir gesagt, dass sie vielleicht warten würde, bis sie eintrifft.«
»Ihre Freundin Karen hat sie gefunden. Du kennst sie?«
»Ja.«
»Und du warst hier zu Hause?«
»Ja.«
»Wann hast du zuletzt mit deiner Frau gesprochen?«
»Gestern Abend. Bevor sie schlafen ging. Sie hatte ihr Handy dabei.«
»Heute hast du also nichts von ihr gehört?«
»Nein, nichts.«
»Sie hat dich nicht in eurem Ferienhaus erwartet?«
»Nein, wir wollten am Wochenende in der Stadt bleiben.«
»Aber sie hat ihre Freundin heute Abend dort erwartet?«
»Ja, so habe ich es verstanden. Der Pastor hat mir gesagt, dass María es … wahrscheinlich gestern Abend getan hat?«
»Der Arzt muss noch die genaue Todeszeit feststellen.«
Baldvin sagte nichts.
»Hat sie das schon früher einmal versucht?«, fragte Erlendur.
»Was? Selbstmord? Nein, nie.«
»Hattest du das Gefühl, dass es ihr schlecht ging?«
»Sie ist vielleicht ein bisschen niedergeschlagen und traurig gewesen«, gab Baldvin zu. »Aber nicht so, dass … Das ist …«
Er brach in Tränen aus.
Der Priester warf Erlendur einen Blick zu und gab ihm zu verstehen, dass es nun reichen würde.
»Entschuldige«, sagte Erlendur und stand auf. »Wir reden später miteinander. Möchtest du jemand anrufen, damit er bei dir bleibt? Oder brauchst du anderen Beistand? Wir können …«
»Nein, es ist … Vielen Dank.«
Auf dem Weg hinaus durchquerte Erlendur das Wohnzimmer, in dem sich eindrucksvolle Bücherschränke befanden. Als er vor dem Haus vorgefahren war, hatte er einen imposanten Jeep vor dem Garagentor stehen sehen.
Weshalb sich umbringen, wenn man ein solches Zuhause hatte, dachte er bei sich. Gab es hier wirklich nichts, wofür es sich zu leben lohnte?
Er wusste, dass derartige Überlegungen zwecklos waren. Erfahrungsgemäß waren Suizide vollkommen unberechenbar und mussten nichts mit der wirtschaftlichen Lage zu tun haben. Sie geschahen oft genug völlig überraschend; es waren Menschen jeglichen Alters, die eines Tages beschlossen, ihrem Leben ein Ende zu setzen. Manchmal gab es einen langen Vorlauf mit depressiven Phasen und misslungenen Versuchen. In anderen Fällen traf es die Angehörigen und Freunde völlig unerwartet. Wir hatten ja keine Ahnung, dass er sich so fühlte. Sie hat nie etwas gesagt. Wie hätten wir etwas wissen können? Die Hinterbliebenen waren immer fassungslos, Fragen über Fragen, Nichtwahrhabenwollen. Und in ihren Stimmen schwang Entsetzen mit: Weswegen? Hätte mir etwas auffallen müssen? Hätte ich etwas tun können?
Der Ehemann begleitete Erlendur hinaus.
»Soweit ich weiß, hat sie vor einiger Zeit ihre Mutter verloren.«
»Ja, das stimmt.«
»Hat ihr Tod María sehr mitgenommen?«
»Es war ein furchtbarer Schicksalsschlag für sie«, erklärte der Mann. »Trotzdem ist es unbegreiflich. Auch wenn sie in letzter Zeit etwas deprimiert wirkte, ist das überhaupt nicht zu verstehen.«
»Natürlich«, sagte Erlendur.
»Ihr kennt euch selbstverständlich mit solchen Selbstmordfällen aus, denke ich«, sagte Baldvin.
»So etwas kommt leider immer wieder vor«, entgegnete Erlendur.
»War sie … Hat sie gelitten?«
»Nein«, sagte Erlendur bestimmt. »Das hat sie nicht.«
»Ich bin Arzt«, sagte Baldvin. »Du brauchst mir nichts vorzulügen.«
»Das tue ich auch nicht«, sagte Erlendur.
»Sie war schon seit längerer Zeit niedergeschlagen«, erklärte Baldvin, »aber sie hat nicht versucht, etwas dagegen zu unternehmen. Vielleicht hätte sie das besser getan. Vielleicht hätte ich aufmerksamer sein müssen für das, was sie durchgemacht hat. Das Verhältnis zwischen ihrer Mutter und ihr war sehr eng, und sie hat sich schwer damit getan, ihren Tod zu akzeptieren. Leonóra war nur fünfundsechzig, sie starb im besten Alter. Krebs. María hat sie bis zum Schluss gepflegt, und ich bin mir nicht sicher, ob sie sich nach ihrem Tod wirklich wieder gefangen hat. Sie war Leonóras einziges Kind.«
»Man kann sich vorstellen, dass das schwer auf einem lastet.«
»Es ist vielleicht nicht ganz einfach, sich in ihre Lage hineinzuversetzen«, sagte Baldvin.
»Ja, natürlich«, gab Erlendur zur Antwort. »Und ihr Vater?«
»Der ist tot.«
»War sie religiös?«, fragte Erlendur und blickte auf eine Jesusfigur auf der Kommode im Eingang. Daneben lag eine Bibel.
»Ja, das war sie«, antwortete der Mann. »Sie ging zur Kirche. Sie war viel religiöser als ich. Und das hat mit den Jahren zugenommen.«
»Du hast es also nicht so mit der Religion?«
»Nein, das kann ich nicht sagen.« Baldvin stöhnte schwer. »Das ist … Das ist alles so unwirklich. Du musst entschuldigen, ich …«
»Entschuldige bitte, ich höre jetzt auf«, sagte Erlendur.
»Ich fahre dann mit dem Pastor zum Barónsstígur.«
»Gut«, sagte Erlendur. »Der Gerichtsmediziner muss sie sich ansehen. Das ist in einem Fall wie diesem üblich.«
»Ich verstehe«, sagte Baldvin.
Kurz darauf hatten alle das Haus verlassen. Erlendur ließ Baldvin und den Pastor vorfahren. Als er aus der Einfahrt bog, warf er einen Blick auf das Haus und hatte das Gefühl, als bewegten sich die Gardinen hinter dem Wohnzimmerfenster. Er trat auf die Bremse und blickte lange in den Rückspiegel. Als er jedoch keine weitere Bewegung hinter dem Fenster bemerkte, kam er zu dem Schluss, dass er sich getäuscht haben musste. Er nahm den Fuß von der Bremse und fuhr los.
Die ersten Wochen und Monate nach Leonóras Tod litt María unter schweren Depressionen. Sie weigerte sich, Besuch zu empfangen, und ging nicht ans Telefon, wenn es klingelte. Baldvin nahm sich zwei Wochen Urlaub, aber je mehr er für sie tun wollte, desto hartnäckiger bestand sie darauf, in Ruhe gelassen zu werden. Baldvin besorgte ihr Medikamente gegen Schwermut und Depression, die sie aber nicht nahm. Er kannte einen Psychiater, der bereit war, mit ihr einen Termin zu vereinbaren, aber das wollte sie nicht. Sie behauptete, sie müsse ihre Trauer selbst bewältigen. Es würde Zeit brauchen, und er müsse Geduld haben. Sie hätte das schon einmal durchgemacht und würde auch jetzt wieder damit fertig werden.
Sie kannte die Furcht, die Niedergeschlagenheit und die Appetitlosigkeit, die Gewichtsverlust nach sich zog, und dieses Gefühl der geistigen Lähmung, das sie kraftlos machte und das Interesse an allem verlieren ließ, was außerhalb der abgekapselten Innenwelt war, die sie sich in ihrer Trauer geschaffen hatte. Niemand hatte Zutritt zu dieser Welt. Sie hatte nach dem Tod ihres Vaters Ähnliches durchgemacht, doch damals war ihre Mutter ihr eine überaus große Stütze gewesen. In den ersten Jahren nach seinem Tod träumte María ständig von ihm, und viele der Träume verwandelten sich in Albträume, die nicht von ihr weichen wollten. Sie litt unter Halluzinationen. Er erschien ihr so deutlich, dass sie manchmal das Gefühl hatte, er sei noch am Leben, als sei er gar nicht gestorben. Sie spürte seine Nähe auch im Wachen, sie roch sogar den Duft seiner Zigarren. Manchmal kam es ihr so vor, als stünde er neben ihr und verfolge jede ihrer Bewegungen. Sie war ja nur ein Kind und glaubte, dass er sie aus der anderen Welt besuchen kam.
Ihre Mutter Leonóra betrachtete das Ganze im Hinblick auf die reale, greifbare Welt und erklärte ihr, dass die Erscheinungen, die sie sah, die Geräusche, die sie hörte, und der Geruch, den sie verspürte, eine natürliche Reaktion auf den Tod des Vaters seien, etwas, was Teil der Trauerbewältigung sei. Sie hatten ein sehr enges Verhältnis gehabt, und sein Tod war ein derartiger Schock für sie gewesen, dass ihr Unterbewusstsein diese Erscheinungen inszenierte: manchmal sein Bild, manchmal einen mit ihm verbundenen Geruch. Leonóra nannte es das innere Auge, das dem, was in ihrer Seele vorging, Leben zu verleihen vermochte; sie sei nach jenem schweren Schock empfindlich, und ihre Wahrnehmungsfähigkeit sei hypersensibel und fragil, aber das würde sich im Laufe der Zeit wieder geben.
»Was ist, wenn es aber nicht das innere Auge war, wie du immer gesagt hast? Was, wenn das, was ich gesehen habe, als Papa starb, an der Grenze zwischen zwei Welten war? Was ist, wenn er tatsächlich zu mir wollte? Mir etwas mitteilen wollte?« María saß am Bett ihrer Mutter. Seitdem feststand, dass Leonóra ihrem Schicksal nicht entgehen konnte, sprachen sie ganz offen über den Tod.
»Ich habe all diese Bücher über das Licht und den Tunnel gelesen, die du mir gebracht hast«, sagte Leonóra. »Vielleicht ist etwas Wahres an dem, was die Leute sagen. Über den Tunnel zur Ewigkeit. Ewiges Leben. Ich werde es bald herausfinden.«
»Es gibt so viele eindeutige Berichte von Menschen, die starben, aber wieder ins Leben zurückgeholt werden konnten. Über Nahtod-Erfahrungen. Über das Leben nach dem Tod«, sagteMaría.
»Wir haben so oft darüber geredet …«
»Weshalb sollten sie nicht wahr sein? Zumindest einige von ihnen?«
Leonóra blickte mit halb geschlossenen Augen auf ihre Tochter, die todunglücklich neben ihrem Bett saß. Die Krankheit machte María beinahe mehr zu schaffen als ihr selbst. Der Gedanke an den bevorstehenden Tod der Mutter war unerträglich für María. Wenn Leonóra ging, blieb sie ganz allein zurück.
»Ich glaube nicht an so etwas, weil ich an alles Reale, Greifbare glaube.«
Sie schwiegen lange. María senkte den Kopf, und Leonóra dämmerte vor sich hin. Nach zweijährigem Kampf gegen den Krebs, der jetzt die Oberhand gewonnen hatte, war sie am Ende ihrer Kräfte.
»Ich werde dir ein Zeichen geben«, flüsterte sie und hob die Augenlider ein wenig.
»Ein Zeichen?«
Leonóra lächelte matt durch den Nebel des Morphiums, der ihr Bewusstsein umgab. »Es muss etwas Einfaches sein.«
»Was?«, fragte María.
»Es muss … Es muss etwas Greifbares sein. Es darf kein Traum sein und auch keine unklare Wahrnehmung.«
»Willst du damit sagen, dass du mir ein Zeichen aus dem Jenseits geben willst?«
Leonóra nickte. »Weshalb nicht? Falls denn das sogenannte Leben nach dem Tod etwas anderes ist als nur eine Wunschvorstellung.«
»Und wie stellst du dir das vor?«
Leonóra schien eingeschlummert zu sein.
»Du kennst meinen Lieblingsschriftsteller.«
»Das ist Proust.«
Leonóra fasste nach der Hand ihrer Tochter.
»Proust«, sagte sie erschöpft und schlief endlich ein. Gegen Abend fiel sie ins Koma. Sie starb zwei Tage später, ohne das Bewusstsein zurückerlangt zu haben.
Drei Monate nach Leonóras Beerdigung schreckte María mitten am Vormittag durch irgendetwas auf und ging ins Wohnzimmer. Sie war allein im Haus, denn Baldvin ging immer sehr früh in die Praxis, und sie fühlte sich nach schweren Träumen und durch die lange psychische Belastung müde und matt. Auf dem Weg zur Küche überkam sie plötzlich das Gefühl, sie sei nicht allein im Haus.
Zunächst glaubte sie, dass sich ein Einbrecher Zutritt verschafft hätte, und sie schaute sich ängstlich um. In der Hoffnung, einen etwaigen Einbrecher abzuschrecken, fragte sie laut, ob jemand im Haus wäre. Sie stand wie versteinert da und verspürte plötzlich den schwachen Duft des Parfüms, das ihre Mutter benutzt hatte.
María starrte angestrengt in das dämmrige Wohnzimmer und sah Leonóra bei den Bücherregalen stehen und zu ihr sprechen, aber María konne nicht verstehen, was sie sagte.
Sie starrte ihre Mutter lange an und wagte nicht, sich zu bewegen, bis Leonóra genauso plötzlich verschwand, wie sie aufgetaucht war.
Vier
Als Erlendur nach Hause kam, machte er zunächst Licht in der Küche. Aus dem Stockwerk über ihm drangen wummernde Bässe nach unten. Vor Kurzem war dort ein junges Paar eingezogen, das abends laut Musik hörte, manchmal sehr laut, und an Wochenenden Partys feierte. Die Gäste trampelten bis zum frühen Morgen durchs Treppenhaus, nicht selten gab es einen Riesenradau. Über das Pärchen hatten sich bereits etliche Anwohner beschwert. Die beiden gelobten auch Besserung, aber mit diesem Versprechen war es nicht weit her. Für Erlendur war das, was das Pärchen da hörte, eigentlich gar keine Musik, sondern nur ein sich unablässig wiederholendes Wummwumm, begleitet von gelegentlichem Geheul.
Dennoch hörte Erlendur ein Klopfen an der Tür.
»Ich hab gesehen, dass Licht bei dir war«, erklärte sein Sohn Sindri Snær, als Erlendur öffnete.
»Komm rein«, sagte Erlendur. »Ich bin gerade aus Grafarvogur zurück.«
»Interessanter Fall?«, fragte Sindri und machte die Tür hinter sich zu.
»Interessant ist eigentlich alles«, antwortete Erlendur. »Möchtest du Kaffee oder etwas anderes?«
»Bloß ein Glas Wasser«, erklärte Sindri und zog eine Zigarettenschachtel aus der Tasche. »Ich hab Urlaub. Zwei Wochen.« Er sah zur Decke und lauschte dem Hardrock über ihm, den Erlendur gar nicht mehr hörte. »Was ist denn das für ein Krach?«
»Da oben sind neue Leute eingezogen«, sagte Erlendur in der Küche. »Hast du etwas von Eva Lind gehört?«
»Das ist schon etwas länger her. Sie hat sich neulich mit Mama gefetzt, aber ich weiß nicht, was da los war.«
»Sich mit eurer Mutter gefetzt?«, hakte Erlendur nach und tauchte im Türrahmen auf. »Weswegen?«
»Deinetwegen, soweit ich weiß.«
»Wieso sollten sie sich meinetwegen fetzen?«
»Frag sie doch selbst.«
»Arbeitet sie?«
»Ja.«
»Und wie ist es mit dem Rauschgift?«
»Sie ist clean, glaube ich. Aber sie will trotzdem nicht mit mir zu diesen Treffen gehen.«
Erlendur wusste, dass Sindri regelmäßig die Zusammenkünfte der Anonymen Alkoholiker besuchte, und glaubte, dass es ihm half. Trotz seines jungen Alters hatte er große Probleme wegen Alkohol gehabt, sich aber auf eigene Faust aus dem Sumpf herausgezogen und das getan, was notwendig war, um die Sucht unter Kontrolle zu bekommen. Seine Schwester Eva hielt sich zwar im Augenblick von Drogen fern, aber von Entziehungskuren und Gruppentherapien wollte sie nichts wissen; sie war überzeugt, dass sie das allein und ohne Hilfe schaffen würde.
»Was war denn da in Grafarvogur?«, fragte Sindri. »Passiert da tatsächlich mal etwas?«
»Selbstmord«, sagte Erlendur.
»Ist das ein Verbrechen?«
»Nein, Selbstmord ist kein Verbrechen«, entgegnete Erlendur. »Höchstens gegenüber denjenigen, die weiterleben.«
»Ich kannte einen Jungen, der sich umgebracht hat«, sagte Sindri.
»Tatsächlich?«
»Ja, der Simmi.«
»Wer war das?«
»Der war in Ordnung. Wir haben seinerzeit zusammen bei der Stadt gearbeitet. Ein ganz ruhiger Typ, der hat niemals was gesagt. Und auf einmal hat er sich erhängt, und zwar bei der Arbeit. Wir hatten da so einen Schuppen auf dem Gelände, und in dem hat er sich aufgehängt. Unser Vorarbeiter hat ihn gefunden und runtergeschnitten.«
»Habt ihr gewusst, weshalb er das getan hat?«
»Nee. Er wohnte bei seiner Mutter. Ich hab einmal zusammen mit ihm einen draufgemacht. Er hatte noch nie Alkohol getrunken und kotzte in einem fort.« Sindri schüttelte den Kopf. »Ein komischer Typ, dieser Simmi«, sagte er.
Über ihnen hämmerte es pausenlos aus den Boxen.
»Willst du nicht was dagegen unternehmen?«, fragte Sindri und sah zur Decke.
»Die lassen sich von niemandem etwas sagen«, erklärte Erlendur.
»Möchtest du, dass ich mit ihnen rede?«
»Du?«
»Ich kann sie bitten, diesen Scheiß auszumachen, wenn du willst.«
Erlendur überlegte. »Versuchen kannst du es ja mal«, sagte er. »Ich habe keine Lust, zu denen hochzugehen. Worüber haben sich deine Mutter und Eva denn gestritten?«
»Da misch ich mich nicht ein«, sagte Sindri. »Gab es bei diesem Selbstmord in Grafarvogur etwas Verdächtiges?«
»Nein, so etwas ist immer eine schreckliche Sache. Der Ehemann war in der Stadt, als seine Frau sich in ihrem Ferienhaus in Þingvellir das Leben nahm.«
»Wusste er von nichts?«
»Nein.«
Kurz nachdem Sindri gegangen war, verstummten die Bässe im Stockwerk über Erlendur. Er blickte zur Decke. Dann ging er in den Flur und öffnete die Wohnungstür. Er rief nach Sindri Snær, aber der war bereits verschwunden.
Einige Tage später erhielt Erlendur den offiziellen Obduktionsbericht der Frau, die in Þingvellir aufgefunden worden war. Aus ihm ging, abgesehen von der Todesursache durch Erhängen, nichts Auffälliges hervor, es gab weder Verletzungen noch irgendetwas Ungewöhnliches im Blut. María hatte keine Krankheiten gehabt und war in guter körperlicher Verfassung gewesen. Biologisch gesehen gab es keine Antwort auf die Frage, weshalb sie sich entschlossen hatte, sich das Leben zu nehmen.
Erlendur musste jetzt noch einmal mit dem Ehemann sprechen, um ihm das Ergebnis mitzuteilen. Er fuhr kurz nach Mittag ins Grafarvogur-Viertel und klingelte. Elínborg begleitete ihn, obwohl sie eigentlich gar keine Zeit dazu hatte. Sigurður Óli war krank und lag mit Grippe im Bett. Erlendur warf einen Blick auf die Uhr.
Baldvin führte sie ins Wohnzimmer. Er hatte sich auf unbestimmte Zeit Urlaub genommen. Seine Mutter war zwei Tage bei ihm gewesen, doch inzwischen war sie wieder weg, Arbeitskollegen und Freunde waren zu Besuch gekommen oder hatten ihm Beileidstelegramme geschickt. Er hatte die Beerdigung vorbereitet und wusste, dass einige vorhatten, Nachrufe für die Zeitung zu schreiben. Das alles erzählte er Elínborg und Erlendur, während er Kaffee machte. Er wirkte niedergeschlagen, und seine Bewegungen waren langsam, er schien aber ansonsten im Gleichgewicht zu sein. Erlendur erzählte ihm, was die Obduktion ergeben hatte. Der Tod seiner Frau wurde als Selbstmord registriert. Er sprach ihm ein weiteres Mal sein Beileid aus. Elínborg sagte kaum etwas.
»Es war bestimmt gut, unter diesen Umständen jemanden im Haus zu haben«, sagte Erlendur.
»Sie kümmern sich sehr um mich, meine Schwester und meine Mutter«, antwortete Baldvin. »Manchmal ist es jedoch auch wichtig, allein zu sein.«
»Ja, keine Frage«, sagte Erlendur. »Für manche ist das sogar das Beste.«
Elínborg blickte zu ihm hinüber. Erlendur schätzte das Alleinsein mehr als alles andere. Sie überlegte krampfhaft, weshalb er sie mitgeschleppt hatte. Erlendur hatte nur gesagt, dass er diesem Mann die Obduktionsergebnisse mitteilen wollte; es würde nicht lange dauern. Jetzt hatte er auf einmal angefangen, sich mit dem Mann zu unterhalten, als seien sie seit Langem befreundet.
»Man gibt sich immer selbst die Schuld«, sagte Baldvin. »Ich habe das Gefühl, ich hätte etwas unternehmen müssen. Dass ich irgendetwas hätte machen können.«
»Das ist eine ganz natürliche Reaktion«, sagte Erlendur. »Wir kennen das sehr gut von unserer Arbeit. In solchen Fällen haben die Angehörigen aber in der Regel fast alles, wenn nicht tatsächlich alles getan, was in ihrer Macht steht.«
»Ich habe es nicht vorausgesehen«, sagte Baldvin. »Das kann ich euch versichern. Ich habe einen Schock bekommen wie noch nie in meinem Leben, als ich erfuhr, was passiert ist. Ihr könnt euch überhaupt nicht vorstellen, wie mir zumute war. Als Arzt bin ich ja einiges gewöhnt, aber wenn … wenn so etwas passiert … Ich bezweifle, dass man jemals auf so etwas vorbereitet sein kann.«
Er schien das Bedürfnis zu haben, sich auszusprechen, und sagte ihnen, dass er und seine Frau sich an der Universität kennengelernt hatten. María studierte Geschichte und Französisch. Er hatte schon auf dem Gymnasium mit der Schauspielerei geliebäugelt und war auch eine Weile auf der Schauspielschule gewesen, bevor er sich entschloss, umzusatteln und Medizin zu studieren.
»Hat sie nach dem Studium in ihrem Bereich gearbeitet?«, fragte Elínborg, die ein Diplom in Geologie hatte, aber beruflich nie auf diesem Gebiet tätig gewesen war.
»Ja, das hat sie«, erklärte Baldvin. »Sie hat alle möglichen Aufträge übernommen und hier zu Hause gearbeitet. Unten ist ihr Arbeitszimmer. Sie hat auch etwas unterrichtet und an bestimmten Projekten für Institutionen und Firmen gearbeitet. Sie forschte und veröffentlichte Artikel.«
»Wann seid ihr hier nach Grafarvogur gezogen?«, fragte Erlendur.
»Wir haben schon immer in diesem Haus gewohnt«, sagte Baldvin und sah sich im Wohnzimmer um. »Ich bin noch während des Studiums hier eingezogen. María war Einzelkind und erbte das Haus, als ihre Mutter starb. Es wurde errichtet, bevor die ganze Siedlung geplant und hier in großem Stil gebaut wurde. Das Haus steht ein bisschen für sich, wie ihr wahrscheinlich bemerkt habt.«
»Es macht den Eindruck, als sei es älter als die anderen«, sagte Elínborg.
»Leonóras Sterbebett war in einem der Zimmer hier«, erklärte Baldvin. »Es vergingen drei Jahre von dem Zeitpunkt an, als der Krebs bei ihr festgestellt wurde, bis sie starb. Sie wollte auf keinen Fall in ein Krankenhaus. Leonóra wollte zu Hause sterben. María hat sie die ganze Zeit gepflegt.«
»Das muss sehr schwierig für deine Frau gewesen sein«, sagte Erlendur. »Du hast mir gesagt, dass sie religiös war.«
Er bemerkte, dass Elínborg heimlich auf ihre Uhr schielte.
»Ja, das war sie. Sie hatte sich ihren Kinderglauben bewahrt. Die beiden sprachen viel über religiöse Dinge, nachdem Leonóra erkrankt war. Leonóra war ganz offen und sprach ohne Scheu über die Krankheit und den Tod. Ich glaube, das hat ihr in ihrer schwierigen Situation sehr geholfen. Ich denke, zum Schluss ist sie versöhnt aus der Welt geschieden. Oder zumindest so ausgesöhnt, wie Menschen unter diesen Umständen sein können. Das kenne ich aus meinem Beruf. Man kann sich zwar nicht im eigentlichen Sinne damit abfinden, so sterben zu müssen, aber es ist möglich, die Welt ausgesöhnt mit sich und seinen Nächsten zu verlassen.«
»Willst du damit sagen, dass deine Frau auch mit diesem Gefühl gestorben ist?«, fragte Erlendur.
Baldvin überlegte. »Das weiß ich nicht«, sagte er. »Ich zweifle daran, dass jemand voll und ganz ausgesöhnt sein kann, der so etwas macht wie sie.«
»Der Tod muss sie sehr beschäftigt haben.«
»Ich glaube, das war schon immer so«, sagte Baldvin.
»Was war mit ihrem Vater?«
»Er ist schon lange tot.«
»Ja, das hast du mir gesagt.«
»Ich habe ihn nie kennengelernt. Sie war ein kleines Mädchen, als das geschah.«
»Wie ist er gestorben?«
»Sie waren in ihrem Haus in Þingvellir, und er ertrank im See. Er war in einem kleinen Boot und fiel über Bord. Es war wohl ziemlich kalt, und er war Raucher, ein Mann, der sich nicht viel bewegte, und … er ertrank.«
»Es ist furchtbar, in so jungem Alter seinen Vater zu verlieren«, sagte Elínborg.
»María war sogar dabei«, erklärte Baldvin.
»Deine Frau?«, sagte Erlendur.
»Sie war erst zehn Jahre alt. Sie wurde traumatisiert. Meines Erachtens hat sie sich nie ganz davon erholt. Als dann ihre Mutter an Krebs erkrankte und starb, brach es mit doppelter Schwere über sie herein.«
»Sie hat viel durchmachen müssen«, sagte Elínborg.
»Ja, sie hat in der Tat viel durchmachen müssen«, sagte Baldvin und starrte auf seine Hände.
Fünf
Ein paar Tage später saß Erlendur mit einer Tasse Kaffee in seinem Büro und ging eine alte Akte über einen Vermisstenfall durch, als ihm mitgeteilt wurde, dass am Empfang jemand nach ihm fragte, eine Frau namens Karen. Er erinnerte sich, dass das der Name der Frau war, die María in Þingvellir gefunden hatte. Als er nach unten kam, stand dort eine Frau in Jeans, brauner Lederjacke und einem dicken weißen Rollkragenpullover darunter.
»Ich möchte mich gern mit dir über María unterhalten«, sagte sie, nachdem sie sich begrüßt hatten. »Du befasst dich mit dem Fall, nicht wahr?«
»Ja, aber von einem Fall kann eigentlich kaum die Rede sein, man hat …«
»Könnten wir uns nicht einen Augenblick irgendwo hinsetzen?«, unterbrach sie ihn.
»Woher kanntet ihr euch?«
»Wir sind seit unserer Kindheit befreundet gewesen«, sagte Karen.
»Ich verstehe.«
Erlendur führte sie in sein Büro, und sie nahm ihm gegenüber Platz. Sie behielt die Lederjacke an, obwohl es sehr warm in dem Raum war.
»Wir haben nichts Ungewöhnliches feststellen können«, sagte er, »falls du darauf aus bist.«
»Sie geht mir einfach nicht aus dem Kopf«, erklärte Karen. »Ich sehe sie ständig vor mir. Du kannst dir nicht vorstellen, was für ein Schock es für mich ist, dass sie das getan hat. Dass ich sie so aufgefunden habe. Sie hat nie etwas in dieser Richtung angedeutet, obwohl sie mir immer alles anvertraut hat. Wir waren sehr eng befreundet. Wenn irgendjemand María gekannt hat, dann ich.«
»Und was heißt das? Meinst du, dass sie niemals dazu imstande gewesen wäre, Selbstmord zu begehen?«
»Genau«, sagte Karen.
»Und was ist dann deiner Meinung nach passiert?«
»Das weiß ich nicht, aber sie hätte das niemals tun können.«
»Wie kannst du das einfach so sagen?«
»Ich sage es eben einfach. Ich kannte sie, und ich weiß, dass es ihr nie in den Sinn gekommen wäre, Selbstmord zu begehen.«
»Selbstmord kommt meist überraschend für andere. Auch wenn sie nicht mit dir darüber gesprochen hat, schließt das nicht aus, dass sie sich das Leben genommen hat. Es gibt nichts, was auf etwas anderes hindeutet.«
»Ich finde es auch etwas merkwürdig, dass er sie hat einäschern lassen.«
»Was meinst du damit?«
»Die Beerdigung hat bereits stattgefunden. Wusstest du das nicht?«
»Nein«, antwortete Erlendur und zählte im Stillen die Tage, die vergangen waren, seit er das erste Mal nach Grafarvogur gefahren war.
»Sie hat mir gegenüber nie erwähnt, dass sie verbrannt werden will, niemals«, sagte die Frau.
»Hätte sie dir das sagen müssen?«
»Ich denke schon.«
»Habt ihr denn jemals über eure Bestattungs… ich meine, darüber gesprochen, was ihr mit euren sterblichen Überresten machen lassen wollt?«
»Nein«, erklärte Karen störrisch.
»Also hast du im Grunde genommen keinerlei Anhaltspunkte, dass sie sich nicht verbrennen lassen wollte?«
»Nein, aber ich weiß es. Ich kannte María.«
»Du kanntest María und erklärst mir hier ganz offiziell im Polizeihauptdezernat, dass es beim Tod dieser Frau nicht mit rechten Dingen zugegangen ist?«
Karen überlegte. »Ich finde das alles sehr seltsam.«
»Aber du hast nichts in der Hand, was deinen Verdacht bestätigt, dass etwas Ungewöhnliches passiert ist.«
»Nein.«
»Dann können wir kaum etwas unternehmen«, sagte Erlendur. »Weißt du, wie das Verhältnis zwischen ihr und ihrem Mann war?«
»Ja.«
»Und?«
»Es war so weit in Ordnung«, sagte Karen mit leichtem Zögern.
»Du glaubst also nicht, dass ihr Ehemann an dem, was passiert ist, beteiligt war?«
»Nein. Vielleicht hat irgendjemand auf einmal bei ihr vor der Tür gestanden. Da treiben sich doch alle möglichen Leute herum. Ein Ausländer vielleicht. Habt ihr das überprüft?«
»Darauf deutet überhaupt nichts hin«, antwortete Erlendur. »Wollte María eigentlich so lange in dem Haus bleiben, bis du eintreffen würdest?«
»Nein«, sagte Karen, »das war nicht vereinbart.«
»Baldvin gegenüber hat sie aber angedeutet, dass sie auf dich warten wollte.«
»Warum sollte sie ihm das gesagt haben?«
»Vielleicht, um ihre Ruhe zu haben«, schlug Erlendur vor.
»Hat Baldvin dir von ihrer Mutter Leonóra erzählt?«
»Ja«, sagte Erlendur. »Er hat gesagt, dass ihr Tod der Tochter sehr nahegegangen ist.«
»Die Beziehung zwischen Leonóra und María war etwas ganz Besonderes«, sagte Karen. »Ich habe noch nie so ein enges Verhältnis zwischen Mutter und Tochter gesehen. Glaubst du an Träume?«
»Ehrlich gesagt glaube ich nicht, dass dich das irgendetwas angeht«, entgegnete Erlendur.
Die Beharrlichkeit dieser Frau überraschte ihn, obwohl er ihre Beweggründe verstehen konnte. Eine liebe Freundin hatte etwas getan, was in ihren Augen unvorstellbar war. Falls es María schlecht gegangen wäre, hätte Karen davon wissen und etwas unternehmen müssen. Jetzt war es zwar zu spät, aber sie wollte trotzdem etwas unternehmen, auf diesen Schicksalsschlag reagieren.
»Oder an ein Leben nach dem Tod?«
Erlendur schüttelte den Kopf. »Ich weiß nicht, worauf du …«
»María glaubte daran. Sie glaubte an Träume, daran, dass sie ihr etwas zu sagen hätten, ihr den Weg weisen könnten. Und sie glaubte an ein Leben nach dem Tod.«
Erlendur schwieg.
»Ihre Mutter hatte vor, ihr ein Zeichen zu senden«, sagte Karen. »Du verstehst … falls sie weiterlebte.«
»Also, da kann ich jetzt nicht ganz folgen.«
»María hat mir gesagt, dass Leonóra ihr ein Zeichen geben würde, falls sich das bewahrheiten würde, worüber sie kurz vor ihrem Ende so viel gesprochen hatten. Falls es ein Leben nach dem Tode gäbe! Sie wollte ihr aus dem Jenseits ein Zeichen geben.«
Erlendur räusperte sich. »Ein Zeichen aus dem Jenseits?«
»Ja, falls es ein Leben nach diesem Leben gibt.«
»Weißt du, um was es ging? Was für ein Zeichen sollte das sein?«
Karen antwortete ihm nicht.
»Hat sie es getan?«, fragte Erlendur.
»Was?«
»Hat sie ihrer Tochter ein Zeichen aus dem Jenseits gesandt?«
Karen sah Erlendur lange an. »Du glaubst bestimmt, dass ich spinne, nicht wahr?«
»Was soll ich darauf sagen«, antwortete Erlendur. »Ich kenne dich überhaupt nicht.«
»Du glaubst, dass alles, was ich sage, purer Blödsinn ist.«
»Nein, aber ich sehe nicht, was das alles mit der Kriminalpolizei zu tun hat. Kannst du mir das sagen? Ein Zeichen aus dem Jenseits! Was für Ermittlungen könnten wir da einleiten?«
»Ich finde, dass du dir zumindest anhören könntest, was ich dir sagen möchte.«
»Ich höre zu«, sagte Erlendur.
»Nein, das tust du nicht.« Karen öffnete ihre Tasche und holte eine Tonbandkassette heraus, die sie auf seinen Schreibtisch legte. »Vielleicht hilft dir das ja«, sagte sie.
»Was ist das?«
»Hör sie dir an, und dann unterhalte dich mit mir. Hör sie dir an, und sag mir, was du davon hältst.«
»Ich kann nicht …«
»Du sollst es nicht mir zuliebe tun«, sagte Karen, »sondern für María. Dann weißt du, wie ihr zumute gewesen ist.«
Karen stand auf. »Tu es für María«, sagte sie und verabschiedete sich.
Als Erlendur abends nach Hause kam, hatte er die Kassette dabei. Sie war nicht beschriftet, eine ganze normale Tonbandkassette. Erlendur besaß irgendwo noch ein altes Radio mit einem Kassettenrekorder, den er noch nie benutzt hatte und von dem er deswegen gar nicht wusste, ob er überhaupt funktionierte. Geraume Zeit stand er mit der Kassette in der Hand da und überlegte, ob er sich die wirklich anhören sollte.
Als er das Radio gefunden hatte, öffnete er das Kassettenfach, legte die Kassette ein und drückte auf »Play«. Zunächst kam gar nichts; es vergingen etliche Sekunden, ohne dass irgendetwas zu hören war. Erlendur rechnete damit, irgendwelche Lieblingsmusik der Verstorbenen zu hören, vielleicht etwas Religiöses, da María angeblich so gläubig gewesen war. Dann hörte man auf einmal ein Knarren, und das Gerät fing an zu rauschen.
»… nachdem ich in Trance gefallen war«, hörte er eine tiefe Männerstimme sagen.
Erlendur stellte lauter.
»Und danach weiß ich nichts mehr«, fuhr der Mann fort. »Es sind die Verblichenen, die entweder durch mich sprechen wollen oder mir Dinge zeigen wollen. Ich bin nur ihr Instrument, um Verbindung zu den Angehörigen aufzunehmen. Das kann alles längere oder kürzere Zeit dauern, je nachdem, wie stark der Kontakt ist.«
»Ja, ich verstehe«, sagte eine leise Frauenstimme.
»Hast du das dabei, worum ich dich gebeten habe?«
»Ich habe einen Pullover dabei, den sie sehr geliebt hat, und einen Ring, ein Geschenk von Papa, den hat sie immer getragen.«
»Vielen Dank. Am besten gibst du mir jetzt die Sachen.«
»Hier, bitte.«
»Erinnere mich daran, dir nachher die Kassette mitzugeben. Du hast sie neulich nicht mitgenommen. Man ist manchmal nicht bei sich.«
»Ja.«
»Nun, dann sehen wir mal, was geschieht. Fürchtest du dich? Du hast mir gesagt, dass du ein wenig Angst hast. Manche fürchten sich vor dem, was unter solchen Umständen zum Vorschein kommen kann.«
»Nein, nicht mehr. Ich hatte auch vorher eigentlich keine Angst, ich war mir nur nicht ganz sicher. Ich habe so etwas noch nie gemacht.«
Langes Schweigen.
»Da glitzert Wasser.«
Schweigen.
»Es ist Sommer, da gibt es Gebüsch, und da glitzert Wasser. Es sieht so aus, als scheine die Sonne auf einen See.«
»Ja.«
»Da ist ein Boot auf dem See. Kommt dir das bekannt vor?«
»Ja.«
»Ein kleines Boot.«
»Ja.«
»In dem Boot ist niemand.«
»Ja.«
»Du erkennst es also wieder? Du kennst dieses Boot?«
»Mein Vater besaß ein kleines Boot. Wir haben ein Ferienhaus am See von Þingvellir.«
Erlendur drückte auf »Stop«. Ihm war klar, dass diese Aufnahme bei einer Séance gemacht worden war, und er war sich ziemlich sicher, dass die leise Stimme der Frau gehörte, die sich das Leben genommen hatte. Er wusste zwar nicht viel über sie, aber er erinnerte sich daran, dass ihr Ehemann gesagt hatte, dass ihr Vater im See von Þingvellir ertrunken war. Erlendur hatte kein gutes Gefühl dabei, ihre Stimme zu hören, er kam sich vor, als schnüffele er in ihrem Privatleben herum. Er stand lange Zeit unbeweglich neben dem Gerät, doch dann gewann seine Neugier die Oberhand, und er schaltete es wieder ein.
»Ich spüre Zigarrenrauch in der Luft«, hörte er das Medium sagen. »Hat er geraucht?«
»Ja. Sehr viel.«
»Er möchte, dass du dich in Acht nimmst.«
»Vielen Dank.«
Den Worten der Frau folgte langes Schweigen. Erlendur lauschte dem Schweigen und hörte nichts als das leise Rauschen des Geräts. Plötzlich begann das Medium wieder zu sprechen, doch jetzt mit einer vollständig anderen Stimme, die dunkel, grob und rau klang.
»Sei auf der Hut … Du weißt nicht, was du tust!«
Erlendur erschrak, da ihm die Stimme bösartig zu klingen schien. Das änderte sich aber im nächsten Moment.
»War das in Ordnung?«, fragte das Medium.
»Ich glaube schon«, antwortete die Frau mit der leisen Stimme. »Was war da …?«
Die Frau zögerte.
»War das jemand, den du kennst?«, fragte das Medium.
»Ja.«
»Gut, ich … Warum ist mir so kalt? Mir klappern ja die Zähne!«
»Da war aber noch eine andere Stimme …«
»Eine andere Stimme?«
»Ja, nicht deine.«
»Und was hat sie gesagt?«
»Ich soll auf der Hut sein.«
»Ich weiß nicht, was das war«, sagte das Medium. »Ich kann mich an nichts erinnern.«
»Sie erinnerte mich an …«
»Ja?«
»Sie erinnerte mich an meinen Vater.«
»Die Kälte … Die kommt nicht von dort. Diese Eiseskälte, die ich verspüre. Sie hat mit dir direkt zu tun, und sie hat etwas Gefährliches, etwas, vor dem du dich in Acht nehmen musst.«
Erlendur streckte seine Hand nach dem Gerät aus und schaltete es aus. Er war nicht imstande, weiter zuzuhören. Er kam sich irgendwie unanständig vor und war peinlich berührt, denn er kam sich so vor, als hätte er irgendwo heimlich an der Tür gehorcht. Erlendur war der Gedanke zuwider, das Andenken dieser Frau zu entwürdigen, indem er lauschte.
Sechs
Der alte Mann wartete am Empfang auf ihn. Früher war er mit seiner Frau ins Hauptdezernat gekommen, doch da sie inzwischen verstorben war, kam er jetzt immer allein, um mit Erlendur zu sprechen. Seit fast dreißig Jahren hatten die Eheleute ihn regelmäßig in seinem Büro besucht, zuerst wöchentlich, dann einmal im Monat, dann einige Male im Jahr, schließlich nur noch einmal im Jahr und zum Schluss alle zwei oder drei Jahre am Geburtstag des Sohnes. Erlendur hatte sie in dieser Zeit ziemlich gut kennengelernt. Die Trauer trieb sie zu ihm. Der jüngere Sohn des Ehepaares, Davið, war 1976 aus dem Haus gegangen, und seitdem hatten sie nie wieder etwas von ihm gehört.