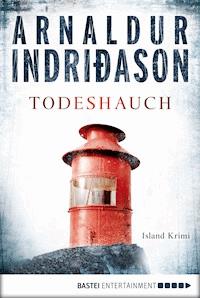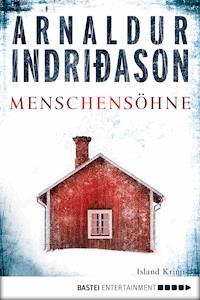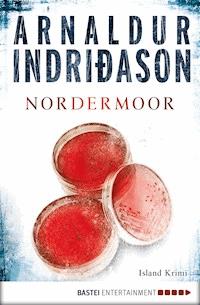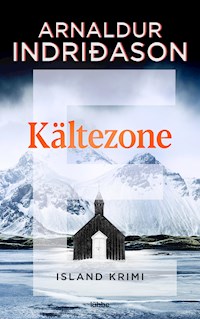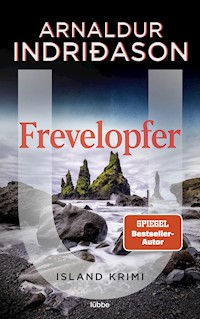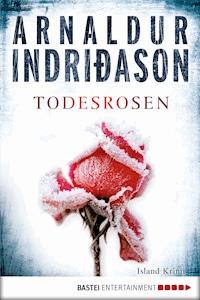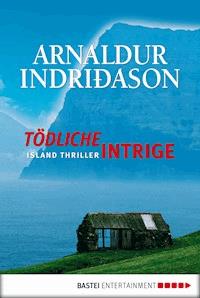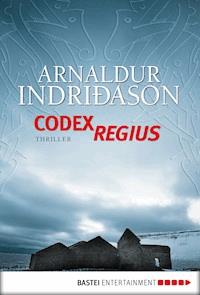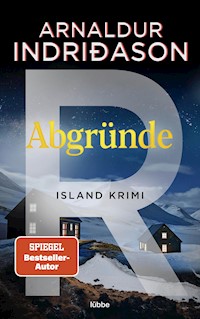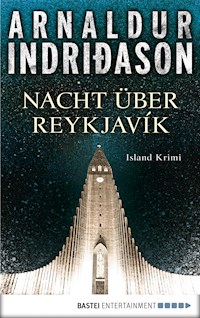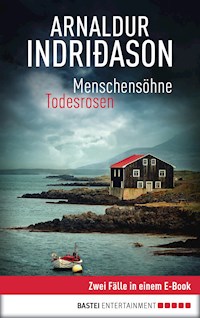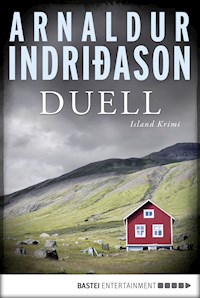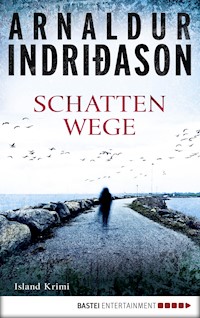9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Bastei Lübbe
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Sprache: Deutsch
Schauplatz: Europas größter Gletscher
Die Eiskappe des Vatnajökull auf Island schmilzt. Die Streitkräfte der US-Basis Keflavík sind in Alarmbereitschaft, denn der Gletscher hütet ein Geheimnis: ein abgestürztes Flugzeug aus dem Zweiten Weltkrieg mit brisanter Fracht. Vor der grandiosen Kulisse des ewigen Eises gerät eine junge Isländerin in Lebensgefahr. Sie weiß nur wenig, aber das ist schon zu viel für die Drahtzieher der "Operation Napoleon" ...
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 426
Veröffentlichungsjahr: 2011
Ähnliche
Inhalt
CoverÜber den AutorTitelImpressumVorbemerkungZitat1. Teil:1945Auf dem Gletscher ...2. Teil: 1999Kapitel 1Kapitel 2Kapitel 3Kapitel 4Kapitel 5Kapitel 6Kapitel 7Kapitel 8Kapitel 9Kapitel 10Kapitel 11Kapitel 12Kapitel 13Kapitel 14Kapitel 15Kapitel 16Kapitel 17Kapitel 18Kapitel 19Kapitel 20Kapitel 21Kapitel 22Kapitel 23Kapitel 24Kapitel 25Kapitel 26Kapitel 27Kapitel 28Kapitel 29Kapitel 30Kapitel 31Kapitel 32Kapitel 33Kapitel 34Kapitel 35Kapitel 36Kapitel 37Kapitel 38Kapitel 39Kapitel 40Kapitel 41Kapitel 42Kapitel 43Kapitel 44Kapitel 45Kapitel 463. Teil: 2005An dem Tag, ...Über den Autor
Arnaldur Indriðason, Jahrgang 1961, war Journalist und Filmkritiker bei Islands größter Tageszeitung. Heute lebt er als freier Autor in Reykjavík und veröffentlicht mit sensationellem Erfolg seine Romane. Sie belegen seit Jahren die oberen Ränge der Bestsellerliste in Island.
Arnaldur Indriðason
Gletschergrab
Roman
Aus dem Isländischen von Coletta Bürling und Kerstin Bürling
Vollständige E-Book-Ausgabe
des in der Bastei Lübbe AG erschienenen Werkes
Für die Originalausgabe:
Copyright © 1999 by Arnaldur Indriðason
Titel der isländischen Originalausgabe: »Napóleonsskjölin«
erschienen bei Vaka-Helgafell, Reykjavík.
Für diese Ausgabe:
Copyright © 2005/2015/2023 by Bastei Lübbe AG, Köln
Covergestaltung: Guter Punkt, München nach einer Vorlage von © Sagafilm ehf. and Splendid Entertainment and ZDF 2023. All rights reserved.
eBook-Erstellung: hanseatenSatz-bremen, Bremen
ISBN 978-3-8387-1259-8
luebbe.de
lesejury.de
Vorbemerkung
In Island duzt heutzutage jeder jeden. Man redet sich nur mit dem Vornamen an. Dies wurde bei den Übersetzungen der Island-Krimis von Arnaldur Indridason beibehalten
»Operation Unthinkable« war der Codename für Churchills Plan, mit deutscher Unterstützung am Ende des Zweiten Weltkrieges die Sowjetunion anzugreifen.
The Daily Telegraph, 1998
1945
Auf dem Gletscher tobte ein Orkan.
Er konnte die Hand nicht vor Augen sehen. Er konnte kaum den Kompass erkennen, den er in der Hand hielt. Umkehren war unmöglich, selbst wenn er gewollt hätte. Es gab auch nichts, wohin er sich hätte wenden können. Der Sturm biss ihn, peitschte ihm ins Gesicht und fegte ihm aus allen Richtungen harten und kalten Schnee entgegen. Der Schnee blieb in seiner Kleidung hängen, und bei jedem Schritt sank er bis übers Knie ein. Er hatte jegliches Zeitgefühl verloren und wusste nicht, wie lange er schon gelaufen war. Er konnte keinen Unterschied zwischen Tag und Nacht ausmachen; dieselbe schwere Dunkelheit hatte ihn eingehüllt, seitdem er losgegangen war. Er wusste nur, dass er am Ende seiner Kräfte war. Er machte jeweils ein paar Schritte hintereinander, ruhte sich aus und ging dann weiter. Ein paar Schritte. Pause. Schritt. Pause. Schritt. Pause. Schritt.
Den Absturz hatte er fast unverletzt überstanden. Andere hatten nicht so viel Glück gehabt. Das Flugzeug war plötzlich mit ohrenbetäubendem Lärm über den Gletscher geschlittert. Für kurze Zeit hatte er Flammen aus einem der beiden Propeller schlagen sehen, bis plötzlich die ganze Tragfläche abriss und in der Dunkelheit und dem tosenden Sturm verschwand. Kurze Zeit später riss auch der andere Flügel unter Funkensprühen ab, und der flügellose Flugzeugtorso schoss wie ein Torpedo über den Gletscher.
Er selbst, der Pilot und drei andere waren bei der Bruchlandung angeschnallt gewesen, aber zwei aus der Gruppe hatten die Nerven verloren, als die Situation kritisch wurde. Sie waren in ihrer Panik von den Sitzen aufgesprungen und zur Pilotenkabine gestürmt. Beim Aufprall auf den Gletscher schossen sie wie Gewehrkugeln durch die Maschine und waren auf der Stelle tot. Er hatte sich geduckt, sah sie erst gegen die Decke, dann gegen die Seitenwand des Flugzeugs prallen, bis sie an ihm vorbei in den hinteren Teil des Flugzeugs geschleudert wurden, wo ihre Schreie erstarben.
Der Torso schabte über den Gletscher und pflügte durch Eis und Schnee, bis er allmählich an Geschwindigkeit verlor und schließlich zum Stehen kam. Dann war auf einmal alles still, bis auf das Heulen des Sturms.
Er war der Einzige, der gleich hinaus in das Unwetter wollte, um zu versuchen, bewohnte Gebiete zu erreichen. Die anderen wollten abwarten, denn sie hofften darauf, dass sich der Sturm legen würde. Sie wollten zusammenbleiben. Er war nicht zu halten. Er wollte nicht Gefahr laufen, im Flugzeug eingeschlossen zu werden. Wollte nicht, dass es zu seinem Sarg wurde. Mit ihrer Hilfe rüstete er sich so gut wie möglich für den Marsch. Er war noch nicht lange in dem unablässig wütenden Schneesturm unterwegs gewesen, als er begriff, dass er besser bei den anderen im Flugzeug geblieben wäre. Nun war es zu spät.
Er versuchte, Kurs nach Südosten zu halten. Vor der Bruchlandung hatte er für einen Moment ein Licht wie von einer menschlichen Ansiedlung gesehen und war der Meinung, in die richtige Richtung zu gehen. Er fror, seine Schritte wurden immer schwerer, und der Orkan schien eher noch an Stärke zu gewinnen als nachzulassen. Er kämpfte sich weiter durch den Schnee, aber seine Kräfte schwanden zusehends.
Er dachte an das Schicksal, das die anderen erwartete, die in der Maschine zurückgeblieben waren. Als er sie verließ, verschwand das Flugzeug schon unter Schnee, und die Furche, die es auf dem Gletscher gezogen hatte, wehte bereits wieder zu. Sie hatten Petroleumlampen dabei, aber das Petroleum würde nicht lange vorhalten, und die Kälte auf dem Gletscher war mörderisch. Die Tür des Flugzeugs durfte nicht offen bleiben, weil es sich sonst mit Schnee füllen würde. Wahrscheinlich waren sie jetzt schon im Flugzeug eingeschlossen. Sie wussten, dass sie auf jeden Fall erfrieren würden, ob sie im Flugzeug blieben oder hinaus auf den Gletscher gingen. Die wenigen Möglichkeiten, die ihnen blieben, hatten sie durchgesprochen. Er hatte ihnen gesagt, dass er nicht still dasitzen und auf seinen Tod warten würde.
Er hatte ihnen gesagt, dass er nicht im Flugzeug eingeschlossen werden wollte.
Die Kette rasselte. Die Tasche zog an seinem Arm. Sie war mit Handschellen an seinem Handgelenk befestigt. Er hatte den Griff schon lange losgelassen und schleifte die Tasche an der Kette hinter sich her. Die Handschellen schnitten in sein Handgelenk, aber das war ihm gleichgültig.
Ihm war alles gleichgültig.
Sie hörten das Flugzeug, lange bevor es in westlicher Richtung über sie hinwegflog. Sie hörten durch das Gebrüll des Orkans, wie es sich näherte, aber als sie zum Himmel schauten, war da nichts als winterliche Dunkelheit und peitschende Schneeböen. Es ging auf elf Uhr abends zu. Sie hatten sofort an ein Flugzeug gedacht. Wegen des Flughafens der Briten im Hornafjörður hatte all die Kriegsjahre hindurch in diesem Gebiet ein ziemlich reger Flugverkehr geherrscht, sodass sie inzwischen die meisten britischen und amerikanischen Flugzeuge am Geräusch erkannten. Dieses Geräusch hatten sie noch nie zuvor gehört. Und noch nie war das Dröhnen so nah gewesen. Es schien, als hielte das Flugzeug direkt auf ihren Hof zu.
Sie waren nach draußen gegangen und hatten schon eine Weile auf der Treppe gestanden, als das dröhnende Motorengeräusch seinen Höhepunkt erreichte. Sie hielten sich die Ohren zu und verfolgten das Geräusch in Richtung Gletscher. Für einen Augenblick sahen sie über sich einen dunklen Schatten, der sofort wieder in der kohlrabenschwarzen Nacht verschwand. Sie hatten den Eindruck, dass das Flugzeug zu steigen versuchte. Das Geräusch entfernte sich langsam, bis es schließlich über dem Gletscher verstummte. Sie dachten beide dasselbe. Das konnte nicht gut gehen. Das Flugzeug flog zu niedrig. Wegen des Unwetters war die Sicht gleich null, und die Maschine würde in wenigen Minuten zur Beute des Gletschers werden. Selbst wenn das Flugzeug noch an Höhe gewinnen würde, wäre es zu spät. Der Gletscher war zu nah.
Nachdem das Dröhnen erstarb, standen sie noch ein paar Minuten auf der Treppe, starrten in den Schneesturm und horchten. Es war nichts zu hören. Dann gingen sie wieder ins Haus. Sie konnten niemanden anrufen, um ihre Beobachtung zu melden, da die Telefonverbindung vor kurzem durch ein anderes Unwetter unterbrochen worden war. Bei dem Wetter war es unmöglich gewesen, die Leitung zu reparieren. Das waren sie gewohnt. Jetzt war wieder ein Unwetter über sie hereingebrochen und tobte fast noch heftiger als das vorige. Als sie zu Bett gingen, sprachen sie darüber, dass sie versuchen wollten, auf Pferden den nächsten größeren Ort, Höfn im Hornafjörður, zu erreichen. Dort wollten sie das Flugzeug melden, sobald der Sturm nachgelassen hatte.
Das Wetter beruhigte sich vier Tage später, und sie brachen auf, um nach Höfn zu reiten. Durch den tiefen Neuschnee kamen sie nur langsam vorwärts. Die beiden waren Brüder und wohnten allein auf dem Hof. Ihre Eltern lebten nicht mehr, und keiner von beiden hatte geheiratet. Auf dem Weg machten sie auf zwei Höfen Rast und übernachteten auf dem zweiten. Sie berichteten vom Flugzeug und ihrer Befürchtung, dass es vermutlich abgestürzt war. Die Leute auf den anderen Höfen hatten das Flugzeug nicht bemerkt.
Als die Brüder nach Höfn kamen, erstatteten sie Meldung über den Zwischenfall. Die Nachricht über die Sichtung des Flugzeugs südlich des Gletschers Vatnajökull und die Vermutung, dass es über dem Gletscher abgestürzt sei, wurden direkt telefonisch nach Reykjavík übermittelt. Der Flugsicherung der amerikanischen Besatzungsmacht in Reykjavík, die den gesamten Flugverkehr über Island und dem Nordatlantik koordinierte, waren keine Flugbewegungen zur angegebenen Zeit in der besagten Region bekannt. Angesichts der gefährlichen Großwetterlage war der Flugverkehr auf ein Minimum reduziert gewesen.
Etwas später am gleichen Tag erreichte den Landrat in Höfn ein Telegramm von der obersten Heeresleitung. Die amerikanischen Streitkräfte übernähmen von nun an die Untersuchung des Falles und würden Rettungsmannschaften auf den Gletscher entsenden. Damit sei die Angelegenheit für die örtlichen Behörden abgeschlossen. Allen Unbefugten sei es untersagt, sich der vermutlichen Absturzstelle auf dem Gletscher zu nähern. Erklärungen dazu wurden nicht abgegeben.
Vier Tage später trafen zwölf Militärtransporter mit ungefähr zweihundert Mann in Höfn ein. Während der dunkelsten Wintermonate war der Flughafen bei Höfn gesperrt, und die großen Gletscherflüsse im Süden Islands waren unpassierbar. Die Militärfahrzeuge hatten jeweils sechs Räder und waren mit Schneeketten ausgerüstet. Sie hatten im Konvoi Nordisland durchquert und waren an den Fjorden der Ostküste entlang zum Vatnajökull gefahren. Auch die Strecke durch Nordisland, die fast um die ganze Insel herumführte, war nahezu unpassierbar. Die Hauptstraße, die die Landesteile miteinander verband, war kaum etwas anderes als eine tief verschneite Piste, und im Hochland von Möðrudalur im Nordosten Islands hatten sie sich mühsam den Weg freischaufeln müssen.
Die Kompanie setzte sich aus Soldaten des 10. Infanterie- und des 46. Artillerieregiments zusammen, die von General Cortlandt Parker befehligt wurden, dem Oberkommandierenden der auf Island stationierten amerikanischen Streitkräfte. Einige der Soldaten hatten im Winter zuvor an einer Militärübung auf dem Gletscher Eiríksjökull teilgenommen, aber die meisten von ihnen waren noch nicht einmal im Umgang mit Skiern trainiert oder verfügten über andere Erfahrungen mit Eis und Schnee.
Ein Offizier namens Miller leitete den Einsatz. Die Soldaten schlugen ein Camp in der Nähe von Höfn auf, wo es bereits ein paar Baracken gab, die die britischen Streitkräfte zu Kriegsbeginn dort errichtet hatten. Von dort aus stießen sie weiter in Richtung Gletscher vor. Als die Soldaten bei den beiden Brüdern eintrafen, waren fast zehn Tage vergangen, seit diese das Flugzeug gesichtet hatten. Seitdem hatte es fast ununterbrochen geschneit. Die Soldaten richteten neben dem Hof ihr Basiscamp ein, und die beiden Brüder wiesen ihnen den Weg auf den Gletscher. Sie sprachen kein Englisch, aber mit Gestik und Zeichensprache konnten sie Miller die Flugbahn der Maschine anzeigen und ihm zugleich bedeuten, dass wenig Aussicht bestand, mitten im Winter auf dem Gletscher oder in der näheren Umgebung ein Flugzeug zu finden. »Der Vatnajökull ist der größte Gletscher Europas«, sagten sie und schüttelten die Köpfe. »Genauso gut könnte man eine Nadel in einem Heuhaufen suchen.« Die Lage wurde noch dadurch erschwert, dass inzwischen vermutlich alle Spuren der Bruchlandung unter dem Schnee verschwunden waren.
Captain Miller verstand ihre Hinweise, schenkte ihnen aber keine Beachtung. Obwohl alles tief verschneit war, konnte der Gletscher vom Hof der Brüder aus bestiegen werden, und sie kamen trotz der widrigen Umstände relativ zügig voran. Die Tage waren kurz. Hell war es nur zwischen zehn Uhr morgens und halb fünf Uhr nachmittags, sodass nicht viel Zeit zum Suchen blieb. Miller hatte seine Leute gut im Griff. Die Brüder kamen schnell dahinter, dass die meisten der Soldaten noch nie im Leben ihren Fuß auf einen Gletscher gesetzt und wenig Erfahrung mit einer winterlichen Mission wie dieser hatten. Die Brüder führten sie ohne weitere Zwischenfälle an allen Spalten und Abbrüchen vorbei. In einer Mulde am Rand des Gletschers schlugen die Soldaten in elfhundert Meter Höhe ihre Zelte auf.
Drei Wochen lang suchte Millers Kompanie die Gletscherzungen und ein fünf Quadratkilometer großes Gebiet auf dem Zentralgletscher ab. In dieser Zeit blieb das Wetter stabil, und die Soldaten gingen die Suche äußerst planvoll an. Sie teilten sich in zwei Suchtrupps auf; der eine durchkämmte das Gelände vom Basiscamp am Hof der Brüder hangaufwärts, der andere suchte den Gletscher vom oberen Camp aus ab, solange es hell war. Wenn es dunkel wurde, versammelten sich die Soldaten in ihren Zelten, aßen, schliefen und sangen Lieder, die die Brüder aus dem Radio kannten. Sie übernachteten in britischen Expeditionszelten aus doppeltem Nylon und wärmten sich an Primuskochern und Petroleumlampen. Gekleidet waren sie in dicke Pelzjacken, die bis über die Knie reichten und eine pelzgefütterte Kapuze hatten. Ihre Hände steckten in dicken, groben Handschuhen aus isländischer Wolle.
Bei dieser ersten Suchaktion wurde vom Flugzeug außer der Felge des Bugrads nichts gefunden. Die Brüder entdeckten sie oben auf dem Gletscher, zwei Kilometer vom Gletscherrand entfernt, und Miller nahm sie sofort in Verwahrung. Der Gletscher war an dieser Stelle ganz eben, und es fanden sich keinerlei Hinweise darauf, dass hier eine Maschine zerschellt oder notgelandet war. Selbst wenn das Flugzeug an dieser Stelle abgestürzt sein sollte, wäre das Wrack sicherlich schon unter Schnee und Eis verschwunden, sagten die Brüder. Der Gletscher hätte es verschlungen.
Captain Miller war bei der Suche nach dem Flugzeug unermüdlich und gewann schnell die Achtung der Brüder, die ihm mit großer Herzlichkeit und Respekt begegneten und bereit waren, alles für ihn zu tun. Miller fragte die beiden wegen ihrer guten Ortskenntnisse oft um Rat, sodass sich zwischen ihnen bald freundschaftliche Bande entwickelten. Als die Expedition auf dem Gletscher zum zweiten Mal von schlechtem Wetter überrascht wurde, war Miller schließlich gezwungen aufzugeben. Beim zweiten Wetterumschwung verschwanden ein Zelt sowie andere Ausrüstungsgegenstände unter dem Schnee und waren nicht mehr aufzufinden.
Zweierlei erstaunte die Brüder während dieser Suchaktion.
Eines Tages trafen sie Miller allein im Pferdestall des Hofes an. Der Pferdestall war direkt mit dem Kuhstall und der Scheune verbunden. Sie waren durch den Kuhstall hereingekommen und hatten Miller überrascht, wie er bei einem der Pferde in der Box stand und ihm über den Kopf strich. Es schien, als hätte sich der Offizier, der sich durch seine energische Art und seinen konsequenten Führungsstil die Bewunderung der Brüder erworben hatte, zurückgezogen und wäre in Tränen ausgebrochen. Er hatte seine Arme um den Hals des Pferdes gelegt, und seine Schultern zuckten leicht. Als einer der beiden sich räusperte, schrak Miller hoch. Er schaute sie an, und sie sahen, dass die Tränen eine feuchte Spur in seinem schmutzigen Gesicht hinterlassen hatten. Miller bekam sich rasch wieder in den Griff, nachdem er die beiden Brüder bemerkt hatte, wischte sich über das Gesicht und verhielt sich, als sei nichts vorgefallen. Die Brüder hatten miteinander schon öfter über Miller gesprochen. Sie hatten ihn nie nach seinem Alter gefragt, aber er wirkte nicht älter als fünfundzwanzig.
»Was für ein schönes Tier«, sagte Miller in seiner Muttersprache, aber die Brüder verstanden ihn nicht. Wahrscheinlich hat er Heimweh, dachten sie. Der Zwischenfall blieb ihnen im Gedächtnis haften.
Das andere, was die beiden Brüder merkwürdig fanden, war die Felge des Bugrads. Sie hatten Zeit genug, sie zu untersuchen, bevor Miller hinzukam und die Felge in Verwahrung nahm. Der Reifen hatte sich gelöst, sodass nur noch die nackte Felge an der gebrochenen Aufhängung hing. Sie sprachen anschließend noch lange darüber, dass in die Felge ein Wort in einer Sprache eingraviert war, die sie noch weniger verstanden als Englisch.
Kruppstahl.
1999
1
Das Gebäude lag in der Nähe des Weißen Hauses in der Hauptstadt Washington. Früher hatte es als Lagerhaus gedient, bevor es dann für etliche Milliarden umgebaut wurde, um darin eine der vielen geheimen Organisationen in dieser Stadt unterzubringen. Dabei war an nichts gespart worden, weder außen noch innen. Riesige Computer surrten dort den ganzen Tag und werteten Informationen aus dem Weltall aus. In der alten Lagerhalle wurden die Satellitenbilder des amerikanischen Militärgeheimdienstes in Datenbanken gesammelt. Dort wertete man sie aus, sortierte sie und schlug Alarm, sobald irgendetwas Ungewöhnliches zum Vorschein kam.
Offiziell hieß das Lagerhaus nur Gebäude 312. Die Organisation, die es beherbergte, war einer der Grundpfeiler des amerikanischen Verteidigungssystems während des Kalten Krieges gewesen. Sie wurde Anfang der sechziger Jahre gegründet, als der Kalte Krieg auf dem Höhepunkt war. Hauptsächlich war sie damit betraut, die Aufklärungsbilder auszuwerten, die über der Sowjetunion, China, Kuba und anderen Ländern aufgenommen wurden, die der usa als feindlich gesinnt galten. Seit dem Ende des Kalten Krieges bestand ihre Aufgabe unter anderem darin, die Terroristencamps in den Ländern östlich des Mittelmeers zu beobachten und die Kämpfe auf dem Balkan zu verfolgen. Die Organisation verfügte insgesamt über acht Satelliten auf Erdumlaufbahnen von achthundert bis fünfzehnhundert km Höhe.
An der Spitze des militärischen Geheimdienstes stand ein General namens Vytautas Carr. Im Augenblick betrachtete er die Monitore, die im Kontrollraum in der oberen Etage eine ganze Wand einnahmen, und studierte aufmerksam die Aufnahmen, deretwegen er gerufen worden war. Wegen der zwölf enormen Computeranlagen, die ohne Unterlass in einem abgetrennten Teil des Raumes surrten, wurden die Temperaturen im Haus niedrig gehalten. Zwei bewaffnete Posten bewachten die Tür. Über die ganze Breite des Saales standen vier Reihen mit flimmernden Computerbildschirmen.
Carr war um die siebzig und eigentlich längst im Pensionsalter, aber in seinem Fall hatte die Organisation eine Ausnahme gemacht. Er war fast zwei Meter groß, und das Alter hatte ihm noch nichts anhaben können. Sein ganzes Leben hatte er beim Militär gedient; er hatte in Korea gekämpft und war eine der dynamischsten Führungspersönlichkeiten des Geheimdienstes, der die Organisation mit aufgebaut und geprägt hatte. Er trug keine Uniform, sondern einen zweireihigen Anzug. Die Bildschirmwand spiegelte sich in seiner Brille. Hinter ihr verbargen sich kleine, stechende Augen, die auf zwei Bildschirme in der linken oberen Ecke starrten.
Einer der beiden Monitore zeigte Bilder aus dem Archiv der Organisation, das viele Millionen Satellitenbilder aus den vergangenen vier Jahrzehnten umfasste. Auf dem anderen Schirm waren neue Aufnahmen zu sehen. Die Bilder, die Vytautas Carr betrachtete, waren über Island aufgenommen worden, über einem kleinen Gebiet im Südosten des Vatnajökull. Das ältere Bild stammte aus dem vorherigen Jahr, das jüngere war erst wenige Stunden alt. Auf dem älteren Bild war nichts Ungewöhnliches zu erkennen, nur die schneeweiße Eisfläche des Gletschers und vereinzelte Spalten, aber auf dem neuen Bild konnte man in der unteren linken Ecke einen kleinen Fleck ausmachen. Die Aufnahmen waren grobkörnig und hatten einen Grauschleier, aber mit einiger Nachbearbeitung zeigten sie ein präzises und detailgenaues Bild. Carr bat darum, den Fleck zu vergrößern, und das Bild veränderte seine Auflösung, bis der schwarze Punkt den ganzen Schirm ausfüllte.
»Wen haben wir in Keflavík?«, fragte Carr den Mann am Kontrollpult, der die Bilder zeigte.
»Wir haben niemanden in Keflavík«, erwiderte der.
Carr dachte nach.
»Holen Sie mir Ratoff ans Telefon«, sagte er dann. »Hoffentlich ist das nicht wieder ein Phantom wie damals ’67«, fügte er hinzu.
»Wir haben bessere Satelliten als damals«, sagte der Mann, den Telefonhörer schon in der Hand.
»Wir haben noch nie ein so klares Bild vom Gletscher gehabt. Wie viele wissen über diese neuen Aufnahmen Bescheid?«
»Nur der Rest der Acht-Uhr-Schicht, das sind drei Leute, abgesehen von mir und Ihnen natürlich.«
»Wissen sie, worum es geht?«
»Sie haben keine Ahnung. Ihnen sind die Bilder noch nicht einmal aufgefallen.«
»Belassen wir es dabei«, sagte Carr und verließ den Raum. Er folgte einem langen Gang, bis er zu seinem Büro gelangte und die Tür hinter sich schloss. Das Telefon blinkte.
»Ratoff auf Leitung zwei«, ertönte eine Stimme aus dem Hörer. Carr zog eine Grimasse und drückte die Taste.
»Wie lange brauchen Sie, um nach Keflavík zu kommen?«, fragte Carr unvermittelt.
»Was ist Keflavík?«, fragte die Stimme im Telefon.
»Unser militärischer Stützpunkt in Island«, antwortete Carr.
»Island? Morgen Abend könnte ich dort sein. Was ist los?«
»Wir haben eine äußerst klare Aufnahme vom größten Gletscher des Landes. Er scheint uns jetzt endlich etwas wiedergeben zu wollen, was wir vor vielen Jahren dort oben verloren haben. Wir brauchen einen Mann in Keflavík, der dort bei unserer Operation alle Fäden in der Hand hält. Zwei Spezialeinheiten werden Sie dorthin begleiten, die Ausrüstung können Sie sich selbst zusammenstellen. Sagen Sie, dass es sich um eine Routineaktion handelt. Verweisen Sie auf den Verteidigungsminister, falls die Isländer Probleme machen sollten. Ich spreche mit ihm. Ich werde auch dafür sorgen, dass die zuständigen isländischen Behörden in Kenntnis gesetzt werden und eine Erklärung bekommen. Die Isländer reagieren sehr empfindlich auf alles, was unseren Militärstützpunkt dort betrifft. Immanuel Wesson wird unsere Botschaft in Island übernehmen und dort als unser Sprecher fungieren. Alle weiteren Informationen bekommen Sie auf der Hinreise.«
»Ich nehme an, dass es sich um eine geheime Operation handelt?«
»Sonst hätte ich Sie nicht hinzugezogen.«
»Keflavík. Jetzt erinnere ich mich. Gab es nicht 1967 irgendeinen Zwischenfall da oben auf dem Gletscher?«
»Wir haben jetzt bessere Satelliten als damals.«
»Sind es dieselben Koordinaten wie damals?«
»Nein. Die Position hat sich geändert. Dieser verdammte Gletscher ist ständig in Bewegung«, sagte Carr und unterbrach die Verbindung ohne ein Wort des Abschieds. Er mochte Ratoff nicht. Er stand auf, öffnete einen großen Glasschrank und entnahm ihm zwei kleine Schlüssel, die er in der Hand wog. Der eine war etwas größer als der andere, aber beide waren sehr schmal und gehörten offenbar zu einem kleinen Schloss. Er legte sie wieder zurück in den Schrank.
Es war schon viele Jahre her, dass Carr die Felge betrachtet hatte. Er holte sie aus dem Schrank und wog sie in der Hand. Er las die Aufschrift: Kruppstahl. Das war die Bestätigung für den Absturz. Das Fabrikat passte zu Typ und Größe der Maschine, zu Baujahr und Tragfähigkeit. Die Felge war der Beweis, dass das Flugzeug oben auf dem Gletscher war.
Und jetzt war es endlich gefunden.
Nach all den Jahren.
2
Kristín schloss die Augen. Sie fühlte, wie ihr der Kopfschmerz in die Stirn kroch. Der Kerl hatte sie jetzt bereits zum dritten Mal in ihrem Büro aufgesucht und gab dem Ministerium die Schuld daran, dass er betrogen worden war. Die beiden letzten Male hatte er schon versucht, sie mit seinem rücksichtslosen und unverschämten Verhalten einzuschüchtern. Er drohte mit einer gerichtlichen Klage, falls er nicht in irgendeiner Form Schadenersatz für den angeblichen Fehler des Ministeriums erhalte. Zweimal hatte sie sich diesen Sermon schon anhören müssen, und beide Male hatte sie sich zusammengerissen und sich bemüht, ihm sachlich und verständlich zu antworten. Er schien ihren Worten nicht die geringste Beachtung zu schenken. Jetzt saß er zum dritten Mal in ihrem Büro, und die Litanei ging wieder von vorne los.
Sie schätzte ihn auf rund vierzig, vielleicht zehn Jahre älter als sie selbst, und der Altersunterschied schien ihm zu genügen, um sich in ihrem Büro breit zu machen und Drohungen auszustoßen, sie sogar mit abfälligen Äußerungen wie »ein junges Ding wie du« herabzuwürdigen. Er versuchte gar nicht, seine Verachtung ihr gegenüber zu verhehlen. Ob es daran lag, dass sie eine Frau war, oder daran, dass sie Juristin war, konnte sie nicht einschätzen. Sie nahm an, dass er meinte, so mit ihr umspringen zu können, weil sie jünger war als er und dazu noch eine Frau. Er hieß Randolf. Wahrscheinlich wurde er Randy genannt, dachte sie und grinste innerlich. Sein Dreitagebart war außergewöhnlich gepflegt, und sein volles schwarzes Haar war mit glänzendem Gel zurückgestrichen. Er trug einen dunklen Anzug mit Weste, an der mit einer dünnen Silberkette eine Uhr befestigt war. Ab und zu holte er sie mit seinen langen, dünnen Fingern heraus und öffnete sie wichtigtuerisch, als hätte er keine Zeit für diesen Quatsch. So hatte er es selber ausgedrückt.
Recht hatte er, was den Quatsch betraf, dachte sie. Er verkaufte transportable Gefrieranlagen nach Russland, und das Außenministerium sowie die Handelskammer waren ihm dabei behilflich gewesen, entsprechende Geschäftsbeziehungen aufzubauen. Er hatte vier Units rausgeschickt, wie er sich ausdrückte, nach Murmansk und Kamtschatka, aber noch keinen einzigen Rubel dafür erhalten. Er behauptete, die Juristin, die früher im Ministerium tätig gewesen war, habe vorgeschlagen, die Units zu verschicken und die Rechnung erst hinterher zu stellen, um den Auftrag unter Dach und Fach zu bekommen. Das hatte er getan, mit der Konsequenz, dass seine Produkte im Wert von fast vier Millionen Kronen jetzt in Russland verschollen waren. Er hatte vergeblich versucht, sie wiederzubekommen, und jetzt forderte er von der Handelskammer und der Wirtschaftsabteilung des Ministeriums Hilfe oder Schadenersatz ein, wenn es gar nicht anders ging. »Was für Beraterheinis arbeiten eigentlich hier im Ministerium?«, fragte er ständig während seiner Gespräche mit Kristín. Sie nahm Verbindung mit ihrer Vorgängerin auf, die erklärte, dem Mann niemals irgendwelche Ratschläge gegeben zu haben, und Kristín vor dem Mann warnte. Er habe ihr einmal mit roher Gewalt gedroht.
»Du musst dir doch darüber im Klaren sein, dass Geschäfte mit Russland in der augenblicklichen Situation äußerst riskant sind«, hatte sie bei ihrem ersten Zusammentreffen gesagt und ihn darauf hingewiesen, dass das Ministerium die inländischen Firmen zwar nach bestem Vermögen beim Aufbau ihrer Handelsbeziehungen mit dem Ausland unterstütze, das unternehmerische Risiko aber in jedem Fall bei den Firmen liege. Das Ministerium bedauere den Ausgang der Dinge sehr und wolle ihn gern dabei unterstützen, über die isländische Botschaft in Moskau Kontakt zu den Käufern aufzunehmen, aber wenn es ihm nicht gelinge, seine Außenstände einzutreiben, könne das Ministerium wenig ausrichten. Dies hatte sie mit anderen Worten bei ihrem zweiten Gespräch wiederholt und erklärte es jetzt zum dritten Mal, während er ihr mit wütender Miene und dieser lächerlichen Silberkette in der Westentasche gegenübersaß. Das dritte Zusammentreffen zog sich in die Länge. Es war spät geworden, und sie wollte nach Hause.
»So einfach kommt ihr mir nicht davon«, sagte er. »So ein saudämliches Pack, lässt einen Geschäfte mit der russischen Mafia machen. Wahrscheinlich steht ihr bei denen auf der Gehaltsliste. Was weiß denn ich? Man hört ja so einiges. Ich will mein Geld zurück, und wenn nicht ...«
Sie kannte diesen Sermon bereits zur Genüge und beschloss, der Sache ein Ende zu setzen. Jetzt reichte es ihr mit diesem Quatsch. Der Kopfschmerz wurde stärker. Es war schon spät.
»Es tut uns natürlich Leid, wenn du bei deinen Geschäften mit den Russen Geld verloren hast, aber das ist nicht unser Problem«, sagte sie ruhig. »Wir übernehmen keine Entscheidungen für andere Leute. Sie müssen selbst entscheiden, was sie tun. Wenn du so schwachsinnig bist, ohne irgendwelche Sicherheiten Waren für zig Millionen Kronen ins Ausland zu schicken, bist du dümmer als du aussiehst. Jetzt möchte ich dich bitten, mein Büro zu verlassen und mich in Zukunft mit diesem Blödsinn von der Verantwortung des Ministeriums zu verschonen.«
Er starrte sie an. Die Worte »schwachsinnig« und »dumm« dröhnten in seinem Kopf. Er öffnete den Mund, um etwas zu erwidern, aber sie war schneller.
»Raus jetzt, gefälligst.« Sie sah, wie sein Gesicht vor Wut anschwoll.
Er stand langsam auf, ohne den Blick von ihr abzuwenden, dann schien er urplötzlich die Beherrschung zu verlieren. Er packte den Stuhl, auf dem er gesessen hatte, und schleuderte ihn hinter sich an die Wand.
»So leicht kommst du mir nicht davon«, schrie er. »Wir sehen uns noch, und dann werden wir ja sehen, wer von uns beiden der Dumme ist. Das ist eine Verschwörung! Verschwörung! Und dafür wirst du mir büßen.«
»Ja, ja, mein Herzchen, nichts wie raus mit dir«, sagte sie, als redete sie mit einem sechsjährigen Kind. Sie wusste, dass sie ihn damit noch wütender machte, konnte sich aber nicht beherrschen.
»Pass bloß auf. Glaub ja nicht, dass du damit durchkommst, so mit mir zu reden«, schrie er, stürzte zur Tür und warf sie so heftig hinter sich ins Schloss, dass die Wände wackelten. Die Mitarbeiter des Ministeriums hatten sich in einer Traube vor ihrem Büro versammelt, als der Stuhl an die Wand knallte und der Mann zu brüllen begonnen hatte. Sie sahen ihn rot vor Wut aus ihrem Büro stürzen. Kristín erschien in der Tür.
»Alles in Ordnung«, sagte sie zu den Mitarbeitern. »Er hat Probleme«, fügte sie hinzu und schloss behutsam die Tür. Sie setzte sich an den Schreibtisch. Ein Schauer durchlief sie. Sie blieb eine ganze Weile still sitzen, während sie versuchte, sich zu beruhigen. Auf so etwas hatte ihr Jurastudium sie nicht vorbereitet. Kristín war klein, mit dunklem Teint und kurzem, schwarzem Haar. Sie hatte ein schmales Gesicht mit klaren Zügen, und ihre scharfen braunen Augen strahlten Entschlossenheit und Selbstsicherheit aus. Sie galt als konsequent und unnachgiebig, und im Ministerium eilte ihr der Ruf voraus, dass sie Haare auf den Zähnen hätte.
Das Telefon klingelte. Es war ihr Bruder, der sofort merkte, dass etwas los war.
»Stimmt etwas nicht?«, fragte er.
»Gerade war ein Mann hier, der beinahe einen Stuhl nach mir geworfen hätte. Sonst ist alles in Ordnung.«
»Einen Stuhl geworfen? Mit was für Typen hast du da eigentlich im Ministerium zu tun?«
»Mit der russischen Mafia, nehme ich an. Es handelt sich um eine Verschwörung. Was gibt’s Neues bei dir?«
»Alles in Ordnung. Ich habe mir gerade ein neues Handy gekauft. Kannst du mich gut verstehen?«
»Wie immer eigentlich.«
»Wie immer eigentlich«, äffte er nach. »Weißt du, wo ich gerade bin?«
»Wo bist du denn?«
»In der Nähe von Akureyri. Die Bergrettungsgesellschaft ist gerade auf dem Weg zum Vatnajökull hinauf.«
»Auf den Gletscher? Mitten im Winter?«
»Eine Winterübung. Das habe ich dir doch schon erzählt. Morgen sind wir auf dem Gletscher, dann rufe ich dich nochmal an. Du musst mir sagen, wie das Handy ist. Ist die Tonqualität jetzt nicht in Ordnung?«, fragte er wieder.
»Super. Bleib bei der Gruppe. Hast du verstanden? Keine Extratouren auf eigene Faust.«
»Eben. Hat auch siebzigtausend Kronen gekostet.«
»Was?«
»Das Handy. Es ist ein nmt-Gerät, das funktioniert auch in unbewohnten Gebieten außerhalb des gps-Netzes.«
»nmt? Du spinnst wohl. Over and out.«
»Man sagt nicht ›over and ...‹«
Sie legte auf. Ihr Bruder Elías war zehn Jahre jünger als sie und hatte unzählige Hobbys, die meist etwas mit Outdoor-Aktivitäten zu tun hatten. In einem Jahr war es die Jagd. Da hatte er ihre Tiefkühltruhe mit Wildgänsen und Rentierfleisch gefüllt. Im nächsten war es das Fallschirmspringen. Ununterbrochen hatte er versucht, sie zu überreden, mit ihm gemeinsam zu springen, aber ohne Erfolg. Im dritten Jahr war es Riverrafting, dann Jeepsafaris im Hochland, Gletschertouren, Skitouren, Motorschlittentouren und so weiter und so fort. Er war bei der Bergnotrettungsgesellschaft in Reykjavík. Es sah ihm ähnlich, ein Handy für 70.000 Kronen zu kaufen. Er war verrückt nach der neuesten Technik. In seinem Jeep sah es vorne wie in einem Cockpit aus.
In dieser Hinsicht waren sich die Geschwister überhaupt nicht ähnlich. Wenn der Winter kam, würde Kristín sich am liebsten verkriechen und erst im Frühjahr wieder zum Vorschein kommen. Sie unternahm niemals Ausflüge ins Hochland, und im Winter verreiste sie überhaupt nicht in Island. In den Sommerferien hielt sie sich an die Ringstraße an der Küste und übernachtete in Hotels. Ansonsten verbrachte sie ihren Urlaub im Ausland: in den usa, wo sie studiert hatte, oder in London bei Freunden, die dort lebten. Zur dunkelsten Jahreszeit in Island buchte sie manchmal eine Woche Strandurlaub im Süden. Sie ertrug die Dunkelheit und die Kälte nur schwer. Manchmal wurde sie von Depressionen gepackt, wenn die Dunkelheit sie zu verschlingen schien.
Abgesehen davon verstanden sich die Geschwister gut. Weitere Geschwister gab es nicht, und trotz des Altersunterschieds von zehn Jahren – oder gerade deswegen – hatten sie sich immer nahe gestanden. Elías arbeitete bei einer großen Kfz-Werkstatt in Reykjavík, die Jeeps zu Monstertrucks tunte. Kristín war Juristin, hatte ein Diplom in Völkerrecht von einer kalifornischen Universität und war seit zwei Jahren beim Außenministerium angestellt. Ihre Stelle war ihrer Ausbildung angemessen. Besuche wie der heutige waren zum Glück die Ausnahme.
Hoffentlich ist er vorsichtig da oben auf dem Gletscher, dachte Kristín auf dem Weg nach Hause. Das Gespräch mit Randolf ließ sie nicht los. Sie hatte das Gefühl, beobachtet zu werden, als sie durch die Fußgängerzone in der Innenstadt ging und vom Laugarvegur in ihre Straße, den Tómasarhagi, einbog. Solche Gefühle kannte sie sonst gar nicht, und sie sagte sich, dass es sich dabei wohl um eine Nachwirkung des unangenehmen Gesprächs handelte. Sie schaute sich um, sah aber nichts Verdächtiges und schüttelte dann den Kopf über ihre Nervosität. Trotzdem fühlte sie sich irgendwie unwohl.
Sie war allerdings noch nie zuvor bezichtigt worden, Bestechungsgelder von der russischen Mafia anzunehmen.
3
Die C-17-Transportmaschine der amerikanischen Streitkräfte landete abends um acht Uhr Ortszeit auf dem Flugplatz in Keflavík. Es war kalt, ein paar Grad unter null, aber der Wetterbericht sagte steigende Temperaturen und starken Schneefall voraus. Der mächtige Rumpf der Maschine rollte in der Winterdunkelheit ans Ende der Landebahn sieben, die ausschließlich dem amerikanischen Militär zur Verfügung stand, das in Keflavík stationiert war.
Als die Maschine zum Stillstand kam, öffnete sich die Heckrampe, und die Mannschaft, die aus geheimen militärischen Spezialeinheiten zusammengestellt worden war, strömte heraus. Sie begannen sofort, das Flugzeug zu entladen. Leistungsstarke Motorschlitten, Raupenfahrzeuge, Skiausrüstung; die gesamte Ausrüstung, die für eine Gletscherbegehung benötigt wurde. Fünfzehn Minuten nachdem das Flugzeug auf der Landebahn aufgesetzt hatte, verließ der erste mit der Ausrüstung beladene Lkw der Spezialeinheiten den Flughafen in Keflavík, bog zunächst auf die Straße nach Reykjavík ein und nahm dann die südliche Route zum Vatnajökull.
Bei dem Lastwagen handelte es sich um ein deutsches Fabrikat, einen Mercedes Lkw, der keinerlei Aufschrift trug und ein isländisches Nummernschild hatte. Er sah aus wie jeder andere Sattelschlepper mit Anhänger, der über die Landstraßen fuhr, ohne Aufsehen zu erregen. Insgesamt nahmen vier Laster verschiedener Fabrikate die Fracht aus der C-17 auf, während die Maschine am Ende der Landebahn wartete. Die Trucks verließen den Flugplatz Keflavík im Halbstundentakt und mischten sich unauffällig unter den Verkehr.
Im letzten Wagen saß Ratoff, der die Expedition anführte. Der Befehlshaber der amerikanischen Streitkräfte auf Island, ein Admiral, hatte ihn auf dem Flugplatz in Empfang genommen. Er war über Ratoff informiert und hatte Anweisung bekommen, Sattelschlepper zu beschaffen und keine Fragen zu stellen. Der Admiral war wegen eines Skandals, bei dem es um Depotdiebstahl großen Stils auf einer Militärbasis in Florida ging, auf diesen Außenposten nach Island versetzt worden. Er besaß genug Verstand, nicht nach Einzelheiten zu fragen, konnte sich aber nicht gänzlich zurückhalten. Er wusste von dem Wirbel, den dieser Fleck auf dem Gletscher 1967 verursacht hatte, kannte die Geschichten, die sich darum rankten, und nach der Ausrüstung der Spezialeinheiten zu urteilen, war jetzt etwas Ähnliches im Busch wie vor zweiunddreißig Jahren: eine Gletscherexpedition.
»Brauchst du vielleicht unsere Hubschrauber?«, fragte er, als er neben Ratoff stand und beim Entladen der Frachtmaschine zusah. »Wir haben neue Pavehawk-Hubschrauber auf der Basis. Die können Berge versetzen ...«
Ratoff war um die fünfzig und wurde schon grau an den Schläfen. Er war klein und schmal, mit slawisch anmutenden Gesichtszügen und kleinen, fast schwarzen Augen. Er trug einen dicken weißen Winteroverall und Bergstiefel. Den Admiral würdigte er keines Blickes.
»Besorg uns, was wir brauchen, und lass uns ansonsten in Ruhe«, sagte er und ließ den Admiral stehen.
Zwei Tage waren vergangen, seit der Punkt auf dem Satellitenbild aufgetaucht war, und seitdem hatte Carr die Hände nicht in den Schoß gelegt. Die C-17 wartete laut Plan abrufbereit auf dem Flugplatz in Keflavík, bis die Operation beendet war. Acht bewaffnete Posten würden Tag und Nacht Wache stehen. Mit an Bord war General Immanuel Wesson, der mit einem Trupp von zehn Mitgliedern der Spezialeinheiten das Kommando über die Botschaft in Reykjavík übernehmen sollte. Der Botschafter und seine engsten Mitarbeiter wurden in Urlaub geschickt.
Schneeregen hatte eingesetzt, und der schwere, nasse Schnee legte sich wie ein dicker Teppich über Islands Süden und Südosten. Die Scheibenwischer der Sattelschlepper kamen nicht dagegen an. Bis nach Hveragerði und Selfoss, den ersten Ortschaften nach Reykjavík, herrschte dichter Verkehr, aber weiter östlich hatten sie freie Fahrt. Die Lastwagen hielten auf der ganzen Strecke den gleichen Abstand. In tiefster Dunkelheit und dichtem Schneefall passierten sie Hella und Hvolsvöllur, zwei kleine Orte im südwestlichen Tiefland, und fuhren dann weiter über Vík í Mýrdal nach Kirkjubæjarklaustur. Danach überquerten sie die Brücken über die Gletscherflüsse auf dem Skeiðará-Sander. Nirgendwo fielen sie besonders auf. Güterverkehr auf dem Land war nichts Besonderes.
Ratoff wusste, worum es ging, und war recht genau über den Truppentransport 1967 in Kenntnis gesetzt worden. Es war das zweite Mal, dass wegen des Flugzeugs auf dem Gletscher Vatnajökull eine Expedition dieser Größenordnung stattfand. Er wusste, dass der Gletscherfluss Skeiðará damals noch nicht überbrückt gewesen war und dass sie sich damals über schlechte Schotterpisten durch Nordisland hatten quälen müssen, um den Gletscher von Osten aus zu erreichen. Damals hatte es einiges Kopfzerbrechen gekostet, die Aktion genauso unauffällig wie diesmal durchzuführen. Am Ende hatte man keine andere Wahl, als eine Mondlandungsübung anzusetzen, über die innerhalb des Geheimdienstes immer noch gesprochen wurde.
Die Dunkelheit schützte sie, und trotz des Schneefalls waren die Straßen, die inzwischen asphaltiert waren, für die Lastwagen problemlos befahrbar. Der Reihe nach passierten sie den Nationalpark Skaftafell und nahmen Kurs auf Hornafjördur. Kurz bevor sie nach Höfn kamen, bogen sie von der Küstenstraße auf den Weg zum Gletscher ein und hielten beim Hof der Brüder. Als Ratoffs Wagen eintraf, hatten die Soldaten bereits mit dem Entladen begonnen, und die ersten Motorschlitten standen schon zur Abfahrt auf den Gletscher bereit.
Der Bauer stand in der Tür und beobachtete die Soldaten. Das hatte er alles schon einmal gesehen. Er kannte Ratoff nicht, der ihm im Schneetreiben entgegenkam, hatte aber andere seines Schlages getroffen. Der Bauer hieß Jón und bewohnte den Hof jetzt allein. Sein Bruder war vor einigen Jahren gestorben.
»Soll wieder einmal ein Vorstoß auf den Gletscher unternommen werden?«, fragte er auf Isländisch, während er im Türrahmen stand und Ratoff die Hand schüttelte. Ein Dolmetscher begleitete Ratoff und übersetzte direkt, was der Bauer sagte.
Ratoff lächelte Jón an. Sie klopften den Schnee von ihrer Kleidung und traten ein. Drinnen war es ordentlich und sehr warm. Sie setzten sich mit dem allein lebenden Bauern ins Wohnzimmer, Ratoff in seinem weißen Overall, der Dolmetscher eingemummelt in einen Polaranorak, der Bauer dagegen in einem rot karierten Hemd, abgewetzten Jeans und auf Socken. Er war fast achtzig, hatte eine Vollglatze und ein runzliges Gesicht, war aber noch gesund und munter und körperlich wie geistig fit. Als sie Platz genommen hatten, bot er ihnen pechschwarzen Kaffee und Schnupftabak an. Weder Ratoff noch der Dolmetscher konnten mit Schnupftabak etwas anfangen, sodass beide den Kopf schüttelten. Jón konnte ein paar Worte Englisch, er verstand das ein oder andere, konnte sich aber selber nicht artikulieren. Ohne den Dolmetscher, der von der Militärbasis in Keflavík kam und dort seit einigen Jahren stationiert war, wäre es nicht gegangen.
Für Jón war es die dritte Militärexpedition auf den Gletscher, die nach dem Flugzeug suchte, wenn man Millers Suche bei Kriegsende mitrechnete. Captain Miller hatte das Land im Abstand von einigen Jahren auf eigene Faust besucht, hatte bei den Brüdern gewohnt und war mit einem kleinen Metalldetektor auf den Gletscher gestiegen. Nach zwei oder drei Wochen war er dann wieder in die usa verschwunden. Zwischen den dreien hatten sich freundschaftliche Bande entwickelt. Als sie bei der Expedition 1967 nach Miller fragten, sagte man ihnen, er sei verstorben. Das war die größte Expedition auf den Gletscher, die Jón erlebt hatte. Die Brüder hatten genau wie bei der vorherigen Expedition des Militärs als Bergführer gedient und die Soldaten auf den Berg zum Gletscher geführt. Sie begriffen, dass ein Stück des Flugzeugwracks auf einem Satellitenbild erschienen war. Zu dieser Zeit unternahm das Militär bereits keine Aufklärungsflüge mehr. Die Brüder hatten früher ab und zu Flugzeuge bemerkt, aber als sie von Satelliten abgelöst wurden, wurden die Flüge über der Gegend urplötzlich eingestellt. Die Brüder hatten sich oft gefragt, warum die Verteidigungstruppen auf Island so ein ungeheures Interesse an einem deutschen Flugzeug hatten, dass sie den Gletscher mithilfe von Satelliten überwachten und vor ihrem Hof aufmarschierten, sobald ein Stück davon aus dem Eis hervorzukommen schien. Die Brüder hatten Miller ihr Wort gegeben, dass sie mit niemandem, weder in ihrer näheren Umgebung noch irgendwo anders, über das wahre Ziel der Expeditionen sprechen würden. Miller hatte sie gebeten, von militärischen Übungen zu sprechen, falls die Leute auf dem Land neugierig würden und versuchten, ihre Nase in diese Angelegenheit zu stecken. Das hatten die Brüder getan. Untereinander stellten sie alle möglichen Hypothesen auf, einige davon sehr weit hergeholt. Vielleicht war die Maschine voll beladen mit jüdischem Gold, mit Diamanten, eventuell sogar Kunstwerken, die die Nazis in ganz Europa gestohlen hatten, vielleicht war ein ranghoher Militär an Bord gewesen, vielleicht eine Geheimwaffe aus dem Krieg. Was es auch war, das amerikanische Militär hatte großes Interesse daran und wollte es sich beschaffen, ohne Aufsehen zu erregen.
Aus irgendeinem Grund schienen die amerikanischen Streitkräfte in Panik zu geraten, sobald ein schwarzer Punkt auf ihren Gletscherbildern auftauchte.
»Was habt ihr diesmal entdeckt?«, fragte Jón und blickte den Dolmetscher an, während der seine Frage Ratoff übermittelte.
»Wir glauben, es endlich gefunden zu haben«, übersetzte der Dolmetscher Ratoffs Antwort. »Bessere Satelliten.«
»Natürlich, bessere Satelliten«, erwiderte Jón. »Weißt du, was in dem Flugzeug ist, wonach deine Leute so verrückt sind?«
»Keine Ahnung«, sagte Ratoff. »Man hat mich bloß geschickt, um einen speziellen Auftrag zu erledigen. Es geht mich nichts an, was in der Maschine ist oder um was für ein Flugzeug es sich handelt. Ich bin ausschließlich daran interessiert, meine Befehle auszuführen, und zwar ohne Rücksicht auf Verluste.«
»Es würde mich nicht überraschen, wenn ihr das Flugzeug diesmal finden würdet«, sagte Jón. »Hier herrscht seit 1960 eine Wärmeperiode, und in unserer Region sind große Teile des Gletschers geschmolzen.«
»Nach den Bildern zu urteilen, ragt der Bug ganz deutlich aus dem Eis«, erklärte Ratoff. »Wir haben die Koordinaten. Vermutlich geht alles ganz schnell.«
»Ihr kennt den Weg«, sagte Jón und saugte den groben Tabak kräftig durch die Nase ein. »Ihr braucht keinen Bergführer mehr. Ich alter Zausel kann euch nicht mehr viel nutzen.«
»Wir kennen den Weg sehr gut«, sagte Ratoff und erhob sich.
»Im Sommer sind dort viele Touristen unterwegs«, meinte Jón. »In Höfn kann man Jeepfahrten auf den Gletscher buchen, und ich habe die Erlaubnis gegeben, dass sie mein Land durchqueren. Die werden immer mehr, diese Touristen.«
Kurze Zeit später trat Ratoff mit seinem Dolmetscher aus dem Haus. Sie gingen schnell zu einem kleinen Raupenfahrzeug hinüber, das einem Jeep ähnelte, stiegen ein und fuhren am Hof vorbei in Richtung Gletscher. Die großen Lastwagen waren verschwunden. Der Schneefall hatte sich im Lauf des Abends noch verstärkt, sodass die Sicht gering war. Das Fahrzeug folgte der Spur, die eins der anderen Fahrzeuge vor ihm durch den Neuschnee gepflügt hatte. Es kam nur langsam voran, kämpfte sich durch den Schnee und suchte sich mit seinen starken Scheinwerfern den Weg. Sie erreichten das Camp am Fuß des Gletschers. Dort waren starke Scheinwerfer aufgebaut, Zelte bildeten einen Kreis, und überall standen Kisten mit Proviant herum. Soldaten in weißer Winterbekleidung arbeiteten organisiert und konzentriert. Sobald sie das Flugzeug gefunden hatten, würden sie ihr Lager auf den Gletscher verlegen.
Inmitten des Schneetreibens konnte man eine große Satellitenschüssel vor einem Zelt erkennen, das als Kommunikationszentrum dienen sollte. Ratoff hielt direkt darauf zu. Zwei Männer waren damit beschäftigt, die Nachrichtentechnik aufzubauen.
»Wann steht die Verbindung?«, fragte Ratoff.
»Spätestens in vierzig Minuten«, antwortete einer der Soldaten.
»Gebt mir Carr, wenn ihr fertig seid.«
Vytautas Carr saß in seinem Büro in Gebäude 312 in Washington, als das Telefon klingelte. »Ratoff auf eins«, sagte sein Sekretär, und Carr drückte auf den Knopf. In der Hauptstadt war es neun Uhr abends, zwei Uhr nachts in Island.
»Alles in Ordnung?«, fragte Carr.
»Alles geht nach Plan. Sobald es morgen hell wird, geht’s auf den Gletscher. Starker Schneefall, aber für uns kein Problem. Wenn die Koordinaten stimmen, macht es nichts, wenn das Wrack wieder zuschneit.«
»Was ist mit den Einheimischen?«
»Die haben keine Ahnung. Wir sehen zu, dass das so bleibt.«
»Sie sind sehr aufmerksam, was unsere Streitkräfte betrifft. Wir müssen vorsichtig sein.«
»Sie halten den Mund, solange sie an uns verdienen.«
»Ist irgendjemand auf dem Gletscher?«
»Wir wissen von einer Bergnotrettungstruppe, die da oben auf dem Eis eine Übung abhält. Sie sind aber nicht auf unserem Gebiet und werden uns nicht in die Quere kommen.«
»Melden Sie sich; wenn Sie das Flugzeug finden.«
4
Kristín wachte in aller Herrgottsfrühe mit dem unangenehmen Gefühl auf, dass ihr ein schwerer Tag bevorstand. Sie wusste, dass der Exporteur die Sache noch nicht zu den Akten gelegt hatte, und musste sich auf ein weiteres Zusammentreffen gefasst machen, vielleicht noch am gleichen Tag. Sie fühlte sich auch nicht wohl bei dem Gedanken an ihren Bruder, der mitten im tiefsten Winter auf dem Vatnajökull war, wo das Wetter jederzeit umschlagen konnte. Sie hatte in der Nacht schlecht geschlafen. Um kurz vor sechs stand sie auf, duschte und setzte Kaffee auf. Es gab niemanden, mit dem sie ihr Leben teilte und mit dem sie über ihre Probleme sprechen konnte. Manchmal vermisste sie das.
Andererseits wohnte sie ganz gern allein. Sie hatte drei Jahre mit einem Mann zusammengelebt, den sie kennen gelernt hatte, nachdem sie von ihrem Studium in den usa nach Island zurückgekehrt war. Er war Jurist wie sie. Als die erste Verliebtheit vorbei war, stellte sich heraus, dass er rücksichtslos und dominant war. Sie war froh, nicht mehr damit leben zu müssen. Als sie sich kennen gelernt hatten, war er ganz anders gewesen, witzig und unterhaltsam. Er brachte sie ständig zum Lachen, verwöhnte sie mit Geschenken und ließ sich alles Mögliche einfallen, um sie zu überraschen. Als sie zusammengezogen waren, kam das immer seltener vor. Es war, als habe er den Fisch jetzt an der Angel, und manchmal schien es Kristín, als sei er dabei, ihr den Angelhaken wieder herauszureißen.
Sie hatte immer schon auf eigenen Füßen gestanden und war sehr selbstsicher gewesen, aber von Natur aus war sie still und zurückhaltend. Die Privatsphäre war ihr heilig, und einen Mann im Haus vermisste sie nicht. Der Sex war auch nicht gerade umwerfend gewesen. So wie sie es gemacht hatten, konnte sie genauso gut ohne leben. Nachdem er gegangen war, befriedigte sie sich selbst, wenn sie das Bedürfnis danach hatte. Sie genoss diese Freiheit sogar. Genoss es, dass sie Zeit für sich selber hatte. Dass nur eine Zahnbürste im Bad stand. Dass sie die Wohnung im Tómasarhagi für sich allein hatte. Sie brauchte niemandem Rechenschaft abzulegen. Konnte ausgehen, wann sie wollte, und nach Hause kommen, wann es ihr passte. Sie genoss das Alleinsein. Genoss es, keine Rücksicht auf andere nehmen zu müssen.
Sie war froh, als alles vorbei war. Sie war sich nicht sicher, ob sie jemals wieder ihre Wohnung mit jemandem teilen wollte. Vielleicht war das ein zu großes Opfer. An Kinder hatte sie nie gedacht. Vielleicht hatte sie Angst, ihren Eltern ähnlich zu werden. Es überraschte sie völlig, als der Jurist auf einmal anfing, von Kindern zu reden, nachdem sie eine Weile zusammengelebt hatten. Dass sie sich Kinder zulegen sollten. Sie blickte ihn an und erwiderte, dass sie darüber noch nicht nachgedacht hätte. »Dann hörst du vielleicht endlich auf, dir ständig Gedanken über Elías zu machen«, sagte er. Und dann kam dieser denkwürdige Satz: »Elías ist nicht dein Kind.« Nicht dein Kind, dachte sie. Sie verstand nicht, worauf er hinauswollte.
»Was meinst du damit?«, fragte sie.
»Du weißt genau, was ich meine«, sagte er.
»Nein.«
»Ich meine, dass du dich um ihn sorgst wie um ein kleines Kind.«
»Wie ein kleines Kind?«
»Du rufst ihn zehnmal am Tag an. Er kommt dauernd zu uns. Ihr seid ständig zusammen in der Stadt. Er hängt abends hier herum. Manchmal schläft er sogar hier auf dem Sofa.«
»Er ist mein Bruder.«
»Eben.«
»Bist du eifersüchtig auf Elías?«
»Eifersüchtig«, schnaubte er. »Ich finde das bloß manchmal einfach nicht mehr normal.«
»Nicht normal?«
»So eine unglaublich enge Beziehung.«
»Wir sind eben Geschwister. Wir stehen uns nahe. Was ist daran unnormal?«
»So meine ich das nicht, nicht unnormal, nur ... er ist eben nicht dein Kind. Er ist dein Bruder. Ich weiß, er ist viel jünger als du, aber er ist fast zwanzig und kein Kind mehr. Ich habe manchmal den Eindruck, dass du ihn behandelst wie ein Kind.«
Sie schwieg so lange, dass er die Gelegenheit ergriff, aufzuspringen und unter dem Vorwand zu verschwinden, noch etwas im Büro erledigen zu müssen.
Kurz danach ging ihre Beziehung in die Brüche. Zuletzt entwickelte sie einen regelrechten Widerwillen gegen ihn. Vielleicht hatte er einen wunden Punkt berührt. Hatte ihr die Augen geöffnet, die sie gar nicht öffnen wollte. Nach der Trennung hatte sie andere Männer kennen gelernt, aber das waren nur kurze Affären, denen sie nicht nachtrauerte, außer vielleicht einer. Sie bedauerte, wie sie Schluss gemacht hatte, die Art und Weise, wie es zu Ende gegangen war. Es war ihre Schuld. Sie wusste das. Verdammt peinlich war das gewesen.
An manchen Tagen, wenn sie allein zu Haus war und nichts zu tun hatte, kam es ihr vor, als blicke sie in ihre Zukunft. Sie sah sich still und zurückgezogen altern, verkümmern und sterben, kinderlos, ohne Familie, ohne alles. Sie sah sich altern in der Stille, die an den langen Sommerabenden über sie herfiel, wenn sie nichts anderes zu tun hatte, als die Papiere aus dem Büro noch einmal durchzugehen. Wenn sie sich gestört fühlte von den Rufen der Kinder auf der Straße. Wenn sie sich abends hinlegte und spürte, wie die Müdigkeit langsam aus ihrem Körper wich. Manchmal spürte sie richtig, wie es geschah. Es war, als kapsele die Zeit sie in sich ein. All diese langen Tage. All diese langen, erdrückenden Tage, die in Einsamkeit und Stille vergingen. Manchmal gefielen sie ihr. Manchmal wünschte sie sich, ihr Leben wäre ereignisreicher.
Elías war ihre Familie. Ihre Mutter war tot, und zu ihrem Vater hatte sie kaum noch Verbindung. Verwandte gab es nicht. Vielleicht hatte der Jurist Recht, wenn er sagte, dass Elías zu viel von ihrer Zeit beanspruchen würde. Selber hatte sie es nie so empfunden.
In diese Gedanken versunken saß sie vor ihrer Kaffeetasse und blätterte in der Zeitung, bis es Zeit war, zur Arbeit zu gehen. Sie verließ das Haus um Viertel vor neun. Bis die Sonne aufging, würde es noch mindestens eine Stunde dauern. Es schneite heftig. Um diese Zeit herrschte dichter Verkehr in der Stadt, und sie schlenderte langsam durch das Schneetreiben. Die Leute hetzten sich alle ab, um so schnell wie möglich zur Arbeit zu kommen, nachdem sie die jüngsten Kinder zum Kindergarten und die älteren in die Schule gebracht hatten. Der Schnee schluckte die Verkehrsgeräusche. Dicke Benzinschwaden vernebelten die Luft in der Stadt. Kristín besaß kein Auto. Sie ging lieber zu Fuß, besonders bei dichtem Verkehr. Die Entfernungen in Reykjavík erschienen ihr nicht weit. Sie hatte in Kalifornien gelebt. Dort konnte man von Entfernungen sprechen. In Reykjavík lebten nur hundertzwanzigtausend Menschen, aber manchmal schienen die Einwohner zu glauben, dass sie in einer Millionenstadt lebten.