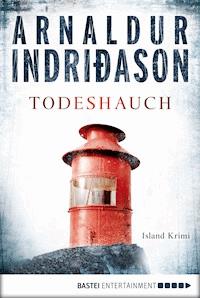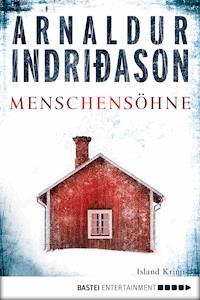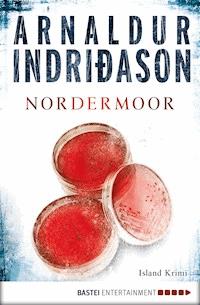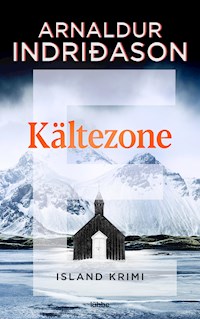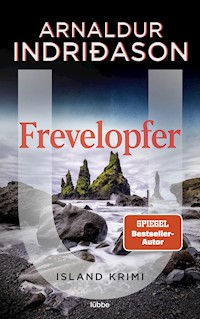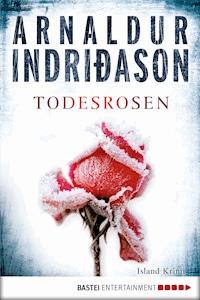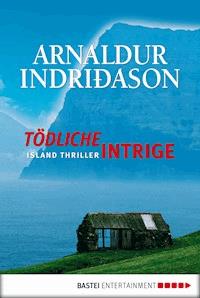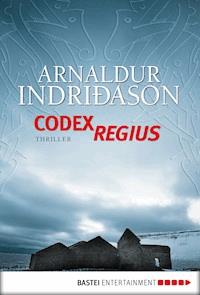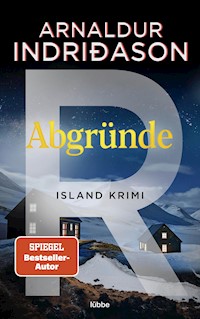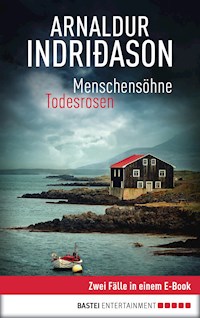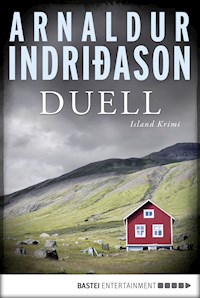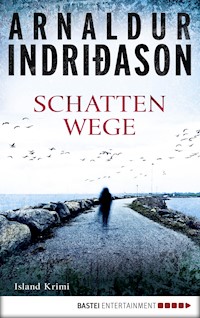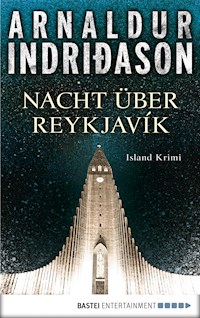
9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 8,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 8,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Bastei Lübbe
- Kategorie: Krimi
- Serie: Der junge Erlendur
- Sprache: Deutsch
Der junge, grüblerisch veranlagte Erlendur Sveinsson hat vor Kurzem seine Tätigkeit als Streifenpolizist in Reykjavík aufgenommen. In den Nachtschichten lernt er die dunklen Seiten der isländischen Hauptstadt kennen: betrunkene Autofahrer, häusliche Gewalt, Einbrüche, Drogenhandel. Ihn bewegt das Schicksal von Randfiguren der Gesellschaft. An einem Wochenende wird ein Obdachloser in einem Tümpel am Stadtrand ertrunken aufgefunden, und eine junge Frau verschwindet spurlos. Beide Fälle lassen Erlendur keine Ruhe, und er beginnt auf eigene Faust zu ermitteln ...
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 394
Veröffentlichungsjahr: 2014
Ähnliche
Inhalt
ARNALDUR INDRIÐASON
NACHT ÜBER REYKJAVÍK
Island Krimi Übersetzung aus dem Isländischen von Coletta Bürling
BASTEI ENTERTAINMENT
Vollständige E-Book-Ausgabe
des in der Bastei Lübbe AG erschienenen Werkes
Bastei Entertainment in der Bastei Lübbe AG
Titel der isländischen Originalausgabe: »Reykjavíkurnætur«
Namen, Personen und Begebenheiten in diesem Roman sind frei erfunden. Ähnlichkeiten mit lebenden oder verstorbenen Personen sind nicht beabsichtigt.
In Island duzt heutzutage jeder jeden.Man redet sich nur mit dem Vornamen an.Dies wurde bei der Übersetzung beibehalten.
Für die Originalausgabe: Copyright © 2012 by Arnaldur Indriðason
Published by arrangement with Forlagið, www.forlagid.is
Für die deutschsprachige Ausgabe: Copyright © 2014 by Bastei Lübbe AG, Köln Textredaktion: Anja Lademacher, Bonn Umschlaggestaltung: Johannes Wiebel, punchdesign, München Umschlagmotiv: © shutterstock/Kjersti Joergensen; shutterstock/donatas1205 E-Book-Produktion: Dörlemann Satz, Lemförde
ISBN 978-3-8387-5870-1
www.bastei-entertainment.de
www.lesejury.de
Eins
Die Jungen stießen mit ihren Stöcken in den grünen Anorak, der sich über dem Wasser aufblähte. Er geriet in Bewegung, drehte sich und sank. Die Jungen stocherten so lange weiter, bis er wieder an die Oberfläche kam. Sie erschraken fürchterlich, als sie sahen, was in dem Anorak steckte.
Die Jungen lebten in den neuen Wohnblocks im Hvassaleiti-Viertel und waren dort Freunde geworden. Das Viertel erstreckte sich bis zu dem Sumpfgebiet von Kringlumýri, dessen nördlicher Teil aus nichts als Brachland bestand, wo sich nordischer Ampfer und Engelwurz ungehindert ausbreiten konnten. Im südlichen Teil befanden sich weithin offene Torfstiche, dort hatten die Reykjavíker in den Jahren des Ersten Weltkriegs zur Beheizung ihrer Häuser tonnenweise Torf gewonnen, weil es kaum anderen Brennstoff gab. Dann wurde das Sumpfgebiet drainiert und mit Wegen erschlossen. Nie zuvor war in der Geschichte Reykjavíks so viel Torf abgebaut worden. Hunderte von Menschen hatten hier Beschäftigung gefunden. Sie stachen den Torf, trockneten ihn und karrten ihn in die Stadt.
Als es nach dem Ende des Krieges wieder Kohle und Öl in Island gab, wurde kein Torf mehr benötigt. Die abgestochenen Bereiche füllten sich mit moorig braunem Wasser, und lange Zeit wurde dort nichts verändert. Als sich die Stadt aber in östlicher Richtung auszudehnen begann, entstanden nördlich des Sumpfgebietes neue Viertel bei Hvassaleiti und Stóragerði, und seitdem diente der ehemalige Torfstich den Kindern dieser neuen Siedlungen als Spielplatz. Sie zimmerten sich Flöße zusammen, um über die größeren Teiche zu stochern, und auf dem Gelände mit seinen Anhöhen und Senken entstanden überall Radwege. Und in kalten Wintern konnte man auf den zugefrorenen Tümpeln wunderbar Schlittschuh laufen.
Die Jungen waren zu dritt. Sie hatten sich aus dem Abfallholz der naheliegenden Neubaugebiete ein Floß gebaut. Auf zwei Querbalken hatten sie aus Verschalholz mit Isoliermaterial darunter eine solide Standfläche zusammengenagelt. Sie stocherten sich mit zwei langen Staken vorwärts, die allerdings überall sofort auf Grund stießen, denn diese Teiche waren nirgendwo wirklich tief. Die Jungs trugen Gummistiefel und passten auf, nicht nass zu werden. Es war mehr als einmal, sogar öfter als zweimal vorgekommen, dass Kinder ins Wasser gefallen waren und nass bis auf die Knochen nach Hause rennen mussten. Dann zitterten sie nicht nur vor Kälte, sondern auch aus Angst, weil sie wieder einmal triefend nass nach Hause kamen, wo sie mit Schimpfe und womöglich Schlimmerem rechnen mussten.
Sie stocherten weiter in Richtung Kringlumýarbraut, der Hauptstraße, und gaben sich große Mühe, das Floß so zu steuern, dass es nicht kippte, denn dann würde unweigerlich jemand über Bord gehen. Das war nicht ganz einfach, hier ging es um Teamwork und Geschicklichkeit, und nicht zuletzt um ein gutes Gespür für Balance, fast so wie bei Seiltänzern. Bevor sie vom Ufer ablegten, nahmen sich die Jungs immer Zeit, das Floß auszubalancieren, denn sie wussten ganz genau, dass es kentern würde, wenn sie zu dicht beieinander oder zu nahe an der Kante standen.
Bisher war aber alles gut gegangen bei ihrer Expedition, die drei Burschen waren sehr zufrieden mit ihrem neuen Floß. Es kam gut voran, und sie stakten an der tiefsten Stelle des Tümpels einige Male hin und her. Im Norden des ehemaligen Torfstichs lag die Ausfallstraße Miklabraut, die Verkehrsgeräusche drangen bis zu ihnen hinüber. Etwas südlich des ehemaligen Sumpfgebiets war die oberirdische Rohrleitung, die zu den großen Heißwassertanks auf Öskjuhlíð führte. Auch dort konnten die Kinder sich austoben. Sie hatten dort manchmal kleine harte Bälle gefunden, etwas kleiner als Hühnereier. So etwas hatten sie noch nie gesehen, aber einer der Väter erklärte ihnen, dass es Golfbälle waren. Er vermutete, dass irgendwelche Leute auf dem brachliegenden Gelände in der Nähe der Heißwasserleitung trainierten, dort sei aber früher auch einmal der Golfplatz von Reykjavík gewesen, ganz in der Nähe des Torfstichs. Er konnte sich aber nicht vorstellen, dass die Golfbälle noch aus dieser Zeit stammten.
Die Jungs kamen auf ihrem Floß gut voran und unterhielten sich über Golfbälle und Heißwasserleitungen, als das Floß gegen irgendetwas stieß und daran hängen blieb. Eine Ecke ihres Floßes verschwand unter Wasser. Die drei kamen zwar nicht mehr voran, doch sie konnten die Schräglage rasch ausgleichen, indem sie sich auf die entgegengesetzte Ecke stellten, um das Gewicht dorthin zu verlagern. Das Floß richtete sich langsam wieder auf, trotzdem blieb ein Teil unter Wasser. Es hatte sich an etwas Schwerem verfangen, sie konnten aber nicht sehen, was es war. Schon früher waren sie in dem trüben Tümpel auf alles Mögliche gestoßen, Gerümpel und Müll, den man einfach in die ehemaligen Torfgruben geworfen hatte. An einer Stelle ragte ein kaputtes Fahrrad aus dem Wasser. Einiges von dem Trödel hatten die Jungs für den Bau ihres Floßes verwendet, unter anderem auch das Isoliermaterial. Dieser Gegenstand hier war aber sehr schwer, er musste sich an einem der vorstehenden Nägel unter den Planken verhakt haben.
Vorsichtig versuchten sie, das Floß wegzusteuern, und sie mussten all ihre Kräfte einsetzen, um es überhaupt von der Stelle zu kriegen. Das, was da unten hängen geblieben war, wurde noch eine Zeit lang mitgeschleift. Doch dann löste es sich, und die überflutete Ecke tauchte wieder aus dem Wasser auf. Das ging so schnell, dass sie taumelten und beinahe über Bord gegangen wären. Als sie wieder sicher auf den Beinen standen, waren sie froh, einem unfreiwilligen Bad entgangen zu sein. Sie starrten auf das, was ihr Floß an die Oberfläche befördert hatte.
»Was ist das denn?«, fragte einer von ihnen und prokelte vorsichtig mit seinem Stecken an dem Objekt herum.
»Vielleicht irgendein Sack?«, vermutete der Zweite.
»Nee, sieht aus wie ein Anorak«, sagte der Dritte.
Er stocherte etwas entschlossener an dem Ding herum, und es gelang ihm, es in Bewegung zu versetzen. Erst tauchte es unter, dann kam es wieder an die Oberfläche und drehte sich langsam im Wasser um. In diesem Moment sahen sie, dass aus dem Anorak ein menschliches Gesicht herausschaute, weiß, blutleer und mit farblosen Haarzotteln. Noch nie hatten sie so etwas Entsetzliches gesehen. Einer von ihnen erschrak so, dass er rückwärts ins Wasser fiel. Das Floß geriet sofort ins Wanken, und bevor sie sich versahen, lagen alle drei im Wasser und wateten schreiend ans Ufer, weg von der Leiche.
Dort standen sie nass und zitternd, starrten auf den grünen Anorak und die Gesichtshälfte, die aus dem Wasser herausragte. Dann rannten sie, was die Beine hergaben, nach Hause, nur weg von dem Tümpel.
Zwei
Sie hörten die Meldung über eine häusliche Streitigkeit im Bústaða-Viertel und beschleunigten die Fahrt, um auf dem kürzesten Weg über die großen Verkehrsadern der Stadt, Miklabraut, Háaleitisbraut und Grensásvegur, zu der Adresse zu gelangen. Es war schon nach drei und zu dieser nachtschlafenden Zeit war so gut wie kein Verkehr auf den Straßen von Reykjavík. Sie überholten zwei Taxis, die auf dem Weg in die Außenbezirke waren, und stießen am Bústaðavegur beinahe mit einem Auto zusammen, das urplötzlich auf die Vorfahrtsstraße einbog. Am Steuer saß ein älterer Herr, der wohl die Geschwindigkeit des Streifenwagens falsch eingeschätzt hatte und seelenruhig auf die Hauptstraße gefahren war.
»Spinnt der?«, rief Erlendur, der an diesem Tag am Steuer saß. Nur durch ein blitzschnelles Ausweichmanöver verhinderte er in letzter Sekunde einen Zusammenstoß mit dem Auto.
»Sollten wir uns den nicht vorknöpfen?«, ließ sich Marteinn von hinten vernehmen.
»Ach, wozu denn«, sagte Garðar.
Erlendur warf einen Blick in den Rückspiegel und sah, dass der Wagen ganz gemächlich über den Bústaðavegur weiterzuckelte.
Garðar und Marteinn arbeiteten den Sommer über als Aushilfskräfte bei der Verkehrspolizei. Beide studierten Jura an der Universität. Erlendur arbeitete gern mit ihnen zusammen. Sie hatten Beatle-Frisuren und Backenbärte bis zum Kinn. Sie patrouillierten in einem Streifenwagen, der in Island liebevoll »Schwarze Maria« genannt wurde. Im hinteren Teil des Wagens befand sich so etwas wie eine Zelle für diejenigen, die aus dem Verkehr gezogen werden mussten. Es handelte sich um einen schwarz-weiß lackierten, zuverlässigen, aber ziemlich schwerfälligen Chevrolet. Weder Sirene noch Blaulicht waren eingeschaltet, was wahrscheinlich auch der Grund dafür gewesen war, dass sie an der Kreuzung fast mit dem anderen Wagen zusammengestoßen waren. Häusliche Streitigkeiten in den Nachtstunden hatten für sie eigentlich keine besondere Priorität, auch wenn Garðar schon des Öfteren aus wesentlich geringerem Anlass über die Straßen von Reykjavík gebrettert war. Manchmal tat er das einfach nur, um bei Laune zu bleiben.
Sie hielten vor der angegebenen Hausnummer in einer Straße mit lauter Reihenhäusern, setzten sich die weißen Mützen auf und begaben sich in die Sommernacht hinaus. Der Himmel war verhangen, doch trotz des Nieselregens fühlte sich die Luft milde an. Wie immer an den Wochenenden war in Reykjavík reichlich Alkohol geflossen, aber bislang hatte es noch keine wirklich ernsthaften Einsätze gegeben. Sie hatten einen Autofahrer wegen Verdachts auf Trunkenheit am Steuer aus dem Verkehr gezogen, und er hatte sich einer Blutprobe unterziehen müssen. Ein weiterer Einsatz hatte sie zu einem beliebten Tanzlokal geführt, vor dessen Eingang es zu einer Schlägerei gekommen war. Und schließlich waren sie zu einer heruntergekommenen Mietwohnung im Reykjavíker Westend gerufen worden. Fünf Personen unterschiedlichen Alters von irgendwo auf dem Land, die immer zusammen auf einem Schiff anheuerten, hatten dort zwei Zimmer gemietet. Sie waren mit den Nachbarn aneinandergeraten, und das Ganze hatte sich zu einer tätlichen Auseinandersetzung entwickelt. Einer der Männer hatte ein Messer gezückt, und bevor es den anderen gelungen war, ihn zu überwältigen, hatte er es einem anderen in den Arm gestochen. Er schäumte vor Wut, als die drei Polizisten eintrafen, um die Gemüter zu beruhigen, womit sie jedoch keinen Erfolg hatten. Also legten sie dem Mann Handschellen an und brachten ihn in einer Zelle im Hauptdezernat an der Hverfisgata unter. Die anderen Personen hatten sich zwar nach dem Eintreffen der Polizei beruhigt, beschuldigten sich aber gegenseitig, den Streit vom Zaun gebrochen zu haben.
Die drei Polizisten hatten inzwischen das Haus erreicht, aus dem die Streitigkeiten gemeldet worden waren, und klingelten an der Haustür. Eigentlich deutete nichts auf irgendwelche Auseinandersetzungen hin, das Haus machte einen friedlichen und ganz normalen Eindruck. Über Sprechfunk war ihnen gesagt worden, dass ein Mann wegen eines lautstarken Streits im Nachbarhaus Meldung bei der Polizei gemacht und diese Hausnummer angegeben hatte. Sie hämmerten gegen die Tür, klingelten ein weiteres Mal und beratschlagten dann, was zu tun war. Erlendur wollte die Tür aufbrechen, um ins Haus zu kommen. Die beiden Jurastudenten fanden das übertrieben. Und der Nachbar, der die Polizei angerufen hatte, war nirgends zu sehen.
Noch während sie darüber diskutierten, was zu tun sei, öffnete sich die Tür plötzlich. Ein Mann um die vierzig erschien. Er trug ein weißes Hemd, seine Hosenträger baumelten zu beiden Seiten herunter und die Hände hatte er in den Hosentaschen vergraben.
»Was soll denn dieser Aufstand?«, fragte er, offensichtlich sehr verwundert über den Besuch der Polizei. Der Mann hatte keine Fahne, und es hatte auch nicht den Anschein, als hätten sie ihn aus dem Tiefschlaf gerissen.
»Bei uns ist eine Beschwerde über nächtliche Ruhestörung in diesem Haus eingegangen«, sagte Garðar.
»Ruhestörung?«, fragte der Mann und kniff die Augen zusammen. »Hier war alles ruhig. Was soll das. Hat sich jemand bei euch beschwert? Wer soll das gewesen sein?«
»Hättest du etwas dagegen, wenn wir einen Augenblick hereinkommen?«, fragte Erlendur.
»Ihr wollt reinkommen? Da hat sich doch bloß irgendjemand einen Spaß erlaubt, Jungs. Lasst euch doch nicht so auf den Arm nehmen.«
»Ist deine Frau noch wach?«, fragte Erlendur.
»Meine Frau? Die ist gar nicht in der Stadt. Sie ist mit ihren Freundinnen in irgendeinem Sommerhaus. Ich verstehe nicht, was … Es muss sich um ein Missverständnis handeln.«
»Vielleicht haben wir die falsche Adresse bekommen«, sagte Garðar und blickte Marteinn und Erlendur an. »Wir fragen noch mal bei der Zentrale nach.«
»Du entschuldigst bitte die Störung«, sagte Marteinn.
»Kein Problem, Jungs. Tut mir leid wegen des Missverständnisses, aber ich bin ganz allein hier im Haus. Macht’s gut.«
Garðar und Marteinn gingen wieder zum Wagen, Erlendur folgte ihnen. Sie stiegen ein und Marteinn erfuhr über den Sprechfunk, dass die Adresse korrekt gewesen war.
»Aber hier ist doch gar nichts los«, sagte Garðar.
»Wartet mal«, sagte Erlendur und stieg noch einmal aus. »Irgendwas stimmt da nicht.«
»Was hast du vor?«, fragte Marteinn.
Erlendur ging wieder zur Haustür und klopfte an. Kurze Zeit später erschien der Mann erneut an der Tür.
»Dürfte ich vielleicht mal die Toilette bei dir benutzen?«, fragte Erlendur.
»Die Toilette?«
»Nur ganz kurz.«
»Leider, das … Es geht nicht …«
»Würdest du mir mal deine Hände zeigen?«, fragte Erlendur.
»Was? Meine Hände?«
»Ja«, sagte Erlendur und drückte die Tür so entschlossen auf, dass der Mann in die Wohnung zurückweichen musste.
Erlendur folgte ihm auf dem Fuß, warf einen kurzen Blick in die Küche und öffnete die Toilette, die sich links gegenüber befand. Dann ging er zurück in den Flur, der zu den Zimmern führte.
»Hallo, ist da jemand?«, rief er. Der Mann stand immer noch unbeweglich in der Diele. Er beschwerte sich darüber, was der Zirkus zu bedeuten habe, verhielt sich aber ansonsten ruhig. Erlendur kehrte in die Diele zurück und ging an dem Hausbesitzer vorbei ins Wohnzimmer, wo eine Frau bewegungslos auf dem Boden lag. In dem Raum herrschte Chaos, Sessel und Stühle waren umgestürzt, ebenso eine Stehlampe und ein Rauchtisch. Gardinen und Vorhänge waren heruntergerissen worden. Erlendur ging sofort zu der Frau und beugte sich über sie. Sie war bewusstlos. Ein Auge war völlig zugeschwollen, und ihre Lippen waren aufgeplatzt. Sie blutete aus einer Wunde am Kopf. Erlendur vermutete, dass sie im Fallen gegen den Rauchtisch geprallt war, sich am Kopf schwer verletzt und dabei das Bewusstsein verloren hatte. Ihr Kleid war hochgerutscht. Am Oberschenkel befand sich ein großes Hämatom, woraus Erlendur schloss, dass die Gewalttätigkeiten nicht erst an diesem Abend begonnen hatten.
»Ruft einen Rettungswagen!«, rief Erlendur Garðar und Marteinn zu, die inzwischen wieder an der Haustür standen. »Wie lange hat sie hier so gelegen!?«, schrie er den Mann an, der immer noch völlig unbewegt in der Diele stand.
»Ist sie tot?«, fragte er.
»Ich weiß es nicht«, antwortete Erlendur. Er traute sich nicht, die Frau zu bewegen. Sie hatte eine schwere Verletzung am Kopf, die Leute vom Rettungsdienst würden Bescheid wissen, wie man sie am besten transportieren konnte. Er deckte sie mit einem der abgerissenen Vorhänge zu und beauftragte Marteinn, dem Mann Handschellen anzulegen und ihn abzuführen. Der Mann sah keinen Grund mehr, seine Hände in den Taschen zu verstecken. Sie waren blutig und verschrammt. Eindeutig Spuren der vorangegangenen Tätlichkeiten.
»Habt ihr Kinder?«, fragte Erlendur.
»Zwei Jungs, die verbringen den Sommer irgendwo auf einem Bauernhof in Südisland.«
»Das überrascht mich nicht«, sagte Erlendur.
»Ich wollte das nicht«, sagte der Mann, nachdem er in Handschellen abgeführt worden war. »Ich weiß nicht … Ich wollte ihr nichts tun. Sie … Ich wollte sie nicht verletzen. Ich wollte euch gerade anrufen. Aber dann ist sie gegen den Tisch gestoßen und hat mir nicht mehr geantwortet. Und ich dachte, dass sie vielleicht …«
Er war nicht imstande, den Satz zu Ende zu bringen. Die Frau stöhnte leise.
»Hörst du mich?«, flüsterte Erlendur ihr ins Ohr, erhielt aber keine Antwort.
Der Nachbar, der die Polizei alarmiert hatte, war um die dreißig. Er war auf die Straße gekommen und sprach mit Garðar. Erlendur ging zu ihnen. Der Mann sagte, dass sie bereits einige Male Lärm aus dem Nachbarhaus gehört hätten, aber nie so schlimm wie diesmal.
»Es geht also schon längere Zeit so?«, fragte Erlendur.
»Das weiß ich nicht, wir wohnen erst seit etwas mehr als einem Jahr hier, und es … Wie gesagt, man hört manchmal Brüllerei und Geschrei«, erklärte der Nachbar. »Das ist sehr unangenehm, weil wir als Nachbarn nicht wissen, wie wir uns verhalten sollen. Wir kennen diese Leute kaum, auch wenn wir Seite an Seite wohnen.«
Sirenen näherten sich. Ein Krankenwagen bog in die Straße zum Haus ein, gefolgt von einem Streifenwagen. Die Leute in den umliegenden Häusern waren aufgewacht, sie standen entweder am Fenster oder an der Haustür. Sie sahen zu, wie die Frau auf einer Krankenbahre in den Rettungswagen gehoben wurde. Der Hausbesitzer wurde in die Schwarze Maria verfrachtet, die langsam in der Straße zurücksetzte. Kurz darauf herrschte wieder Ruhe. Die Leute gingen zu Bett, ohne recht begriffen zu haben, was vorgefallen war.
Ansonsten gab es während dieser Schicht keine größeren Zwischenfälle. Erlendur war bereits auf dem Weg nach Hause, als er den Gewalttäter aus dem Reihenhaus im Bústaðahverfi vor dem Polizeidezernat auf ein Taxi warten sah. Er war nach seiner Vernehmung wieder auf freien Fuß gesetzt worden, der Fall war abgeschlossen. Die Frau schwebte nicht in Lebensgefahr, sie würde in ein paar Tagen aus dem Krankenhaus entlassen werden und aller Voraussicht nach zu ihm zurückkehren. Wahrscheinlich wusste sie nicht, wohin sie sonst gehen sollte. Für Frauen, die von ihren Ehemännern geschlagen wurden, gab es nirgendwo eine Zuflucht.
Erlendur war vor Dienstschluss noch einmal sämtliche Protokolle über die Ereignisse der Nacht durchgegangen und sah, dass ein älterer Mann im Vogar-Viertel gegen eine Laterne gefahren war und sein Auto zu Schrott gefahren hatte. Er war allein unterwegs und schwer angetrunken gewesen. Aus der Beschreibung des Autos schloss Erlendur, dass es der Mann sein musste, der ihm auf dem Weg zum Einsatzort im Bústaða-Viertel die Vorfahrt genommen hatte.
Er blickte an der neumodischen Fassade des Polizeidezernats hinauf und ging hinunter zur Skúlagata, die am Meer entlangführte. Im Norden war der Hausberg Esja und südöstlich davon die Bergketten der Reykjanes-Halbinsel. Die Sonne stand bereits hoch am Himmel. Es war früh am Sonntagmorgen, und die Ruhe in der Stadt war dazu angetan, die misstönenden Geräusche der vergangenen Nacht vergessen zu machen.
Auf dem Nachhauseweg musste er wieder einmal an den Obdachlosen denken, der vor einiger Zeit in einem der Tümpel im Torfstich ertrunken war. Irgendwie wollte ihm dieser Fall nicht aus dem Kopf gehen. Vielleicht weil er den Mann flüchtig gekannt hatte. Er hatte damals Streifendienst gehabt und über Sprechfunk die Meldung von einem Leichenfund erhalten. Da er ganz in der Nähe gewesen war, traf er als Erster am Tümpel ein. Er hatte immer noch den aufgeblähten grünen Anorak vor Augen und die drei Jungen, die auf ihrem Floß über den kleinen Teich gestochert waren.
Erlendur wusste, dass in dem Jahr, das verstrichen war, seit der obdachlose Hannibal ertrunken war, keine neuen Hinweise bei der Kriminalpolizei eingegangen waren. Es wurde davon ausgegangen, dass er eines natürlichen Todes gestorben war, und Erlendur glaubte, aus den Akten herauslesen zu können, dass der Tod eines Obdachlosen keine wirklich hohe Priorität für die Polizei gehabt hatte. Alle Umstände deuteten darauf hin, dass der Mann einfach ins Wasser gefallen war, damit war die Todesursache ein Unfall. Anscheinend hatte niemand Interesse an ihm. Erlendur schien es, als würde der Tod dieses Mannes überhaupt keine Rolle spielen. So als sei im ehemaligen Torfstich von Kringlumýri nichts weiter passiert, als dass es jetzt eben einen Obdachlosen weniger in der Stadt gab. Vielleicht war der Fall ja so simpel – vielleicht aber auch nicht. Hannibal hatte gar nicht lange vor seinem Tod zu Erlendur gesagt, jemand habe versucht, den Keller, in dem er zu diesem Zeitpunkt untergeschlüpft war, in Brand zu setzen. Niemand hatte ihm Glauben geschenkt. Auch Erlendur nicht, und es machte ihm zu schaffen, dass er den Mann nicht besser beschützt hatte, sondern ihm mit der gleichen Teilnahmslosigkeit begegnet war wie alle anderen.
Drei
Einige Zeit später ging Erlendur an einem Abend, an dem er keine Nachtschicht hatte, zu dem früheren Torfstich in Kringlumýri. Wenn er nicht im Dienst war, wusste er wenig mit sich anzufangen, und er hatte schon einige Male abends einen Spaziergang dorthin unternommen, um sich die Zeit zu vertreiben. An Sommerabenden streifte er manchmal durch die Stadt, vom Stadtteich aus ging er ins Reykjavíker Westend und manchmal auch bis hinaus auf die Halbinsel Seltjarnarnes. Oder zu der kleinen Bucht Skerjafjörður unweit des Inlandflughafens. Er besaß eine alte Klapperkiste, mit der er hin und wieder aus der Stadt herausfuhr. Das Auto stellte er dann irgendwo abseits der befahrenen Straßen ab und wanderte in den Bergen. Wenn die Wetteraussichten gut waren, nahm er Zelt und Proviant mit. Er zählte sich zwar nicht zu den überzeugten Freiluftfanatikern, war aber trotzdem dem isländischen Bergwanderverein beigetreten, weil er dessen Jahrbücher schätzte. Sie enthielten eine große Menge an Informationen über ausgewählte Landesteile. Ein einziges Mal hatte er an einer vom Verein angebotenen Wanderung nach Landmannalaugar teilgenommen und festgestellt, dass er mit all diesen Menschen, die immer zu irgendwelchen Späßen aufgelegt waren, nichts gemeinsam hatte. Diese Art von Fröhlichkeit und Geselligkeit auf Kommando verursachte ihm Beklemmungen, und so fand er auch keinen Gefallen an den Wanderungen.
Frauenbekanntschaften hatte er kaum gehabt, und es war ihm auch nicht unbedingt daran gelegen. Mit Bekannten hatte er einige Tanzlokale in Reykjavík besucht und sich dort eher gelangweilt als amüsiert. Laute Musik und betrunkenes Herumgegröle waren nichts für ihn. Bevor die Glaumbær-Disco niedergebrannt war, hatte er dort aber eine junge Frau kennengelernt, die Halldóra hieß. Sie hatten sich gut unterhalten, und sie machte keinen Hehl aus ihrem Interesse für ihn. Als er einige Zeit später mit Kollegen von der Polizei ausging, hatte er Halldóra in einer anderen Diskothek wiedergetroffen. Sie lud ihn anschließend zu sich nach Hause ein. Danach hatte sie ihn hin und wieder angerufen, um sich mit ihm zu verabreden, und so war etwas entstanden, das man eine Beziehung nennen konnte.
Erlendur kam auf seinem Spaziergang am Hamrahlíð-Gymnasium vorbei, wo man seit Neuestem in Abendkursen das Abitur nachmachen konnte. Er überlegte selbst, ob er noch mal die Schulbank drücken sollte. Er hatte nur die mittlere Reife und war nach den Pflichtschuljahren nicht aufs Gymnasium gegangen. Nachdem seine Eltern mit ihm nach Reykjavík gezogen waren, landete er in der neuen Schule in einer Klasse für minderbegabte Schüler. Er kam aus ärmlichen Verhältnissen, seine Intelligenz war nie getestet worden, und man ging einfach davon aus, dass der halsstarrige und widerspenstige Junge dort am besten aufgehoben wäre. Er hatte nicht nach Reykjavík ziehen wollen, und er mochte die Stadt nicht, aber mit der Zeit lernte er, seine Meinung für sich zu behalten. An einer weiteren Ausbildung hatte er kein Interesse, denn er kam weder mit seinen Lehrern noch irgendwelchen anderen Autoritäten klar, und so verließ er die Schule nach der mittleren Reife. Im Sommer verdiente er sich Geld, und nach dem letzten Winter in der Schule zog er von zu Hause aus und mietete sich eine Kellerwohnung. Seine Mutter arbeitete zum niedrigsten Tarif für ungelernte Arbeiter, und auch er verdiente nicht viel mehr, als er bei der städtischen Fischereiverarbeitung begann.
Er sah zu dem Schulgebäude hinüber. Das neu eingerichtete Abendgymnasium interessierte ihn. Er war achtundzwanzig, und es war noch nicht zu spät, sich weiterzubilden. Das Abitur war Voraussetzung für ein Universitätsstudium. Er interessierte sich vor allem für Geschichte, für alles, was mit der isländischen Vergangenheit und Kultur zu tun hatte, und er konnte sich sehr gut vorstellen, in Zukunft die Vergangenheit zu erforschen.
Erlendur überquerte die breite Allee Kringlumýrarbraut im Laufschritt und ging hinüber zum Torfstich. Er war im vergangenen Jahr mehrmals zu den Teichen gegangen, ohne selbst recht zu wissen, warum. Das moorige Wasser in den Tümpeln war nicht tief, und in ihnen gab es kein Leben. Deswegen war die Bezeichnung Teich eigentlich nicht angemessen. Ein paar Kinder stakten auf Flößen über das Wasser oder radelten die umliegenden Böschungen rauf und runter. Zwei knatternde Mopeds durchpflügten den Erdboden an den abgestochenen Hängen, der Lärm drang in der Abendstille auch bis an Erlendurs Ohren.
Der Obdachlose war in einem der Tümpel aufgefunden worden, dort, wo das Wasser am tiefsten war. Man war davon ausgegangen, dass die Leiche mindestens zwei Tage im Wasser gelegen hatte, bevor sie entdeckt worden war. Laut Obduktionsbericht war der Mann an genau diesem Ort gestorben, die kriminalpolizeilichen Ermittlungen richteten sich darauf, ob er ertrunken oder aus irgendwelchen Gründen ertränkt worden war. Bei der Untersuchung hatte sich herausgestellt, dass er etliche Promille im Blut gehabt hatte, und das sprach für die erste Annahme. Die Leiche wies keine Anzeichen von äußerlicher Gewaltanwendung auf, dasselbe galt für die Kleidung. Zeugen gab es keine. Und am Ort des Geschehens gab es auch keine verdächtigen Hinweise auf die Anwesenheit anderer, wie beispielsweise Fußabdrücke oder Radspuren. Von dem mutmaßlichen Zeitpunkt des Ertrinkens bis zum Eintreffen der Polizei am Schauplatz des Geschehens war allerdings auch einige Zeit verstrichen, und in der Zwischenzeit hatten spielende Kinder das Erdreich zertrampelt. Es konnten keine Spuren gesichert werden, und so war die Ermittlung wegen Mangels an Beweisen eingestellt worden.
Erlendur hatte sich in seinen ersten Wochen und Monaten bei der Verkehrspolizei einige Male mit diesem Obdachlosen, der Hannibal hieß, befassen müssen. Er war aus verschiedenen Gründen hin und wieder mit der Polizei in Berührung gekommen, und meist hatte es etwas mit Alkohol zu tun gehabt. Erlendur war ihm das erste Mal im tiefsten Winter begegnet, da saß er vornübergebeugt auf einer Bank im Stadtzentrum, und seine vor Kälte starren Finger umklammerten den Hals einer leeren Schnapsflasche. Isländischer Brennivín. Es war eine eiskalte Nacht gewesen, und nach einigem Hin und Her hatten die Streifenpolizisten ihn mitgenommen und in einer Ausnüchterungszelle einquartiert. Für Erlendur stand damals fest, dass der Mann erfroren wäre, wenn sie ihn dort hätten sitzen lassen, und dafür hatte er keine Verantwortung übernehmen wollen. Sie mussten ihm aber auf dem Weg zum Streifenwagen unter die Arme greifen, wobei er wieder zu sich kam. Aber er brauchte einige Zeit, um sich zu orientieren, auch wenn ihm sowohl die Umstände als auch die Polizisten bekannt vorkamen. Er bedankte sich überschwänglich bei ihnen, den netten Jungs, die sich so rührend um ihn kümmerten. Als er sich nach seiner Flasche erkundigte, teilte man ihm mit, dass das begehrte Objekt keinen einzigen Tropfen mehr enthielt. Hannibal fragte Erlendur, dem er noch nie begegnet war, ob er nicht einen Schluck Schnaps für ihn hätte. Er hoffte wohl auf eine positive Antwort von einem Anfänger. Als Erlendur nicht auf die Frage einging, wiederholte Hannibal sie so lange, bis Erlendur erklärte, er solle gefälligst die Klappe halten. Von diesem Punkt an änderte sich Hannibals freundliches Verhalten der Polizei gegenüber ganz entschieden.
»Ihr seid doch alle dieselben Arschlöcher«, knurrte er.
Beim nächsten Mal hatte Erlendur ihn »unter dem Blech« gefunden, wie die Wellblecheinzäunung rings um das schwedische Gefrierhaus genannt wurde. Es befand sich am Nordende des Hügels, auf dem das Denkmal für den ersten isländischen Siedler Ingólfur Arnarsson stand. Dort suchten die Obdachlosen Schutz vor ihrem elenden Dasein und dem bitterkalten Frost, den der scharfe Nordwind mit sich brachte. Hannibal saß mit ausgestreckten Beinen auf dem Boden und lehnte sich mit dem Rücken gegen die Wellblechwand. Er trug wie immer seinen abgerissenen grünen Anorak, war völlig durchgefroren und kaum ansprechbar. Erlendur hatte in der Stadtmitte zu tun gehabt und war auf dem Weg nach Hause, als er den Mann in einiger Entfernung entdeckte. Zuerst verspürte er keine besondere Lust, sich um ihn zu kümmern, doch dann kamen ihm Zweifel. Der Frost verschärfte sich zusehends, und der Wind aus dem Norden trieb wirbelnde Schneeflocken über den gefrorenen Boden, die sich an den Beinen des Obdachlosen ansammelten. Als Erlendur nach ihm rief, erhielt er keine Antwort. Er rief noch einmal sehr viel lauter, aber Hannibal hätte ebenso gut wie der erste Siedler dort oben eine Bronzestatue sein können, er rührte sich nicht. Erlendur trug zwar einen dicken Winteranorak sowie Mütze und Schal, doch auch die konnten den eisigen Nordwind nicht abhalten. Er ging zu Hannibal und stieß ihn mit dem Fuß an.
»Was ist mit dir, Hannibal?«, fragte er.
Der Angesprochene zeigte keine Reaktion.
Erlendur ging neben Hannibal in die Hocke und schüttelte ihn, bis der Mann die Augen einen Spalt weit öffnete. Er erkannte Erlendur nicht, und er schien keine Ahnung zu haben, wo er sich befand.
»Lass mich bloß in Ruhe, du Scheißkerl«, sagte er und schlug nach Erlendur.
»Komm schon, Hannibal«, sagte Erlendur, »du kannst doch nicht bei dieser Kälte hier herumliegen.«
Er versuchte, Hannibal hochzuziehen, was nicht ganz einfach war, denn der Mann war nicht gerade leicht, und er sträubte sich. Unter Aufbietung all seiner Kraft gelang es Erlendur, ihn auf die Beine zu stellen, und er musste ihn auf dem Weg den Hügel hinunter stützen. Durch die Bewegung erwachte Hannibal allmählich wieder zum Leben, zumindest konnte er Erlendur sagen, wohin er wollte. Zu einem kleinen Haus in einem Hinterhof auf der Vesturgata. Dort deutete Hannibal auf eine schmale Kellertreppe. Da er kaum auf den Beinen stehen konnte, half Erlendur ihm die Treppe hinunter. Die Tür zum Kellereingang war nicht verschlossen, nur ein hölzerner Riegel, wie man sie sonst an einem Scheunentor fand, hielt sie zu. Als Erlendur den Riegel hochgeschoben hatte, trat Hannibal die Tür auf und tastete sich an der Wand entlang, bis er den Lichtschalter gefunden hatte. Eine nackte Glühbirne baumelte von der Decke herunter.
»Meine Zuflucht in diesem elenden Jammertal«, erklärte Hannibal und fiel bei dem Versuch, die Schwelle zu überqueren, der Länge nach auf den Boden.
Erlendur half ihm wieder auf die Beine. Diese Zuflucht im Keller verdiente kaum die Bezeichnung Wohnung, es handelte sich um eine Art Abstellkammer für wertloses Gerümpel jeglicher Art. Niemand würde irgendetwas hiervon stehlen wollen, und so reichte auch der primitive Holzriegel an der Tür. Rohrstücke und abgefahrene Autoreifen bildeten zusammen mit rostigen Blechwannen, Kanistern und kaputten Fischernetzen ein undurchdringliches Chaos, und auf dem Boden lag die dreckigste Matratze, die Erlendur je gesehen hatte. Und zusammengeknüllt darauf eine schäbige Wolldecke. Drumherum lagen verstreut leere Schnapsflaschen, diverse Pillengläser und die kleinen Fläschchen, die es in den Lebensmittelläden gab und in denen Kardamom-Backtropfen verkauft wurden, ebenso Fläschchen für Brennspiritus, den es nur in der Apotheke gab und im Jargon der Stadtstreicher Sprit genannt wurde. Und über allem schwebte der penetrante Gestank von Gummi und Urin. Erlendur half Hannibal auf sein Lager und wollte gerade wieder gehen, als der sich aufrichtete.
»Wer zum Teufel bist du eigentlich?«, sagte er.
»Mach’s gut«, sagte Erlendur und trat seinen Rückzug an.
»Wer bist du?«, fragte Hannibal wieder. »Kennen wir uns?«
Erlendur hielt zögernd an der Tür inne. Er hatte kein Interesse daran, mit dem Mann zu reden, wollte ihn aber auch nicht abschätzig behandeln.
»Ich heiße Erlendur«, sagte er. »Wir sind uns schon einmal begegnet. Ich bin bei der Polizei.«
»Erlendur«, wiederholte Hannibal. »Ich kann mich nicht an dich erinnern, mein Freund. Hast du vielleicht ein paar Tropfen für mich?«
»Ein paar Tropfen?«, fragte Erlendur.
»Oder hast du vielleicht ein bisschen Kleingeld für mich übrig?«, fragte Hannibal. »Es muss nicht viel sein, ein paar Kronen reichen. Ganz bestimmt hat so ein hilfsbereiter Mensch wie du etwas übrig für einen wie mich.«
»Das Geld gibst du doch bloß für Fusel aus«, entgegnete Erlendur.
Hannibals Mund verzog sich zu einer Grimasse, die wohl ein Lächeln darstellen sollte.
»Ich will dir nichts vorlügen, mein Lieber«, sagte er im sanftesten Ton. »Es fällt dir vielleicht schwer, das zu glauben, aber ich kann anderen einfach nichts vorlügen. Mir fehlt ein Flachmann mit Genever, das ist das Einzige, was mir in dieser elenden Welt fehlt. Das klingt nicht nach viel in deinen Ohren, und ich würde dir auch nie was vorjammern, wenn es nicht um so eine winzige Kleinigkeit ginge.«
»Von mir bekommst du kein Geld für Genever«, sagte Erlendur.
»Aber vielleicht für ein bisschen Sprit?«
»Nein.«
»Na schön«, sagte Hannibal und fiel auf seine Matratze zurück. »Dann scher dich meinetwegen zum Teufel.«
Die Knattergeräusche entfernten sich, als die Mopeds in das neue Viertel in Hvassaleiti zurückfuhren. Die Kinder auf den Flößen stakten zum Ufer und zogen ihre Flotte aufs trockene Land. Erlendur warf einen Blick nach Süden zu den Heißwassertanks. Bei der Untersuchung des Falles hatte sich herausgestellt, dass Hannibal im Torfstich gewesen war, weil er in der Nähe so etwas wie eine Unterkunft gefunden hatte. Und zwar in dem Sommer, der seinem Tod vorausging, und nachdem er aus seiner Behausung in dem Kellerloch vertrieben worden war. Dort hatte es einen Brand gegeben, für den er verantwortlich gemacht wurde, obwohl er hartnäckig seine Unschuld beteuerte. Danach war Hannibal in der Tat zum Obdachlosen geworden, und sein Leidensweg endete damit, dass er sich einen Unterschlupf in der Heißwasserleitung gesucht hatte. Die Zuleitungen zu den Heißwassertanks waren zur Wärmedämmung mit Betonplatten ummantelt worden. An einer Stelle war ein Stück der Verkleidung herausgebrochen. Es war groß genug, um an dieser Stelle hineinzukriechen und neben den Rohren etwas Wärme zu finden.
In dieser Rohrleitung hatte Hannibal also seine letzte Unterkunft gefunden, bevor er ertrunken in einem der Tümpel im ehemaligen Torfstich aufgefunden worden war. Dort hatte er in Gesellschaft einiger streunender Katzen gehaust, die unter ähnlichen Bedingungen lebten und sich zu ihm gesellt hatten – wie seinerzeit die Vögel zum heiligen Franz von Assisi.
Vier
Erlendur stand am Ufer des Tümpels, in dem Hannibal tot aufgefunden worden war, als ein Junge auf einem Fahrrad an ihm vorbeisauste. Der Junge machte kehrt und radelte zurück. Obwohl mehr als ein Jahr vergangen war, seit sie sich zuletzt begegnet waren, hatte Erlendur ihn sofort erkannt. Er war einer der drei Jungen, die Hannibals Leiche gefunden hatten.
»Bist du nicht der von der Polizei?«, fragte der Junge und stieg vor Erlendur auf die Bremse.
»Ach, du bist das«, sagte Erlendur.
»Was machst du denn hier?«, fragte der rothaarige, sommersprossige Junge, der Erlendur schon damals durch seinen frechen Gesichtsausdruck und sein forsches und selbstsicheres Verhalten aufgefallen war. Er hatte einen guten Schuss in die Länge gemacht, innerhalb eines Jahres war aus dem Kind ein Teenager geworden.
»Ich seh mich einfach ein bisschen um«, antwortete Erlendur.
Vor einem Jahr war der Bursche so etwas wie der Anführer der drei Jungen gewesen, die auf die Leiche gestoßen waren. Die drei waren zu ihm nach Hause gerannt und hatten seiner Mutter von dem Fund erzählt. Auch wenn die Geschichte ziemlich unglaubwürdig geklungen hatte, merkte ihre Mutter doch bald, dass die Jungen ihr nichts vorflunkerten. Sie schimpfte noch nicht einmal mit ihnen, weil sie wieder einmal völlig durchnässt von den Tümpeln zurückgekehrt waren, sondern rief sofort bei der Polizei an. Seine Freunde waren nach Hause gegangen, um sich trockene Klamotten anzuziehen, und dann radelten sie allesamt wieder zu ihrem Spielgelände zurück. Zwei Streifenwagen und ein Krankenwagen waren bereits dort eingetroffen. Man hatte Hannibals Leiche aus dem Wasser geholt und ans Ufer gelegt. Irgendjemand hatte eine Decke über sie gebreitet.
Erlendur hatte Streifendienst gehabt, als der Leichenfund in dem Tümpel in Kringlumýri gemeldet wurde. Gleich nach seinem Eintreffen watete er ins Wasser und zog den Toten an Land, den er nicht sofort erkannte. Erst als der leblose Körper auf dem Rücken an Land lag, wurde ihm klar, um wen es sich handelte. Aber Hannibals Tod überraschte ihn nicht wirklich. Die anderen Polizisten versuchten, die Jungen und andere Schaulustige wegzuscheuchen. Doch als die Jungen ihnen sagten, dass sie es waren, die die Leiche gefunden hatten, wurden sie einer nach dem anderen in einem der Streifenwagen befragt, und es wurde genau festgehalten, wie sie die Leiche gefunden hatten.
»Mein Papa meint, dass er einfach ertrunken ist«, sagte der Junge, der immer noch diesen frechen Eindruck machte. Er stützte sich auf sein Fahrrad und blickte in die Richtung, wo Hannibals Leiche vor einem Jahr im Wasser gedümpelt hatte.
»Ja«, sagte Erlendur. »Wahrscheinlich ist er ins Wasser gefallen und hat es nicht geschafft, sich ans Ufer zu retten.«
»Er war doch bloß ein Penner«, erklärte der Junge.
»Habt ihr euch nicht schrecklich erschrocken, als ihr den Mann so gefunden habt?«
»Addi hat danach richtige Albträume gekriegt«, entgegnete der Junge. »Seine Eltern haben einen Arzt holen müssen. Palli und mir hat es nichts ausgemacht.«
»Und stakt ihr hier immer noch mit euren Flößen herum?«
»Nein, jetzt nicht mehr. Das ist doch bloß was für Kinder.«
»Aha. Seid ihr diesem Mann irgendwann schon mal begegnet, als er noch gelebt hat? Bei der Heißwasserleitung vielleicht? Kannst du dich daran erinnern?«
»Nein«, sagte der Junge. »Den hab ich vorher noch nie gesehen.«
»Aber vielleicht einer von den Jungs, die du kennst?«
»Nein. Wir haben manchmal dort gespielt, aber ich habe ihn nie gesehen. Vielleicht war er ja auch nur nachts da.«
»Vielleicht. Und was habt ihr bei der Heißwasserleitung gemacht?«
»Wir haben nach Golfbällen gesucht.«
»Nach Golfbällen?«
»Ja. Drüben in einem von den Reihenhäusern wohnt so ein Typ, der dort ständig Golf trainiert«, sagte der Junge und deutete in die Richtung der Reihenhaussiedlung in Hvassaleiti. »Mein Papa sagt, dass da oben früher auch ein Golfplatz war, genau da, wo jetzt die Wasserleitung ist. Manchmal haben wir da alte Bälle gefunden.«
»Und was macht ihr mit den Bällen?«
»Nix«, sagte der Junge, der weiterfahren wollte. »Die sind mich egal.«
»Sie sind dir egal, muss es wohl heißen.«
»Ja, okay.«
»Okay ist auch kein korrektes Isländisch …«
»Ich muss nach Hause«, sagte der Junge plötzlich, schwang sich auf sein Rad und war auf und davon, noch bevor Erlendur seinen Satz beendet hatte.
Er folgte den Trampelpfaden, die zwischen den Tümpeln im Torfstich entstanden waren und bis zur Heißwasserleitung führten. Die Leitung war fünfzehn Kilometer lang und führte von den Thermalgebieten in der Nachbargemeinde Mosfell im Norden der Stadt mitten hinein nach Reykjavík. Zwei mit Betonplatten eingefasste Vierzehn-Zoll-Rohre beförderten das Wasser in die sechs großen Tanks auf Öskjuhlíð, einem der sieben Hügel von Reykjavík. Die Rohre waren zwar gut isoliert, strahlten aber trotzdem noch etwas Wärme ab, und deswegen hatte Hannibal sich dort in den letzten Tagen oder Wochen seines Lebens einquartiert.
Das Loch in der Betonummantelung war noch nicht repariert worden. Aus der Seitenwand war ein großes Stück herausgebrochen und lag im Gras davor. Erlendur überlegte, woher diese Beschädigung rührte, außer Erdbeben oder Frostschäden fiel ihm nichts ein. Das herausgebrochene Stück war so groß, dass ein Erwachsener ohne Mühe in die Röhre hineinkriechen konnte. Ihm fiel auf, dass das Gras ringsherum plattgetreten war, und als er seinen Kopf in die Öffnung steckte, sah er, dass sich nach Hannibal noch jemand anderes hier verkrochen hatte. Irgendjemand hatte da drinnen eine Decke ausgebreitet. Zwei leere Schnapsflaschen und ein paar Spritfläschchen lagen unter den Leitungen. Und nicht weit davon sah er eine schäbige Kopfbedeckung und einen Fausthandschuh liegen.
Erlendur versuchte, die Behausung genauer in Augenschein zu nehmen, aber es war zu dunkel. Er erschrak heftig, als sich seine Augen an die Dunkelheit gewöhnt hatten und er weiter drinnen einen großen Schatten ausmachen konnte.
»Ist da wer?«, rief Erlendur.
Eine Antwort bekam er nicht, aber er sah, dass sich der Schatten in Bewegung setzte und auf ihn zu kroch.
Fünf
Nach dem ersten Schreck kroch Erlendur durch die Öffnung zurück, stand auf und trat ein paar Schritte zurück. Wenig später streckte ein Mann seinen Kopf aus dem Loch, krabbelte hinaus und setzte sich vor Erlendur ins Gras. Er trug einen zerschlissenen dunklen Mantel, Mütze und Fingerlinge, und seine Füße steckten in ausladenden Galoschen. Erlendur hatte den Mann bereits zuvor zusammen mit anderen Obdachlosen gesehen, wusste aber weder wie er hieß noch irgendetwas sonst über ihn.
Der Mann wünschte ihm einen guten Abend und klang so, als sei er es gewöhnt, zu später Stunde an einem Ort wie diesem Besuch zu bekommen. Er benahm sich, als wären sie sich irgendwo auf der Straße begegnet, als wäre er nicht gerade aus einer Betonröhre herausgekrochen. Erlendur nannte seinen Namen, sein Gegenüber stellte sich als Vilhelm vor. Sein Alter war schwierig zu schätzen. Erlendur vermutete, dass er kaum älter als vierzig war, auch wenn er dem Aussehen nach bereits auf die sechzig zugehen konnte. Er hatte keine Vorderzähne mehr, und sein Gesicht wurde von einem dichten Bart verhüllt.
»Kenne ich dich?«, fragte der Mann und starrte Erlendur durch seine Hornbrille an. Die Gläser waren so dick, dass seine Augen dahinter unnatürlich groß wirkten, als er zu Erlendur aufsah.
Sein röchelnder Husten saß tief.
»Nein«, sagte Erlendur, während er die Brille des Mannes fixierte. »Das glaube ich nicht.«
»Suchst du nach mir?«, fragte Vilhelm hustend. »Haben wir vielleicht irgendeine Rechnung zu begleichen?«
»Nein, ganz und gar nicht«, entgegnete Erlendur. »Ich kam nur zufällig vorbei. Ehrlich gesagt war ich nicht darauf gefasst, hier jemanden anzutreffen.«
»Hier kommen nicht viele vorbei«, sagte Vilhelm. »Da hat man seine Ruhe. Du hast nicht zufällig eine Zigarette für mich?«
»Leider nein«, sagte Erlendur. »Hast du … Darf ich dich fragen, ob du schon lange in dieser Betonröhre lebst?«
»Zwei oder drei Tage«, sagte Vilhelm, ohne genauer zu erklären, weshalb er sich dort eingenistet hatte. »Oder … Was für ein Tag ist heute?«
»Dienstag«, sagte Erlendur.
»Ach so«, sagte Vilhelm hustend. »Dienstag. Dann bin ich vielleicht doch schon etwas länger hier. Es ist in Ordnung, die ein oder andere Nacht hier zu verbringen, auch wenn es manchmal scheißkalt ist. Aber ich habe schon Schlimmeres erlebt.«
»Und wie macht deine Gesundheit das mit?«
»Was zum Teufel geht dich das an?«, fragte Vilhelm unter einem weiteren Hustenanfall.
»Ich bin vielleicht doch nicht ganz ohne Grund hier«, erklärte Erlendur, als der Anfall vorüber war. »Ich kannte einen Mann, der genau wie du in der Heißwasserleitung gewohnt hat. Er hieß Hannibal.«
»Hannibal? Ja, den kannte ich auch.«
»Er ist da drüben in einem der Tümpel im Torfstich umgekommen«, sagte Erlendur und deutete in Richtung Kringlumýri. »Erinnerst du dich daran?«
»Ich hab davon gehört. Wieso fragst du danach?«
»Aus keinem besonderen Grund«, sagte Erlendur. »Es war wohl ein Unfall mit bösen Folgen.«
»Ja genau, das war bös.«
»Woher kanntet ihr euch?«, fragte Erlendur und setzte sich auf die Leitung.
»Wie man sich so kennt. Unsere Wege haben sich manchmal gekreuzt. Er war ein ziemlich netter Kerl.«
»Keine Feindschaft zwischen euch?«
»Feindschaft? Nein. Ich habe keine Feinde.«
»Weißt du, ob Hannibal irgendwelche Feinde hatte, ob es Menschen gab, die schlecht auf ihn zu sprechen waren?«
Vilhelm starrte Erlendur durch die gewölbten Gläser hindurch an.
»Wieso willst du das wissen?«, fragte er.
Ein weiterer Hustenanfall unterbrach ihn, er japste nach Luft.
»Nur so«, erklärte Erlendur.
»Da steckt doch irgendwas dahinter.«
»Nein, wirklich nicht.«
»Glaubst du vielleicht, dass er nicht ganz von selbst ertrunken ist?«
»Was glaubst du?«
»Keine Ahnung«, sagte Vilhelm. Er stand auf und reckte sich, bevor er sich neben Erlendur auf die Betonmauer setzte. »Du hast nicht zufällig ein paar Kronen für mich?«, fragte er.
»Wozu brauchst du die?«
»Für Zigaretten, mehr nicht.«
Erlendur fand zwei Fünfzig-Kronen-Münzen in seiner Jackentasche.
»Mehr habe ich nicht dabei«, sagte er.
»Danke«, sagte Vilhelm und griff rasch nach den Münzen. »Das reicht für eine Schachtel. Hast du gewusst, dass eine Flasche Wodka auf die zweitausend Kronen zumarschiert? Die Leute, die in diesem Land das Sagen haben, sind komplett meschugge, finde ich. Die haben nicht alle Tassen im Schrank.«
»Die Tümpel da drüben sind nicht tief«, sagte Erlendur.
Vilhelm hustete in seine Fingerlinge.
»Aber tief genug.«
»Muss man nicht sehr weit hineingehen, um dort zu ertrinken?«
»Woher soll ich das wissen?«
»Oder betrunken sein«, fuhr Erlendur fort. »Er hatte ziemlich viel Alkohol im Blut.«
»Ja, Hannibal konnte sich manchmal ganz schön die Rübe zuballern, mein lieber Scholli.«
»Erinnerst du dich, mit was für Leuten er unterwegs war, bevor er starb?«
»Mit mir nicht«, sagte Vilhelm. »Ich habe ihn kaum gekannt. Bin ihm nur manchmal in der ›Epidemie‹ begegnet. Und da habe ich ihn das letzte Mal gesehen. Er wollte da unbedingt rein, aber er war so zu, dass die dort nichts mit ihm zu tun haben wollten.«
Mehr Informationen konnte Erlendur dem Röhrenbewohner nicht entlocken. Der hatte vor, noch eine weitere Nacht darin zu verbringen und sich dann anderweitig umzutun. Erlendur versuchte, ihn davon abzubringen. Er fragte ihn, ob er denn keine anderen Möglichkeiten hätte. Vilhelm wurde wütend, weil Erlendur sich einmischte, und verbat sich das. Erlendur solle ihn gefälligst in Ruhe lassen.
Erlendur kletterte auf die Heißwasserleitung, die mit über einen Meter breiten Platten abgedeckt war. Der röchelnde Husten des Mannes verfolgte ihn, als er über die Leitung in Richtung des Hügels ging, auf dem die Speichertanks standen. Von dort war es nicht weit bis ins Hlíðar-Viertel. Die Nacht war hell, und er folgte der Leitung bis auf den Hügel und kehrte von da aus wieder ins Hlíðar-Viertel zurück.
Ihm war bekannt, dass Obdachlose auf der Suche nach Betreuung oder einem Dach über dem Kopf für die Nacht in einem ehemaligen Krankenhaus, einem der ersten in Island, Unterkunft finden konnten. Es war errichtet worden, um Seuchen zu behandeln, daher kannte es auch jeder unter dem Namen »Epidemie«. Es gab dort nur eine ungeschriebene Regel, und die lautete, dass niemand in betrunkenem Zustand eingelassen wurde. Hannibal hatte wohl mehr als einmal vergeblich versucht, dort aufgenommen zu werden. Vielleicht war das der Grund dafür, dass er sich zum Schluss einen Unterschlupf in der Heißwasserleitung gesucht hatte. Wie ein Geächteter, der frei von anderer Leute Einmischung abseits der menschlichen Gesellschaft existieren wollte.
Sechs
Gegen Morgen erhielten sie den Auftrag, einen Ausbrecher aus Litla-Hraun wieder nach Eyrarbakki zurückzubringen. Das größte isländische Gefängnis in dem kleinen Hafenort an der Südwestküste war ähnlich wie die Epidemie ursprünglich als Krankenhaus errichtet worden. Der Häftling war vor zwei Tage ohne große Mühe von dort entkommen, doch dann hatte er sich freiwillig wieder gestellt. Er saß eine zweieinhalbjährige Gefängnisstrafe wegen Drogenschmuggels ab. Doch an diesem Wochenende hatte er wohl das Gefühl gehabt, unbedingt einen Ausflug in die Hauptstadt unternehmen zu müssen. Er war fünfundzwanzig und trotz seines jungen Alters bereits häufig mit der Polizei in Berührung gekommen, und zwar meist in Verbindung mit Drogen- und Alkoholschmuggel, aber auch wegen Einbrüchen und Dokumentenfälschung. Bereits mit zwanzig hatte er wegen einer Serie von Diebstählen mehrere Monate in Litla-Hraun verbracht, und kurze Zeit später war er mit einer beträchtlichen Menge Haschisch am Flughafen in Keflavík geschnappt worden, als er total zugekifft aus Amsterdam zurückgekehrt war. Er stand bei den Zollbeamten auf einer besonderen Liste mit Verdächtigen, aber er wäre auch so wohl nicht durch die Zollkontrolle gekommen, denn die Beamten hätten es sich auf gar keinen Fall nehmen lassen, einen schlaksigen Hippie mit Bart und langen Haaren zu filzen. Es stellte sich heraus, dass er sich fast keine Mühe gemacht hatte, die Haschplatten zu verstecken, er hatte sie einfach in eine Jeans gewickelt und die in eine nagelneue Sporttasche gestopft.
In der Nacht nach seinem Ausbruch hatte er sich im Hauptdezernat an der Hverfisgata gestellt. Dort mussten Erlendur und seine Kollegen ihn abholen, um ihn zurück nach Eyrarbakki zu befördern. Der Mann war sehr gesprächig, er hatte sich offensichtlich eine anständige Portion Gras genehmigt, bevor er sich gestellt hatte.